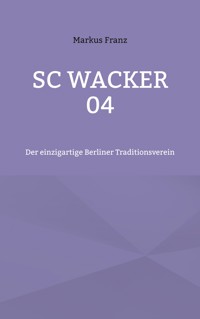
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wacker 04 Berlin. Ein Verein voller Tradition, der immerhin 90 Jahre existierte. 1 Deutscher A Nationalspieler, 2 Berliner Meistertitel, 3 Berliner Pokalsiege, 4 Jahre 2. Bundesliga. Das sind nur wenige Fakten über die lila weißen "Feierabendprofis" vom Wackerweg. Eine Bier- und tränenreiche Zeit, in der es allerorten menschelte. Anekdotenreich erzählt der dabei gewesene Autor spannende Teile der Berliner Fußballgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Geschichte(n) vorab
Der Fußball kommt nach Berlin (1883 – 1904)
Gründung und Entwicklung des Vereins (1904 – 1950)
Das wichtige Bruderpaar bei Wacker 04
Ein Nationalspieler bei Wacker 04!
Heimstätte „Am Wackerweg“: Ein Club und sein Stadtteil
Die schwierigen 1950er und 1960er Jahre
Berichterstattung rund um den Verein: „Das Braune“ ging nach dem Krieg schwer raus
Wacker startet durch: In den 1970er Jahren
Wackers starker Höhenflug: Die 1970er Jahre Gründungsmitglied der 2 Liga
Bundesliga-Aufstiegsrunden 1971, 1972, 1973
Und dann krachte es: Zwei Trainingsunfälle mit verheerenden Folgen – die Bundesligaträume starben plötzlich
Der Koffer mit dem Geld ging nicht zu
Exkurs: Wie heißt die Liga bitte? Deutschlands Fußballigen im Wandel
Interview mit Wackers Rekordtorschütze Rainer „Ratze“ Liedtke
1974/75: 2 Bundesliga Nord
1975/76: Noch einmal gut gegangen
1976/77: Bitterer und unnötiger Abstieg
1978/79: Abgeschlagen und doch fast dringeblieben
Der lila-weiße Abend: Als das Berliner Olympiastadion Wacker 04 gehörte
1979/80: Kehraus bei Wacker 04
Als Jugendspieler im lilafarbenen Dress (1980 – 1982)
Niedergang, Auferstehung und das Ende: Wacker in den 1980er Jahren bis zur Auflösung und Fusion
Niedergang und Auferstehung: 1981 in der Landesliga, 1987 bereits wieder Berliner Spitzenclub
Saison 1987/88
Saison 1988/89
Saison 1989/90
Inmitten des Geschehens: Wende und Wiedervereinigung 1991 Ende der Oberliga Berlin Ein Jahr in der Oberliga Nordost Neustart in der Verbandsliga Berlin und 1994 Fusion mit dem BFC Alemannia 90
Oberliga Nordost/Staffel Nord: Saison 1991/92
Mein Kurzabenteuer bei der Berliner Fußball-Woche
Exkurs: Brief eines Fans (Im Magazin Tip, März 1992
Die Finanzierung eines Vereinsetats am Beispiel von Wacker 04 (vorwiegend 1988 – 1994)
Weiter mit der Oberliga Nordost 1991/92
1992/93: Wieder eine neue Liga Die Verbandsliga Berlin
Interview mit Ingo Reißner Ein Ostberliner wird Wackeraner
Nachgesang
Statistik
Der SC Wacker 04 im Pokal
Zum letzten Geleit?
Literatur
(
Fast) alle Vereine, die von Wacker 04 Berlin besiegt wurden
Vorwort
Beim Blick auf die Geburtsdaten der Spieler, die den Club in der großen Zeit während der 1970er Jahre prägten, wurde mir schnell klar, dass es höchste Zeit ist, ein Buch über meinen Heimatverein zu verfassen. Wer lebt noch, wer ist noch fit und auskunftsfreudig? Leider lebt von den alten Vorständen inzwischen niemand mehr. Umso wichtiger scheint mir eine Dokumentation der Vereinsgeschichte, bevor es noch weniger Zeitzeugen gibt. Was mir zunächst ins Gedächtnis kam bzw. in die Hände fiel, waren Fotos, Stadionmagazine und eigene Erinnerungen. Der Blick ins sogenannte „Netz“ war ein zwiespältiges Vergnügen: Statistik war zum Teil (vor allem aus der Zeit in der 2. Bundesliga) vorhanden, aber nur grenzwertig verlässlich zu verwenden. Außerdem: Nackte Zahlen erzählen selten ihre Geschichte. Man muss sie erklären und in Zusammenhang stellen. Und weil ich gerade beim Thema „alte Vorstände“ war… in verschiedenen Interneteinträgen waren die Herren gar nicht vorhanden. Ob erster oder letzter Wacker-Präsident, man findet darüber nichts im Netz. Diese Geschichtsvergessenheit störte mich – sie ist der Hauptanlass für dieses Buch über meinen Verein, der immerhin bis heute auf Rang 84 der ewigen Tabelle der 2. Bundesliga liegt.
Die Herangehensweise war (auch) ein innerliches Abwägen. Sollte ich historisch schreiben und die eigenen Erinnerungen verwerfen? Doch dann wagte ich ein Experiment, das man vielleicht als „Stilbruch“ bezeichnen könnte. Aber als Autor empfinde ich nicht so: Die Jahre vor meiner Geburt beleuchte ich sachlich und sporthistorisch fundiert. Auch mit Interviews der früheren Protagonisten. Ein weiterer Teil, den ich persönlich erleben konnte, habe ich spürbar persönlicher geschrieben. Dabei verlasse ich Tabelle, Spielerwechsel und Spielverläufe nicht, aber dieser Teil ist deutlich subjektiver – mit meinen Empfindungen versehen – geprägt. In Archiven allein spürt man keinen Schweiß, keine Tränen – erst das eigene Erleben und Empfinden würzt manches Ereignis aus der Vereinsgeschichte.
Doch auch ich hatte natürlich etliche Barrieren zu meistern, um diesen Mix aus persönlicher Anschauung und historischer Recherche zu realisieren. Zunächst einmal: Wer lebt überhaupt noch, und wen kann ich noch interviewen? Die Quellen zu sichten war extrem zeitaufwendig. Einer ansprechenden Ausstellungsbroschüre zum Fußballsport in Reinickendorf konnte ich beispielsweise etliche interessante Informationen entnehmen. Allerdings waren die meisten Hinweise in wörtlicher Rede. Es handelte sich – notiert im Jahr 2006 – um persönliche Erinnerungen aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1970er Jahre. Weil es sich um individuell gefärbte Reminiszenzen handelte, stellte sich im Zuge der Überprüfung heraus, dass vieles lediglich sozusagen halb wahr war. Kein Wunder, da das menschliche Erinnerungsvermögen prinzipiell fehlbar ist.
Noch ein Blick auf die Quellenlage. Es war mitunter hanebüchen, was für Gerüchte über Wacker 04 kursierten. Drei Beispiele sollen dies veranschaulichen. Es existiert beispielsweise ein Werk über die Berliner Traditionsvereine. Welcher Verein glänzt durch Abwesenheit?! Bingo!
Im ansonsten großartigen Buch „Das große Buch der deutschen Fußball-Stadien“ (Göttingen 2001, hrsg. von Werner Skrentny) ist zwar auch der Platz am Wackerwerg, bzw. Wacker 04 auf einer knappen Seite gewürdigt worden. Allerdings sind dem Autor vier Fehler unterlaufen, komplettiert um eine „schwammige“ Behauptung. 1. Wacker ist nicht erst seit 1945 in Reinickendorf beheimatet, sondern von Anfang an. 2. Das Aufstiegsrundenspiel 1974 gegen Braunschweig fand weder am Wackerweg noch im Olympiastadion statt, sondern im Poststadion 3. Wacker stieg nicht 1976 aus der 2. Bundesliga ab, sondern 1977. 4. schließlich ist der Zuschauerrekord am Wackerweg sehr wohl bekannt – es waren 18.000 gegen Hertha BSC im Jahre 1929. Hinsichtlich der „schwammigen“ Behauptung ist zu präzisieren: Wacker ging das Wagnis 2. Liga nicht aus freien Stücken, sondern gezwungenermaßen im Poststadion ein. (Immerhin ist neben einem schönen Foto erwähnt, dass die Flutlichtanlage im Jahr 1967 installiert wurde.) Und dann gibt es ja noch das 1997 erschienene und in Sachen Wacker fragwürdige Buch „100 Jahre Fußball in Berlin“, in dem Wacker 04 gleich gar nicht, bzw. lediglich als eine statistische Randnotiz erwähnt wird. Kein einziger Wacker 04-Profi oder -Trainer wird portraitiert, obwohl es ansonsten an Kurzporträts im Buch nur so wimmelt…
Last but not least: In Klaus Bitters ansonsten hervorragendem Standardwerk „Deutschlands Fußball. Das Lexikon“ werden 50 (!) Berliner Fußballvereine ausführlich gewürdigt. Welcher Verein glänzt durch Abwesenheit? Bingo!
Zweierlei habe ich mir mit diesem Buch über ‚meinen‘ Verein vorgenommen: Einerseits, das versteht sich von selbst, der ‚Wahrheit‘ verpflichtet zu sein, indem gediegene Recherche mein oberstes Ziel war. Andererseits aber sollte über der Sachlichkeit der Überschau der ‚menschliche‘ Faktor nicht zu kurz kommen. Die Personen hinter dem Verein, also u.a. auch die bereits verstorbenen Funktionäre, sollen in ihrer jeweiligen Eigenart quasi verlebendigt werden. Da mein Herz an meinem inzwischen aufgelösten Heimatverein und damit an all denen hängt, die vor Zeiten sein Gesicht nach Innen und Außen geprägt haben.
Fehler sind menschlich. Sie wurden sicher auch am Wackerweg gemacht. Letztlich aber, so viel Pathos muss sein, gilt meine Hochachtung allen, die in diesem einzigartigen Verein, jeder an seiner Stelle, über die Jahrzehnte tätig gewesen sind. Eine selbstgerechte Jubelchronik ist daraus dennoch hoffentlich nicht geworden.
Danksagung
Wir bedanken uns herzlich für die freundliche, tatkräftige und finanzielle Unterstützung bei der Kanzlei DAHL LAW FIRM in Kopenhagen, und hier vor allem bei meinem Freund, Rechtsanwalt Nicolai Mallet. Des Weiteren bei Rainer „Ratze“ Liedtke für hilfreiches Material und zahlreiche Hintergrundinformationen. Außerdem danken wir den Supportern Ingo Reißner, Frank Misch, Stefan Gympel, Thomas Czerwionka und Rechtsanwalt Dirk Ulrich Greiser sowie meiner lieben Frau Gabi. Ohne Euch hätten wir das alles nicht gestemmt!
Geschichte(n) vorab
Der Fußball kommt nach Berlin (1883 – 1904)
Am 11. September 1897 gründete sich der Verband der Deutschen Ballspielvereine (VDB) in der Kreuzberger Bergmannstraße, wo der BFC Preussen von 1894 in der Gaststätte Dustern Keller sein Domizil besaß. „Deutsch“ deshalb, weil man darauf baute, auch Vereine aus dem Reich aufnehmen zu können. Anwesend waren Vereinsvertreter von Britannia, Fortuna, Preussen, Argo, Brandenburg, Akademischer BSC und Rapide. Die sechs Gründungsvereine des VDB waren der BFC Preussen 1894, BFC Fortuna 1894, FV Brandenburg 1892, SC Argo, SC Hohenzollern Lichterfelde und der Friedenauer SC 1896.
Doch resümieren wir die Vereinsgründungen in Berlin möglichst exakt in chronologischer Folge. Begonnen hatte alles 1885 mit dem Berliner Fußball Club Frankfurt und dem FC Concordia Wilhelmsruh 1895, der rasch zur Berlin-Liga zählte. Ihnen folgten der Friedenauer TSC (1886), Germania 88 und der TSV Rudow (beide 1888), Viktoria 89, Stern Britz (1889), BFC Alemannia, Blau-Weiß 90 (beide hatten sich am 2. November 1890 gegründet; Blau-Weiß entstand jedoch erst 1927 aus der Fusion von FC Union 1882 und Vorwärts 90). Aus der TV Dorner (1891) gingen später die Reinickendorfer Füchse hervor. Dazu kam der BFC Askania und der BFC Teutonia (beide 1891). Die Alte Dame Hertha hieß ursprünglich BFC Hertha 92 (1892). Der FV Brandenburg von 1892 wurde später zur Lichterfelder SU, dann zum VfB Lichterfelde und schließlich zum LFC. Britannia 92 von 1892 nannte sich später BSV 92. 1893 fiel der Startschuss für Minerva 93, genauso wie für BFC Rapide, aus dem später Rapide Wedding wurde und für den VfB Pankow. BFC Preussen, BFC Fortuna und der Spandauer SV nahmen ihre Aktivität alle 1894 auf. Der BSC ein Jahr danach, wobei sich die Fußballabteilung erst wesentlich später bildete, so dass der Verein nur mit Einschränkungen in diese Auflistung gehört. 1895 war das Gründungsjahr des 1. FC Neukölln, 1896 dasjenige von Nord-Nordstern, und 1897 folgte Helgoland 97. Jahr für Jahr brachten Neugründungen: Norden Nordwest und BTuFC Helvetia (beide 1898), Corso Vineta und Spandauer SC (beide 1899), NSC Cimbria (1900), sowie, im selben Jahr, Tasmania, die Kickers und Wacker (der spätere SC Siemensstadt). Der SC Westend erblickte 1901 das Licht der Öffentlichkeit, ihm folgten 1902 Marathon 02, der SCC und Tennis Borussia. Seit 1903 existieren Hertha 03 Zehlendorf, Blau-Weiß Spandau und der FC Brandenburg 03. Wobei wir hier vom heutigen Berlin ausgehen. Fest steht aber auch, dass Randbezirke wie Reinickendorf, Zehlendorf oder auch Spandau erst ab 1920 zu Berlin gehörten.
Gründung und Entwicklung des Vereins (1904 – 1950)
Der SC Wacker 04 wurde am 25. Juli 1904 gegründet. Bis ein Verein eine solide Basis hat und etabliert ist, durchläuft er verschiedene Entwicklungen. Manchmal kommt es auch zu Zusammenschlüssen mit anderen Vereinen sowie Umbenennungen inklusive wechselnder Vereinsfarben. Dies war beim SC Wacker 04 Berlin nicht anders.
Bereits 1902 hatten sich in den nördlichen Industrievororten von Berlin (Reinickendorf ist Berlins nördlichster Bezirk) Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren zusammengetan und – vermutlich ohne es zu wissen und zu wollen – den Ball für Wacker 04 ins Rollen gebracht. Der Kapitän (später hieß er Spielführer, heute ist er, wie ehedem, der Kapitän) hatte Schärpen umgehängt, die Spieler trugen Rudermützen. Die Torstangen wurden noch zum Platz getragen, während die Torlatte ein gespanntes weißes Band war. Die Wacker-Jubiläumsfestschrift von 1954 (Vgl.: 50 Jahre SC Wacker 04) formulierte pathetisch: „die ungeheure Begeisterung aller Teilnehmer brachte die in unserm Sport liegenden Werte doch ans Tageslicht und gab vielen von ihnen jenen fanatischen Glauben an die gute Sache, der sie für immer treu zur Fahne halten und das Fundament unserer Bewegung werden ließ.“
Tegel ist ein gemütlicher, bürgerlicher Ortsteil von Reinickendorf, bekannt vor allem durch den Tegeler See, der noch heute ein beliebtes Ausflugsziel ist. 1903 existierte dort in Form eines losen Zusammenschlusses der FC Vorwärts sowie, allerdings lediglich für eine kurze Zeit, eine Normannia. Doch bereits 1904 machte man sich daran, einen richtigen Verein mit dazugehöriger Satzung zu gründen. Im Zentrum Reinickendorfs (also etwa in der Gegend rund um die Residenzstraße) gab es einen Reinickendorfer Fußball Club West 04, in dem längst vergessene Männer wie Kossacks, Zellmer, Rülmann oder der spätere Wacker 04 Präsident Franz Dobbratz engagiert waren. In Tegel hatte sich darüber hinaus ein TFC Wacker 05 gegründet. Dort war Otto Hein aktiv, der auch noch Wackers Vorsitzender werden sollte. Noch im selben Jahr lösten sich diese Vereine auf. Gegründet wurde stattdessen der TFC Hohenzollern mit den Vereinsfarben Schwarz-Weiß-Rot. Gekickt wurde auf einem Gelände gegenüber der Tegeler Strafanstalt. Zu jener Zeit taten sich drei Gruppen zusammen: die Jungs im Einzugsbereich der Chausseestraße, die Reinickendorfer und eben die Tegeler.
Es gab laut Vereinsschrift schon damals ein blühendes Vereinsleben. „Der Verein wurde nicht allein durch seine guten Spiele bekannt, sondern auch durch seine großartige Geselligkeit, da es kein Spiel gab, dem nicht ein Kommers folgte“, wie es damals noch hieß. Ein Herr Stoffregen aus Hannover war als Mitarbeiter der Großfirma Borsig 1906 nach Berlin gezogen und bei der Gelegenheit auch Mitglied des Vereins geworden. Als 1907 der „Berliner Ballspiel Bund“ gegründet wurde, wurde Stoffregen dort Schriftführer. Die erste Meisterschaft wurde 1907/08 von den Hohenzollern nach voraufgegangenem Kräftemessen mit Nordstern gewonnen. Bereits im Frühjahr 1908 traten aber politisch motivierte Zwistigkeiten im Verein auf. Die besten Kicker wollten nicht mehr unter diesem Namen antreten und wechselten geschlossen zum RFC West 04. Blau-Weiß-Schwarz waren nun für einen allerdings überschaubaren Zeitraum – vom 8. Juli bis zum 19. August (!) – die Vereinsfarben.
An diesem Sommertag verhandelten die Herren Jädick (1. Vorsitzender des TFC Hohenzollern) und besagter Stoffregen für die übriggebliebenen „Hohenzollern“ mit den Herren Dobbratz und Leonhard von Wacker 04.
Aus diesen Verhandlungen ging, auf den Tag genau am 18. September 1908, der Tegeler Sportclub Wacker 04 hervor. Der Gründungstag – eine kleine Schummelei – wurde auf den 25. Juli 1904 rückverlegt. Die Vereinsgaststätte befand sich in der Birkenstraße. Nicht zu verwechseln, aber das versteht sich von selbst, mit der heutigen Birkenstraße im Bezirk Moabit. Sondern die heutige Kienhorst Straße hieß damals eben noch Birkenstraße. Später waren dann sowohl das Vereinsheim als auch der Sportplatz an der heutigen Kreuzung Eichborndamm/Oranienburger Straße gelegen. Diesen Hinweis verdanke ich dem Reinickendorfer Kartenexperten, Herrn Markus Heske.
Wie in einem anderen Kapitel bereits angedeutet, ging es in einer Wacker-Jubiläumsschrift von 1954 darum, Spieler dafür, dass sie den Verein wechselten, zu kritisieren. Dies war aber nicht lediglich ein Problem der frühen 1950er Jahre, sondern zieht sich über die Jahrzehnte bis in die Gegenwart (jüngstes Beispiel Lewandowski) hin. Allenthalben handelt es sich bei dem dann anstehenden Vertragsgezänk um den finanziellen Aspekt, damals freilich auf ungleich niedrigerem Niveau als heutzutage. Weil der Fußballsport nach dem Krieg sich noch halbwegs auf Amateurniveau bewegte.
Zwar wurden 1962 endlich Nägel mit Köpfen gemacht, als man auf einem Bundestag des DFB in Dortmund die Gründung der Bundesliga beschloss. Die Professionalisierung des Fußballs (= Kommerzialisierung) war damit endgültig zu einem festen Bestandteil dieser sportlichen Betätigung geworden. Die verbale Rechtfertigung erfolgte prompt durch einen Kommentar von Dietrich Schulze-Marmeling: „Der deutsche Amateurismus war eine Weltanschauung, die den Professionalismus als dekadente Entartung, besonders üble Form der materialistischen Verseuchung, Ausdruck eines unseligen Zeitgeistes etc. verurteilte und den Profisportler gewissermaßen in die Nähe der Prostitution rückte.“ Und weiter zitiert er aus dem DFB-Jahrbuch von 1930: „Die Pflege des Amateursports verlangt auf der anderen Seite Kampf gegen den Berufssport. Es ist unsere Pflicht, Berufssportler, die sich in unseren Reihen finden sollten, auszumerzen. (…) Tatsächlich wurde die wirtschaftliche Depression zum Geburtshelfer des Fußballprofitums in Deutschland“, lautete sein neutrales Resümee.
Wie hat man sich das vorzustellen? Es ging im Wesentlichen weniger um punktuelle Geldbezüge, sondern vielmehr um eine solide Arbeitsplatzbeschaffung mit den entsprechenden Aufstiegsmöglichkeiten. Das prominenteste Gegenbeispiel allerdings war ausgerechnet der spätere deutsche Nationalheld Sepp Herberger, der seinen Spielern, einerseits, unentwegt die Flausen vom großen Geld madig machte, selbst aber, andererseits, seine moralischen Ansprüche der finanziellen Besserstellung aufgeopfert hatte. Bereits im Herbst 1921 war er, aus eindeutig pekuniären Gründen, von Waldhof Mannheim zum Ortsrivalen Phönix gewechselt. Seine offizielle Begründung für diesen Vereinswechsel lautete zwar dahingehend, dass der neue Verein ihm, als Zugabe, ein über den Ballsport hinausgehendes Jobangebot unterbreitet habe. Darüber hinaus seien im sportlichen Umfeld von Phönix bessere Voraussetzungen vorhanden, nach seiner Karriere als Fußballer das Handwerk des Trainers zu erlernen. – Unter der Hand freilich erhielt Herberger, eine kleine Entscheidungshilfe, eine Zuwendung von 10.000 Mark. Die Kehrseite der Medaille: Er durfte, der Deal gelangte an die Öffentlichkeit, fortan nicht mehr für die deutsche Nationalelf auflaufen, heißt, wurde lebenslang gesperrt. Die Reue des Ertappten freilich kam zu spät und vor allem: Sie erzielte nicht den erwünschten Erfolg.
Selbstredend ist auch Wacker 04 keine – löbliche – Ausnahme von der inzwischen hundertjährigen Regel gewesen. So heißt es in der Chronik zum 50-jährigen Vereinsjubiläum: „Von der 1. Mannschaft gingen im Juni 1920 F. Bache zu ‚Hertha 92‘, die Gebrüder Strehlke und A. Schudowa zu ‚Minerva 93‘, R. Mittelstädt zu ‚Wedding’ und E. Hawranneck zu ‚Triton Spandau‘.“ Und das finanziell unterfütterte Wechseln fand seine zeitnahe Fortsetzung. „Da die neue Spielzeit schon begonnen hatte, wirkte es wie ein Bombeneinschlag bei uns, als wir eines Sonnabends früh die Abmeldung von weiteren vier Spielern der 1. Mannschaft erhielten. H. Lemke und F. Binte waren der Berufsspielertruppe ‚Eidinger und Amsel‘ in die Arme gelaufen, M. Wuschke war von ‚NNW‘ liebevoll aufgenommen worden, und O. Klippenstein hatte vom ‚BSC‘ eine Anstellung erhalten. (…) Nun standen wir zu Anfang der Spielzeit 1920/21 ohne ein festes Mannschaftsgefüge da.“ A. Strehlke wechselte 1922 übrigens zu Alemannia-Haselhorst, weil man ihm dort einen Arbeitsplatz in einer Margarinefabrik in Aussicht gestellt hatte.
Auf Seite 30 fährt der Chronist dann interessanterweise wie folgt fort: „Das Berufsspieler-Intermezzo, in das sich einige unserer Spieler verstickt hatten, ging nach nur zwei Spielen gegen eine ungarische Profimannschaft pleite, und wir waren nun wieder gut genug, für die Begnadigung dieser Spieler zu kämpfen. Im Anfang des Jahres 1921 gab es dann vom DFB eine allgemeine Amnestie für alle Verstöße gegen den damaligen § 66, wie später noch öfter, und H. Lemke, F. Bache, A. Schudoma, und A. Strehlke wurden wieder unsere Mitglieder. An den Verbandsspielen durften sie aber erst in der nächsten Spielzeit wieder teilnehmen, während ihre Mitwirkung bei Gesellschaftsspielen erlaubt war.“
1942, also mitten im Zweiten Weltkrieg, wurde weiterhin Fußball gespielt. Wacker 04 machte da keine Ausnahme. Man spricht ja immer über die tollen Jahre in der 2. Bundesliga, übersieht dabei aber, dass Wacker 04 zwar leider nie in der („richtigen“) 1. Bundesliga gespielt hat (siehe das unsägliche „Braunschweig-Drama“ 1974), aber dennoch ganze 34 Jahre (!) erstklassig spielte! Und zwar im sogenannten „Sportbereich 3 Berlin-Brandenburg“.
Jedenfalls hatten die Veilchen des Nordens eines schönen Sonntags mal wieder ein Auswärtsspiel in der Köpenicker Wuhlheide bei Union-Oberschöneweide. Von Seiten der Berliner Straßenbahn wurde tatsächlich ein Sonderzug für die zahlreichen Wacker 04-Anhänger bereitgestellt. Ausgangspunkt war die Scharnweber Straße (heutige General Barby Straße). Da der reguläre Linienbetrieb nicht unterbrochen worden war, mussten etliche Pausen auf der langen Fahrt eingelegt werden. Außerdem musste, der Zeitverzögerung zweiter Teil, der Schaffner immer wieder die Straßenbahn verlassen, um per Hand die Weichen zu stellen. Im Anschluss an die Fahrt quer durch Berlin mussten die 04-Fans noch einen Fußmarsch durch den Wald auf sich nehmen, um an ihr eigentliches Ziel zu gelangen. Und der ganze Aufwand hatte sich, wie sich kurze Zeit später herausstellte, gelohnt: Wacker 04 siegte mit 6:3! Das muss schon allein deshalb für extreme Ausgelassenheit gesorgt haben, weil die Wackeraner in der Spielzeit zuvor mit 1:7 unterlegen waren.
Bei der Gelegenheit soll auf die unterschiedlichen Taktiken im Laufe der Jahrzehnte ein Blick geworfen werden. Als Deutschland 1954 erstmals Weltmeister wurde, spielten sie mit lediglich fünf Angreifern, da vor dem Weltkrieg tatsächlich mit acht Angreifern das gegnerische Tor berannt worden war. 1974, beim zweiten WM-Titel, war das 4-3-3-System das Maß aller Dinge. 1990 waren es nur noch zwei (3-5-2), und beim letzten Titel 2014 kam lediglich einer zum Einsatz.
Zugegeben, das war eine globale Entwicklung. Worauf ich aber hinauswill: Früher ging es den Mannschaften prinzipiell darum, möglichst viele Tore zu erzielen. Gegentore gehörten entsprechend auch dazu. Heute redet man von Kompaktheit, Laufbereitschaft, Mentalität und schließlich noch von Mut zum Risiko, wenn ein Spieler ab und an das Leder in die Schnittstelle der Abwehr transportiert. Das sind doch alles Selbstverständlichkeiten oder sollten es jedenfalls sein. Genauso aberwitzig ist das unentwegte Resümieren der von den Kickern abgespulten Kilometer pro Match. Ganz so, als ob sie mit ihrer doch eigentlich ebenso selbstverständlichen Laufbereitschaft ihre absurd hohen Millionengagen ernsthaft rechtfertigen könnten. Was folgt daraus? Dass Resultate wie das 1:7 oder 6:3 vor achtzig Jahren sicher nicht mit taktischen Höchstleistungen zu erklären sind.
Im Jahr 1947 waren im Übrigen die ersten fünf deutschen Ligen wie folgt untergliedert: In der amerikanischen Zone spielten Eintracht Frankfurt, Kickers Stuttgart, VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg, SV Waldhof Mannheim, 1860 München, Schwaben Augsburg, Schweinfurt 05 und Kickers Offenbach. In der russischen Zone tummelten sich Dresden, Dessau, Leipzig-Probstheida, Chemnitz und Zwickau. Die britische Zone bestand aus FC St. Pauli, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, Borussia Dortmund, Schalke 04, VfB Lübeck, Rot-Weiß Oberhausen, Werder Bremen, Holstein Kiel, VfL Köln und TSV Braunschweig. Und die französische Zone schließlich setzte sich aus Wormatia Worms, 1. FC Saarbrücken, 1.FC Kaiserslautern, Mainz 05 und VfL Konstanz zusammen. In der Berliner Stadtliga spielten Charlottenburg, Oberschöneweide, Wilmersdorf, Südring, Staaken, Köpenick, Prenzlauer Berg, Mariendorf und Reinickendorf-West. Bei Reinickendorf-West handelte es sich um den für kurze Zeit umbenannten SC Wacker 04-Tegel, der seit dem 13.3.1949, also zwei Jahre später, SC Wacker 04 Berlin hieß.
Das wichtige Bruderpaar bei Wacker 04
Zwei immens wichtige Männer bei Wacker 04 waren die Brüder Otto und Walter Nadolny, die leider nicht im Internet zu finden sind. Beginnen wir mit Walter, der um 1920 herum mitwirkte, den Wackerplatz wieder in Schuss zu bringen, bzw. erstmals einen richtig schönen Rasenplatz anzulegen. Er war eigentlich Verwaltungsobmann bei den Wackeranern, setzte aber seine Energie bis zu einem schweren Nervenzusammenbruch dafür ein, dem Verein auf jede erdenkliche Art zu helfen. Er beteiligte sich sogar an den Kosten des Aufbaus, indem er 5000 RM aus seinem Privatvermögen beisteuerte. 1938 wurde er von den Nationalsozialisten zum Vereinsführer bestimmt, womit er Otto Pelzner ablöste. Es war zwar einerseits klar, dass das NS-Regime nur Gesinnungsfeste mit Führungspositionen betraute. Andererseits aber ist über die genauen Hintergründe dieses Vorgangs (bzw. die eigentliche Gesinnung von Nadolny) nichts bekannt geworden. Zehn Arbeitspflichtstunden ‚brummte‘ er den Vereinsmitgliedern auf, um noch vor Kriegsanbruch den Platz umzugestalten. Die berühmten Pappeln pflanzte er 1939 sogar eigenhändig. Nach dem Krieg stand er der Sportgruppe Reinickendorf-West, also Wacker 04 Tegel vor. Doch 1947 zwang ihn der oben bereits erwähnte Nervenzusammenbruch, sein Amt niederzulegen. Zwar kehrte er noch einmal kurz als Vorsitzender zurück, doch krankheitsbedingt zog er sich dann bald schon endgültig aus dem Vereinsleben zurück. 1948 wurde der Platz vor allem mithilfe fleißiger Vereinsmitglieder erneut in Stand gesetzt.
An dieser Stelle kommt der ältere Bruder Otto – der sogenannte „Gras-Opa“ vom Wackerplatz – ins Spiel, der zunächst als Torwart und Verteidiger bei den Veilchen seinen Mann stand, und nach seiner aktiven Laufbahn als Spielausschuss-Obmann fungierte. Doch im Zuge der Begrünung der Spielfläche fand er zu seiner wahren Bestimmung: den Rasen fortan instand zu halten. Das sah dann so aus, dass er über die Grashalme wachte wie die Ordner im Louvre über die Mona Lisa. Auch junge Spieler wurden dazu angehalten, beispielsweise Unkraut auszustechen. Dafür durften sie dann auch barfuß kicken. Die Vertragsspieler trainierten in Turnschuhen, und nur am Spieltag waren die gängigen Stollenschuhe bei Nadolny erlaubt. Im Jahre 1953 verstarb er mit nur 62 Jahren an einer „heimtückischen Krankheit“, wie die Wacker-Jubiläumsschrift zum 50-jährigen Bestehen des Vereins vermeldete. Nicht zuletzt dank Gras-Opas unermüdlichem Einsatz heißt der Wackerplatz zurecht das „Schmuckkästchen“. Hans Lehmann, bis 1967 für zwanzig Jahre Wacker 04-Kicker, klärt uns auf: „Wenn sonntags ein Spiel war, haben sie vorher die Fahnenstangen weiß angestrichen. In den Ecken blitzten die lila-weißen Wimpel. Das war alles wie aus dem Ei gepellt. Daher kam der Begriff ‚Schmuckkästchen‘.“
Ein Nationalspieler bei Wacker 04!
Bereits im Jahr 1923 gehörte zum Team von Wacker 04 ein deutscher Nationalspieler. Fritz Bache (gerufen „Neipe“) war sein Name. Dieser wuchtige Verteidiger, der in einer Brauerei arbeitete, wurde am 29. März 1898 geboren, wechselte zwar von Wacker 04 zum BFC Hertha 1920, kehrte jedoch alsbald wieder zurück an den Wackerweg. Von 1921 bis 1924 kickte er im Trikot der 04er und wurde zweimal in die deutsche Nationalelf unter Professor Otto Nerz berufen. Er debütierte am 4. November 1923 in Hamburg, beim 1:0 Sieg im Freundschaftsländerspiel gegen Norwegen, als Deutschland mit folgender Aufstellung antrat: Stuhlfauth, Risse, Bache, H. Schmidt, Kalb. W. Krause, Leip, Reißmann, Harder, Wieder, Sutor.
Am 31. August 1924 durfte er dann noch ein zweites Mal ran, beim 1:4 gegen Schweden im Deutschen Stadion, das auch unter dem Namen Berliner Grunewald Stadion bekannt war. Auf diesem Areal befindet sich heute das Olympiastadion. Fürth und Nürnberg stellten zu dieser Partie keine Akteure ab, so dass Fußballer aus Berlin, Hamburg, Leipzig und Dresden nachrücken konnten.
1924 spielte er auch für Alllemannia (sic!), wo er einmal an der Endrunde zur DM teilnahm. Fast genauso wichtig wie die Länderspielverpflichtungen sind jedoch die wenigen überlieferten Gerüchte, die über ihn kursierten. So soll er im April 1923 bei einer Reise mit der Berliner Stadtauswahl nach Bratislava und Budapest zuerst versehentlich eine Hoteltür und später eine Glastür bei der Deutschen Reichsbahn zertrümmert haben. Die Grobmotorik war ihm also offensichtlich durchaus vertraut. Die Autoren Knieriem und Grüne resümieren: „Für die Begleichung des ersten Schadens (21 Mio. ungarische Kronen) stand Bache übrigens selber gerade, derweil die Kosten für sein zweites Missgeschick vom Berliner Verband übernommen wurden.“
Bache starb am 6. Dezember 1959 mit nur 61 Jahren. Aber woher hatte er seinen Spitznamen „Neipe“? Es war ganz simpel. Bache hatte einen leichten Sprachfehler. Er konnte das „k“ nicht richtig aussprechen: „Gehen wir in die Neipe…?“
Der Fußballer Bache und sein sprachliches Handicap: Abgehsehen von seinem Engagement bei Wacker 04 absolvierte Bache 36 Spiele für die Berliner Stadtauswahl. Es war im April 1923, als Berlin in Budapest antrat. Im Zug hatte der umstrittene DFB-Begleiter Carl Koppehel noch gefrotzelt, dass der „Neipe“ wohl nie im Leben ein Tor schießen werde und schon gar nicht einen Elfmeter verwandeln könne. Doch dann geschah es! Berlin erhielt einen Elfmeter zugesprochen und Bache, immer mit einem kleinen Bäuchlein ausgestattet, trabte los und schnappte sich das Leder. Sein Schuss hatte eine derartige Urgewalt, dass der ungarische Goalie nur noch schnell den Kopf einziehen konnte. Tor! Und Bache stürmte gleich darauf in Richtung Carl Koppehel, der neben der ungarischen Delegation saß, und stellte, vermutlich mit einem breiten Grinsen, die naheliegende Frage: „Noppehel, wat sagste nu?“
Heimstätte „Am Wackerweg“: Ein Club und sein Stadtteil
„Was früher galt, als die von meiner Straße, und da gehe ich hin, weil das die sind und für die bin ich, also so eine Art Patriotismus, das gibt’s auch zunehmend nicht mehr.“ (Der Kabarettist Dieter Hildebrandt 2006 in seinem Hörbuch „Dieter Hildebrandt wirft ein“) Fährt man heutzutage mit dem Bus in Richtung U-Bahnhof Scharnweber Straße, ertönt es zwei Busstationen davor aus dem Lautsprecher: Kienhorststraße. Das war doch, schießt es mir sofort durch den Kopf, früher mein geliebter Wackerweg. Wacker 04 war bundesweit der einzige Verein, nach dem eine Straße benannt worden war.
Unvergessen die Sonntagnachmittage zwischen 1987 und 1994. Gemeinsam mit meinen damaligen Freunden zum Wackerplatz. Von der Pannwitzstraße, wo meine Eltern ein Haus hatten, ging es hoch zum Eichborndamm, wo der Verkehrslärm der Feiertagslaune ein wenig abträglich war. Doch dann bogen wir rechts in den Wackerweg ein, und spätestens von hier ab setzte ein irres Kribbeln in der Magengegend ein. Es ging, links und rechts befanden sich Gärten, den ungepflegten Sandweg hinunter. Allmählich zog der Duft von Bier und Wurst in unsere Nasen, und aus der Ferne hörten wir bereits die Stadionsprecheranlage. Vorstand Fritz Herz war beispielsweise gerade dabei, die anwesenden Gäste mit: „Guten Tag meine lieben Fußballfreunde“ zu begrüßen. Gleich darauf wurden Hände geschüttelt, immer wieder kam es auch zu einem Smalltalk mit den Spielern, und von überall her erklang ein uns willkommen heißendes „da seid ihr ja wieder!“ Nachdem die mitgebrachte lila-weiße Fahne hinter dem Tor positioniert worden war, konnte das Spektakel beginnen. Großkampftag für Blutdruck, Herzmuskeln und Stimmbänder.
Der Sportkanal DSF warb um die Jahrtausendwende mit dem Slogan „Mittendrin statt nur dabei“ und suggerierte damit allen Ernstes, dass der TV-Zuschauer eine Art richtiger Teilnehmer der Ligaspiele sei! Wenn aber überhaupt so etwas wie ein „mittendrin“ existiert, dann lediglich und ausnahmslos im Amateurfußball. Hier wird einem Spieler noch, wie damals Ingo Reißner, beim Warmmachen ein Kaffee über den Zaun gereicht. Nur hier ruft der Fan einem Spieler (oder noch schöner dem Schiri!) etwas zu, das dieser dann auch wirklich registriert und eventuell beherzigt. – Was ich damit sagen will? Statist ist man in einem bis auf den letzten Platz besetzten großen Bundesligastadion. Einsam und allein kann man sich hier bisweilen durchaus fühlen. Und zwar paradoxerweise gerade deswegen, weil man in der Masse der abertausenden Fans untergeht und verschwindet. Wir Fans sind nicht nur hinsichtlich der räumlichen Distanz vom Ort des Geschehens himmelweit entfernt, sondern auch unter dem finanziellen Gesichtspunkt trennen uns Welten von den Elitekickern.
Aber beim Amateurkick auf dem Wackerplatz vor 100 Unentwegten, da war und ist jeder, ob Besucher, Sprecher, Spieler oder Pressefritze, ein Teil vons Janze. Nach den Spielen wurde in den guten alten Zeiten im Wacker-Casino oft noch ausgiebig geredet, gespeist, vor allem jedoch getrunken und zwar zumeist zusammen mit den sich mit „Beam-Cola“ erfrischenden Spielern. Und oft ging es – der Anpfiff war ja vorwiegend schon um 14:30 Uhr – erst gegen 21:00 Uhr wieder in Richtung Heimat. Dort wurde häufig noch Zotiges gesungen, und die Fahnen geschwenkt, was ich im Nachhinein auch nicht mehr komplett großartig finde, da es – vor allem am Sonntagabend – auch Leute gibt, die grölenden Fußballfans nicht völlig vorurteilsfrei gegenüber stehen… Indes, so neu war das alles anscheinend gar nicht, was wir im Jahre 1991 veranstalteten, wenn man dem Zeitzeugenbericht eines Werner Siebke Glauben schenken darf. Was ich natürlich gerne tue… – Dieser nämlich hatte im Beiheft der Ausstellung „…körperlich und physisch topfit!“ das Folgende notiert: „Als wir uns schließlich auf den Heimweg machten, waren wir alle nicht mehr ganz nüchtern (…) Jetzt singt mal ein richtig schönes Fußballlied! Forderte ich sie auf. So marschierten wir über den Eichborndamm. Es war 22:00 Uhr. Damals ging die Polizei noch regelmäßig Streife.“ Jedenfalls setzte es wegen „nächtlicher Ruhestörung“ eine Geldstrafe, die der Älteste (Siebke!) begleichen musste. Und was sich im Jahr 1951, also 40 Jahre vor uns, im Wacker-Casino abgespielt hatte, war uns späteren Wacker 04 Fans auch geläufig. Werner Siebke, die Zweite: „Nach jedem Heimspiel wurde im Wacker Casino gefeiert. Das war eine Stimmung! Wir haben lauthals gesungen. ‚Lila-weiß sind unsere Farben, lila-weiß ist unser Stolz. Ein jeder Feind, der hat’s verspüret, ja, wir sind aus kern’gem Holz‘.“ Gut, Feinde nannten wir die Fangemeinde der Gegner dann doch nicht mehr.
Noch ein kleiner Schwenk zum Thema Fußballsport in Verbindung mit dem Ausschank von Alkoholika sei an dieser Stelle aus gegebenem Anlass eingefügt. Besieht man sich die Werbung in den 1950er Jahren, fällt einem sofort auf, dass lediglich für wenige Produkte geworben wurde: Kaffee, Leder, Bier und Zigaretten, was auch in der Broschüre „50 Jahre Wacker 04“ aus dem Jahr 1954 vermerkt worden ist. Aber bereits in den 1920er Jahren fragte man sich, ob es denn sinnvoll sei, einerseits auf Wehrfähigkeit und körperliche Ertüchtigung zur Volksgesundheit zu setzen – ein Beispiel mehr dafür, dass viele Dinge, die üblicherweise der Hitler-Zeit vorbehalten zu sein scheinen, schon 20 Jahre zuvor bis in den Sprachgebrauch hinein grassierten –, andererseits aber dem Alkohol zuzusprechen. Der DFB freilich verwies darauf, dass er Einnahmequellen benötige, und dass es ja gerade die Brauereien seien, die mit ihrem finanziellen Engagement (wenn auch nicht uneigennützig) dafür gesorgt hätten, den Bau und Erhalt von Sportplätzen überhaupt zu gewährleisten. Geradezu legendär ist der folgende Passus, in dem der DFB seine, aus heutiger Sicht, durchaus erheiternde Beweisabsicht zu verplausibilisieren unternimmt: „Um ein geschlossenes Vereinsleben beizubehalten und um auch den Eltern unserer Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ohne jede Hemmung (sic!) und Einschränkung in den Klubhäusern zu verkehren und dabei die Betätigung ihrer Kinder im Vereinsleben zu überwachen, muss ein absolutes Alkoholverbot in Klubhäusern als eine Gefahr für das Vereinsleben betrachtet werden.“ (Aus dem DFB-Jahresbericht 1927/28)
Das sahen „wir“ bei Wacker 04 genauso, und arbeiteten – ich werde jetzt ein bisschen süffisant – eifrig dagegen an.
Bis 1920 zählte der Bezirk Reinickendorf übrigens zum Landkreis Niederbarnim des preußischen Bezirks Brandenburg. Deshalb kickte Wacker 04-Tegel dort auch seit 1918. Als Tabellendreizehnter stiegen sie in dieser Saison allerdings sofort ab.





























