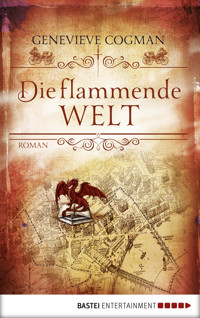14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Liga des Scarlet Pimpernel
- Sprache: Deutsch
England, 1793. Vampire und menschliche Aristokraten leben Seite an Seite. Das Bluttrinken ist eine geregelte Angelegenheit, gemordet wird höchstens im Geheimen. Als in Frankreich die Revolution ausbricht, setzt eine Gruppe von verwegenen Kämpfern alles daran, die französische Königsfamilie vor der Guillotine zu retten. Ihr Deckname: die Liga des Scarlet Pimpernel. Unvermittelt sieht Eleanor sich in dieses Abenteuer verstrickt, ein Dienstmädchen mit starker Ähnlichkeit zu einer hochgestellten Persönlichkeit. Ihr Auftrag: nach Frankreich reisen und in die Rolle von Marie Antoinette schlüpfen. Als eine Magierin von ihr Besitz ergreifen will, wird ihr klar, dass neben der Französischen Revolution auch ein uralter Krieg zwischen Zauberern und Vampiren stattfindet - und sie sich mitten darin befindet ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungEinige kurze Bemerkungen zur Französischen RevolutionDramatis PersonaePrologErstes KapitelZweites KapitelDrittes KapitelViertes KapitelFünftes KapitelSechstes KapitelSiebtes KapitelAchtes KapitelNeuntes KapitelZehntes KapitelElftes KapitelZwölftes KapitelDreizehntes KapitelVierzehntes KapitelFünfzehntes KapitelSechzehntes KapitelSiebzehntes KapitelAchtzehntes KapitelNeunzehntes KapitelZwanzigstes KapitelEinundzwanzigstes KapitelZweiundzwanzigstes KapitelDreiundzwanzigstes KapitelVierundzwanzigstes KapitelDanksagungenÜber dieses Buch
England, 1793. Vampire und menschliche Aristokraten leben Seite an Seite. Das Bluttrinken ist eine geregelte Angelegenheit, gemordet wird höchstens im Geheimen. Als in Frankreich die Revolution ausbricht, setzt eine Gruppe von verwegenen Kämpfern alles daran, die französische Königsfamilie vor der Guillotine zu retten. Ihr Deckname: die Liga des Scarlet Pimpernel. Unvermittelt sieht Eleanor sich in dieses Abenteuer verstrickt, ein Dienstmädchen mit starker Ähnlichkeit zu einer hochgestellten Persönlichkeit. Ihr Auftrag: nach Frankreich reisen und in die Rolle von Marie Antoinette schlüpfen. Als eine Magierin von ihr Besitz ergreifen will, wird ihr klar, dass neben der Französischen Revolution auch ein uralter Krieg zwischen Zauberern und Vampiren stattfindet – und sie sich mitten darin befindet …
Über die Autorin
Genevieve Cogman hat sich schon in früher Jugend für Tolkien und Sherlock Holmes begeistert. Sie absolvierte ihren Master of Science (Statistik) und arbeitete bereits in diversen Berufen, die primär mit Datenverarbeitung zu tun hatten. Mit ihrem Debüt »Die unsichtbare Bibliothek« sorgte sie in der englischen Buchbranche für großes Aufsehen. Die Reihe um Agentin Irene Winters hat auch in Deutschland viele Fans. Genevieve lebt im Norden Englands.
FRANKREICH, 1793REVOLUTIONEN VERLANGEN BLUTVAMPIRE AUCH
Roman
Übersetzung aus dem Englischenvon Dr. Arno Hoven
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Titel der englischen Originalausgabe:
»Scarlet«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2023 by Genevieve Cogman
First published 2023 by Tor, an imprint of Pan Macmillan,a division of Macmillan Publishers International Limited
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Textredaktion: Dr. Frank Weinreich, Bochum
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.deunter Verwendung von Motiven von © Markus Weber/Guter Punkt, München
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-4797-4
luebbe.de
lesejury.de
Für das »Terminologie & Klassifikationen«-Team, das mich gewiss vor der Guillotine retten würde.
Einige kurze Bemerkungen zur Französischen Revolution
Soziale und ökonomische Ungleichheit – Erwerbslosigkeit, hohe Lebensmittelpreise, wirtschaftliche Krisen, mangelhafte Führung des Steuerwesens und Widerstand der herrschenden Oberschicht gegen Reformen – führen nicht immer zu einer landesweiten Revolution und der öffentlichen Hinrichtung des Königs. Doch manchmal passiert genau das.
Eine vollständige Erörterung der Französischen Revolution müsste natürlich sehr viel ausführlicher ausfallen, als es auf diesen wenigen Seiten möglich ist – und würde auch keine Vampire miteinbeziehen. Die meisten Leute sind sich allerdings darüber einig, dass sie mit dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 wirklich begann. Dies geschah, nachdem Gerüchte in Umlauf gekommen waren, dass König Ludwig XVI. die Absicht hätte, die Nationalversammlung, eine Vereinigung aus nicht-adligen Bürgern, zu schließen und Reformen zu unterbinden. Es folgten Bauernaufstände im ganzen Land. In dem Bemühen, die Bevölkerung zu beruhigen, erließ die Nationalversammlung die August-Dekrete, die den Feudalismus, einschließlich der Steuerbefreiung des Adels, die Abgabe des Zehnten und den Verkauf von Justizämtern abschafften, und verkündete die Gleichheit vor dem Gesetz, das Recht auf freie Ausübung der Religion und vieles mehr. Darüber hinaus wurde Paris durch die Schaffung der Nationalgarde zur am besten überwachten Stadt Europas. Ludwig XVI., der kaum eine andere Wahl hatte, stimmte der konstitutionellen Monarchie widerwillig zu und setzte sich eine dreifarbige Kokarde auf. Ebenfalls noch im August 1789 wurde die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verabschiedet.
So weit, so gut.
Die Nationalversammlung war jedoch in zunehmendem Maße gespalten. Im Juni 1791 spitzte sich die Situation zu, als die königliche Familie versuchte, aus Paris zu fliehen und in Österreich Zuflucht zu nehmen. Allerdings wurden sie unterwegs erkannt und festgenommen. Die öffentliche Meinung wendete sich gegen den König, der des Versuchs beschuldigt wurde, konterrevolutionäre Handlungen zu organisieren – ein Verrat an der Revolution und ihrem Gedankengut. Die Nationalversammlung verlangte Treueschwüre auf das neue Regierungssystem, und es verbreitete sich eine allgemeine Furcht vor »Spionen und Verrätern«. Man fing an, Vorbereitungen für einen Krieg zu treffen. Zahlreiche französische Aristokraten, die ihrer Ländereien und Privilegien beraubt worden waren, flüchteten in jener Zeit aus Frankreich und suchten in Ländern Asyl, die ihnen größeres Wohlwollen entgegenbrachten. Andere schlossen sich den royalistischen Aufständen an oder versuchten einfach, das Beste aus der Situation zu machen.
Im März 1792 führte man die Guillotine als allgemeines Hinrichtungswerkzeug in Frankreich ein, im April kam sie erstmals öffentlich zum Einsatz. Sie wurde sowohl als barmherzig als auch als Symbol für die Gleichheit aller Bürger angesehen – anstelle der zuvor gebräuchlichen Verfahren, Adlige mit dem Schwert oder der Axt und das gemeine Volk mittels Galgenschlinge hinzurichten. Nicht selten sprach man vom Fallbeil als dem »nationalen Rasiermesser«.
Am 20. April 1792 begannen die Koalitionskriege, als französische Armeen die österreichischen und preußischen Streitkräfte entlang ihrer Grenzen angriffen. Am 25. Juli veröffentlichte der Herzog von Braunschweig das sogenannte Koblenzer Manifest, in dem er versprach, dass die Alliierten (Österreich und Preußen) den Zivilpersonen in Frankreich kein Leid zufügen und nicht plündern würden, wenn die französische Königsfamilie unversehrt bliebe. Sollten gegen diese jedoch Gewalttaten oder demütigende Taten verübt werden, dann würden die Alliierten Paris niederbrennen. Anfang August erreichte der Inhalt des Manifests die Hauptstadt und versetzte die Bevölkerung in Aufruhr. Ein Mob griff den Tuilerien-Palast an, und Ludwig und seine Familie suchten Zuflucht bei der Nationalversammlung. Dort stimmten die anwesenden Abgeordneten für eine »vorläufige Absetzung des Königs« und setzten somit die Monarchie außer Kraft.
Im August 1792 wurde ein neues Parlament gewählt: der Nationalkonvent. Im September 1792 ersetzte er die Monarchie durch die Erste Französische Republik, führte einen neuen Kalender ein und klagte den Bürger Ludwig Capet – den ehemaligen König Ludwig XVI. – wegen »Verschwörung gegen die öffentliche Freiheit und allgemeine Sicherheit« an. Am 17. Januar 1793 wurde der Angeklagte zum Tode verurteilt und am 21. Januar hingerichtet. Dies versetzte die Konservativen in ganz Europa in Angst und Schrecken: Dass es eine Revolution gab, war schon schlimm genug, aber einen König hinzurichten war etwas, das man einfach nicht tat. Im Februar schlossen sich Großbritannien und die Republik der Vereinigten Niederlande der Allianz gegen Frankreich an.
Die allgemeine Wut des Volkes, eine riesige Zahl von Einberufungen zum Militär, Hungersnöte und hohe Inflation sowie andere Faktoren führten in ganz Frankreich zu weiteren Aufständen – diesmal gegen den Nationalkonvent. Als Reaktion darauf wurde im April 1793 der Wohlfahrtsausschuss gegründet, den man mit der Aufgabe betraute, »die neue Republik gegen ihre äußeren und inneren Feinde zu schützen«. Ihm wurden umfassende Aufsichts- und Verwaltungsbefugnisse über die Streitkräfte, die Justiz und die Legislative übertragen. Trotz interner Unruhen und eines Umsturzversuchs wurde eine neue Verfassung geschrieben, die radikale Reformen enthielt. Sie wurde jedoch ausgesetzt, nachdem der Revolutionsführer Jean Paul Marat im Juli 1793 einem Mordanschlag zum Opfer gefallen war. Der Wohlfahrtsausschuss nutzte dies als Vorwand, um die uneingeschränkte Herrschaft über das Land zu übernehmen. Der Nationalkonvent legte Preiskontrollen für eine breite Palette von Produkten fest und führte die Todesstrafe für das Hamstern von Waren ein; und am 9. September kam es zur Gründung »revolutionärer Gruppen«, die diese Maßnahmen durchsetzen sollten. Am 17. September wurde das Gesetz über die Verdächtigen beschlossen, das die Verhaftung mutmaßlicher »Feinde der Freiheit« verfügte – und damit begann eine Zeit, die als Schreckensherrschaft bekannt wurde.
Dramatis Personae
Der Haushalt von Lady Sophie
Lady Sophie, Baronin von Basing
Mr Barker, Butler
Mrs Swan, Haushälterin
Mrs Dommings, Köchin
Eleanor Dalton, Dienstmädchen
Sarah, Melanie, Dienstmädchen
Der Haushalt der Blakeneys
Sir Percy Blakeney und Lady Marguerite Blakeney, Adlige
Mrs Bann, Haushälterin
Mr Sturn, Butler
Mrs Jennet, Köchin
Alice, Melissa, Rebecca, Sarah, Anne, Maggie, Dienstmädchen
James, Lakai
Die Liga des Scarlet Pimpernel
Sir Andrew Ffoulkes, Adliger
Lord Anthony Dewhurst, Adliger
Lord Charles Bathurst, Adliger und Gelehrter
Andere Gentlemen von adliger Geburt, die ein Leben in Muße führen
Die französische Königsfamilie
Ludwig XVI., ehemaliger König von Frankreich (ist bereits verstorben)
Marie Antoinette, Königin von Frankreich
Louis Charles, Dauphin
Marie Thérèse Charlotte, Prinzessin und Tochter von Ludwig XVI.
Madame Élisabeth, Prinzessin und Schwester von Ludwig XVI.
Nicht-adlige Einwohner Frankreichs
Armand Chauvelin, Agent des Wohlfahrtsausschusses
Desgas, Sekretär von Chauvelin
Fleurette, Mitglied des Haushalts von Chauvelin
Louise Roget, Haushälterin von Chauvelin
Adele »von unbekannter Abstammung«, Dienstmädchen im Haushalt von Chauvelin
Bürgerin Monique Camille, leidenschaftliche Revolutionärin
Prolog
»Comtesse?«
Henris Stimme war kaum ein Wispern, und anstatt vorsichtig an der Schlafzimmertür zu klopfen, kratzte er nur leicht daran. Dennoch hörte sie ihn natürlich. Selbst bei Tageslicht waren die Sinne der Comtesse schärfer als die der Lebenden. »Herein!«, befahl sie.
Reflexartig strich er seinen Rock glatt und trat mit einer Verbeugung ein. Die Comtesse d’ Angoulême saß an ihrem Schreibtisch, auf dem Geschäftspapiere, die einst zu einem Bündel zusammengefasst waren, verstreut umherlagen. Aber die Feder, die sie zwischen den Fingern rasch hin und her drehte, hatte sie schon so lange nicht zum Schreiben benutzt, dass die Tinte an der Spitze eingetrocknet war. Der Raum wurde von zwei vergoldeten Kerzenleuchtern erhellt, deren Flammen sich unter dem plötzlichen Luftzug heftig bewegten. Die violetten Brokatvorhänge waren zugezogen, damit kein Sonnenlicht hereinkommen konnte. Zwar würde es die Comtesse nicht verbrennen, wie von abergläubischen Leuten behauptet wurde, doch sie hatte es noch nie gemocht. Kein Vampir und keine Vampirin mochte es.
Sie sah von ihren Papieren auf und betrachtete Henri mit ihren dunklen Augen, die an das Schwarz von Stiefmütterchen erinnerten; und wie immer schien sich sein Herz vor lauter Bewunderung zusammenzukrampfen. Im Unterschied zu der rohen Hässlichkeit der Welt und der Revolution da draußen war sie perfekt. Ihr goldenes Haar, ihre wunderschönen winzig kleinen Hände – so weiß und rein wie die Hände von Engeln –, ihr unschuldiges Gesicht … Sie trug ein helles Musselin-Kleid, und die Spitzen, die wie Schaum um ihren Hals und auf ihren Handgelenken wirkten, ließen sie unberührbar wie eine Heilige aussehen.
Aber jetzt, da die Revolution die eigentliche Ordnung der Dinge zerschlagen hatte, war niemand mehr sicher. Wenn sie den König umbringen konnten, dann konnten sie jeden umbringen.
»Madame …« Er zögerte, denn es widerstrebte ihm, die schlechten Nachrichten zu überbringen.
»Sprich frei heraus, Henri!«, sagte sie. »Ich muss das Schlimmste wissen.«
»Drei weitere Lakaien haben uns verlassen, Madame«, antwortete er. »Und zwei der Dienstmädchen. Schlimmer noch, es sind Männer aus Paris am Stützpunkt der Nationalgarde im Dorf eingetroffen. Jeanne hat berichtet, dass sie Schärpen in den Farben der Trikolore tragen.«
Am Anfang war die Trikolore ein Symbol für selbstherrliche Bauern und allzu gebildete Dummköpfe mit großspurigen Ideen über ihren gesellschaftlichen Stand gewesen – Ideen wie das »Recht auf Gleichberechtigung« und die »Freiheit von Tyrannei«. Doch während des letzten Jahres waren ihre sogenannten Ideale zu grausamen Morden an genau jenen Adligen herabgesunken, die ihre Löhne zahlten und die aus der natürlichen Ordnung die Legitimation bezogen, über diese Leute zu herrschen. Mittlerweile versetzten Nachrichten von der Trikolore selbst die unerschütterlichsten Aristokraten in Angst und Schrecken. Und Vampire waren die reinsten Aristokraten von allen …
Die Feder zerbrach zwischen den Fingern der Comtesse. »Männer des Revolutionstribunals auf meinem Grund und Boden?! Benachrichtige den kleinen Pierre: Er muss sie vertreiben lassen. Sag ihnen, dass ich nach Österreich gefahren bin. Oder vielleicht nach Preußen. Es ist egal, wohin – Hauptsache, sie verschwinden von hier. Weiß der Himmel, ich zahle ihm genug.«
Es ist typisch für die Comtesse, immer noch vom »kleinen Pierre« zu sprechen, wenn sie an den Bürgermeister des Ortes denkt, kam Henri in den Sinn. Sie kannte ihn, seit er ein Säugling war, und obwohl er zu einem hartgesottenen, trinkfesten Mann herangewachsen war, würde er für sie nie mehr als ein Kind sein. »Ich werde tun, was Sie befehlen, Madame«, antwortete er ernst. »Aber ich fürchte, die Lage ist verzweifelt und höchst gefährlich. Möchten Sie nicht in Erwägung ziehen, wirklich nach Österreich zu reisen? Oder nach England? Es heißt, dass Aristokraten dort gut aufgenommen werden.«
»Aber nur, solange sie bezahlen können«, entgegnete die Comtesse rundheraus. »Sobald mir das Geld ausgeht, wenn ich meine Juwelen verkauft habe – was dann? Und eine solche Auslandreise wäre sowieso bloß möglich, wenn ich tatsächlich das Land verlassen könnte. Das Revolutionstribunal bewacht jedoch die Häfen und die Grenzen. Zu viele von meiner Art haben bereits zu fliehen versucht und es nicht geschafft. Nein, ich werde meinen Grund und Boden nicht aufgeben. Dieses Land gehört mir. Und die Menschen darauf gehören mir.« Ihre Zähne blitzten auf, als sie sie wütend fletschte. »Werde die Männer des Revolutionstribunals los, Henri! Mir ist egal, wie du das bewerkstelligst. Wenn ich sie auch nur sehe …«
Sie verstummte plötzlich. Henri brauchte einen Moment länger, um zu hören, was seine Herrin bereits vernommen hatte: rasches Laufen im Korridor vor der Tür, gefolgt von schweren, gestiefelten Schritten.
Demetrice, die Kammerzofe der Comtesse, stieß die Tür auf und stolperte herein, ohne sich die Mühe zu machen, vorher anzuklopfen. Ihr Gesicht war tränenüberströmt, und ihr für gewöhnlich so sauberes blaues Kleid wies Flecken an Schultern und Ärmeln auf. »Herrin, Sie müssen fliehen. Die Männer des Revolutionstribunals sind hier!«
Die Comtesse sprang auf. »Haben diese brutalen Menschen dich misshandelt, Demetrice? Komm her, Kind, lass mich sehen …«
»Sie sollten sich mehr Sorgen um sich selbst machen, Bürgerin.« Der Mann, der im Eingang auftauchte und von einer Schar von Gefolgsleuten flankiert wurde, wirkte kümmerlich und unscheinbar; seine schlichte schwarze Kleidung wurde nur durch die verabscheuungswürdige Schärpe in den Farben der Trikolore aufgelockert. Sein Haar war dunkel und ungepudert, und sein Gesicht, fand Henri, ähnelte eher dem eines Wiesels. »Sie sind es schließlich, die wir hier aufsuchen wollen.«
»Sie werden mich mit der korrekten Anrede für eine Angehörige meines Standes ansprechen!«, sagte die Comtesse schneidend.
Der Mann wischte sich den Staub von seinem Ärmel. »Wenn wir schon von Ständen sprechen wollen, dann bin ich Bürger Chauvelin, Agent des Wohlfahrtsausschusses. Sie dagegen sind nicht mehr als eine ehemalige Aristokratin: ein nutzloses Relikt einer vergangenen Epoche. In unserem freien Frankreich gibt es keine Bauern mehr, keinen Adel mehr – nur noch die Gleichheit der Menschen. Ihre Titel sind bedeutungslos, Bürgerin.«
»Wie können Sie es wagen, so mit der Comtesse zu sprechen!« Henri stellte sich zwischen den drohenden Pöbel und seine Herrin. »Ich verlange, dass Sie sofort diesen Ort verlassen, oder unsere Wachen –«
»Sie haben niemanden, den Sie rufen könnten«, schnitt Chauvelin ihm das Wort ab. »Die Bediensteten dieses Hauses stehen unter Arrest oder sind geflüchtet. Diese Frau ist des Verrats an der Republik und der Bestechung von Beamten angeklagt. Sie, Bürger, stehen möglicherweise unter ihrem Einfluss, und in diesem Fall wird man die Anklagepunkte gegen Sie abmildern. Aber ich rate Ihnen, zur Seite zu treten, während sie in Gewahrsam genommen wird.«
Zwei Männer mit Schärpen in den Farben der Trikolore schoben sich nach vorn. In den Händen hielten sie Handschellen, in die man Blüten wilden Knoblauchs eingeflochten hatte. Henri zögerte. Er hatte der Comtesse jahrelang treu gedient, so wie schon sein Vater und sein Großvater vor ihm. Aber diese Männer des Revolutionstribunals stellten eine Bedrohung dar, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen durfte, und er hatte keine Lust, in einem feuchtkalten Stadtgefängnis eingesperrt zu werden.
Die Comtesse dachte nicht daran, aufzugeben. »Henri, Demetrice – beschützt mich!«, befahl sie.
Eine plötzliche Wut befeuerte Henri; sie glühte in ihm, als hätte er soeben eine Karaffe heißen Weins getrunken. Jeder andere Gedanke verschwand, und eine einzige brennende Leidenschaft blieb in ihm zurück: Er musste die Comtesse beschützen, ganz egal, was kommen mochte. Ohne zu zögern, stürzte er sich auf die näher tretenden Männer. Demetrice schloss sich ihm an, schrie und schlug wild um sich; ihre Fingernägel suchten die Augen dieser Leute.
»Genug!«
Chauvelin zog seine Pistole, spannte sie und feuerte auf die Comtesse. Die Detonation war in dem Raum mit den schweren, zugezogenen Vorhängen unvorstellbar laut. Henri hätte dem Schuss keine Beachtung geschenkt – seine Herrin war schließlich gefeit gegen Kugeln –, aber sie kreischte überraschend laut auf. Aus einem Impuls heraus, den er nicht zu kontrollieren vermochte, wandte sich Henri von dem Mann ab, dem er gerade einen Fausthieb verpasst hatte, und sah zur Comtesse: Sie lag zusammengesackt auf dem Boden. Blut rann aus einer Schulterwunde und durchtränkte ihr weißes Kleid.
Die Ablenkung reichte den anderen Männern, um Henri und Demetrice zu überwältigen. In dem Pöbelhaufen erblickte Henri vertraute Gesichter: Leute aus dem Dorf und andere Bedienstete des Schlosses – Menschen, die er sein ganzes Leben lang gekannt hatte. Aber sie hielten ihn fest, als sei er ein Geistesgestörter, und sahen ihn mit einer Mischung aus Mitleid und Angst an.
Kalt lächelnd tauschte Chauvelin seine leer geschossene Pistole gegen eine geladene, die ihm einer seiner Untergebenen reichte. »Fesselt sie!«, befahl er. »Und öffnet die Vorhänge. Wir brauchen etwas Licht hier drinnen.«
Die Augen der Comtesse waren vor Schmerz geweitet. »Wie … wie …«, keuchte sie, und blutige Tränen liefen ihr über das Gesicht.
»Der Wohlfahrtsausschuss hat die Verwendung von Holzkugeln genehmigt.« Mit gespannter Pistole schaute er zu, wie seine Männer ihr die Hände auf den Rücken fesselten.
Henri wehrte sich hilflos, um sich aus der Umklammerung zu befreien, als die Vorhänge aufgerissen wurden. Eine Menge Staub rieselte herab, als der schwere alte Brokat energisch zurückgeschoben wurde, um das grelle Sonnenlicht in den Raum hineinzulassen. Obwohl es sie nicht verletzen konnte, wandte die Comtesse ihr Gesicht ab und erschlaffte in den Händen derer, die sie gefangen genommen hatten.
»Was geschieht jetzt?«, verlangte sie zu wissen. Das Blut floss inzwischen langsamer ihren Arm herab. »Bringt ihr mich nach Paris, um mich vor Gericht zu stellen? Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr Bauern das so macht.«
»Das wird … nicht nötig sein.« Chauvelin ließ endlich die Pistole sinken. »Normalerweise würde man Sie nach Paris befördern – und dort ins Gefängnis oder auf die Guillotine bringen. Aber im Falle von Bluttrinkern wie Ihnen, die sich der Verhaftung widersetzt haben, bin ich bevollmächtigt, noch vor Einbruch der Nacht ein Ad-hoc-Gerichtsverfahren durchzuführen. Die Republik darf nicht zulassen, dass ihre Feinde flüchten könnten. Bevor die Sonne untergegangen ist, werden Sie sich dem Schandpfahl und der Guillotine gegenübersehen.«
»Das können Sie mir nicht antun!« Die Comtesse war von der Sonne geschwächt, aber es waren noch weitere Männer nötig, um sie festzuhalten, während sie zur Tür geschleift wurde. »Ich bin die Comtesse d’ Angoulême! Ich besitze diese Ländereien seit Jahrhunderten. Ich habe Freunde in Paris. Sie werden dafür sorgen, dass man Sie wegen dieser Sache tötet!«
»Sie haben keine Freunde mehr in Paris, Bürgerin«, widersprach Chauvelin. »Und Sie werden von der Republik weitaus größere Gerechtigkeit erfahren, als jeder gewöhnliche Bürger Frankreichs es vor der Revolution erdulden musste.« Er holte eine Schnupftabakdose aus seiner Tasche hervor und entnahm ihr eine Prise, während einige seine Männer – halb zerrend, halb tragend – Henri und Demetrice ebenfalls zur Tür hinausbeförderten. »Heutzutage, Bürgerin, herrscht in Frankreich die Republik. Ihr Aristokraten und Bluttrinker, ihr Sanguinokraten, seid nicht länger willkommen im Land … und werdet nicht mehr geduldet.«
Erstes Kapitel
»Du meinst, sie tragen noch nicht einmal Hosen?«, fragte Sarah entsetzt.
»Sie tragen keine Kniebundhosen«, korrigierte Melanie sie. »Alle Aristos – so nennen sie die Adligen dort drüben, wenn sie in unhöflicher Weise von ihnen sprechen – nannten die einfachen Leute Sansculotten, weil sie keine hübschen Kniebundhosen trugen. Aber mit Rüschen besetzte Kleidung nützt ihnen nicht viel, jetzt, wo sie alle geköpft werden. Ist es nicht so, Nellie?«
Eleanor blickte nicht auf, sondern konzentrierte sich darauf, das Porzellangeschirr abzutrocknen. Es war keine gute Idee, im Haushalt der Baronin von Basing bei der Arbeit nachzulassen, selbst dann nicht, wenn sie sich ausschließlich zwischen anderen Bediensteten unten in der Küche befand. Sie hatte schon reichlich viel Zeit gebraucht, um sich zu einem nur im Hause tätigen Dienstmädchen hochzuarbeiten, und die Möglichkeit, als waschechte Kammerzofe zu dienen, war inzwischen fast zum Greifen nah. Sie würde sich diese Chance jetzt nicht verbauen.
»Das ist mehr oder weniger so«, stimmte sie zu und nahm einen weiteren kostbaren Teller in die Hand, einen aus dem Geschirrset mit rosa Mustern und Goldrand. »Allerdings steht in den Zeitungen, dass die Bürger sowieso meistens in Lumpen herumlaufen – außer denen, die dort in der Nationalversammlung sitzen.«
»Es zerreißt mir das Herz«, sagte Mrs Dommings, während sie den Teig mit kräftigen Händen knetete, »wenn ich höre, dass du darüber sprichst, was sie alle anhaben, und nicht davon, was diese schlechten Franzmänner tun. Ein Volk, das seinen eigenen König tötet, wird von Gott und den Menschen gleichermaßen verflucht.« Sie schlug ein weiteres Mal mit der Faust auf den Teig ein. »Gäbe es nicht diesen heldenhaften Scarlet Pimpernel, der arme verfolgte Edelleute vor der Guillotine rettet, wären noch Hunderte mehr von ihnen tot. Endgültig tot, wenn man die Vampire mitzählt. Ich weiß nicht, wie er das macht.«
Eleanor und Melanie schauten sich an, verdrehten die Augen und unterdrückten ein Seufzen. Mrs Dommings war die größte Langweilerin der Welt, sobald sie auf den geheimnisvollen Scarlet Pimpernel zu sprechen kam und darüber redete, wie er unschuldige Aristokraten davor rettete, geköpft zu werden. Welchen Sinn hatte es, ein Gespräch über einen Mann zu führen, wenn ein jeder einzig und allein von ihm wusste, dass er geheimnisvoll war? Selbst die geretteten französischen Adligen wussten nichts über ihn – oder behaupteten zumindest, nichts zu wissen.
Sarah begann, Möhren für das Abendessen der Dienerschaft zu schälen. Melanie und sie gehörten zum Tagesdienst des Herrenhauses; der Nachtdienst würde später zu seiner Schicht antreten. Lady Sophie aß selten … normale Mahlzeiten. Aber die Bediensteten brauchten Nahrung wie jeder andere Mensch auch. Trotzdem, wenn man eine Vampirin als Herrin hatte, arbeitete man nachts und beklagte sich nicht.
»Ich wünschte, wir müssten nicht Französisch lernen«, sagte Sarah. »Das macht doch nicht irgendeinen, ja überhaupt keinen …« Sie hielt inne, da Mrs Dommings sie mit einem stechenden Blick ansah, und korrigierte ihre Grammatik. »Also, das ergibt keinen Sinn.«
»Die Baronin möchte, dass die Mitglieder ihres Haushalts in der Lage sind, Französisch zu sprechen, wenn sie Besucher aus Frankreich hat«, erwiderte Eleanor, die sich ihrer Stellung als ranghöchstes der drei Dienstmädchen bewusst war. »Außerdem – in Anbetracht all der vielen Adligen, die aktuell das Land verlassen, wird es vielleicht letztendlich so kommen, dass wir für einen von ihnen arbeiten.« Noch wichtiger war, dass man keinerlei Aussicht hatte, in der Hierarchie der Bediensteten aufzusteigen und eine Tätigkeit in den oberen Wohn- und Repräsentationsräumen zu bekommen, wenn man kein Französisch beherrschte. Und Eleanor hatte nicht die Absicht, ihr ganzes Leben in der Küche zuzubringen.
»Du hast eine gute Einstellung, Nellie«, lobte Mrs Dommings. »Nicht, dass es Ihrer Ladyschaft jemals gefallen würde, dass Bedienstete weggehen, aber wer weiß? Wir alle sagten früher, dass so etwas, was bei den Franzosen nunmehr geschehen ist, nicht passieren könnte – und dennoch ist es passiert. Das zeigt schon alles. Ihr König ist tot; ihre arme Königin und der Prinz sowie deren Freunde sind allesamt in Gefangenschaft. Einfach entsetzlich!«
Eleanor nickte und ließ sich abermals gewisse Gedanken durch den Kopf gehen, die sie sich ganz fest eingeprägt hatte. Ich muss einfach weiterarbeiten. Wenn ich Französisch lernen kann, so wie Ihre Ladyschaft es wünscht, wenn ich es schaffe, gut genug im Sticken zu werden, gut genug im Bedienen, dann werde ich vielleicht eines Tages aus dieser Küche herauskommen …
Ihre Ladyschaft, die Baronin von Basing, mochte eine gute Herrin sein – und es stimmte, dass sie es nicht mochte, wenn Bedienstete weggingen. Eleanor wollte jedoch mehr als nur ein Leben hier in Basing. Eine Kammerzofe könnte mit Ihrer Ladyschaft nach London reisen und dort möglicherweise sogar eine Anstellung bei einem der Freunde ihrer Herrin finden oder – in Eleanors kühnsten Träumen – einen Arbeitsplatz als Modistin und Stickerin bekommen. Niemand konnte Ihrer Ladyschaft vorwerfen, keine Freunde zu haben; sowohl unter lebenden Menschen als auch unter Vampiren hatte sie welche. Genau in diesem Moment waren zwei von ihnen zu Besuch, und der Gentleman trug eindeutig Kniebundhosen. Die obendrein aus besticktem Satin waren.
»Wie verstehst du dich eigentlich mit dem jungen William, Nellie?«, erkundigte sich Mrs Dommings. Sie versuchte, es wie eine beiläufige Bemerkung klingen zu lassen, aber ihre wachen Augen blickten stechend und ein wenig alarmiert. »In der letzten Zeit hast du nicht viel über ihn geredet, wie mir aufgefallen ist.«
»Ich habe ihn zuletzt nicht oft gesehen, Miss«, entgegnete Eleanor.
»Nun, du weißt ja, was Ihre Ladyschaft sagt«, bedrängte Mrs Dommings sie. »Es ist besser, zu heiraten, als vom Feuer der Leidenschaft verbrannt zu werden.«
»Das mag sein, doch ich war es nicht, die gebrannt hat«, erwiderte Eleanor. Sie stellte das letzte Geschirr ab und bemerkte, wie Melanie und Sarah sich Blicke zuwarfen und ein Kichern unterdrückten. Sie wünschte, sie könnte das Gespräch wieder auf den geheimnisvollen Pimpernel lenken. »Um ehrlich zu sein, Miss – er allein ist ständig hinter mir her gewesen, und ich habe nichts anderes getan, als Nein zu ihm zu sagen.«
»Das mag ja sein, aber kein Mann ist jemals einer Frau nachgelaufen, wenn sie ihm nicht etwas vorgemacht hat«, behauptete Mrs Dommings entschieden. »Wenn deine Mutter nicht so weit weg von hier lebte – auf dem Landgut Ihrer Ladyschaft –, dann hätte seine Mutter sicherlich schon mit ihr gesprochen.«
Ein Schauer lief Eleanor den Rücken hinunter. Sie war der Überzeugung gewesen, dass sie die Angelegenheit bei ihrem letzten Gespräch mit William geklärt hatte. Sie beide hatten lediglich ein paar gemeinsame Spaziergänge unternommen; ansonsten war nichts passiert. Er war kein schlechter Mann, aber … Wenn ihre Eltern oder, schlimmer noch, Ihre Ladyschaft allerdings wollten, dass sie heirateten, dann hätte Eleanor keine andere Wahl. Sie war bereits zweiundzwanzig. Viele der Dienstmädchen waren in diesem Alter längst verheiratet. Bei dem Gedanken schienen sich die Mauern des alten Hauses um sie zu schließen wie die Wände eines Grabmals.
Natürlich könnte sie Nein sagen … Bei einer Vermählung in der Kirche mussten schließlich sowohl der Mann als auch die Frau vor dem Geistlichen ein Ja von sich geben. Aber danach wäre ihr Leben nicht mehr lebenswert: Sollte sie so etwas tatsächlich tun, würde ihre Mutter sich gegen sie stellen, würden alle älteren Bediensteten behaupten, sie hätte William etwas vorgemacht, würde Ihre Ladyschaft ein solches Verhalten missbilligen – und es gäbe so gut wie keine Aussicht mehr, dass Eleanor jemals eine höhere Position einnahm oder nach London kam. Für die Leute war es leicht, zu sagen, dass man einfach für sich selbst eintreten solle, aber es war schwieriger, es tatsächlich zu tun, wenn man mit den Konsequenzen leben musste. Möglicherweise konnten reiche Damen Flugschriften über die Rechte der Frauen verfassen – aber Eleanor würde Geld dafür geben, damit sie ihre Zeit nicht mehr mit dem Putzen von Kaminrosten, dem Abtrocknen von Geschirr oder dem Schälen der Möhren verbringen musste …
Ihre düstere Stimmung wurde durch das Knarren der aufschwingenden Küchentür unterbrochen. Hastig griff sie nach dem letzten Teller, um ihn unnötigerweise noch einmal auf Hochglanz zu polieren, denn sie wollte nicht untätig wirken. Gleich darauf blickte sie zum Eingang, um zu schauen, wer gekommen war.
Es war Mr Barker, der Butler. Er inspizierte die Küche wie ein General, der sein Regiment von Soldaten mustert; die Daumen steckten dabei in seinen Westentaschen. Seine Nase war rot; er musste wieder am Gin gewesen sein und dachte wohl immer noch, dass es niemand bemerkte. »Ihre Ladyschaft hat nach Wein, Ratafia-Likör sowie Gebäck für ihre Gäste verlangt«, gab er kund. »Und das Übliche für sie selbst.«
»Du bist an der Reihe, Sarah«, sagte Melanie in einem Tonfall, der irgendwo zwischen Schadenfreude und Bosheit lag. »Geh die Lanzette und den Becher holen. Ich habe dir gezeigt, wo sie sind.«
Sarah, nun ganz weiß um die Lippen, trippelte zu dem Geschirrschrank hinüber, in dem die persönlichen Trinkgefäße Ihrer Ladyschaft aufbewahrt wurden. Eleanor wollte eigentlich nicht hinschauen, aber der ganze Vorgang übte eine perverse Faszination aus. Teilnahmsvoll holte sie einen sauberen Lappen aus Leinen, während Sarah das lange, dünne Messer rasch mit kochendem Wasser reinigte, das sie dem Kessel auf der Herdplatte entnahm. Das neue Dienstmädchen mochte zwar immer noch Mühe haben, mit dem Französischen und der korrekten Grammatik zurechtzukommen, aber diesen Teil ihrer Arbeit hatte sie ausreichend schnell verstanden. Schließlich war Ihre Ladyschaft eine Vampirin – und Vampire brauchten mehr als nur Gebäck, um sich zu ernähren.
»Komm, nun mach schon!«, schimpfte Mr Barker. »Glaubst du, sie wird den ganzen Tag warten? Und du, Nellie – achte darauf, dass du kein Blut auf deine Kleidung bekommst! Du wirst es zu ihr hochbringen.«
»Ich, Sir?« Eleanor war überglücklich: Das war eine günstige Gelegenheit, zu beweisen, dass sie ihre Arbeit beherrschte. Doch sie war auch überrascht. Ihre Ladyschaft zu bedienen, wenn sie Gäste hatte, war für gewöhnlich den höhergestellten Hausmädchen und Dienern vorbehalten. Trotz größter Bemühungen hatte sie noch nie zuvor die Möglichkeit dazu bekommen.
»Ihre Ladyschaft hat ausdrücklich nach dir verlangt«, sagte Mr Barker und tätschelte wie ein freundlicher Onkel ihre Schulter. »Jetzt gerate nicht in Panik, Mädchen! Erinnere dich einfach an deine Lektionen und deine Umgangsformen, und du wirst alles schon sehr gut hinbekommen. Die Getränke stehen auf einem Tablett draußen auf dem Gang; ich habe die Gläser dort bereitgestellt. Stell das Tablett auf den Tisch, mach einen Knicks und geh wieder hinaus – das ist alles, was du tun musst.«
»Ja, Sir«, antwortete Eleanor und malte sich bereits aus, was alles schiefgehen könnte.
Sarah keuchte auf, als die Lanzette in ihre Vene drang. Sie biss die Zähne zusammen, während das Blut in einen der kleinen Glasbecher tropfte, die die Baronin so gerne verwendete.
»Das war’s, Liebes«, sagte Mrs Dommings sanft. Sie wurde immer mütterlich, wenn sie eines der Mädchen bei der Blutentnahme beaufsichtigte – wahrscheinlich, weil man sie selbst nicht mehr wieder zu so etwas aufforderte, wie Melanie einmal gehässig hervorgehoben hatte. Ihre Ladyschaft bevorzugte die jüngeren Mädchen. »Ja, so ist es gut. Leg jetzt das Messer weg, und achte darauf, dass du dich richtig verbindest!«
Mr Barker drehte Eleanor langsam um ihre Achse, um ihr Äußeres zu inspizieren. Eleanor war unendlich glücklich, dass sie heute ihr besseres Kleid trug – eines aus hübschem graublauem Musselin mit einem sauberen weißen Kragen. Ihre ebenfalls weiße Schürze war trotz der Sommerhitze und der Küchenarbeit immer noch makellos rein. Und ihr hellblondes Haar – das sich weigerte, golden zu werden, egal wie viele Male sie es auch mit Kamille wusch – war ordentlich und gepflegt.
»Ja«, sagte er, »du wirst es schaffen. Hast du das Gebäck fertig, Melanie?«
»Alles fertig, Sir.« Melanies Tonfall war ehrerbietig, aber der Blick, den sie Eleanor zuwarf, drückte pure Eifersucht aus. »Hier ist es.«
Eleanor nahm nacheinander die Platte mit den Gebäckstücken, die kleinen Teller und den Becher mit Blut und stellte alles auf das Tablett. »Gibt es sonst noch etwas, Sir?«
»Das war’s«, antwortete Mr Barker. »Jetzt beeil dich – es sind schon fünf Minuten vergangen, seitdem Ihre Ladyschaft geläutet hat.«
Eleanor eilte die Treppe hinauf und hielt im Korridor der Dienerschaft inne, um die Stärkungen auf dem Tablett ein weiteres Mal zu arrangieren. Das gab ihr auch die Möglichkeit, den Rest des Gesprächs in der Küche mitzubekommen.
»Ich verstehe nicht, warum ausgerechnet nach ihr gefragt wurde«, blaffte Mrs Dommings. »Es ist ja nicht so, als hätte Nellie noch für etwas anderes Talent als fürs Nähen. Warum nicht Jill oder Susan?«
»Ihre Ladyschaft hat ausdrücklich nach ihr verlangt«, erwiderte Mr Barker in einem Tonfall, der die Unterhaltung beendete. »Und ich werde kein Streitgespräch mit der Herrin führen. Sie etwa?«
*
Ihre Ladyschaft hielt sich mit ihren Gästen im vorderen Salon auf, dem Raum, wo sie Besucher am Nachmittag stets empfing. Eleanor blieb vor dem Zimmer stehen, um ihr Tablett abzustellen und zu überprüfen, ob ihre Hände sauber waren. Es war schade, dass sich hier keine Spiegel befanden – so, wie es sie in Häusern gab, deren Eigentümer … nun ja … lebendige Menschen waren. Man gewöhnte sich jedoch auch daran.
Eleanor atmete tief ein, um ihre Nerven zu beruhigen. Ihr Vorstellungsvermögen lieferte ihr wenig hilfreiche Bilder von all dem, was sie falsch machen könnte. Sie könnte just in dem Moment, in dem sie den Raum betrat, über den Teppich stolpern. Sie könnte Ratafia und Gebäckstücke über die Gäste verschütten – oder, noch schlimmer, das Blut über Ihre Ladyschaft. Sie könnte etwas sagen, das sie nicht sagen sollte. Sie könnte etwas nicht sagen, was sie sagen sollte. Sie könnte auf einem der Läufer ausrutschen, quer durch das Zimmer schlittern, gegen die Fenster krachen, die Vorhänge herunterreißen und schließlich das Glas zerbrechen. Und jeder dieser Einrichtungsgegenstände kostete mehr Geld, als sie im Jahr verdiente.
Aus dem Salon drang das laut schallende, dümmliche Gelächter eines Mannes nach draußen, das auf dem Korridor und wahrscheinlich auch in einigen der nahe gelegenen Räume zu hören war. Es machte Eleanor auf eine gewisse Weise Mut: Sie mochte nur ein Dienstmädchen in diesem Haushalt sein, aber wenigstens war sie nicht dumm. Sie riss sich zusammen und schritt hinein.
Durch einige der Fenster, deren Vorhänge zur Seite gezogen waren, fiel das Tageslicht auf etwa die Hälfte des Raumes, sodass die Gäste im grellen Schein der Sonne saßen. Ihre Ladyschaft allerdings wurde durch schwere Samtgardinen vor den hellsten Strahlen geschützt. Vampire mochten zwar in der Lage sein, im Sonnenlicht spazieren zu gehen, aber es gefiel ihnen nicht. Als Ihre Ladyschaft Eleanor erblickte, gab sie dem Dienstmädchen mit einem Handzeichen zu verstehen, dass es vortreten und ihnen das Tablett mit den Stärkungen bringen sollte. Das Haar Ihrer Ladyschaft war stark gepudert – für jemanden wie sie veränderte sich die Mode nicht –, und ihre Haut war so makellos weiß wie Sahne. Sie trug hellgraue und lavendelfarbene Seidenstoffe, und ihr weiter Rock breitete sich zu einem Meer aufwendiger Stickereien aus. Ihr Gesicht wirkte vollkommen harmonisch und ausgeglichen, weshalb man sich eigentlich nicht vorzustellen vermochte, dass sie keinen Spiegel verwenden konnte, um sich morgens zu schminken.
Was die zwei Gäste hingegen trugen, war der letzte Schrei in der Mode, und beides waren lebendige, atmende Menschen. Der Mann war groß – nein, ohne jeden Zweifel hünenhaft, befand Eleanor, und maß wenigstens einen Meter fünfundachtzig. Er hatte glänzendes blondes Haar und funkelnde blaue Augen, aber einen abgestumpften, unscharfen Blick, der den ansonsten brillanten Eindruck störte. Sein cremefarbener Seidenrock und die Kniebundhose waren vom gleichen kostbaren Schnitt wie die Kleider Ihrer Ladyschaft und mit einer solchen Kunstfertigkeit bestickt, dass Eleanor sich wünschte, sie könnte sie genauer betrachten. Der Mann hatte sich in einen Sessel gelümmelt; augenscheinlich war ihm niemals mitgeteilt worden, dass es den Regeln der Höflichkeit entsprach, sich aufrecht hinzusetzen.
Die Frau, die ihn begleitete, war von sehr modernem Äußerem, was sich auch darin zeigte, dass ihr Haar nur ein ganz kleines bisschen gepudert war. Dessen natürliches Rotgold leuchtete im Sonnenlicht auf eine Weise, die Eleanor vor Neid erblassen ließ. Gekleidet war die Dame dementsprechend auch gemäß der allerneuesten Mode: ein hoch tailliertes, herabwallendes Musselin-Kleid, unter dem sich kein Reifgestell befand, das den Rock erheblich breiter gemacht hätte, sowie eine Seidenschärpe in demselben Cremeton wie die Oberbekleidung ihres Begleiters. Als Antwort auf eine Frage gab sie gerade ein perlendes Lachen von sich, und der Mann – ihr Ehemann? – lächelte sie an.
Eleanor ging verzweifelt die Regeln der Etikette in ihrem Kopf durch. Zuerst die Gäste, dann Ihre Ladyschaft. Sie machte einen Knicks vor dem Mann und hielt ihm das Tablett entgegen.
Er schaute mit einem trägen Lächeln zu ihr auf, während sich seine Hand um eines der Gläser schloss – und dann erstarrte sein Gesicht, und das Lächeln schmolz dahin wie Butter auf einem heißen Blech. Seine Augen verengten sich unvermittelt zu einem Ausdruck scharfsinniger Intelligenz. Doch Sekunden später war dieser konzentrierte Blick verschwunden, und er zeigte wieder ein unbestimmtes Blinzeln, während er Gläser und Karaffen vom Tablett auf den Beistelltisch beförderte. »Zum Teufel noch mal, meine teure Sophie«, beschwerte er sich bei Ihrer Ladyschaft, »Sie hätten uns vorwarnen können!«
Seine Begleiterin folgte seinem Blick, und sogleich riss sie ihre Augen weit auf. »Pardieu – wahrhaftig!«, rief sie laut mit ausgeprägtem französischem Akzent. »Sie ist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten. Wer würde das für möglich halten?«
Eleanor stand wie angewurzelt da. Ihr Erstaunen verblasste, und an seine Stelle trat Verärgerung, während die Gäste sie auf eine ausgesprochen würdelose Art interessiert musterten. Offensichtlich sah sie aus wie jemand, den sie kannten – so viel war klar –, aber das bedeutete nicht, dass sie deswegen unhöflich sein mussten. Doch was sonst war von Aristokraten zu erwarten? Sie verhielten sich für gewöhnlich auf diese Weise und nannten es Ehrlichkeit, aber sollte jemand wie Eleanor die eigenen Gefühle zum Ausdruck bringen, würde das als Unverschämtheit ausgelegt, und sie würde ihre Anstellung verlieren. Das jedoch konnte sie sich nicht leisten. Also hielt sie ihren Blick gesenkt und bot Ihrer Ladyschaft den Becher mit Blut an.
»Sehen Sie«, sagte Lady Sophie, als sie ihr Getränk entgegennahm. Sie nahm einen Schluck, und das frische Blut schimmerte für einen Moment scharlachrot auf ihren Lippen, bevor sie es ableckte. »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich Sie zu überraschen vermag, Percy.«
»Meiner Treu, es ist wirklich wahr. Ich glaube, so verblüfft war ich zuletzt, als meine reizende Marguerite mir das Jawort gab.« Der Mann schenkte Ratafia für die Frau ein, dann Wein für sich selbst. Dann sprach er tatsächlich Eleanor an. »Du musst uns entschuldigen, meine Liebe. Dein Gesicht hat uns in Erstaunen versetzt; das ist alles. Eine unbedeutende Ähnlichkeit mit einer Person, die wir beide kennen. Ich hoffe, du wirst uns vergeben.«
»Natürlich, Mylord«, murmelte Eleanor, die verblüfft darüber war, dass er sich tatsächlich die Mühe gemacht hatte, sich bei ihr zu entschuldigen. Sie fragte sich, welche Person es wohl war, der sie ähnelte.
Ihre Ladyschaft tätschelte Eleanors Arm; ihre Hand fühlte sich selbst in der Hitze des Sommers und durch die Stoffschichten von Handschuh und Ärmel kalt an. »Nellie ist seit einigen Jahren in meinen Diensten. Sie ist ein gutes, gehorsames Mädchen und sehr geschickt im Sticken. Sie haben vorhin meine Handschuhe bewundert, Marguerite. Nellie, ich glaube, die hast du gemacht, nicht wahr?«
»Ja, Mylady«, antwortete Eleanor, diesmal mit einem Anflug echten Stolzes.
»Gut genug für London«, befand die Frau – Marguerite – und lächelte Eleanor an, bevor sie sich wieder der Gastgeberin zuwandte. »Sie sollten uns wirklich häufiger besuchen, meine liebe Sophie. Die Londoner Gesellschaft könnte ein wenig von Ihrer Urteilskraft gebrauchen.«
»Wozu brauche ich London, wenn ich Sie habe, um alle Neuigkeiten in Erfahrung zu bringen?«, entgegnete Ihre Ladyschaft. Sie stellte ihren leeren Becher auf Eleanors Tablett ab. »So, jetzt kannst du wieder gehen, Nellie … Außerdem, meine liebe Marguerite, höre ich, dass die Londoner Gesellschaft gegenwärtig voll von französischen Emigranten, Flüchtlingen und anderen Besuchern aus diesem armen Land ist. Sagen Sie, ist es wahr, was die Leute über den Scarlet Pimpernel erzählen?«
Der Mann – Percy – schnaubte, als Eleanor zur Tür schlich. »Sapperlot, der Bursche ist ein echter Langweiler! London spricht von nichts anderem. Ich habe ein kleines Gedicht über dieses Thema verfasst.«
»Ach ja«, sagte Ihre Ladyschaft. »Von dem habe ich gehört. ›Sie suchen ihn hier, sie suchen ihn dort …‹«
Percy winkte mit einer Hand, wobei seine blasse Haut und die langen Finger ins Auge fielen. »Manchmal bin ich inspiriert, meine Liebe. Aber diejenigen von uns, die lieber über wichtigere Dinge reden würden, wie etwa über den Schnitt unserer Mäntel oder die Länge unserer Krawatten, werden gemieden, ganz und gar gemieden. Selbst meine geliebte Frau zieht es vor, beim Abendessen über ihn zu sprechen …«
Eleanor schloss die Tür hinter sich, sodass sie das weitere Gespräch nicht mitbekam. Das nagte an ihr; und sie wurde in Versuchung geführt. Sie interessierte sich nicht sonderlich für Scarlet Pimpernel oder französische Aristokraten, aber sie hätte nur zu gerne gewusst, warum die Gäste über ihr Aussehen so verwundert waren – und wem sie ähnelte. Vielleicht hatten die beiden nicht darüber sprechen wollen, solange sie im Raum war, aber jetzt war sie ja nicht mehr dort …
Die Bediensteten unten in den Personalräumen hatten ihre eigenen privaten Verschwörungen und Geheimnisse: wie man zusätzliches Essen für sich besorgte, an welchen Stellen man recht nachlässig putzen konnte und wo es bei Ereignissen wie diesem hier – wenn Ihre Ladyschaft oder das Dienstpersonal oben Geheimnisse für sich behielten – die Möglichkeit gab, Leute zu belauschen. Das Gelbe Zimmer hatte seinen Namen von der zitronengestreiften Tapete und den topasfarbenen Vorhängen. Es befand sich direkt neben dem vorderen Salon, und die Kamine in den beiden Räumen hatten einen gemeinsamen Schornstein. Eleanor wusste, dass zu dieser Stunde niemand da drinnen sauber machen würde. Sie schlüpfte leise in das Zimmer, stellte ihr Tablett mit dem blutbefleckten Becher auf einem Beistelltisch ab und schlich zum großen Kamin hinüber. Wenn es im Sommer heiß war, gab es keine Feuer – und keine Asche –, um die man sich hätte Sorgen machen müssen.
Das Gemurmel, das zuerst zu vernehmen war, löste sich rasch in deutlich zu verstehende Stimmen auf. Die Ihrer Ladyschaft war die erste, die Eleanor von den anderen unterscheiden konnte. »… Besitz ist natürlich ein Streitpunkt. Obwohl ich mein Bestes tue, um zu helfen …«
»England ist ein verteufelt großes Land.« Das war Percys Stimme. »Und das englische Volk ist ein freundlicher Menschenhaufen, meine liebe Sophie. Die Leute werden sicherlich Mitleid mit den Opfern haben, die man nur aufgrund ihrer Geburt aus dem eigenen Land gejagt hat. Schließlich kann man nichts dafür, wenn man von edler Geburt ist.«
»Solange das Geld eines Opfers reicht – vielleicht«, antwortete Ihre Ladyschaft; ihr Tonfall war überraschenderweise recht schneidend. »Aber die Kriegserklärung an Frankreich im Februar hat möglicherweise alles auf eine neue Grundlage gestellt. Die öffentliche Meinung wird sich wahrscheinlich ändern. Und was ist mit dem Scarlet Pimpernel? Werden er und seine Liga weiterhin ihr Handwerk ausüben?«
»Ich weiß nicht, warum Sie mich das fragen«, entgegnete Percy leichthin. »Wenn ich ernsthaft sein muss, behalte ich mir diese Attitüde für etwas weitaus Wichtigeres vor. Zum Beispiel meine –«
»Ja, Ihre Kleidung. Ich weiß. Aber bedenken Sie, meine Freunde, die schlimme Lage der Vampire, die noch immer in Frankreich festsitzen. Die lebenden Aristokraten können sich verstellen und sich im Gewimmel des Pöbels verstecken, aber welche Chance haben Leute von meiner Art, die sich dem Schandpfahl und der Guillotine gegenübersehen? Das sollte die Liga des Scarlet Pimpernel sicherlich berücksichtigen, wenn sie die Zielgruppen für ihre Rettungsaktionen auswählt.«
Diesmal war es Marguerite, die antwortete. »Nach dem, was ich gehört habe, Sophie, hilft die Liga allen, die sie retten kann; aber es muss ihre Handlungsmaxime sein, zunächst denen zu Hilfe zu kommen, die sich in unmittelbarer Gefahr befinden. Traurigerweise gibt es im Moment viel zu viele solcher Opfer in Frankreich: Adlige und Bürgerliche, Reiche und Arme, Lebende und Vampire.«
»Einige sind in größerer Gefahr als andere«, erwiderte Lady Sophie. »Vor allem die Gefangenen, die sich derzeit im Temple-Gefängnis befinden …«
Es entstand eine Pause, und Eleanor beugte sich noch ein wenig mehr in den Kamin hinein. »Und jetzt sagen Sie mir, mein lieber Percy, möchten Sie sich meine kleine Stickerin ausleihen?«
»Das ist ein verdammt großzügiges Angebot«, antwortete Percy. In dem Zimmer auf der anderen Seite der Wand schien es sehr still zu werden. »Nicht, dass ich etwas im Mindesten dagegen hätte. Aber warum?«
Ihre Ladyschaft lachte. »Habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich Ihren Vater und Ihren Großvater kannte – und Generationen vor ihnen?«
»Nur ungefähr jedes Mal, wenn Sie mich gesehen haben«, entgegnete Percy träge. »Nicht, dass ich etwas dagegen hätte. Ich bin mir sicher, meine Vorfahren wären erfreut, zu hören, dass sich eine Dame an sie erinnert, die in den letzten paar Jahrhunderten eine der bedeutsamsten Schönheiten Englands war.«
»Sie waren gute Männer. Sie verstanden den Nutzen und Wert unserer Stellung in der Gesellschaft – dass es den Adel geben muss, um zu regieren, so wie es andere gibt, die folgen. Es ist natürlich nicht so, dass ich die Identität der Männer und Frauen der Liga des Scarlet Pimpernel kenne; aber ich bin mir sicher, dass sie zu diesen Werten stehen und ihr Möglichstes tun dürften, um, wie die liebe Marguerite sagte, denen Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauchen.« Ihre Ladyschaft hielt inne. »Ich glaube, dass Sie aus demselben Holz geschnitzt sein könnten wie Ihre Vorfahren, Percy.«
Er gluckste. »Bitte schätzen Sie mich geringer ein, meine liebe Sophie, denn wenn Sie noch mehr dergleichen sagen, bin ich verpflichtet, vor lauter Verlegenheit dahinzuschmelzen …«
»Sie brauchen uns nicht zu sagen, dass mein Mann ein guter Mensch ist«, warf Marguerite ein. »Er ist zu sehr Engländer, um ein solches Lob anzunehmen, aber ich werde es für ihn tun. Er ist der beste aller Männer, Madam.«
Ihre Ladyschaft lachte. »Das bezweifle ich nicht. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ein solch tadelloser Mann wie Sie in der Lage ist, einem jeden inkognito lebenden vorbildlichen Zeitgenossen eine Nachricht zukommen zu lassen … Wie war noch einmal der besondere Ausdruck, den man heutzutage für so jemanden benutzt? Eine kleine Blume am Wegesrand? Also, ein Mann wie Sie dürfte imstande sein, einem solchen Blümchen eine Nachricht zu übermitteln. Oder er kennt jemanden, der so etwas tun würde.«
»Oh, ich kenne jeden, der von Bedeutung ist«, antwortete Percy. »Und falls nicht, dann sicher meine geliebte Marguerite hier.«
»Wenn Sie es so ausdrücken möchten«, sagte Lady Sophie. »Aber ganz ehrlich, mein teurer Percy –«
»Seien Sie nicht ehrlich! Ich bin das niemals. Davon bekommt man nur Falten.«
»Seien Sie ernsthaft, mein lieber Freund, und lassen Sie mich einen Moment lang reden, ohne mich zu unterbrechen. Ich habe mit einigen unserer vor Kurzem eingetroffenen unfreiwilligen Emigranten gesprochen … Nun ja, sagen wir mal, dass nicht jeder von ihnen so diskret ist, wie er sein sollte. In Anbetracht der Äußerungen solcher Leute und der bestehenden Gerüchte über den Scarlet Pimpernel könnte man mit dem Finger auf eine Reihe von Personen zeigen, die möglicherweise in gewisse französische Eskapaden verwickelt sind. Glauben Sie mir, ich werde mit Sicherheit nichts sagen, aber …«
Eleanor, die sich in den Kamin hineinbeugte, der das Herz bis zum Hals schlug und die sich anstrengte, selbst das leiseste Flüstern zu vernehmen … hörte plötzlich ein Geräusch hinter sich. Es war das einer Türklinke, die nach unten gedrückt wurde.
Panik überfiel sie. Sie sprang von dem Kamin fort und flitzte durch den Raum. Es blieb keine Zeit, einen der anderen Ausgänge zu erreichen. Stattdessen hastete sie zu der Stelle direkt hinter der sich öffnenden Tür, drückte sich flach an die Wand und presste sich die Hand auf die Lippen.
Sie konnte nicht sehen, wer hereinkam, aber sie erkannte das charakteristische schwere Atmen wieder. Es war Mr Barker. Er musste hochgekommen sein, um nach ihr zu suchen, als sie nicht in die Küche zurückgekehrt war.
Eleanor überdachte mit grimmiger Miene ihre Situation. Falls man sie dabei erwischte, wie sie die privaten Gespräche Ihrer Ladyschaft mit den Gästen belauschte, würde das ihre Aufstiegschancen vollkommen zunichtemachen. Selbst wenn Mr Barker es Ihrer Ladyschaft tatsächlich nicht erzählen sollte, so würde er es doch wissen – und Eleanor würde Jahre brauchen, um eine solche Schande durch ihre Arbeit wiedergutzumachen. Sie würde Möhren schälen und Ihre Ladyschaft mit Blut versorgen, bis sie zu alt für so etwas geworden war – und anschließend würde sie nur noch Möhren schälen. Aber solange er die Tür nicht weiter öffnete, bestand immer noch die Möglichkeit, dass sie aus der Geschichte heil herauskam. Am Kamin hatte sie keinerlei Spuren hinterlassen. Sie könnte behaupten, dass sie auf dem Rückweg mit dem Becher Ihrer Ladyschaft irgendwie aufgehalten worden war. Und sie war gut darin, sich glaubwürdige Erklärungen auszudenken …
Ihr Blick wurde von dem blutverschmierten Becher auf dem Tablett förmlich angezogen, das sich immer noch auf dem Tisch neben dem Kamin befand.
Womöglich nahm Mr Barker das Glasgefäß nicht bewusst wahr. Eleanor formulierte in Gedanken sehr ausführliche und inbrünstige Gebete, auf dass er vorübergehend mit Blindheit geschlagen sei …
Die Tür schloss sich.
Mit hämmerndem Herzen rannte Eleanor geräuschlos zu dem Tablett und nahm es in die Hand, dann lief sie zu einer der weiteren Türen des Raums. Sie öffnete sie und fand sich in einem anderen Korridor wieder, durch den sie zur Küche zurückkommen würde. Wenn sie es jetzt noch schaffte, sich eine gute Ausrede für ihre Verspätung auszudenken, könnte sie sich vielleicht gerade noch aus der Affäre ziehen.
Stolpernd kehrte sie in die große Küche zurück. Sie schenkte Mrs Dommings und den anderen Dienstmädchen ihr schönstes Lächeln, als sie sagte: »Alles erledigt, Ma’am.«
»Du hast dir aber Zeit gelassen.« Mrs Dommings runzelte die Stirn. »Ich hätte erwartet, du würdest schneller sein, wenn du Botengänge machst, Nellie.«
»Möglicherweise wollte ja Ihre Ladyschaft, dass sie sich an der Unterhaltung beteiligt«, spöttelte Melanie hinterhältig.
»Ihre Ladyschaft hat sich sehr freundlich über meine Stickarbeiten geäußert«, sagte Eleanor selbstgefällig. Das stimmte sogar, und wenn sie das als Ausrede für die zusätzlichen Minuten nutzen konnte … »Es tut mir sehr leid, Mrs Dommings. Ich wollte Sie nicht warten lassen.«
Unvermittelt tauchte Mr Barker auf, der sich irgendwo im Dunkeln versteckt hatte. Die tiefen Falten in seinem Gesicht brachten zum Ausdruck, dass er sich ein richterliches Urteil gebildet hatte, und die drohende Haltung seiner Schultern ließ eher auf Strafe als auf Gnade schließen. »Nun sag mir, Nellie – hast du auf dem Rückweg zufälligerweise das Gelbe Zimmer betreten?«
Eleanors Kehle wurde trocken. Er hatte das Tablett und den Becher doch gesehen. Er hatte darauf gewartet, dass sie zurückkam und sich selbst belastete. Sie suchte verzweifelt nach einer Ausrede, aber es fiel ihr keine ein. »Ich … Also, ich habe mich einen Moment lang etwas unwohl gefühlt, Sir. Ich habe die Sachen einfach abgestellt und gewartet, bis es mir besser ging …«
Die Aufmerksamkeit aller war auf sie gerichtet, während sie unbeholfen nach Worten suchte. Die Konzentration auf sie fand jedoch ein abruptes Ende, als plötzlich das schnappende Geräusch eines sich rasch entfaltenden Fächers zu vernehmen war. Sie alle, einschließlich Eleanor, drehten sich um und sahen Ihre Ladyschaft oben an der Treppe stehen, die in die Küche hinunterführte.
Alle Dienstmädchen machten hastig einen Knicks. Mrs Dommings gelang eine gesetztere Ausführung dieser Geste, wobei es bei ihr knackte, während Mr Barker den Kopf beugte. Es sollte sie vor dem möglichen Zorn ihrer Herrin ebenso schützen, wie es einen angemessenen Ausdruck von Ehrerbietung darstellte; Ihre Ladyschaft begab sich normalerweise nie in das untere Stockwerk.
»Darf ich Ihnen behilflich sein, Mylady?«, fragte Mr Barker.
»Eigentlich bin ich wegen Nellie hergekommen. Der teure Percy und die liebe Marguerite benötigen eine Näherin, und daher habe ich angeboten, ihnen Nellie für ein paar Monate auszuleihen. Glauben Sie, der Haushalt kann auf sie verzichten, Barker?«
Mr Barker warf Eleanor einen vernichtenden Blick zu, der sie dazu brachte, ihn am liebsten umbringen zu wollen. Doch zu Eleanors Überraschung antwortete er: »Ich denke, der Haushalt kommt auch ohne sie ziemlich gut zurecht, Mylady. Soll ich Vorbereitungen für ihre Fahrt nach Richmond treffen?«
Ihre Ladyschaft nickte, und die grauen Augen leuchteten in ihrem bleichen Gesicht. Hier in der Küche, einem Ort für lebende Menschen, war sie völlig fehl am Platz: ein fahles Gespenst – wie schön auch immer sie sein mochte – unter Lebenden. »Kümmern Sie sich darum!«
Einen Augenblick später war sie verschwunden.
»Auf ein Wort, Nellie«, befahl Mr Barker, ohne sie zu fragen, ob sie damit einverstanden war – genauso, wie Ihre Ladyschaft sich nicht nach Eleanors Einwilligung erkundigt hatte, als sie sie fortschickte. Er schob sie nach draußen in den Hof, weg von neugierigen Lauscherinnen.
»Sir?«, sagte Eleanor und fragte sich, ob Blitz und Donner gleich auf sie herniederfahren würden. Sie konnte nicht hoffen, dass Ihre Ladyschaft ein zweites Mal plötzlich herbeikommen würde.
Mr Barker schloss die Tür hinter ihnen und schirmte sie so vor dem Lärm und den Gerüchen der Küche ab. Auf dem Hof fühlte sich die Augusthitze an, als würde man einen Schlag mit dem Hammer bekommen. »Deshalb hast du gelauscht, nicht wahr? Du hast gehört, wie sie über deine Stellung im Haushalt gesprochen hat, und wolltest dann mehr in Erfahrung bringen.«
Eleanor blickte auf die Spitzen seiner polierten Schuhe in der Hoffnung, dass eine Zurschaustellung von Demut ihn besänftigte. »Ich … kann es nicht sagen, Sir.«
»Das kannst du nicht, und das solltest du auch nicht.« Er hob ihr Kinn an und zwang sie, ihm in die Augen zu sehen. »Hör mir jetzt ganz genau zu, Nellie! Du bist ein gutes Mädchen, und du arbeitest hart.« Sein Atem roch nach Gin. »Ich sage nicht, dass ein Dienstmädchen oder ein Diener niemals die eigene Herrschaft belauscht. Ich sage lediglich, dass ein gutes Dienstmädchen oder ein guter Diener sich niemals beim Lauschen erwischen lässt. Ich war selbst einst ein einfacher Diener, somit weiß ich, wie das ist. Du wirst in den Haushalt einer anderen Herrschaft kommen, und du wirst uns dort repräsentieren. Ich möchte, dass du dort dein Allerbestes gibst. Es kann nicht dein Wunsch sein, dich selbst oder Ihre Ladyschaft zu blamieren. Du weißt, was mit Dienstmädchen geschieht, die ohne ein gutes Zeugnis fortgeschickt werden, nicht wahr? Du weißt, wo sie am Ende landen.«
Eleanor stand kurz davor, als Antwort ein »Ja, Sir« oder »Nein, Sir« hervorzustoßen – sobald sie sich entscheiden konnte, was am angemessensten war. Doch dann stellte sie fest, dass seine Hand ganz leicht zitterte.
Er hat ebenfalls Angst. Unvermittelt überkam sie eine Erkenntnis; und es war, als würde sie plötzlich sehen, wie sich ein Abgrund vor ihr auftat. Ich habe immer geglaubt, dass höherrangige Diener wie Mrs Dommings und Mr Barker eine sichere Stellung innehaben; aber sie haben genauso viel Angst wie wir anderen …
Eleanor biss sich auf die Lippe. »Ich werde mein Allerbestes geben, um diesem Haushalt Ehre zu machen, und so hart arbeiten, wie ich nur kann.« Und vielleicht – dieser Gedanke kreiste in ihrem Hinterkopf – werde ich ja befördert, wenn ich meine Arbeit gut genug mache, oder ich erreiche sogar noch mehr …
Er entließ sie und gab ihr mit einem Wink zu verstehen, dass sie in die Küche gehen sollte. »Kehr zurück an die Arbeit, Mädchen! Ich muss mich noch um einige Dinge kümmern.«
Eleanor nickte und befolgte den Befehl. Immerhin … diese neue Wendung in ihrem Leben war die einzige Möglichkeit, wie sie von hier wegkommen konnte. Fort von Basing, weg von der Herrschaft Ihrer Ladyschaft, raus aus den engen vier Wänden eines Daseins als Bedienstete, in dem sich niemals etwas änderte …
Dennoch … vielleicht sollte sie sich nicht wünschen, dass sich etwas änderte. Schau dir schließlich Frankreich an! Es konnte immer passieren, dass die Situation sich verschlimmerte.
Zweites Kapitel
Zwei Tage später hatte Eleanor so lange ohne Schlaf durchgehalten, dass sie das Gefühl hatte, sich in einem Wachtraum zu befinden.
Sie war vor Sonnenaufgang aufgestanden, und der Kutscher Ihrer Ladyschaft hatte sie vor der Herberge der Poststation in Basingstoke abgesetzt. Dort hatte sie sich zu der Menschenmenge gesellt, die auf die Postkutsche nach London wartete. Es war alles arrangiert worden: Ihre Ladyschaft hatte die Fahrkarte für sie gekauft, und Eleanor war mitgeteilt worden, dass am Ende ihrer Reise Sir Percy in London alles regeln werde. Eleanor hatte nichts weiter zu tun, als sich in eine Ecke der überfüllten Postkutsche hineinquetschen zu lassen, wo sie sich genauso zusammengezwängt wiederfand wie ihr Handkoffer oben in der Gepäckablage.
Ihr war noch nicht einmal die Möglichkeit gegeben worden, sich von ihrer Mutter zu verabschieden, bevor sie sich ins Ungewisse gestürzt hatte. Natürlich hatte sie einen Brief geschrieben, aber das war nicht das Gleiche. Sie hatte die Mutter um Rat fragen wollen. Genauer gesagt, war es ihr Wunsch gewesen, etwas zu fragen, was sie sich nicht einmal laut auszusprechen getraute: Was passiert, wenn ich nicht zurückkomme? Wirst du in Sicherheit sein? Wirst du für dich selbst sorgen können? Wirst du mir vergeben, dass ich dich zurückgelassen habe?
Sie hatte damit gerechnet, die ganze Reise in einem Zustand schrecklicher Angst und Sorge zu verbringen. Schließlich reiste sie ohne Begleitung: Lady Sophies Freigebigkeit war nicht so groß gewesen, dass sie eine zweite Fahrkarte einschloss. Nicht, dass Eleanor das überrascht hätte, kannte sie doch die Ansichten ihrer Herrin über unnötige Ausgaben. Die älteren Dienstmädchen hatten sie vor den Gefahren gewarnt, die eine allein reisende junge Frau erwarteten, und sie ermahnt, stets den Mund zu halten, außer wenn sie Fremde darauf hinweisen musste, dass sie ihre Hände bei sich behalten sollten. Aber sie war wahrlich nicht enttäuscht darüber, dass niemand so etwas versucht hatte. Die anderen Passagiere waren viel mehr am neuesten Klatsch und Tratsch interessiert gewesen. Also blieb sie still eingezwängt in ihrer Ecke der Kutsche und hörte zu – und fand es in der Tat sehr interessant.
Es wurde von Englands Krieg gegen Frankreich gesprochen – und von anderen Ländern, die, wie Österreich und Preußen, ebenfalls im Krieg mit den Franzosen lagen. (Eleanor konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dies wichtiger klang als die Geschichten über den Scarlet Pimpernel, der umherreiste und wehrlose Aristokraten rettete.) In ganz England marschierten junge Männer los, um dem König in seinen Armeen zu dienen. (Und dadurch wurden den ehrlichen Kaufleuten, die auf Personal angewiesen waren, gute Arbeitskräfte weggenommen, wie ein Mann murrte.) Konterrevolutionäre Streitkräfte in Frankreich bekämpften die Republik und schlossen sich den Invasionstruppen an. (Was vermutlich jedoch nicht sehr wirkungsvoll war, weil immer noch Krieg geführt wurde …)
Wenn die Mitreisenden nicht gerade über den Krieg diskutierten, stritten sie zumeist über Wegelagerer, die anscheinend jede zweite Postkutsche überfielen, und über brutale Mörder und Straßenräuber, die es im Ausland gab. (Gespräche dieser Art endeten in der Regel damit, dass jemand Eleanor die Hand tätschelte und sich dafür entschuldigte, dass er einem »hübschen jungen Mädchen wie dir« Angst eingejagt hatte.) Man redete aber auch über etliche andere Themen, etwa die steigenden Mieten und Gebührensätze, die ebenso steigenden Zölle, und die Steuern würden zweifellos auch steigen, sobald die Regierung nur dazu kam, sie abermals zu erhöhen. Französische Einwanderer – sowohl Aristokraten als auch einfache Menschen wie Eleanor – nahmen redlichen Engländern die Arbeitsplätze weg. (Diese Auffassung wurde für gewöhnlich mit den Worten eingeleitet: »Ich weiß, dass die Situation dort drüben schlecht ist, aber …«) Im Parlament wurde darüber debattiert, ob man die Gesetze aus der Zeit Oliver Cromwells ändern sollte, die Vampire von Staatsämtern und aus den Führungsstäben der Armee fernhielten. Und letzten Endes war die Regierung korrupt, war es schon immer gewesen und würde es für alle Zeiten bleiben, und man konnte jenen Männern in Westminster nicht trauen.
Nach zwölf Stunden in der Kutsche – die zahlreichen Aufenthalte bei Gasthäusern nicht mitgerechnet – hatte Eleanor die anderen Passagiere mehrere Male über diese Themen reden gehört. Die Mitreisenden waren natürlich Menschen. Vampire waren so reich, dass sie eigene Kutschen besaßen oder für die persönliche Nutzung mieteten; außerdem reisten sie nachts und zeigten sich unterwegs nicht in der Öffentlichkeit. Irgendwann fuchtelte ein besonders energischer Herr mit einer Ausgabe der Times vom Vortag herum, offenbar um seine Argumente zu bekräftigen. Eleanor wünschte sich, sie hätte den Mut, ihn zu fragen, ob sie einen Blick darauf werfen dürfe.
Sie war sich immer bewusst gewesen, dass es eine Welt außerhalb der Ländereien Ihrer Ladyschaft gab. Aber man hatte sie gelehrt, dass anständige junge Frauen ihre Stellung im Leben akzeptierten und dass jeder Aufstieg ausschließlich im Rahmen der durch Geburt und Klasse vorgegebenen Pfade stattfand. Und dennoch … Hier in der Postkutsche reisten Frauen, die ihren eigenen beruflichen Tätigkeiten nachgingen: Gouvernanten, Ladenbesitzerinnen, Hausherrinnen und Angehörige von Gewerben, die Eleanor nicht einmal kannte. Wieder andere Frauen waren in den Gasthöfen beschäftigt, wo sie Zwischenstopps einlegten. Überall gab es Frauen, die weder in der Landwirtschaft tätig waren noch in den Diensten von Adligen standen.
In ihrer Vorstellungswelt war Eleanor davon ausgegangen, dass die Arbeit in den Wohn- und Repräsentationsräumen als persönliche Zofe Ihrer Ladyschaft der Höhepunkt ihrer beruflichen Laufbahn sein würde. Aber hier und jetzt – selbst inmitten des Lärms und Trubels, des Staubs auf der Straße, der beengten Unterbringung und harten Sitzplätze und der anderen Unannehmlichkeiten des Reisens – begann sie sich zu fragen, ob sie nicht von mehr träumen konnte. Ob vielleicht ihr Traum, als Stickerin zu arbeiten – möglicherweise sogar in einer Stadt wie London –, nicht ganz so unerreichbar war.
Als die Postkutsche schließlich nach Sonnenuntergang und bei rasch zunehmender Dunkelheit in London ankam, wurde Eleanor im Hof des Gasthauses ebenso zügig abgeladen wie ihr Gepäck. Sie zog sich an die nächstgelegene Wand zurück, umklammerte ihren Handkoffer und ihre Geldtasche und versuchte, sich zurechtzufinden. Der Schwan mit den zwei Hälsen war größer als alle anderen Gasthöfe, die sie zuvor am heutigen Tag aufgesucht hatten. Der Kutschenplatz war groß genug, um mehrere Gefährte gleichzeitig aufzunehmen; und auf ihm wimmelte ein unübersichtlicher Haufen von Menschen umher, deren Treiben von Öllampen beleuchtet wurden. Fahrgäste stiegen ein, Fahrgäste stiegen aus, Pferde wurden gewechselt, den Passagieren wurden Mahlzeiten gebracht, Gepäck wurde den jeweiligen Besitzern oder Trägern übergeben, Gassenjungen boten an, Besorgungen zu machen oder Nachrichten zu überbringen …