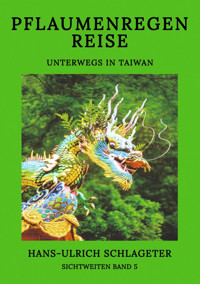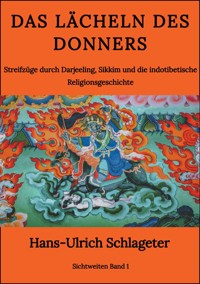14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Mit literarischem Anspruch und persönlichem Blick verwebt der Autor wie in seinen anderen Büchern persönliche Reiseerlebnisse mit fundierter Landeskunde, lebendiger Geschichte und feinfühligen Naturbeschreibungen. Er entführt in ferne Länder und macht mit fremden Kulturen vertraut – kenntnisreich, inspirierend, berührend. Fünf Wochen mit dem erwachsenen Sohn im Mietwagen durch Neuseeland. Die Fülle der Eindrücke und Erlebnisse, die alles überstrahlende Natur des Landes; all dies findet in diesem Buch lebendig geschildert seinen Platz. Neuseeland, Paradies am anderen Ende der Welt: Vulkane, Regenwälder, sandige und felsige Küsten, vergletscherte Hochgebirge, Fjorde, die endemische Fauna und Flora, die Bewohner, deren Kultur und Geschichte ... Nichts wurde ausgelassen, was das Inselreich im südlichen Pazifik so einzigartig macht und diese Lektüre selbst zu einem Abenteuer. Die Fülle der über 500 hochwertigen Fotografien trägt dazu bei, Reisesehnsüchte anzufachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1278
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
SCHAFE, KIWIS UND
VIEL MEER
EINE REISE DURCH NEUSEELAND
HANS-ULRICH SCHLAGETER
SICHTWEITEN BAND 4
© 2023 Hans-Ulrich Schlageter
Lektorat von: Ute Haller-Göggelmann Coverdesign von: Hans-Ulrich Schlageter Satz & Layout von: Hans-Ulrich Schlageter ISBN 978-3-347-57246-1
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Dr. Hans-Ulrich Schlageter, Türnenstraße 10, 78647 Trossingen, Deutschland.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Bildnachweis: 515 Abbildungen Fotograf: Hans-Ulrich Schlageter Kamera: Nikon D800E
INHALT
1
[1] Landkarten
2
[2] Zum Geleit
3
[3] Abreise nach Neuseeland
4
[4] Doha, Drehkreuz Arabiens
5
[5] Ankunft in Christchurch und erste Schritte
6
[6] Von Kaikoura bis zum French Pass
7
[7] In den Marlborough Sounds
8
[8] Von Picton zur Golden Bay
9
[9] Von der Farewell Spit an die Westküste
10
[10]Von Pfannkuchenfelsen und Treibholzgestalten
11
[11] Fox Glacier, Haast und ein Südalpenpass
12
[12] Ein Baumwinzling und Gletscherpracht
13
[13] Auf dem Weg zum Milford Sound
14
[14] Im wilden Fjordland
15
[15] Aus dem Gebirge an die Ostküste
16
[16] Dunedin, der Otago Harbour und Meer
17
[17] Von Kaps, Seelöwen und den Catlins
18
[18] Vom Stirling Point zurück in das Fjordland
19
[19] Vom Lake Manapouri in den Doubtful Sound
20
[20] Die Remarkables und der Lake Wakatipu
21
[21] Auf den Isthmus Peak und nordwärts
22
[22] Der Mount Aoraki und einige Gletscherseen
23
[23] Vom Lake Tekapo zum Arthur’s Pass
24
[24] Die Westküste, die Marlborough Sounds und die Fährfahrt zur Nordinsel
25
[25] Wellington, Napier und das Reich der Vulkane
26
[26] Im Tongariro-Nationalpark
27
[27] Tongariro-Wanderung mit vernebelter Sicht
28
[28] Durch die vergessene Welt führt ein Highway
29
[29] Der Vulkan Taranaki und die Whanganui River Road
30
[30] Durch einsames Inland an die Ostküste
31
[31] Vom Kap Palliser bis in die Hauptstadt
32
[32] Zur Südinsel zurück und durch das Awatere-Tal
33
[33] Von Hanmer Springs an den Lake Tekapo
34
[34] Über den Castle Hill an die Westküste
35
[35] Die Banks-Halbinsel und ein Gefängnisaufenthalt in Christchurch
36
[36] Abschied von Neuseeland
37
[37] Die letzten Stunden bis daheim
38
[38] Der Autor
39
[39] Quellenangaben
40
[40] Über dieses Buch
Eine Wolke! Eine weiße Wolke! Eine lange weiße Wolke!
Verloren im Süden des Pazifiks ein Paradies,
nicht nur für Schafe.
LANDKARTEN [0]
ZUM GELEIT [0]
Wenn der Vater mit dem Sohne ... Die erhellende Vorstellung, über diese Reise ein Buch zu schreiben, wurde durch das Fehlen eines Tagebuchs geweckt. Der Wunsch, gemeinsame Erinnerungen zu bewahren, ließ das Vorhaben in wirkliche Buchseiten verwandeln.
Wenn ich über Neuseeland schreiben würde, dachte ich, dann vor allem über die Landschaften und die Natur, unbedingt aber auch über die Inselbewohner, und das waren hier vornehmlich die Schafe. Die wiederum hatten viele Gesichter, mit denen sie dich ausdrucksstarr ansahen, bevor sie sich dann alle miteinander in Marsch setzten, nur weg von dir.
Von den Neuseeländern menschlicher Natur hingegen wurde uns stets unverbindliche Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft entgegengebracht, allenfalls erkundigte man sich nach unserer Herkunft und was wir hier vorhatten.
Wie es mir in Neuseeland erging? Das wissen die restlichen Seiten des Buches. Ich widme es, dankbar für die zusammen erlebten Reisetage, meinem Sohn Caspar, dessen fotografisches Talent ich mit ein wenig Neid und voller Anerkennung bewundere.
ABREISE NACH NEUSEELAND [0]
Trossingen: Donnerstag, 14. Februar 2019: Wie stets war meine Abreise im Vorfeld mit zunehmend erhöhter Betriebsamkeit verbunden. War alles gepackt? Wurde tatsächlich nichts vergessen? Wir schrieben den 14. Februar 2019, Valentinstag, als meine Lebensgefährtin mich mit ihrem Auto auf den Zug brachte. Kaum die ersten von 15 Kilometern zum Bahnhof im schwäbischen Rottweil zurückgelegt, durchfuhr mich ein Schreck. Ich glaubte, ein wichtiges Kameraobjektiv zu entbehren, mein Immerdrauf. Extrem wichtig! Essenziell! Hektisch gruben meine Hände in dem Kamerarucksack zwischen meinen Beinen. Nichts. Noch einmal. Nichts.
»Ute, wir müssen zurück!« Und schon fuhren wir wieder meinem Zuhause entgegen, obwohl ich bangte, den Zug nicht pünktlich zu erreichen. Währenddessen ich weiter fieberhaft suchte und auf einmal das Objektiv in der Hand hielt, es hatte sich im Ärmel meiner Regenjacke versteckt.
»Alles bestens, Ute, wir können schon wieder umkehren!« Gleich zwei Ampeln wollten, mir offensichtlich wenig wohlgesonnen, ihre Rotphase absichtlich in die Länge ziehen. Bei der dritten Ampel gab Ute Gas, Sekunden bevor der dickliche Junge an der Fußgängerampel den Knopf drückte. »Yes!«
Endlich auf dem Bahnsteig angelangt. Acht Minuten bis zur planmäßigen Abfahrt des Zuges. Meine Ute wartete gern mit mir zusammen, schließlich mussten wir uns die nächsten fünf Wochen entbehren.
Irritierend die Anzeigetafel. Statt meines Direktzuges zum Flughafen Zürich zeigte diese den vorherigen, 15 Minuten verspäteten an und sortierte sich dann nach dessen Abfahrt neu.
Noch sechs Minuten: Eine behäbige Laufschrift sagte in einem überlangen Satz, Fahrräder dürften nicht mitgenommen werden.
Den sich wiederholenden Schriftzug nach Minuten wieder lesend stach mir der Text ins Auge, der nach dem mit den Fahrrädern angezeigt wurde, also in derselben Priorität: Der Zug hatte Verspätung. Wie bitte? Wie viele Minuten? Was? 67 Minuten? Das konnte nicht sein. Ich las das noch einmal, im nächsten Durchlauf, was seine Zeit benötigte. 67 Minuten. Aber dann kam ich ja zu spät in Zürich am Flughafen an und verpasste meinen Flug!
Ohnmacht. Hektik. Wir rannten mehr als wir liefen zur Informationsstelle im Bahnhofsgebäude. Zum Glück musste ich nicht anstehen.
»Die Verspätung ist korrekt«, wusste die Dame.
»Und was jetzt?«, fragte ich. »Ich muss nach Zürich!«
»Da kann ich auch nichts machen«, meinte gelangweilt die Bahnangestellte. Pause. Das war die falsche Antwort, und ich war entsetzt.
»Ja, aber, ich bin dabei, meinen Flug nach Neuseeland zu versäumen, es gibt doch sicherlich Alternativen?«
Pause »Nein!« Pause.
Nun war ich in Schnappatmung verfallen und zu perplex, um eine Entschädigung oder ein Taxi zu fordern. Dann fiel mir ein: »Wann geht denn der nächste Zug von Singen nach Zürich Flughafen, der keine Verspätung hat?« Das wenigstens suchte sie mir heraus, wenngleich diese Mühe ihr sichtlich lästigfiel.
»12 Uhr 36 von Singen nach Schaffhausen«, sagte sie. Ich sah auf die Uhr: Es war nun 11 Uhr 52. Ich hatte 44 Minuten Zeit, um nach Singen zu kommen. »Ute?!«
»Ja, ich fahre dich, selbstverständlich, sofort.« Und wir verschwanden eilig in Richtung Auto. 11 Uhr 55. Ob das reichte?
Das waren exakt 61 Kilometer und dauerte laut Google Maps 43 Minuten. Wir mussten fünf Minuten schneller sein, mindestens. Kein Stau, keine Baustellen, kein sonst etwas. 38 Minuten bis Singen, das war sportlich. Auf nach Singen, mit singenden Reifen!
Bald waren wir auf der Autobahn, jagten dahin, lagen bis ins Stadtzentrum Singen gut in der Zeit. Aber dann. Wo war dieser verd...flixte Bahnhof? Warum wurde der nicht auf Schildern angezeigt? Und warum hatte ich kein WLAN auf meinem Smartphone. Gut, letzteres war meine Schuld.
12 Uhr 31. Endlich. Aber was war das? Der Bahnhof wurde komplett umgebaut, die normale Zufahrt war gesperrt. Da, ein einziger Fußgänger. Aber der war schon beinahe entschwunden. Rasch das Fenster runtergelassen und: »Hallo! Entschuldigung! Notfall!«
Bereitwillig gab er Auskunft. Wir preschten in eine Nebenstraße, hielten zuletzt verbotenerweise bei der Bahnpolizei zwischen den Polizeifahrzeugen. Egal. Notfall. Noch drei Minuten. Hektisch alles Gepäck auf die Straße gezerrt. Den großen Rucksack über den Rücken gezogen, den kleinen Rucksack auf den Bauch geschnallt, die Verpflegungstüte in die Hand. Jetzt ab! Nein, nicht ohne Abschiedskuss. Schon rannte ich mit meinen 32 Kilogramm die Treppen hinunter in die Unterführung.
Nur nicht stolpern! Noch eine Minute. Wo war das Gleis? Den Fahrplan studiert, dann außer Atem die Treppen hinaufgehetzt. Genau 12 Uhr 36. Der Zug! Er stand noch da. Er fuhr dann sechs Minuten verspätet ab. Aber ich war drinnen. Und ich war überglücklich. Schon kam das nächste? Würde ich den Anschluss in Schaffhausen erreichen? Zuerst aber schickte ich Ute eine SMS: »Bin tatsächlich im Zug.«
Der Regionalbahnzug schaffte die Strecke in offiziell 18 Minuten und sammelte vier weitere Minuten Verspätung auf. Einerlei, es blieb ein Puffer von 9 Minuten.
Der Anschluss nach Zürich Flughafen fuhr von Gleis 2B, und ich war auf Gleis 2 angekommen. Gleis 2, Gleis 2B, war das ein Unterschied? Der Zug, der bald auf Gleis 2 kam fuhr nicht nach Zürich. Also gut: Gleis 2, Gleis 2B, das war ein Unterschied. Noch vier Minuten bis zur Abfahrt. Unruhig blickte ich mich um. Die Gleise eins bis vier waren alle ohne B. Und keiner der wenigen Reisenden auf dem Bahnsteig wusste eine Antwort, und ein Zugbegleiter war nicht in Sicht. Im Bahnhofsgebäude nachfragen, dazu reichte die Zeit nicht mehr. Ich fühlte mich hilflos, aufgeschmissen.
Auf der Bank dort vorne das Schulmädchen. War sie mein rettender Engel? Ich fragte sie ohne Hoffnung, beinahe schon rhetorisch.
»Das Gleis ist hier vorne«, sagte das Mädchen, »ganz am Anfang.« Ich dankte ihr erleichtert. Zwei Minuten später tauchte pünktlich, wie es sich für Schweizer Bahnen gehörte, aber schon lange nicht mehr für deutsche, die S24 auf. Ich stieg in dem Doppelstockwagen nach oben.
Gleich nach Schaffhausen kam der berühmte Rheinfall. Für mich war es eine Premiere, ihn von einem Zug heraus vom linksrheinischen Ufer her zu erleben. Ich weiß nicht, wie oft ich auf der anderen Seite vorbeigefahren war, aber unzählige Male waren es bestimmt. Wenn nicht noch mehr. Die ungewohnte Perspektive gefiel. Noch spektakulärer war es bei diesem Rekordniedrigwasser. Plötzlich teilte sich das sonst so üppig auf voller Breite um den Hauptfelsen in der Mitte herumstürzende Wasser in viele kleine und größere Wasserfälle auf, und so viele nie gesehene Felsen ragten aus dem Wasser. Ich wollte mich sattsehen, aber das Bild wurde mir entzogen.
Jetzt, entspannt im Zug, gönnte ich mir die ersten beiden von sechs Käsebrötchen, die ich der Bahnhofsbäckerei, als eine Teilnahrungsmenge für die 37 Stunden bis zur Landung in Christchurch, Neuseeland, abgenommen hatte. Ein alter Mann musterte mich lange und sagte dann unerwartet: »Wandern macht hungrig.«
Darauf ich: »Ich bin noch ganz am Anfang meiner Wanderung.« Worauf er nichts erwiderte, und ich sah ihn nachdenken. Hatte er mich für einen Obdachlosen gehalten? Einen Landstreicher oder Stadtstreicher, der wahrscheinlich auch noch schwarzfuhr? Ich musste schmunzeln, zumal ich mir erst vor ein paar Tagen eine schicke Kurzhaarfrisur gegönnt hatte.
Als ich nachher beim Flughafen ausstieg, dämmerte es dem alten Mann: »Ah, Sie gönnd ind Luft?« Ich erklärte es ihm: nach Neuseeland, Bergwandern mit Zelt und Schlafsack und allem.
»Darum das viele Gepäck, ja dann dann schöni Zitt!«
»Merci vielmols, alles Gute Ihnen!«
14 Uhr 02: Am Check-in erhielt ich meine Bordkarten nur bis Perth. Für die letzte Etappe nach Christchurch war Qatar-Airways nicht zuständig, sondern Air New Zealand. Mein Hauptgepäck ging durch nach Christchurch, allerdings wieder einmal als Sperrgepäck an einem Extraschalter, den ich erst einmal finden musste.
Als das Flugzeug um 16 Uhr 05 steil in die Luft stieg, standen gleich die tief verschneiten Alpen neben dem Bullauge, und sie begleiteten mich, bis wir sie überflogen hatten und auch die Stadt Graz. Danach wurde es bald dunkel, schließlich waren wir im Winter und die Tage waren immer noch kurz.
Sechs Stunden reine Flugzeit waren gerade über der Grenze, ab der ein Flug als zu lange empfunden wurde. Zum ersten Mal hatte ich mir Kompressionsstrümpfe übergezogen, was vor allem auf der nächsten Etappe von Doha nach Perth notwendig war. Zwölf Stunden im Sitz, darauf freute ich mich jetzt schon nicht, wo noch zwei Stunden der ersten Etappe nach Doha übrig waren.
Mittlerweile war die Schweizerin neben mir aufgetaut. Mit ihren 68 Jahren hatte sie sich für eine Ayurveda-Kur in Sri-Lanka entschieden. Sie freute sich darauf, eine Woche dürften sie mit ihr alles anstellen, was sie für notwendig erachteten, die zweite Woche gehörte dann der Entspannung an einem der Strände im Süden der Insel.
»Auch ein wenig Besichtigung?«, erkundigte ich mich vorsichtig. »Ja, auch einmal ein Tempel. Aber nicht so viele, denn die sind sowieso alle gleich.«
Dazu schwieg ich, erinnerte mich umso mehr an meine Reise durch Sri-Lanka einige Jahre zuvor, auf der gerade die Tempel und antiken buddhistischen Stätten den faszinierenden Hauptgegenstand gebildet hatten.
Wie verschieden wir doch alle waren! Bestimmt konnte man sich auch in Italien eine einzige Kirche stellvertretend für alle anderen des Landes ansehen, weil sie sich durch alle Epochen hindurch glichen, schließlich wies eine jede Turm und Schiff auf. »Ein interessanter Ansatz«, hätte das ein nicht näher von mir genannter Jemand auf seine Weise ablehnend beantwortet.
DOHA, DREHKREUZ ARABIENS [0]
Doha, Katar: Freitag, 15. Februar 2019: Minuten vor Mitternacht landeten wir im Emirat Katar, einem Stück hellerleuchtete Wüste mit modernsten hohen Gebäuden und Hafenanlagen. In geringer Höhe waren wir eine Weile darüber hinweggeflogen, an der dicht bebauten Küste entlang. Alles sah aufgeräumt aus und geometrisch strukturiert.
In Doha, einem der Drehkreuze Arabiens, erfolgten viele Starts und Landungen nachts. Entsprechende Passagiermassen wanderten durch die Kontrollen, aber alles funktionierte hier zügig und reibungslos. Wieder musste ich mein Trinkwasser zuerst ausleeren, um es nur wenig später durch Wasser aus den gekühlten Wasserspendern hier im Terminal zu ersetzen. Hoffentlich war es tatsächlich purifiziert und nicht einfach nur stark gekühlt, wie ich das einmal in Indien sehr körperlich erfahren hatte.
Zum Zeitvertreib ziellos durch die Hallen der Terminals wandernd, beobachtete ich Menschen, nahm hier und dort Notiz von dem Kunterbunt der zahlreichen Duty-free-Shops. Die fehlenden Stunden bis zum Weiterflug abzusitzen, das verbot ich mir, die zwölf Stunden nachher bis zur Landung in Perth im Flugzeugsitz beanspruchten mein Sitzfleisch bereits genug.
Um 2.30 Uhr Ortszeit wieder in der Luft versuchte ich zu schlafen, aber zu rasch war es wieder hell. Auf dem langen Flug verwöhnten zwei Bordmahlzeiten. Auch dem zweitenMenü war ein Plastikbecher mit arabischem Schriftzug beigesellt. Viel später zog ich den Aludeckel ab und setzte den Becher an den Mund. Das war ja Joghurt! Nicht Trinkwasser wie zuvor! Ich behalf mich mit einer ungebrauchten Papierserviette. Das funktionierte auf seine Art als Löffelersatz.
Das Seniorenpaar aus Schottland neben mir besuchte seine Enkelkinder. Solange das Fliegen noch möglich sei, sagte sie. Ihr Akzent bereitete mir Verständnismühe. In einer kleinen Ortschaft zwischen Glasgow und Edinburgh waren sie daheim. Als ich von ihrem Land schwärmte, gaben sie zu: »We never made it to the Isle of Skye. But we certainly should one of these years.«
Sympathisch waren die beiden. Der Geruch einer vollen Windel, Folge einer altersbedingten Inkontinenz, war allerdings weitaus unangenehmer als der Besuch einer Bordtoilette, die zehn Stunden Flug hinter sich hatte.
Der indische Ozean: endlose Weite ohne Landüberflug. Unser Annähern an den fünften Kontinent verfolgte ich auf der Satellitenkarte auf dem Bildschirm. 400 Kilometer von der Küste entfernt flogen wir mehr nach Süden als nach Osten. Orte an der Westküste Australiens, die mir als nächste Entfernung genannt wurden, erkannte ich wieder, und ich erinnerte mich an meine letzte Australienreise zurück. Shark Bay, Geraldton, dann endlich der Großraum Perth.
Nun hielt ich aus dem Bullauge nach Land Ausschau. Unter mir wurde die Rottnest Island angekündigt, an der wir knapp vorbeiflogen, in nur mehr 4000 Meter Höhe. Faszinierend nun das Meer. Erfrischend azurblau leuchtete es herauf, und da war auch die Insel, die alle Einzelheiten erkennen ließ. Noch einmal tiefer beobachtete ich das Meer, sah einzelne Wellen und Haie oder Delfine springen. Dann zeigte sich die lange Küstenlinie mit Perth. Der Grundton des Landes war rötlich. Das Grün der Bäume, die geordneten Linien der Straßen, die akkuraten Wohnviertel der Vororte, alles sauber wie frisch gewaschen. Und es lag ausgebreitet da unter der Abendstimmung eines ausklingenden sonnigen Tages. Zuletzt flogen wir knapp über Wohngebiete und setzten auf den grauen Asphalt auf. Es war 19.50 Uhr Ortszeit.
Wir Ankömmlinge wanderten durch die Korridore immer den Schildern »Transit Passengers« hinterher. Als ein Seitenkorridor abzweigte, wurden manche von uns von einem Uniformierten und seiner Kollegin abgefangen. »Nach Christchurch?« Sie hielten ein Schild mit eben diesem Namen hoch. Sie hatten mich, und ich bog auf ihr Geheiß ab und gelangte sogleich an ein »Transfer Desk«, wo meine noch fehlende Bordkarte auf mich wartete. Das funktionierte reibungslos.
Bei den Kontrollen gleich dahinter wurden zusätzlich beide meine Kameragehäuse und jedes meiner Objektive auf Sprengstoff hin untersucht. Da war ich jedes Mal selbst auf das Ergebnis gespannt, wie ich den Beamten wissen ließ. Was, wenn der Test durch einen Fehler plötzlich positiv ausfiel?
Warum aber schleppte ich zwei Kameragehäuse mit mir herum? Mein Sohn Caspar, den ich auf dem Weg war zu besuchen, weilte seit nunmehr zweieinhalb Monaten in Neuseeland. Mitte Januar war seine teure professionelle Kamera kaputtgegangen, als er sich auf dem »Blue Lake Track« befand. Sie hatte beim nächsten Einschalten ihren Geist aufgegeben, blieb einfach von einem auf den anderen Moment tot: keine Anzeige mehr, kein Saft. Für einen Fotografen war das absolut ärgerlich, der Supergau. Nun hatte ich für ihn nach einem Monat Abstinenz ein neues Kameragehäuse mit im Gepäck, und er konnte wieder loslegen. Immerhin begleiteten ihn ein sehr brauchbares Smartphone und eine recht gute Videokamera. Ein wirklicher Ersatz war das jedoch nicht.
Ein deutscher Twen hatte beim Passvorzeigen sein Brillenetui liegenlassen. Er durfte zurück, worauf ihn dann dieselbe Kontrolle noch einmal ereilte, mit dem Unterschied, dass diesmal seine Taschen und vor allem sein Notebook ebenfalls auf Sprengstoff hin untersucht wurden. Mit ihm kam ich ins Gespräch, ein interessanter Mensch, der sich seine Zukunft mutig selbst gestaltete, ohne mehr oder weniger »gepampert« in den üblichen geregelten Bahnen zu laufen: Schule, Studium, Firmeneintritt, Firmenaustritt, Rente.
Der großgewachsene durchtrainierte Mann war passionierter Radsportler und hatte sich auf Mountainbiking und Bike packing spezialisiert, Freeride und Downhill und einiges mehr, was kurz unter MTB lief, Akrobatik und Sprünge inklusive. Er gab Kurse, leitete Exkursionen, reiste weltweit von Event zu Event, nahm an Rennen teil und hatte seinen eigenen Blog. Vor allem aber konnte er davon leben. Natürlich wollte ich all das im Gedächtnis behalten und mir seinen Internet-Auftritt ansehen. Und dann hatte ich es mir leider nicht merken können.
ANKUNFT IN CHRISTCHURCH UND ERSTE SCHRITTE [0]
Perth: Samstag, 16. Februar 2019: Eine halbe Stunde vor Mitternacht begann meine letzte Etappe bis Neuseeland. Nun lag aus der Perspektive des fernen Europas Neuseeland gleich neben Australien und Tasmanien und wurde sogar kulturell oft gleichgesetzt. Sechs Stunden Flug waren da eine lange Zeit, aber es wollte bereits Ewigkeiten dauern, bis auf der Bordlandkarte die ellenlange Südküste Australiens abgearbeitet war, immerhin dreieinhalbtausend Kilometer, und mit Tasmanien die australischen Gefilde endlich ganz hinter uns lagen.
Für die nächsten 2000 Kilometer zeigte sich unter uns nichts als die Wasserwüste der Tasmansee, Zeit genug, sich einstweilen mit Neuseeland geologisch zu beschäftigen, zumal, wenn erst einmal dort, mich die Erdgeschichte auf Schritt und Tritt begleiten würde. Neuseeland besuchen ohne Interesse für Geologie, Flora und Fauna im Gepäck? »Just no way!«
Wenn wir die Weltkarte zur Hand nehmen und aus der Perspektive Europas auf das ferne Australien blicken, fällt stets auch das am Rande liegende Neuseeland auf, und wir werfen es automatisch mit Australien in einen Topf. Neuseeland, das Australien im Kleinformat? Sicherlich ganz ähnlich, weil schließlich ebenso von diesen eigenartigen verschrobenen Briten besiedelt. Aber stimmt das denn?
Im Gegensatz zu der Insel Tasmanien haben die Inseln Neuseelands mit dem australischen Kontinent auch geologisch wenig gemein, besser gesagt, das Gemeinsame liegt weit in der Vergangenheit zurück, nämlich in den Zeiten, als Neuseeland mit Australien, der Antarktis, Südamerika, Afrika aber auch mit Madagaskar, Neuguinea, Indien und der Arabischen Halbinsel den Großkontinent Gondwana gebildet hatte.
Vor circa 200 Millionen Jahren begann Gondwana auseinanderzubrechen. Wie das geschah, dazu müssen wir uns grob den Aufbau der Erde vor Augen führen. Die feste Schale unserer Erde, die Lithosphäre, besteht aus der Erdkruste und dem oberen Teil des Erdmantels. Je nachdem, ob an der ozeanischen oder der kontinentalen Kruste gemessen, besitzt sie eine Dicke zwischen 100 und 200 Kilometern.
Unter der Lithosphäre liegt die Asthenosphäre, die ebenfalls aus festem Material besteht, jedoch aufgrund der hohen Temperatur weich und plastisch verformbar ist, bis hin zum Fließen. In dem aus flüssigem Eisen bestehenden inneren Erdkern herrscht eine ähnlich hohe Temperatur wie auf der Sonnenoberfläche, nämlich 6000 Grad Celsius.
Diese Hitze verursacht im unteren Erdmantel Konvektionsströme enormer Ausdehnung. Die Umwälzungen des Mantelmaterials führen zu Strömungen in Richtung Erdinneres oder nach oben in Richtung Lithosphäre, beides mit großem Einfluss auf die Erdkruste. Die Kruste ist elastisch, kann jedoch brechen. Und so entstanden und entstehen durch die Interaktion der Sphären die Platten und an den Plattengrenzen die Gräben. Diese tektonischen Platten »schwimmen« auf der Asthenosphäre, unterschieben sich, werden hier gegeneinandergepresst und dort auseinandergerissen. Da Kontinentalkrusten und Platten nicht deckungsgleich sind, folgen Kontinente den Bewegungen der unterliegenden Platten, brechen auf oder bilden sich neu. Gleiches gilt für Ozeanböden, die sich spreizen oder gar aufreißen können.
Durch Subduktion absinkendes Krustenmaterial kann in extremen Fällen sogar bis in den oberen Erdkern hinabgelangen. Umgekehrt strömt hier und dort Erdkernmaterial als flüssiges Magma an die Oberfläche auf, etwa die Mantel-Plumes, die dann die Hotspots speisen, wie das beispielsweise unter den Hawaii-Inseln geschieht.
Die Plattentektonik verursachte ein Zerbrechen des Großkontinents Gondwana. Zuerst lösten sich Afrika und Südamerika heraus. Als sich die Pazifische Platte unter die Ostküste von Gondwana schob, entstand paradoxerweise, trotz des sich Auftürmens eines Gebirges, die Tasmansee, und das ist exemplarisch ein Prozess, den die Wissenschaft erst in jüngster Zeit besser zu verstehen begann. Das aufgeschobene Gebirge kollabierte mit der sich stetig verlangsamenden Plattenbewegung unter seiner eigenen Last. Der Druck nach unten und zu den Seiten kehrte schließlich die Bewegungsrichtung der Pazifischen Platte um. Das Gebirge sackte ab, drückte auf die Asthenosphäre. Dehnungen und Risse in der Kruste folgten, der Kontinent teilte sich, die Teile strebten auseinander, und dazwischen öffnete sich die Tasmansee1.
Während Australien und die Antarktis bereits seit ca. 168 Millionen Jahren getrennt waren, spaltete sich die viel größere Landmasse, zu der Neuseeland gehört, vor rund 82 Millionen Jahren von der Antarktis ab. Es öffnete sich wie eben beschrieben die Tasmansee, die erst nach weiteren 20 bis 30 Millionen Jahren ihre heutige Ausdehnung erreichte, nach der Neuseeland und Tasmanien nunmehr 2000 Kilometer auseinanderliegen. Der nach Osten driftende Mikrokontinent, der seit einiger Zeit Zealandia genannt wird, versank allmählich im Meer. Auch von der heutigen Landmasse Neuseelands waren einmal mehr zwei Drittel unter Wasser gelegen, vor 35 Millionen Jahren2. Heute ist Zealandia weithin als achter Kontinent anerkannt. Neben Neuseeland ragt als einzig Größeres Neukaledonien aus dem Meer. Die Norfolkinseln, die Lord-Howe-Inselgruppe und die Riffe Elizabeth- und Middleton rechnet man ebenfalls dazu.
Da die tektonischen Platten in ständiger Bewegung sind und miteinander agieren, ließ ein ähnliches Ereignis die Pazifische Platte vor circa 23 Millionen Jahren erneut die Bewegungsrichtung wechseln, sodass sie seither gegen die Australische Platte wandert. Außerdem erhielt die Pazifische Platte eine Drehung, was dazu führt, dass sie sich gerade in Neuseeland im Norden unter die Australische Platte schob und weiterhin schiebt und im Süden darüber, was dort dienoch nicht abgeschlossene Auffaltung der Südalpen in Gang setzte. Neuseeland steht unter dem Einfluss des Puysegur-Subduktionssystems im Süden, dem Hikurangi-Subduktionssystem im Norden und vor allem dem Alpine-Fault-System dazwischen3. Wir sehen längst, dass eine Reise durch Neuseeland eine faszinierende Reise durch Erdgeschichte ist, die dem Besucher an jedem Ende und jeder Ecke anschaulich präsentiert wird, und das durch die Natur selbst.
Seit Perth flogen wir Passagiere mit einer Boeing 737 MAX, was mir zu diesem Zeitpunkt nichts ausmachte, weil diese Flugzeugversion erst Wochen später in Verruf geraten sollte, als eine zweite Maschine wegen eines eklatanten Softwarefehlers abgestürzt war. Vielleicht hatte ich da wieder einmal Glück gehabt.
Zum zweiten Mal seit Abflug begann ein neuer Tag, der 16. Februar. Da wir auf dem Weg nach Osten insgesamt 12 Stunden einsparen würden, war der mittlerweile gestrige Tag nach meinen Berechnungen auf 17 reale Stunden zusammengeschmolzen und Christchurch war Perth noch einmal fünf Stunden voraus.
Nachdem ich immerhin zweieinhalb Stunden Schlaf geschöpft hatte und eine weitere Stunde zuvor am Flugsteig in Perth, meldete sich die Stimme des Kapitäns und teilte uns mit, wir erreichten in diesen Minuten die Westküste der Südinsel Neuseelands. Immer noch lag unter uns das dunstblaue Meer. Wie weiße Schiffe schwammen Kumuluswolken darüber im Raum. Sie standen aufgelockert, und das Bild verlor sich in endloser Ferne. Dann wie aus dem Nichts, immer deutlicher erkennbar, die Küstenlinie der West coast, endlos lang, ein Kranz Wellen, Klippen und Sandstrände in Dunkelgrau. Dahinter ein breiter sattgrüner Gürtel, der in rasant ansteigendes, bewaldetes Bergland überging, letzteres allerdings sofort von Wolkengrau vereinnahmt.
Unser Anflug kam mir vor wie die moderne Fassung der Entdeckung einer neuen Welt. Wochenlang auf See, beziehungsweise hier stundenlang nur Wasser unter uns, und dann urplötzlich tauchte am Horizont Land auf.
Wie mochte das gewesen sein, als einst die Māori dieses Inselreich entdeckt hatten und Aotearoa nannten? Der Legenden sind viele, und jeder Stamm, iwi, bewahrt seine eigene Version, die seinen Wurzeln entspricht. Ausnahmslos jedoch ist von dem Helden Kupe die Rede, der von seiner Heimat Hawaiki aufbrach, auf das Meer hinausfuhr und schließlich das Inselreich entdeckte, eher zufällig.
Wo aber ist nun Hawaiki zu suchen, lässt sich Hawaiki bestimmen, wenn auch nur als eine bislang unbewiesene Vermutung, oder existiert es lediglich in den Mythen?
Alle polynesischen Völker betrachten Hawaiki als die Urheimat, die ihre Ahnen auf der Suche nach neuen Horizonten einst verließen. Die Legenden sprechen von einem relativ großen Land, von dem die Vorfahren in grauer Vorzeit aufbrachen, um nach und nach die Inselreiche im Pazifik zu besiedeln. Im leeren Süden und Norden kann der Ursprung kaum gewesen sein, bleiben also der Osten und der Südosten Asiens.
Sowohl archäologisch als auch linguistisch und seit einiger Zeit auch durch die Genetik, und hier durch den Vergleich der mitochondrialen DNA, lassen sich die Wege nachzeichnen, und Letzteres gilt sogar für die mit den Menschen mitgereisten polynesischen Ratten, Rattusexulans, die als Nahrung dienten und als Delikatesse galten. Gleichwohl lässt sich nicht oder noch nicht feststellen, wann und wo vor 10000 bis 15000 Jahren die neolithische Kultur entstand, aus der die Austronesier hervorgingen. Jedenfalls sind diese Kulturen um 4000 v. Chr. auf der Insel Taiwan präsent und hatten die Insel wahrscheinlich Jahrtausende zuvor vom nahegelegenen südchinesischen Festland aus besiedelt.
Die Linguistik kennt rund 1200 austronesische Sprachen, die sie in zehn Zweige gliedert, von denen tatsächlich neun auf Taiwan zurückgehen und ausschließlich dort existieren, als die formosanischen Sprachen. Der verbliebene Zweig gehört dem Malayo-Polynesischen, dem, bis auf die gegenwärtig noch bekannten 21 Sprachen Taiwans, alle anderen austronesischen Sprachen angehören, einschließlich malaiisch, indonesisch und madagassisch4. Die heute als kleine Minderheit auf Taiwan lebenden Urtaiwaner gliedern sich in die Völker Atayal, Saisiyat, Bunun, Tsou, Rukai, Paiwan, Puyuma, Amis und Yami. Erst Ende des 20. Jahrhunderts wurde eine enge sprachliche und genetische Verwandtschaft mit den Māori festgestellt, das gilt besonders für die Amis an der Ostküste Taiwans5. Von den mehr als 200000 verbliebenen Amis sprechen bis zu 140000 noch ihre Sprache Amisisch, während zum Vergleich in Neuseeland maximal 90000 der 540000 Māori aktiv maorisch (Te Reo) sprechen und ca. 160000 es verstehen. In beiden Ländern werden mittlerweile Sprachen und Kulturen der Ureinwohner gefördert, sodass man für die Zukunft optimistisch sein darf. Zumindest dort, denn für die Welt gilt das leider nicht, sind mittlerweile doch 60 bis 80 Prozent der rund 6000 Sprachen bedroht, und das lässt große Traurigkeit empfinden.
Die austronesische Expansion begann vor etwas mehr als 5000 Jahren. Sie verlief über die Batan-Inseln, Philippinen, Borneo, Neuguinea, die Salomonen, Fiji, Tonga nach Tahiti. Von den Philippinen aus wurden Indonesien, Malaysia und sogar Madagaskar besiedelt, von Tonga und Tahiti aus als letztes Neuseeland6. Am Schluss der Überlegungen über die ursprüngliche Herkunft der Polynesier steht eine Frage im Raum: War mit Hawaiki am Ende die Insel Taiwan gemeint?
Für die Māori Neuseelands jedenfalls war das mythologische Hawaiki eventuell nicht nur der Ursprung ihrer jahrtausendealten Legenden, sondern parallel dazu etwas Greifbares, Existierendes, nämlich womöglich der Ort, von dem sie zuletzt aufgebrochen waren. Somit hätten sich Mythos und Wirklichkeit überlagert, zumal das Ereignis des Aufbruchs und die Fahrt über den weiten Ozean ähnlich und vergleichbar sind.
Der Sprache der Māori am nächsten sind die Idiome auf den Cook-Inseln, den zu den Gesellschaftsinseln gehörigen Inseln Raiatea und Tahiti. Raiatea heißt ursprünglich auf polynesisch Havaii, was Hawaiki nahekommt, allerdings ebenso Hawai’i, nicht zu vergessen die älteren Formen Hau’aiki und Savai’i. Kommt hinzu, dass die Sprecher den Konsonanten k zwischen zwei Vokalen gern unterdrücken. Jedenfalls gibt es zu Hawaiki mehrere Hypothesen, und ich beschränke mich auf eine und gebe sie vereinfacht wieder. Hau’aiki, Sitz der Götter und Ahnen, Eingang zur Unterwelt oder Anderswelt, oft direkt verbunden mit vulkanischer Aktivität.
Die Samoa-Insel Savai’i mit dem höchst aktiven Vulkan Matavanu ist ein Beispiel, bei dem sogar der Name passt. Hunderte Vulkane gibt es in Polynesien, Melanesien, Mikronesien und überhaupt dem pazifischen Feuerring. Die Südseevölker lebten von jeher mit dem Vulkanismus. Da waren die Hawaii-Inseln mit dem Vulkan Kilauea, dann Tonga mit dem Tofua sowie einigen Unterseevulkanen, ferner Raiatea, ein Atoll vulkanischen Ursprungs, nicht zu vergessen die Philippinen mit dem Mayon und vielen anderen; weiters Neuguinea mit den Inseln im Bismarck-Archipel, hier besonders gefährlich der Ulawun, und nicht zuletzt der Tinakula auf den Salomonen.
Aber selbst Taiwan kennt vulkanische Aktivität, zumindest auf Inseln um Taiwan herum. Auf der Insel selbst sind die wenigen Vulkane erloschen, heiße Quellen, Schlammvulkane und Fumarole jedoch keine Seltenheit.
Kennt man also den Ort, von dem aus die Māori aufgebrochen waren, um Neuseeland zu besiedeln? Immerhin lässt sich das auf ein Gebiet zwischen Tahiti und Tonga eingrenzen, demnach auf die Gesellschaftsinseln. Heißester Kandidat die Insel Raiatea, welche die Polynesier einst Havai’i nannten. Auf Raiatea und der nahen Nachbarinsel Bora-Bora lebten verschiedene Stammesgruppen mit ihren Clans, die sich oft bitter bekriegten. Raiatea darf als das religiöse und geistige Zentrum des Inselreichs gelten, vielleicht wegen der hohen vulkanischen Prägung. Von dort aus wurde sogar Tahiti dominiert.
Verließen die Māori ihre Heimat im Streit? Folgten sie ihrem Entdeckerdrang zu neuen Horizonten? Für die Polynesier beschränkte sich ihre Heimat mitnichten auf ihre kleinen verlorenen Inselwelten; die weiten Wasser darum herum gehörten dazu, waren ihr Einzugsgebiet, und sie befuhren das Meer, das sie ernährte. Die zuletzt genannten Inselgruppen liegen im Einfluss des Südäquatorialstroms. Diesen ausnutzend, gelangten die polynesischen Seefahrer unter günstigen Winden nach Neuseeland. All dies spricht für eine Besiedlung Neuseelands aus dieser Gegend. Was uns zu Kupe zurückbringt und seiner Entdeckung Neuseelands.
Da es unterschiedliche und detailreiche Versionen der Legenden von Kupe gibt, hier lediglich eine einfachste gekürzte Version nach meinem Belieben: Kupe lebte auf der Insel Hawaiki als Häuptling, ariki, einer der Stammesgruppen. Wiederholt mussten seine Fischer feststellen, dass ihre Fischernetze geplündert wurden, und Kupe bekam heraus, dass dies das Werk eines Riesenkraken war, mehr noch, dass der Kopffüßer Muturangi gehörte7, dem Anführer eines der benachbarten Stämme. Kupe suchte also Muturangi auf und bat ihn, er solle dafür sorgen, dass der Krake sie in Ruhe ließe. Muturangi erwiderte, er könne und wolle auf die Vorlieben seines Kraken nicht Einfluss nehmen. Wenn dem so sei, war Kupes letztes Wort, und der Krake wieder den Fang zunichtemache, dann sähe er sich gezwungen, ihn zu töten. Worauf Muturangi lachte, die Frage sei doch wohl, wer hier wen töte.
Wie erwartet wilderte der Krake wieder in Kupes Netzen, aber als Kupe ihn verfolgen wollte, floh er weit aufs Meer hinaus. Kupe beschloss, ihm beim nächsten Mal gezielt den Garaus zu machen. Dazu hielt er zwei ausgerüstete Kanus versteckt. Und tatsächlich setzte man bald dem Kraken hinterher. In dem einen Kanu namens »Matahorua«, gesteuert vom Navigator Reti, saßen Kupe nebst seiner Frau Hine-i-te-aparangi und seinen Töchtern; in dem anderen Kanu namens »Tawirirangi« war Ngahue der Navigator. Insgesamt mochten die beiden Besatzungen 72 Menschen zählen, die da den Riesenkraken aufs Meer hinaus verfolgten, immer weiter nach Süden, und bald war kein Land mehr zu sehen.
Nach vielen Tagen auf See sah der Himmel im Süden dunkel aus. Und plötzlich war da durch weißliche Wolken durchscheinend Land, tatsächlich Land. Eine von Kupes Töchtern hatte es zuerst wahrgenommen, hatte sich erhoben und: »He ao!« hatte sie geschrien: »He ao tea! He ao tea roa« »Eine Wolke! Eine weiße Wolke! Eine lange weiße Wolke!« Und so erhielt das Land seinen Namen: Aotearoa8.
Und der Riesenkrake? Genaueres an anderer Stelle. Hier sei nur verraten, dass Kupe ihn am Ende schlachtete.
An dieser Stelle ein Einwand, und das zurecht? Hier waren romantisierende Ethnographen des frühen 20. Jahrhunderts am Werk, Stephenson Percy Smith und William Pember Reeves beispielsweise, die sich, geprägt durch ihre eigene Kultur, die Vielzahl der Legenden zurechtbogen und den Namen Aotearoa erst aufbrachten9.
Wie aber benannten die zahlreichen iwi der Māori das Inselreich? Höchstwahrscheinlich gar nicht und allenfalls Te Wahi Pounamu (Fundort des Grünsteins) für die Südinsel sowie Te Ika a Maui (der Fisch von Maui) für die Nordinsel. Wie dem auch sei, ich bleibe gern bei Aotearoa.
Mittlerweile hatten wir die Küstenlinie von Aotearoa überflogen, und durch die Löcher in der Bewölkung hatte das satte Grün einer regengewohnten Küste geleuchtet. Gleich darauf hatten dichte Wolkenbänke das Land vorerst versteckt. Immerhin dünnten sie sich in größerer Höhe aus und ließen mich immer wieder Ausschnitte der neuseeländischen Alpen erkennen. Ich hoffte auf mehr, als der Kapitän sich meldete und von dem Ausblick nach Süden schwärmte. Offenbar sah man, und das war selten genug, die gletscherbedeckte Alpenkette und als Krönung den Aoraki, Mount Cook, gar nicht so weit entfernt. Leider saß ich auf der falschen Seite. Dennoch sah ich angestrengt an dem großen Tragflügel vorbei und erkannte einige höhere Gipfel mit Schnee und sogar kleinere Gletscher. Nach Osten hin verebbten die hohen Berge in sanfteres Bergland mit Erhebungen von maximal 2000 Metern. Gleich darauf vermehrten sich die Wolken erneut. Hier und dort schauten weiterhin schroffe Gipfel heraus. Dann, nachdem wir die Wasserscheide überflogen hatten, war kein Land mehr unter uns zu sehen.
Neuseeland, einsam abgeschottete Welt im Südpazifik. Betroffen wohl auch die nationale Fluglinie. Jedenfalls hatte meine Vorbestellung vegetarischen Essens nur Perth erreicht. Als Ersatz hielt mein letztes Käsebrötchen von zu Hause her.
Um 10.10 Uhr waren wir in Christchurch gelandet, Zeitdifferenz zu Europa: plus 12 Stunden. Meine Erdnüsse vertilgte ich sparsamer Mensch in der Warteschlange vor der Migration. Den Rest entsorgte ich nur Meter vor der Passkontrolle in den von der Bio Security bereitgestellten Behälter, letzte Gelegenheit vor der empfindlichen Strafe.
Unkompliziert rasch war mein Pass gescannt und über eine Kamera die biometrischen Daten abgeglichen worden. Schon war ich eingereist, nicht jedoch mein Gepäck, das ich aufgabelte; und damit begann das Procedere, das bis zu zwei Stunden dauern konnte, was die Warteschlange vor der Bio Security bestätigte. Warum wurden so wenige Beamte eingesetzt, diese Menschenmenge abzuarbeiten?
Während wir warteten, liefen Beamte mit Spürhunden an uns vorbei. Sie hielten einigen Abstand, sodass keiner an eine Kontrolle dachte. Die Hunde schlugen auch nicht an, wenn ihre feinen Nasen einen Verdacht meldeten. Sie setzten sich brav neben das Gepäckstück und warteten ab. Der Beamte fragte dann, wem der Koffer gehöre, und ob er mal hineinsehen dürfe. Sie durften immer, und wenn nicht, dann inspizierten sie ihn wahrscheinlich trotzdem. Sie blieben bis zuletzt freundlich und nett.
Nicht umsonst hatte ein im Flugzeug gleich mehrmals gezeigtes Video uns eingeschärft: »I am sorry, das zählt nicht.« Wer erwischt wurde, und sei es auch nur ein vergessener Apfel, dem drohten empfindliche Strafen. Da half kein Sich-herausreden, eben kein: I am sorry. Es gab kein Pardon. Hatte ich auch wirklich nichts vergessen?
Der Radfreak hatte neben seinem Gepäck nun auch sein teures Spezial-Mountainbike in Empfang genommen. Der Transport von Sportgerät käme gar nicht einmal so teuer, wusste er, der die Wartezeit nutzte, das Rad zusammenzubauen.
Zwei angehende Studenten aus Deutschland, die drei Monate reisen wollten, sagten, in meinen Klamotten und mit dem Rucksack und so weiter sähe ich aus wie ein passionierter erfahrener Globetrotter, Trekker und Freak, der schon mehrmals die Welt bereist und viel hinter sich habe. Ich dankte für die Zusammenfassung, ich hätte tatsächlich Wanderungen und Trekkingtouren vor, aber es sei jedes Mal auf das Neue spannend zu erleben, in welchem Zustand sich der Körper präsentiere, nachdem der Sport sich in den Monaten davor hauptsächlich auf sitzende Tätigkeiten und das Sofa beschränkt habe. Man glaubte an einen Scherz, dabei hatte ich in der Tat den Winter über körperlich zu wenig getan.
Die meisten Ankömmlinge packten, was unnötig Zeit kostete, zweifelhafte Güter erst nach Aufforderung aus, etwa eventuell mit fremder Erde behaftete Bergschuhe und Trekkingstöcke. Was mit Wandern zu tun hatte, hielt ich, wie einige andere in meinem Umfeld, längst parat.
Nach der ersten Stunde hatte ich immer noch vielleicht 60 Leute vor mir. Endlich öffnete ein Beamter einen weiteren Schalter, gedacht einzig für diejenigen, die keinerlei Nahrungsmittel mit sich führten, sondern entweder gar nichts zu Kontrollierendes oder Schuhe, Zelte, Trekkingstöcke und dergleichen.
Keine zehn Minuten später zeigte ich dem Beamten ich meine Schuhe mit den Worten, ich hätte sie nach dem gründlichen Waschen extra noch desinfiziert und den Stock auch, vor allem die Spitze. Da bedankte er sich tatsächlich und winkte mich durch.
Mein Empfangskomitee stand draußen in der Ankunftshalle: mein Sohn Caspar und sein Freund Dominic. Beinahe zwei Stunden hatten sie ausharren müssen. Caspar hatte ich nun knapp drei Monate nicht mehr gesehen. Dementsprechend freudig war das Wiedersehen. Wie viele Abiturienten, bevor sie sich für ein Studium entschlossen, hatte er sich eine Auszeit in Neuseeland gegönnt. »Work and Travel« ist bei der jungen Generation beliebt, bei Caspar beschränkte sich das dann, seinem sparsamen Naturell entsprechend, fast komplett auf Travel.
Per Whatsapp hatte er mich sporadisch an seiner Reise und seinen Abenteuern teilhaben lassen, jetzt war ich angekommen, mir selbst ein Bild von Neuseeland zu machen, einem Land, das immer schon weit oben auf meiner Wunschliste stand.
Im Büro der Autovermietung war ich die Nummer sechs in der Reihe, ein arabischer Geschäftsmann in feinstem Tuch stand vor mir an nebst seiner vier Koffer.
Eine Viertelstunde später, es war exakt Mittag, waren alle Papiere ausgefüllt und mit Unterschriften versehen. Mit guten Wünschen hatte ich den Autoschlüssel erhalten und vor allem keine Zusatzversicherungen aufgedrängt bekommen.
»Den Komplettschutz haben Sie ja bereits über den Anbieter des Internetportals abgeschlossen, dann haben Sie ja alles.« Anscheinend nahm man es in Neuseeland tatsächlich entspannter und lockerer, und da passte ich mich sofort an, ohne mich anpassen zu müssen.
Draußen auf dem großen Parkplatzgelände, wo alle Mietwagenfirmen ihre Autos stehen hatten, jede in ihrem eigenen Bereich, fanden wir unser Auto, einen kleinen Toyota SUV, der mir groß und wuchtig vorkam. Wir luden all unser Gepäck ein. Erst vor ein paar Tagen hatte Caspar für nur zehn Dollar einen gebrauchten Gaskocher erstanden. Der war nicht gerade klein und in einen Kunststoffkoffer integriert, aber wir mussten ihn ja nicht auf Wanderungen mitschleppen. Es gab sogar eine Ersatzgaskartusche.
Dominic hatte mit meinem Sohn Caspar bis im Sommer die Schulbank gedrückt und war dann nach dem Abitur auf Weltreise gegangen. In Neuseeland hatten die beiden sich vor einem Monat getroffen und waren dann zusammen weitergereist. Nun waren sie beide hier. Ich hatte mich erboten, Dominic ein paar Tage mitzunehmen. Auf länger hatte ich mich nicht festlegen wollen, zumal ich nicht wusste, wie groß das Auto sein würde und ob wir uns alle vertrugen. Jetzt, wo der Toyota so geräumig war, bot ich Dominic an, uns weiter zu begleiten, solange er mochte. Aber er hatte schon anderes vor, wollte in Picton für Kost und Logis in einem Hostel arbeiten, ab übermorgen. Wahrscheinlich würden wir morgen Abend durch Picton kommen und dann in Dominics Hostel übernachten. Heute jedoch hatten wir Kaikoura, 180 Kilometer weiter nördlich, zum Ziel.
Durch die offene Schranke rollten wir vom Hof. Linksverkehr, Müdigkeit, ungewohntes Auto, fremde große Stadt, andere Verkehrsregeln: Ich tat gut daran, besonders aufmerksam zu sein. Nach der zweiten Kreuzung steckten wir schon im dichten Verkehr. Zuerst wollten wir eine Filiale der großen Supermarktketten ansteuern: Es gab die fünf großen: PAK’nSAVE, Countdown, »New World«, »Four Square« und »Fresh Choice«, in dieser Reihenfolge nach preiswert sortiert, wobei die letzten drei ähnlich lagen und PAK’nSAVE eindeutig am preisgünstigsten war.
»Ihr müsst mich leiten, ich muss auf den Verkehr achten«, sagte ich, aber dort vorne waren wir bereits am Ziel. Für uns war es der Countdown geworden, weil er gleich beim Flughafen in der Memorial Ave angesiedelt war.
Nun war ich auf die Preise gespannt. Die Lebensmittelpreise in Neuseeland sind bekanntlich hoch. Erst neulich hatte mir mein Sohn ein Bild mit Melonen geschickt. Die Warenhatte man so ausgezeichnet, dass eine Sechs-Kilo-Wassermelone auf 38 Dollar kam, in etwa genauso viel wie die Markenjoggingschuhe, die er im Ausverkauf in New Plymouth erstanden hatte, denn seine sündhaft teuren alten Treter waren nach kaum sechs Wochen Neuseeland hinüber.
Diese teuersten Schuhe, die wir je gekauft hatten, nahm ich am Ende der Reise mit nach Hause und präsentierte sie daheim im Sportgeschäft. Trail-Running-Shoes seien nicht zum Wandern geeignet. Das hatte sein Kollege ein paar Monate zuvor anders gewusst. Mein Sohn müsse eine absolute Gewalttour gegangen sein, durch schier unwegsames Gelände. Nein, die Schuhe waren nur nass geworden, und es stand Goretex drauf. Jedenfalls tat es dem Verkäufer leid, dass er mir leider nicht helfen konnte. Die neuen preiswerten Schuhe indes hielten dann problemlos durch.
Es ist noch jedes Mal interessant, in einem fremden Land zum ersten Mal einen Supermarkt zu betreten. Zu dem riesigen Parkplatz gehörte drinnen eine riesige Verkaufsfläche. Wenn ich meine ersten Eindrücke eines neuseeländischen Supermarkts mit denen eines us-amerikanischen, kanadischen, australischen und selbst britischen verglich, dann kam der australische am nächsten; und ich hätte nicht einmal sagen können, was genau das Urteil ausmachte.
Wir kauften groß ein, immer unter der Prämisse, günstige Angebote zu finden. Sofort auffällig das teure Obst und Gemüse. Die Preise übertrafen die in der Europäischen Union oft um das Dreifache. Dennoch: Ein Salatkopf musste sein. Karotten wollten wir uns ebenfalls leisten. Joghurt, am besten gleich im Kiloeimer, das kam günstiger und war dennoch teuer, Milch, Brot und süßes Backwerk. Dann haltbare Dosenware. Ganz wichtig Nescafé, wenn möglich die Espresso-Variante.
Statt an der Kasse anzustehen, checkten wir die Ware aus, platzierten alles auf einer Ablage und legten die Einkäufe dann einzeln auf eine Wiege- und Scan-Vorrichtung. Wenn etwas nicht klappte, kam sofort eine Angestellte angesprungen, um zu helfen. Am Schluss steckte ich meine Kreditkarte in den Schlitz, und die Sache war erledigt. Halt, ich musste noch einen Kassenbon unterschreiben, den die Angestellte dann entgegennahm. Wahrscheinlich war das kein Traumjob, herumzustehen, aufzupassen und nötigenfalls einzugreifen.
Wir fanden den State Highway 1 und folgten ihm nach Norden. Nach einigen Kilometern waren die Vororte von Christchurch Vergangenheit und auch erste automatische Radarkontrollen. Der Highway wurde nach und nach immer schmaler. Wiesen, Weiden, Hügel, in einiger Entfernung Berge. Das Fahren war entspannt, zügig floss der Verkehr, überholen lohnte sich nicht. Bald kam meine erste einspurige Brücke in Neuseeland, bei der wir Gegenverkehr abwarten mussten. Sie half uns über den recht breiten Fluss Hurunui, dessem Lauf wir dann eine ganze Weile folgten. Bei der Ortschaft Domett gedachte ich, wie im Vorhinein geplant, den ersten Abstecher an die Küste zu unternehmen. Ich machte ein Geheimnis daraus. Es gab sogar eine Abkürzung, meine erste Schotterstraße.
Den Mietwagen auf Schotterstraßen zu bewegen, war in Neuseeland erlaubt, solange sie befestigt waren. Diese hier war breit ohne Schlaglöcher und führte die meiste Zeit an einer Viehweide entlang, auf der sich schwarze Kühe verloren.
Die folgende Weide war auf weiter Fläche homogen sattgrünes Gras, das einen Fuß hoch stand und eine Vielzahl Schafe auf sich sah. Es waren hunderte, die sich recht gleichmäßig verteilten. Alle waren mit Grasen beschäftigt und hoben sofort kollektiv den Kopf, als wir am Zaun auftauchten. Dann setzten sie sich gemeinsam in Bewegung, und für eine Weile zeigten sie uns nur ihre wolligen Hinterteile. Bald siegte die Neugier. Ja, wir waren immer noch da, aber anscheinend nun ausreichend weit entfernt, sodass sie das nicht scherte. Also senkten sie wieder ihre Häupter, um neuerlich zu grasen. Fanden wir das amüsant? Gewiss. Jedenfalls begann allmählich das Neuseelandklischee aufzuleben.
Die Abkürzung endete in einer Teerstraße, die sich durch die Hügellandschaft wand. Grasberge mit gelblichem Bewuchs, hier und dort mit Nadelbäumen bestanden, manchmal kleine Forste in Reih und Glied gepflanzt, für die Farmer ein Zubrot, für das Auge nicht unbedingt schön. Umso mehr die Hügel. Die Straße ießuns, nun oben auf den Hügelkämmen verlaufend, in die sanften Täler und Mulden hineinsehen. Mit der Kamera lief ich ein Stück. Alles er erschien mir so neu, obwohl Europa ähnliche Landschaften kannte. Wenige Tage und Vieles war alltäglich, wurde kaum mehr bemerkt. Ich fotografierte ein Tälchen entlang, fünf schwarze Kühe auf einem Hügelvorsprung inklusive. Jetzt schloss mein Sohn zu mir auf, der das nach knapp drei Monaten in Neuseeland natürlich nicht sehr spannend fand.
»Mit den Kühen sieht das gut aus«, rechtfertigte ich mich. Und er: »Welche Kühe?« Ich sah noch einmal hin. Jetzt waren sie weg, wie vom Erdboden verschluckt, wahrscheinlich in den Sichtschatten einer Erhebung gewandert. »Kuhrios!« Wir warteten, aber sie tauchten nicht wieder auf.
Wir kamen durch ein luftiges Waldstück gefahren, als in einer Kurve die »Cathedral Gully« ausgeschildert war. Ein kleiner Parkplatz, eine Grasfläche, ein Zaun, an der Absperrung drei uns zugewandte Rücken. Man blickte auf etwas, das wir nicht sahen. Zur Begrüßung stellten die Leute gleich fest: »Ist das nicht wunderschön!« Der flüchtig geworfene Blick und ich gaben ihnen recht, und nun waren es sechs Rücken, und im Verein schauten wir in den Abbruch hinunter in das steilwandige, jedoch dicht bewachsene Tal, das zum Meere hin entwässerte.
Auf unserer Höhe schob sich als lange Linie die Abbruchkante ins Bild. Die Erde war tiefes Ocker, und die Erosion hatte Drecknadeln ausgeformt, die in Vielzahl den Abhang bevölkerten. Es handelte sich um ehemalige Sedimentablagerungen, Schluffstein. Die Vegetation rundherum, die sanft geschwungene Bucht des blassblauen wellenwerfenden Meeres: das Bild lag in Gegenlicht getaucht. Nichts von Menschenhand Geschaffenes störte.
Strenggenommen wussten wir, dass dort unten die Straße verlief und an ihr und dem Strand entlang die Häuser von Gore Bay standen. Von hier oben war das alles ausgeblendet. Wer allerdings zu genau hinsah, entdeckte, dass dennoch an einer Stelle Hausdächer sichtbar waren.
Beim Smalltalk wunderten sie sich. Kaum zwei Stunden in Neuseeland und dann ausgerechnet hier. Wie wir davon gewusst hätten? Ich hatte auf Google Maps die Küste nach Sehenswertem zwischen Christchurch und Kaikoura abgegrast.
In die Gore Bay hinabrollend erwartete uns gleich unten, wo die Straße den Wald verließ, ein kleiner Kiesplatz direkt an der Böschung zum Meer. Wir traten den Pfad hinunter das kurze Stück auf den Strand. Umgehendtauchte ich, und das war ein Ritual, die Hand in eine auslaufende Welle: mein erster Kontakt mit diesem Teil des Südpazifiks.
Der Himmel zeigte sich stark bewölkt. Laut rauschte die Brandung, der Sand war dunkel, grobkörnig und mit Kieselsteinen durchmischt. Wo das Terrain anstieg, blühten orange die wuchernden Wicken, während bis zum Saum hinauf ausgebleichte Baumskelette kreuz und quer lagen. Hatten Sturmfluten sie an anderer Stelle aus dem bis ans Wasser wachsenden Wald geraubt, als Teile des Ufers abbrachen, und sie dann hier angeschwemmt wurden? Oder hatte die Erosion sie von den Klippen gestürzt, die nur ein paar Schritte von hier steil und hoch aufragten? Diese gut achtzig Meter hohen »Cathedral Cliffs« aus hellem Kalkstein liefen ein Stück weiter südlich um ein vorspringendes Kap herum und somit aus dem Bild. Wir wagten uns nicht zu dicht an die Wände, aus Furcht, von fallendem Material erschlagen zu werden.
Zwischen groben abgeschliffenen Kieseln und all dem Schwemmholz fand ich ein Monster. Wenn ich ihn auf das stellte, was ich als seine Füße erachtete, erwachte der getrocknete braungoldene Tang zu einem Wesen mit Beinen, Oberkörper, Kopf und ein wenig zu kurz geratenen Armen. Ich nahm die Tanggestalt an der Hand, die einen guten Kopf kleiner war als ich, und tanzte mit ihm eine Runde über den Strand, sehr zum Gelächter der anderen. Dann lehnte ich das Monster aufrecht an eine Baumleiche.
Die Uferstraße durchmaß den wenige Häuser zählenden, wie ausgestorben daliegenden Ort, der kleine schmucke Häuschen mit Vorgarten zeigte, aber auch moderne Wochenendsitze der reicheren Christchurcher. Schon schwenkte die Straße landeinwärts, verschwand im Wald und strebte die Hügel hinauf.
Bei Cheviot hatte uns der gut ausgebaute NH1 wieder, Ziel weiterhin Kaikoura. Nach zwanzig Kilometern führte sie geradewegs einen Hügel hinunter und unten in der Talsohle unter dem Viadukt hindurch. Als ich im letzten Moment in eine Ausweichstelle hineinscherte: Da war eine Abzweigung zum Meer gewesen: »Kaikoura Coast Track«. Ein weiterer Abstecher zur Küste? Auch das hatte ich mir vor der Reise vorab in Google Maps angesehen. Ich hörte keine Widersprüche.
In nicht einsehbaren Kurven den Wagen zu wenden, war gefährlich. Ich beeilte mich, von Unbehagen begleitet. Prompt kamen, kaum mitten auf der Straße, zwei lange Trucks mit irrsinnniger Geschwindigkeit dahergebraust.
Kollisionskurs: Ich gab Vollgas. Kurz scharf gebremst und links hineingebogen, bevor sie meinetwegen in die Eisen gehen mussten, für alle Beteiligten eine brenzlige Situation. Puh, das war knapp!
»Conway Flat 5 Km«, sagte ein Schild und das darunter: »Kaikoura Coast Track«. Am Meeresufer entlangsüdwärts kamen bald die Gebäude der Conway Flat in Sichtweite, ein privates Anwesen, Fremde und Neugierige nicht willkommen. Kurz vor einem kurzen Anstieg ließ ein Erosionsdurchbruch uns direkt auf den breiten Sandstrand sehen. Darum herum wuchsen knorrige Nadelbäume, die wir im Verdacht hatten, der Gattung Zeder anzugehören.
Ein gut vier Meter hoher lössfarbener Steilabbruch lief als Band endlos in einer fast geraden Linie nach Süden. Davor lagen Baumstämme und riesige Wurzelwerke durcheinander auf dem breiten Strand. Sie waren bei Hochwasser abgestürzt, manche Stämme längst ausgebleicht. Bäume gediehen weiterhin oben auf dem Absatz. Manche standen weiter im Land, manche gefährlich nahe am Rand. Ihr Schicksal hatten ihre Baumbrüder bereits vorweggenommen. Die nächste Sturmflut war nur eine kurze Frage der Zeit beziehungsweise des kommenden Herbstes oder des Winters.
Den dunklen Sand unten am Saum des Abbruchs unter den Sohlen, kletterten wir über liegende Stämme und versuchten, mit der Kamera am Auge meterhohes Wurzelwerk in Szene zu setzen. Frisch gefallene Bäume hatten ihre Wurzelballen komplett in gelbliche Erde eingebacken, während die dem Meere zugewandten Stämme und Geäste bereits vom Salzwasser abgenagt waren. Schon länger liegende Bäume hingegen waren komplett von Erde befreit, die ältesten nur mehr aller Rinde beraubte weiß-gebleichte Skelette.
In der anderen Richtung lag tatsächlich eine junge braunschwarze Robbe im schwarzbraunen Sand. Der Strand war an dieser Stelle noch einmal breiter, und der Weg ins Wasser war weit, zumindest wenn man robben musste. Erst hatte ich gedacht, die Robbe sei tot, ausgedörrt, oder, falls sie noch lebte, hilfsbedürftig. Der Sand hatte sie rundherum paniert. Mittlerweile hatte sie ihren Kopf erhoben und sah anklagend zu mir. Wahrscheinlich fühlte sie sich gestört. Ich wollte ihr nicht zu nahetreten, nur sie fotografieren, das tat nicht weh. Das Tier drehte sich, robbte dann zwei Meter weg und lag schon wieder im Sand, als sei es fest eingeschlafen. Jedenfalls musste ich mir keine Sorgen machen. Die Robbe verhielt sich nach Robbenart und sah überdies gut genährt aus. Ich ließ sie endlich allein.
Auf der Südinsel gibt es fast nur den Neuseeländischen Seebären, Arctocephalus forsteri. Seelöwen, Phocarctos hookeri, beschränken sich, bis auf einige Stellen im Süden der Südinsel und der Steward Island, auf die noch viel weiter im Süden liegenden Auckland Islands. Wenn wir also Robben sehen, sind es mit Sicherheit fast immer Seebären. Sie Robben zu nennen indes, ist nie falsch; zu denen gehören sogar die Seeelefanten Südamerikas und die Walrosse hoch im arktischen Norden.
Die flächendeckend dichte Bewölkung ließ diffus das Sonnenlicht durch und sonderte keine Niederschläge ab. Das änderte sich nicht die verbleibenden 40 Kilometer bis Kaikoura.
Der Highway 1 hatte sich kurvenreich durch die Vorberge der Kaikoura Range gemüht und dann bei Oaru die Küste wiedergetroffen. Hier begleitete er gut ausgebaut die Eisenbahnstrecke, welcher einige Tunnel mehr spendiert worden waren. Felsen und Riffe standen in der Brandung, auffällig der Pinnacle Rock als die Verlängerung eines bis ins Meer reichenden Felsmassivs. Befremdlich war der enge einspurige Straßentunnel. Gerade hier, wo die Küstenberge direkt und steil ans Ufer traten, war die Straße durch das Erdbeben im November 2016 besonders geschädigt worden und bestenfalls lediglich durch Erdrutsche stellenweise verschüttet. Hier waren in den letzten beiden Jahren enorme Anstrengungen unternommen worden, die wichtige Küstenroute und Hauptnordsüdverbindung wieder instandzusetzen, die Rutschhänge zu befestigen und zu sichern. Die Bahnlinie betraf das gleichermaßen.
Die Kaikoura Peninsula rückte ins Bild, die Stadt Kaikoura auf beiden Seiten der Halbinsel um eine Bucht geschmiegt, die Landzunge selbst zu ihrem Ende hin steil ins Meer abfallende Kaps ausbildend, das Grasland oben auf den Klippen topfeben und unbebaut.
In der Stadt rollten zur Kaikoura Beach hinab bis auf die Uferfrontpromenade, der Esplanade zum Point Kean hinaus folgend, dem Ende der Straße am Ende der Halbinsel.
Gegenwärtig herrschte Ebbe. Die zurückweichenden Wasser hatten bis weit hinein Felsrücken bloßgelegt. In der Nähe des Piers am Ende der Esplanade nahmensich die aus dem Wasser ragenden Gesteinsformationen unwirklich bizarr aus.
Gewaltige Erdkräfte hatten ehemalige, durch enormen Druck umgewandelte Meeresböden, in verschiedenen Winkeln zwischen 30 Grad und senkrecht aufgestellt und zusammengeschoben, klastisches Sedimentgestein, eine Vielzahl nur wenige Zentimeter dicke Kalk- und Schluffsteinschichten. Hitze und Feuchtigkeit hatten ihren Anteil gehabt. Spalten und Risse formten lange Linien, aber die zerborstenen Schichten wiesen auch Quersprünge auf. Beim Laufen darauf war Vorsicht geboten.
Bis weit ins Wasser hinein formten diese Rücken eine Vielzahl kleiner Inseln. Jenseits der weiten Bucht steckte das Gebirge der Kaikoura Range seine hohen Gipfel in dunkle Wolken.
Hier waren wir mitten in einer Zone, die zwischen zwei großen Kontinentalplatten zerrieben und aufgemischt wird, der Australischen und der Pazifischen Platte. Während die Nordinsel vollständig auf der Australischen Platte liegt, verläuft die Grenzlinie zwischen beiden Platten durch die Südinsel. Entlang der Subduktionszone beider Platten sind die Südalpen aufgefaltet worden. Kommt hinzu, dass der Graben einer geschwungenen Linie folgt, und im Gebiet um Kaikoura ein Wendepunkt liegt. Hier fächert sich die Störungszone in mehrere auf. Die Verwerfungslinie, auf der wir gerade standen, heißt Hope Fault.
Hochinteressant ist der Wechsel der Subduktion. Vor der Nordinsel schiebt sich die Pazifische Platte unter die Australische, bei großen Teilen der Südinsel hingegen genau umgekehrt die Australische Platte unter die Pazifische. Da kommt wieder der Wendepunkt ins Spiel. Auf hunderten Kilometern finden auf der Südinsel Blattverschiebungen anstelle von Subduktionen statt. Es erscheint logisch, dass der Wechsel der Subduktionspartner nicht an einem Punkt stattfindet sondern mehrfach hier entlang der alpinen Verwerfungslinie. Fazit: Wer in Neuseeland lebt, weiß darum, dass er den Erdkräften ständig ausgesetzt und ausgeliefert ist.
Noch vor dem Point Kean kamen wir an dem historischen Gebäude Fiffy House vorbei, vor dem lange ausgebleichte Walknochen lagen. Da das Wetter nicht mitspielte und die hohen Küstenberge der Kaikoura Costal Range sich zunehmend hinter Schleiern von Regenschauern verbargen, verschoben wir eine eingehendere Besichtigung der Halbinsel auf den nächsten Morgen.
Die Neugier ließ uns dennoch am Ende der Straße ein kurzes Stück am Fuß der Klippen entlangwandern. Die Ebbe hatte weithin Felsbänke freigelegt, die wir unter unsere Sohlen nahmen, stets bedacht, nicht auszurutschen. Insbesondere galt das für die nassen, von einem grünen Algenflaum besiedelten Stellen, und es stellte sich als ratsam heraus, manch eine Abkürzung zu vermeiden, so glitschig war das Terrain. Außerdem hätten sich die Möwen gestört gefühlt, die herumstaksten und in den Resttümpeln nach Krebsen und Muscheln pickten. Wir wollten sie nicht um ihr mühsam zusammengesuchtes Abendessen bringen.
Die hohen Wellen wurden weiter draußen an den jetzt bei Ebbe herausstehenden Felsen und Riffen gebrochen oder überspülten diese mit Unmengen an Schaum. Das Wasser fand in den kleinen Fjorden zwischen den Felsbänken bis zu uns. Ganz allmählich setzte die Flut ein, Grund umzukehren.
Es stellte sich die Übernachtungsfrage. Der offizielle Campingplatz war teuer, aber Dominic hatte den Highway zurück einen kostenlosen Platz aufgetan. Der Pohowera Freedom Campground lag einen Weg hinein 50 Meter neben der Straße und war ein schlechterer Kiesplatz, der stellenweise mit Büschen und allem möglichen Kraut bewachsen war und zum Meer hin direkt in den Strand überging.
»Maximal 25 Fahrzeuge«, sagte ein Schild. Es waren jetzt schon deutlich mehr und noch einmal eines mehr würde auch nichts machen.
Die besten Plätze waren vergeben, und wir fuhren auf der Suche nach einem Kompromiss den holperigen Weg einmal im Kreis. Der Platz eingangs des Kreises, der uns zuerst ins Auge gefallen war, blieb der einzig für uns geeignete, und ich setzte den Wagen auf den Kies und nicht in den Sand. Schon räumten wir alle Sachen aus dem Kofferraum und bauten das große Zelt auf, das Dominic für ein paar Dollar von anderen Reisenden übernommen hatte. Drei Personen bot es gut Platz. Der feine Kiesgrund wollte die Heringe des Zelts kaum festhalten beziehungsweise gar nicht, und wir suchten große Steine, die wir dann zusätzlich auf die gespannten Schnüre legten. Hoffentlich kam nachts kein starker Wind auf.
Kurz nach unserer Ankunft fragten uns Neuankömmlinge höflich, ob sie ihr Zelt in die Nähe von unserem aufbauen dürften. Ich bejahte, gab jedoch zu bedenken, dass der Boden dort abschüssig und krumm sei. Den beiden machte das wohl nichts aus. Auf Steinen lagen wir ohnehin alle, aber sie waren so klein und beweglich und auch nicht spitz, dass sich der Rücken anpasste. Es waren dann die zwei oder drei Größeren, die drückten. Nachher saß das Paar aus Südosteuropa zufrieden auf seinen Matten vor dem kleinen niedrigen Zelt und garte sich ein Süppchen. Von unserer Warte aus war das Meer nicht einsehbar, ein Wulst aus Sand, durchsetzt mit Kies, nahm uns die Sicht. Auf diesen Hang hatten Kinder mit hellen Kieselsteinen Wörter gelegt, Namen von Städten aber auch ein Vorname hatte sich daruntergemischt, oder war Michael eine Stadt?
Wir wollten den Strand kennenlernen und überwanden den Hang, auf dem zwei Zweijährige kaum beaufsichtigt herumtapsten, immer wieder hinfielen und anfingen, im Sand nach Interessantem zu wühlen, was gegebenenfalls geeignet war, sich in den Mund zu stecken. Diesen Schluss ließ jedenfalls das sandverschmierte Mündchen des einen Kerlchens zu.
Der Strand war weit, es wehte eine kühle Brise, und die Sonne fand durch den blassblauen Himmel. Nicht weit draußen zog gerade ein riesiges Kreuzfahrtschiff vorbei, sonst war das Wasser horizontweit leer und gleichförmig. Auf ein Bad verzichteten wir. Ganz allmählich machte sich Abendstimmung breit. Die wenigen Wolken in der Ferne färbten sich leicht orange und gleichsam der Streifen Dunst am Horizont. Hier wurde es rund zwei Stunden später dunkel als zu Hause in Mitteleuropa, wo der Frühling erst in viereinhalb Wochen Einzug hielt und hier dann eben der Herbst. Kurz vor Herbstanfang würde ich dann zurückfliegen.