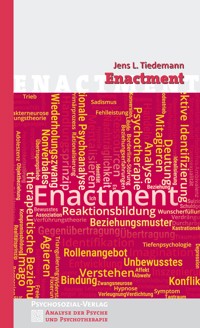16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Psychosozial-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Analyse der Psyche und Psychotherapie
- Sprache: Deutsch
Schamkonflikte belasten Menschen in unterschiedlicher Weise und hemmen Lebensfreude, Selbstwertgefühl und intime Beziehungen grundlegend. In der Scham erfährt das Subjekt eine Infragestellung und Bedrohung der sozialen Akzeptanz und Anerkennung. Scham ist aber nicht nur ein subjektives Gefühl, sondern hat auch eine intersubjektive Dimension, die in der Psychoanalyse in den letzten Jahren zunehmend verstanden und fokussiert wird. Im psychoanalytisch-therapeutischen Prozess ist Scham eine Hauptquelle für Widerstand, Verstrickungen und problematische Übertragungs-Gegenübertragungs-Konstellationen. In der vorliegenden Einführung werden die zentralen psychoanalytischen Schamkonzepte skizziert und hinsichtlich ihrer klinischen Dimension vorgestellt. Zahlreiche Beispiele verdeutlichen die Relevanz von Schamaffekten und -konflikten in der therapeutischen Behandlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Jens L. Tiedemann
Scham
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
E-Book-Ausgabe 2013
© der Originalausgabe 2013 Psychosozial-Verlag
Walltorstr. 10, D-35390 Gießen
Fon: 0641-969978-18; Fax: 0641-969978-19
E-Mail: [email protected]
www.psychosozial-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung & Satz: Hanspeter Ludwig, Wetzlar
www.imaginary-world.de
ISBN Print-Ausgabe 978-3-8379-2229-5
ISBN E-Book-PDF 978-3-8379-6585-5
ISBN E-Book-EPUB 978-3-8379-6589-6
Inhalt
Einleitung
Scham ist ein Problem, dessen Existenz in der Psychotherapie und Psychoanalyse stillschweigend hingenommen, jedoch von vielen Therapeuten unterschätzt wird. Man könnte sogar so weit gehen und behaupten, dass das ganze System der Psychotherapie nur funktioniert, wenn wir die Scham übersehen, die wir tagein, tagaus in unserer therapeutischen Arbeit ungewollt und vor allem unbewusst sogar hervorbringen. In unserer postfreudianischen Gesellschaft wurde nahezu alles behandelt, außer Scham. Das Ausmaß und die Schwere einer unbehandelten Scham übersteigt bei Weitem alles, was wir uns vorstellen können, wie der Emotionsforscher und Therapeut Donald L. Nathanson (1996) provokativ anmerkt.
Scham und häufiger noch Schamangst können spezielle Probleme in der psychotherapeutischen und psychoanalytischen Behandlung (und anderen Lebenssituationen) hervorrufen. Sie können viele Handlungen hemmen und eine Art emotionaler Stagnation hervorbringen, aus der es kein Entkommen zu geben scheint. Weil die Psychotherapie voraussetzt, dass sich Patientinnen und Patienten verbal mit ihren Gefühlen exponieren, ist Scham potenziell ein grundlegender Aspekt unserer therapeutischen Arbeit.
Mit der »Renaissance des Gefühls« in den Wissenschaften der letzten Jahre wurden viele Gefühle, aber endlich auch ein bestimmtes Gefühl von seinem »Schattendasein« befreit: die Scham. Das Gefühl der Scham ist in den letzten zehn bis zwanzig Jahren von Psychoanalytikern, Sozialwissenschaftlern, Neurowissenschaftlern, Philosophen, Anthropologen und Emotionspsychologen untersucht worden. Scham ist ein Affekt, der auch erst seit Kurzem im analytischen Diskurs auftaucht. Sie ist vom Status einer wenig geschätzten und beachteten »Fußnote« aufgestiegen zu einem klinischen Thema von größter Bedeutung. Francis J. Broucek (1991) vertritt den meiner Ansicht nach angemessenen Standpunkt, dass man, wenn man Scham versteht, viel über Pathologie, aber auch über Gesundheit versteht.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass »Gefühl« als psychoanalytischer Begriff erst seit kurzer Zeit in entsprechenden Wörterbüchern zu finden ist. Dies ist deswegen verblüffend, weil – wie Wilfred R. Bion einmal bemerkt hat – »Gefühle zu den wenigen Dingen gehören, bei denen Analytiker den Luxus genießen, sie als Tatsachen ansehen zu können« (Bion 1990, S. 38). Die meisten Psychoanalytiker oder Psychotherapeuten machen sich vorrangig Gedanken über das affektive Leben ihrer Patienten und reden mit ihnen auch hauptsächlich über diese Emotionalität. Meiner Auffassung nach bestünde die konsequente Weiterentwicklung dieser Praxis in der Feststellung und Anerkennung, dass eine Theorie der Affekte die übergeordnete Perspektive darstellt, die die Behandlungspraxis leitet sowie die Theorien von Trieb, Ich, Objekt, Selbst und interpersonellen Beziehungen verbindet und transzendiert. Die Psychoanalyse hat bisher keine befriedigende und konsensfähige Theorie über das Wesen und die Funktion der Affekte entwickelt. Hier gilt es noch viel zu erforschen.
Diese affektzentrierte Vision der Psychoanalyse stellt eine Alternative zu den gängigen Fokussierungen dar und trägt der paradoxen Tatsache Rechnung, dass die klinische Zentralität mit der theoretischen Vernachlässigung der Affekte unvereinbar ist.
Scham fühlt sich subjektiv an wie eine unerwartete Bloßstellung, die uns defizitär und minderwertig erscheinen lässt. Das Selbst fühlt sich den Blicken des anderen wie unter einem Vergrößerungsglas ausgesetzt. Schüchternheit, Peinlichkeit, Selbstbeobachtung und Schuld stellen die affektiven Indikatoren für Scham dar.
Scham als ein kurz und »überflutend« auftauchender Affekt muss jedoch von der verinnerlichten Scham unterschieden werden. Die Aufgabe von Therapeutinnen und Therapeuten ist es, einerseits einen Zugang zu dieser verinnerlichten Form der Scham zu finden, die mit stabilen und konstant abwertenden Verurteilungen, dem »inneren Richter«, in Zusammenhang steht. Andererseits sollte ein Fokus auch auf dem »Gegenwarts-Unbewußten« (Sandler/Sandler 1985) und der »Hier-und-jetzt-Scham« liegen, die immer wieder verhüllt und maskiert in der therapeutischen Dyade oder Gruppe auftaucht.
Das Schamgefühl ist – zusammen mit dem Angstgefühl – insgesamt der sich am leichtesten generalisierende, der am schnellsten sich ausbreitende und überflutende von allen Affekten. Er ist auch jener Affekt, der die Wurzel für Gefühle der Minderwertigkeit darstellt. Die Scham als »Wärterin der Integrität des Selbst« (Joraschky 1998, S. 105) ist doppelgesichtig: Sie bezieht sich einerseits auf den intrapsychischen Bereich der Selbst(wert)regulation, andererseits auf den intersubjektiven Bereich der Beziehungsregulation. Die Scham ist dabei nicht nur ein »subjektives« Gefühl, sondern besitzt vor allem eine »intersubjektive« Dimension, von der ihr »ansteckender« Charakter zeugt (Tiedemann 2008 a).
In der Scham erfährt das Subjekt eine Infragestellung und Bedrohung der sozialen Wertschätzung, Akzeptanz und Anerkennung. Das Selbst wird über die Dimension der Fremdperspektive, über den Blick des anderen bedroht und in diesem Blick des oder der anderen erscheint das Selbst als nicht akzeptabel: »Wie eine Wunde, die von einer unsichtbaren Hand im Inneren verursacht wurde, unterbricht Scham das natürliche Funktionieren des Selbst« (Kaufman 1989, S. 5, eigene Übersetzung).
Psychotherapie nun kann derAuflösungvon Scham dienen, sie kann aber genauso ein Setting für dasHervorbringenvon Scham sein. Scham durchzieht von der ersten bis zur letzten Minute den therapeutischen Prozess der Begegnung und ist, so meine zentrale These, eine Hauptquelle für Widerstand, Kollusionen und problematische Übertragungs-Gegenübertragungs-Konstellationen im Sinne von »Enactments«. Da Schamgefühle an der Grenze zwischen dem Selbst und dem Anderen angesiedelt sind, sind sie »ansteckend«: Das Teilhaben an einer Schamszene, von der der Patient berichtet, löst automatisch Scham im Therapeuten aus. Das ist auch ein wichtiger Grund dafür, warum Scham so lange von der Psychoanalyse ignoriert wurde: Der Therapeut muss sich selbst innerlich mit der eigenen Scham auseinandersetzen, die die Scham des Patienten in ihm zum Resonieren bringt. Es existiert daher ein unbewusster Wunsch und Drang beim Therapeuten, die Wahrnehmung und Anerkennung der eigenen Scham zu umgehen.
Als Zuschauer an einer beschämenden Szene teilzuhaben oder von ihr zu hören, löst ein Gefühl der Peinlichkeit aus, wie wir aus der neurophysiologischen Forschung über Spiegelneurone wissen (Bauer 2005). In einem Bereich, in dem es um »Geschichten« – persönliche Narrationen – geht, wird dies besonders deutlich. Das Schildern von Inhalten, die zum Teil ein Leben lang geheim gehalten wurden, ist für den Patienten in der Psychotherapie mit zum Teil intensivsten Schamgefühlen verbunden. In der Folge kann diese Scham auch den Psychotherapeuten ergreifen und anstecken, ohne dass ihm dies bewusst sein muss. Diese Art der »Gefühlsansteckung« durch Scham hat demnach eine besondere Relevanz in psychodynamischen Psychotherapien. Das subjektive Gefühl der Grenzenlosigkeit, das mit solchen Schamgefühlen verbunden ist, verweist auf den Zeitpunkt seiner genetischen Entstehung.
Deshalb sind Einfühlung und therapeutisches Taktgefühl das oberste Gebot, um dem Patienten erst einmal Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln, bevor es an die Aufarbeitung der tief vergrabenen Affekte und Konflikte geht, die oft genug schon als Defekte in der frühesten Entwicklung angelegt worden sind, wenn die Feinabstimmung etwa zwischen Mutter und Kind missglückt ist.
Da Schamgefühle und -konflikte dermaßen unsere Fähigkeit zu Lust, Freude und Sexualität hemmen und limitieren – die »vielleicht am meisten unterschätzte Kraft der Menschheitsgeschichte« (Briegleb 2009, S. 9) –, ist es erstaunlich, dass sich die Psychoanalyse nicht eingehender mit diesem Affekt beschäftigt hat. Besonders die Schamangst kann die Selbsterforschung und Selbstoffenbarung hemmen, von denen die Behandlung abhängig ist. Aus Scham leisten viele Patientinnen und Patienten Widerstand, weil sie sogar Vernichtung fürchten, wenn sie bisher uneingestandene Gefühle und Konflikte einräumen müssen. Jedoch ist die Scham in der Hinsicht nicht bloß als »Widerstand« zu verstehen, der aufgelöst werden muss, sondern als ein grundlegend bedeutsames Element, das bestimmt, wer jemand ist. Scham ist nicht einfach ein Hindernis auf dem Weg dahin, wer jemand sein möchte (»Idealitätsscham«).
Scham kann aber nicht nur als Widerstand in der Therapie auftauchen. Nach neuem psychoanalytischen Verständnis kann Scham als ein Zentralaffekt verstanden werden, von dessen Analyse aus sich viele Störungen neu erschließen und therapieren lassen.
Scham kann zurückgehen auf eine »Urscham«, die entsteht, wenn ein Kind unwillkommen, abgelehnt oder in seiner Existenz verachtet wird. Und Scham kann sich grundsätzlich auf andere Gefühle und Bedürfnisse ausdehnen, besonders auf Gefühle der Abhängigkeit in intimen Beziehungen.
Scham entsteht an der Grenze von Selbst und Anderem. Aber: Wessen Scham ist es dann eigentlich, könnte man zu Recht fragen. Kann ich mich schämen, ohne beschämt zu werden? Kann ich mich vor mir selbst schämen, ohne dass es einen Beschämenden oder wenigstens einen Zeugen gibt? Vielleicht ist Scham, so kann man postulieren, der ultimative »intersubjektive« und »relationale« Affekt, ein Produkt, aber auch ein Zeichen unserer tief verwurzelten Verstrickung mit unserer interpersonellen Umgebung, unser »unerträgliches Eingebettetsein des Seins« (Stolorow/Atwood 1992, S. 22), die uns unsere grundlegende soziale Natur immer wieder vor Augen führt. Das Thema der Scham bringt uns zum Verbindungspunkt zwischen Kultur und Individuum, Selbst und Anderem. Scham ist einerseits »sozialer Klebstoff«, der die kulturellen Standards und Ideale und deren Überschreitung anzeigt und überwacht, wird andererseits aber auch schnell zu einer unüberbrückbaren Trennung.
Es ist das Thema der Scham, mehr als jedes andere, das uns meines Erachtens mit dem konfrontiert, was Sozialkonstruktivisten und intersubjektiv orientierte Psychoanalytiker die intersubjektive Ableitung des Selbst nennen. Die Beschäftigung mit Scham sammelt unsere Gedanken in die von Donald W. Winnicott (1974) dargestellte Richtung, dass es nämlich so etwas wie ein Baby nicht gibt – ohne die mit ihm interagierende Mutter. Für Winnicott ist die Einheit der psychischen Entwicklung nicht das Kind allein, sondern eine intersubjektive Entität, die Mutter-Kind-Einheit. So stellt die intersubjektive Natur der Scham den Ausgangspunkt dafür dar, zu erforschen, wer wir für uns selbst sind und ob dieses Selbst Ablehnung oder Anerkennung von anderen Menschen erfährt.
Zur Entstehung psychoanalytischer Schamkonzepte
Freuds vier Schamauffassungen
Das zunächst Auffälligste an Freuds Beschäftigung mit der Scham ist die theoretische Inkonsistenz, mit der er diesen Affekt zu konzeptualisieren versucht. Er hat in diesem Sinne auch keineTheorieder Scham vorgelegt, vielmehr stehen in seiner strukturellen und triebtheoretischen Auffassung die Schuld, Angst und der Ödipus-Komplex im Zentrum. Dieses grundsätzliche Fehlen eines Interesses an der Scham als für die Psychodynamik des Individuums relevanten Affekts hat sicherlich unterschiedlichste theoretische und persönliche Beweggründe, um die es unten kurz gehen soll.
Nichtsdestotrotz hat Sigmund Freud über Scham geschrieben. Er versteht Scham zunächst als ein Motiv für Abwehr, also als eine affektive Erfahrung, die die Furcht beinhaltet, abstoßende Geheimnisse einem beobachtenden Publikum zu offenbaren. Gleichzeitig verbindet er Scham mit Moralität und Ekel und sieht sie als Grund für die Verdrängung der Sexualität, das heißt als Funktion der Abwehr. Zusammen mit Josef Breuer (Freud 1895) hat Freud den Begriff der Verdrängung als umfassenden Begriff der Abwehr konzeptualisiert, die dagegen gerichtet ist, dass bestimmte unlustvolle Affekte, so auch Scham, ins Bewusstsein dringen. Diese Abwehr ist somit gegen das Bewusstsein gerichtet, der Schmerz ist ein solcher, der mit der Erwartung einer Ablehnung und Bewertung von anderen verbunden ist, eine Ablehnung, die als Selbstkritik verinnerlicht wird.
Es scheint, dass die affektive Erfahrung und die Abwehr in Freuds Denken untrennbar miteinander verknüpft sind. Diese Sicht der Scham als interpersonalem Affekt, der mit der Erfahrung des Beobachtetwerdens zu tun hat, wird von ihm jedoch nur in seinen Briefen an Wilhelm Fließ (1893) und in der Traumdeutung (1900) am Rande erwähnt. Diese Bestimmung findet nie den Weg zu einer von Freud ausgearbeiteten Theorie der Scham.
In einem weiteren Brief an seinen Freund Fließ aus dem Jahre 1896 liefert Freud die theoretische Vorarbeit zum Thema der Abwehrneurosen. Freud sieht hierin Scham zunächst in Verbindung mit der Sauberkeitserziehung. In einer Passage schreibt er, »daß Scham und Moralität die verdrängenden Kräfte sind und daß die natürliche Nachbarschaft der Sexualorgane unfehlbar beim Sexualerlebnis auch Ekel wecken muß« (Freud 1896/1999, S. 179). In diesem Abschnitt betrachtet Freud Ekel neben der Scham und der Moral als eine Kraft, die sich der Abfuhr der Libido in den Weg stellt. Freud benutzt dabei die Begriffe Scham, Ekel und Moralität stets gemeinsam und beschreibt Scham und Ekel als eine Art Damm gegen das instinkthafte Leben. Nach Freud ist Scham phylogenetisch und ontogenetisch reaktiv, hemmend und verbietend, dem Lustprinzip entgegengestellt und führt dazu, dass man sich selbst bestimmte (natürliche) Verhaltensweisen verbietet. Die ursprüngliche Natur des Menschen ist in seiner Sichtweise »schamlos« (oder besser »schamfrei«). »Diese der Scham entbehrende Kindheit«, so Freud im Jahre 1900, »erscheint unserer Rückschau später als Paradies, und das Paradies selbst ist nichts anderes als die Massenphantasie von der Kindheit des einzelnen« (ebd., S. 250).
Die Bemerkungen über den sozialen Kontext der Scham, die Freud in diesem Brief an Fließ andeutet, aber kaum weiterverfolgt hat, tauchen im Wesentlichen in der Traumdeutung aus dem Jahre 1900 wieder auf. Verstreut finden sich hier Hinweise auf den interpersonalen, sozialen Kontext der Scham. Freud stellt fest, dass Scham ursprünglich nicht ohne die Anwesenheit eines beschämenden Erwachsenen denkbar ist. Er schreibt: »Ein Selbstvorwurf wird zu Scham, wenn ein anderer ihn zufällig mithört« (ebd., S. 274). Anhand von Verlegenheitsträumen der Nacktheit verweist Freud in der Traumdeutung auf die Rolle, die der Wechsel vom Privaten zum Öffentlichen in der Scham spielt. In diesen Nacktheitsträumen, die er »Exhibitionsträume« nennt, taucht Scham dann auf, wenn etwas, das der Einzelne als zu seiner Intimsphäre gehörend betrachtet, an die Öffentlichkeit kommt: »Die Leute, vor denen man sich schämt, sind fast immer Fremde mit unbestimmt gelassenen Gesichtern« (ebd., S. 248).
Anhand der Beschreibung einer eigenen Kindheitserinnerung verdeutlicht Freud, wie er selbst mit der eigenen kindlichen Scham zurechtkam: »Nun ist mir folgende Szene aus meinem Kinderleben erzählt worden […]. Ich soll – im Alter von zwei Jahren – noch gelegentlich das Bett naß gemacht haben, und als ich dafür Vorwürfe zu hören bekam, den Vater durch das Versprechen getröstet haben, daß ich ihm in N. (der nächsten größeren Stadt) ein neues, schönes rotes Bett kaufen werde« (1900, S. 221). Der französische Analytiker Serge Tisseron (2000) kommentiert diese Szene dahingehend, dass der junge Freud tatsächlich weniger Angst vor der eigenen Scham empfunden haben muss als vor jener Scham, die seine Eltern seinetwegen empfunden haben könnten. Freud möchte seinen Eltern diese Verlegenheit und Scham ersparen.
Anhand dieser Episode verdeutlicht sich das grundlegende Versäumnis Freuds, dieses Beispiel zu einer Theorie der Scham auszuarbeiten. Freud begnügte sich stattdessen mit dem Hinweis auf den »kindlichen Größenwahn«, der bei dem Versprechen, ein neues Bett zu kaufen, durchscheine, sowie auf den intimen Zusammenhang zwischen Bettnässen und dem Charakterzug des Ehrgeizes.
Freud hat in den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) Scham, ebenso wie Schüchternheit, als Reaktionsbildung auf exhibitionistische und voyeuristische Wünsche interpretiert und nicht etwa Ehrgeiz als Reaktionsbildung auf Scham, eine Interpretation, die diese Anekdote ebenso zulässt. In dieser zentralen Arbeit beschreibt Freud Scham als »Macht, welche der Schaulust entgegensteht« (S. 56). Er definiert diesen Affekt als Reaktionsbildung im Dienste der Verdrängung – ein Gedanke, den er schon in seinen früheren Arbeiten verfolgt hat. Die Verdrängung richte sich gegen die exhibitionistischen und voyeuristischen Partialtriebe.
In denDrei Abhandlungen zur Sexualtheoriebewegt sich Freud eindeutig weg von der Sicht der Scham als einer affektiven Antwort darauf, gesehen zu werden, hin zu einer Theorie der Scham als Abwehr gegen (Partial-)Triebe. Er beginnt damit, ein Modell der Psyche zu entwerfen, das Angst und Schuld eine hervorragende Bedeutung beimisst. Freud bestimmt, in dieser Phase seines Schreibens, Scham als Affektundals Abwehr. Von seinen früheren Werken ausgehend, in denen er sie alsMotivfür Abwehr, als Vermeidung des Schamaffekts sah, bewegt er sich immer mehr dahin, sie zusätzlich alsMethodeder Abwehr zu verstehen – als Affekt, der der instinkthaften »Schamlosigkeit« entgegensteht und uns auf einen ethischen und zivilisierten Weg bringt.
Nach der Erwähnung der Scham in den frühen Formulierungen in Zusammenhang mit Konflikten und deren Abwehr kommt es in Sigmund Freuds Werk zu einer abrupten Vernachlässigung der Scham, nachdem er den Fokus auf die intrapsychischen Fantasien gelenkt hat. Freud hat nach diesem Fokuswechsel die Natur der Scham und Schamkonflikte einseitig konzeptualisiert und sich fast ausschließlich auf Konflikte bezogen, die sich um den Partialtrieb des Exhibitionismus drehen. Nach besagter Arbeit aus dem Jahr 1905 taucht das Thema der Scham tatsächlich für fast ein Jahrzehnt nicht mehr in den Schriften Freuds auf. Im Jahr 1914 streift Freud die Scham in seiner wichtigen Arbeit Zur Einführung des Narzissmus nur indirekt, indem er das Konzept des Ich-Ideals im Zusammenhang mit dem Narzissmus einführt. Er erwähnt nur am Rande, dass Scham und Schüchternheit Gefühle seien, derer man sich entledigen müsse, die »durchgearbeitet werden müssen«, wenn die Analyse fruchtbar sein soll.
Der Zusammenhang zwischen Scham und Narzissmus wird von Freud weder hier noch in seinen späteren Arbeiten explizit erwähnt. Erst in jüngster Zeit wurde diese Verbindung von Autoren wie Léon Wurmser (1990) und Andrew P. Morrison (1989) aufgenommen und speziell von Letztgenanntem ins theoretische Zentrum seiner Konzipierung der Scham gestellt. Nach 1914 ignorierte Freud Scham fast gänzlich, sie taucht nur selten auf, und wenn, dann am Rande.
Mit der Einführung der Strukturtheorie in Das Ich und das Es (1923) schreibt Freud die Kraft, die dafür sorgt, dass der Geschlechtstrieb das normale Maß nicht überschreitet, einer unabhängigen Instanz zu, die er »Über-Ich« nennt. Diese Instanz, die zum Teil unbewusst ist, verbindet das moralische Gewissen, die Selbstbeobachtung und die Idealbildung. Neben der Moral, der Traumzensur und der Verdrängung umfasst das Über-Ich auch das »Ich-Ideal«. Durch das Ich-Ideal ist die Scham mit dem Über-Ich verbunden. Von dieser Hypothese weicht Freud nicht mehr ab, und auch zeitgenössische psychoanalytische Theorien über Scham stellen diesen Aspekt in den Vordergrund.
Die letzten beiden Erwähnungen des Schamaffekts in Freuds Werk stammen aus den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts. Er schreibt in Das Unbehagen in der Kultur (1930) in einer Fußnote, dass Scham beim Menschen entstanden sei, als er den aufrechten Gang angenommen habe, »der nun die bisher gedeckten Genitalien sichtbar und schutzbedürftig macht und so das Schämen hervorruft« (S. 459). Mit dem aufrechten Gang und der damit einhergehenden stärkeren Sichtbarkeit der Genitalien sei auch eine Veränderung der sexuellen Stimulation von einer eher olfaktorischen hin zu einer betont visuellen Stimulation verbunden. Daraus folgert Freud, dass Konflikte des Exhibitionismus, also des Sehens und Gesehenwerdens, phylogenetisch bedeutsamer wurden. Diese Sicht steht in klarem Widerspruch zu seiner früheren Auffassung der Scham als Hemmung gegen instinkthafte Gratifikationen. Im Jahr 1933 bringt Freud die Scham nicht so sehr mit dem Bedürfnis, sich zu verstecken und die Genitalien zu schützen, in Zusammenhang, als vielmehr mit dem Wunsch, ein genitales Defizit zu verbergen. Scham kennzeichnet er hier als »exquisit weibliche Eigenschaft«, ihre »ursprüngliche Absicht« sei, »den Defekt des Genitals zu verdecken« (S. 142).
Zusammenfassend lassen sich vier Auffassungen von Freud gegenüber der Scham ausmachen. In seinen frühen Arbeiten bestimmt Freud die Scham:
eindeutig als Affekt innerhalb eines sozialen Kontextes und setzt sie mit der Angst vor Bewertung gleich,als ein Motiv für Abwehr, das heißt als affektive Erfahrung,als eine Methode der Abwehr, als Reaktionsbildung im Dienste der Verdrängung sowiein Verbindung zum Narzissmus und zu Idealen.Diese Ambiguität (Scham als Affekt, als Motiv und Methode der Abwehr, als Symptom) zieht sich durch Freuds Werk und findet sich auch bei den meisten Autorinnen und Autoren, die sich nach ihm mit dem Thema der Scham befasst haben. Angefangen mit Freuds Unterscheidung von »sozialer Angst« (Scham) und »moralischer Angst« (Schuld) haben die meisten Autoren in seiner Folge eine psychodynamisch-triebtheoretische und strukturell-konflikthafte Differenzierung dieser Affekte vorgenommen.
Wir können also festhalten, dass Freud keine konsistente Theorie der Scham entwickelt hat. Grundsätzlich ist seine Einstellung diesem Affekt gegenüber eine ablehnende. Scham sieht er als Hauptmotiv dafür an, die Verdrängung und den Widerstand in den psychoanalytischen Prozess zu bringen, somit sich der Einsicht in die sexuelle Dynamik entgegenzustellen, die den unterschiedlichen Neurosen zugrunde liegen. Freud hat sich nur in seinen ersten großen Arbeiten mit dem Schamaffekt beschäftigt. Das Problem der Schuld ist für ihn – und damit auch für die ganze spätere Psychoanalyse – von größerer Bedeutung.
Angst wurde in der Folge zum »historischen Prototyp« von Affektzuständen erklärt (Altmeyer 2008), gewissermaßen zum »Superaffekt« (Hilgers 2006). Die psychoanalytische Literatur hat sich demnach zwar mit Angst, Depression und Schuld beschäftigt, die Triebe blieben jedoch immer ihr Mittelpunkt. Auch in der Zeit nach Freud wurde zwar viel über spezifische Affekte geschrieben, in der Regel waren diese Ausführungen jedoch nicht in eine umfassende Theorie der Affekte eingebettet.
Vor diesem Hintergrund der generellen Vernachlässigung der Affekte erscheint es nicht mehr verwunderlich, dass Freud auch der Scham keine besondere Bedeutung beigemessen hat. Insgesamt versteht Freud die Scham als eine Reaktionsbildung gegen den Partialtrieb der Schaulust. Er bleibt bei seinem Verständnis dieses Affekts im Rahmen der von ihm konzipierten Triebtheorie. Aufgrund der sehr widersprüchlichen Aussagen Freuds über die Natur der Scham kommt Serge Tisseron (2000) zu dem Schluss, dass heutzutage »den Psychoanalytikern immer noch das theoretische Rüstzeug für die Auseinandersetzung mit Schamsituationen zu fehlen scheint« (S. 9).
Freuds »blinder Schamfleck«
Sigmund Freud maß der Scham weder in den theoretischen Schriften noch bei der psychoanalytischen Behandlung eine explizite Bedeutung bei und konzentrierte sich stattdessen auf Schuldgefühle und -konflikte. Wie Till Bastian (1998) feststellt, wurden die Gefühle, mit denen sich der Kliniker Freud tagtäglich in seinen Behandlungen auseinandergesetzt hat, bei der Theoriebildung seltsamerweise vernachlässigt. Dies ist verwunderlich aufgrund der Tatsache, dass Freud sich bei seiner Behandlung von neurotischen Störungen stark auf den Aspekt der Sexualität und deren Verdrängung bei der Hysterie konzentrierte und sich somit schon thematisch zwangsläufig in die Nähe des Schamerlebens bewegte. Das Aussprechen sexueller Fantasien, die sich auch auf den Analytiker beziehen, muss man sich in der analytischen Behandlung als eine sowohl für die Patienten als auch für die Analytiker potenziell peinliche und beschämende Situation vorstellen. Dies wird jedoch in Freuds Behandlungsprotokollen nicht ersichtlich. Sein früher Behandlungsstil erscheint, besonders im legendären Fall Dora (Freud 1905) als ein tendenziell direktiver, »überführender« und sogar potenziell beschämender.
Einige psychoanalytische Autoren haben darauf hingewiesen, dass Freud bezüglich des Schamaffekts nicht nur einen theoretischen, sondern vor allem einen persönlichen »blinden Fleck« gehabt hat. Theoretisch ist dieser blinde Fleck sicherlich vordergründig damit zu erklären, dass Freud Schuld als »reiferes« und »edleres« Gefühl verstand und damit ins Zentrum seiner Theorie stellte. Scham wurde entwicklungsgeschichtlich als ein »primitiverer« Affekt, als Produkt eines oralen Bedürfnisses und eines analen Scheiterns angesehen – im Gegensatz zu den ödipalen, »höheren« Wünschen und Fantasien. Nach heutiger affekttheoretischer Sichtweise ist dies nicht korrekt, denn Scham und Schuld tauchen entwicklungspsychologisch etwa zur selben Zeit auf.
Es war für die frühen Analytiker sicherer und leichter, sich mit den schuldbelasteten Impulsen statt mit einem »sich-schämenden Selbst« zu befassen. Beide Affekte spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Gewissens. Ein Grund für die Nicht-Beachtung der Scham ergäbe sich daher aufgrund der fehlenden Sprache über diesen Affekt – solange es in der Psychoanalyse keine »Sprache für das Selbst« gab, konnte auch der Affekt, der dem Selbst am nächsten steht, die Scham, nicht angemessen konzeptualisiert werden. Zudem gibt es ein gewisses Ausmaß an Scham über die Scham an sich, die sie der Betrachtung entzieht. Wie Micha Hilgers (2006) zu Recht betont, entspricht die auffällige Nicht-Beachtung der Scham in der Psychoanalyse auch ihrem Charakter selbst, denn der ansteckende und gleichzeitig versteckende Charakter der Scham führt schnell zu einem Übersehen in der Gegenübertragung.
Die Nähe der Scham zum Narzissmus und zum »Minderwertigkeitsgefühl« – und damit auch zu den von Alfred Adler in die Psychoanalyse eingebrachten Begrifflichkeiten – sieht Andrew P. Morrison (1989) als weitere theoretische Erklärung dafür an, weshalb Freud der Scham nicht die gebührende Aufmerksamkeit zollte. Adler hingegen bezeichnet die Grundspannung zur Identitäts- und Autonomieentwicklung zwar nicht explizit als Scham, aber die von ihm beschriebenen »Inferioritätsgefühle« zielen eindeutig auf diesen Affekt ab.