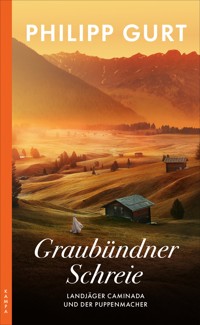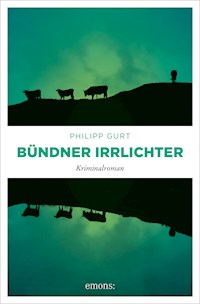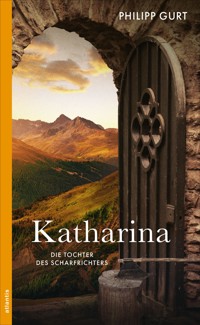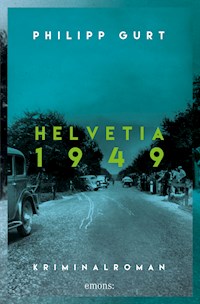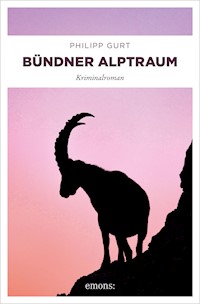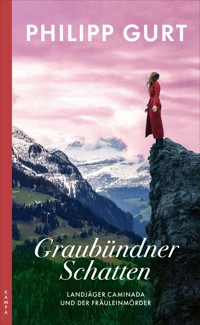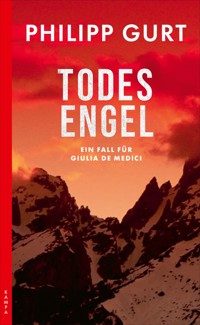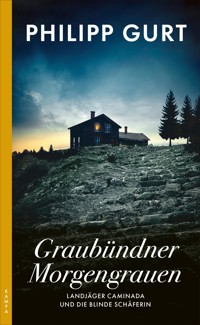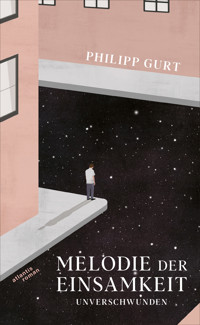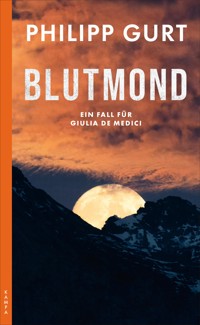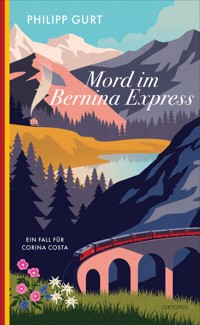11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als siebtes von acht Kindern einer finanziell benachteiligten Bergdorffamilie wurde Philipp Gurt in Graubünden in der Schweiz geboren. 1972 wurden alle acht Kinder voneinander getrennt. In den folgenden zwölf Jahren durchlebte Gurt neben der Einweisung in verschiedene Kinderheime unter anderem Zwangspsychiatrie, Beugehaft, sexuellen Missbrauch durch Erzieherinnen und rohe Gewalt. Detailliert und bewegend schildert der Autor seine schweren Schicksalsjahre, anschaulich beschreibt er seine Strategien, die er sich früh aneignen musste, um das Unfassbare zu überleben. Doch wo Schatten war, fand er auch Licht! So schreibt Philipp Gurt auch davon, wie er in seiner zerstörten Welt immer wieder Momente des Glücks gesucht und gefunden hat, sodass er nie die Hoffnung und sein Lachen verlor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
»Schreiben war für mich immer auch eine Überlebensstrategie – ein Ventil, auszudrücken, was in meinem Innersten vorgeht.«
Philipp Gurt
Autor
Philipp Gurt wurde 1968 als siebtes von acht Kindern geborgen. Er wuchs in verschiedenen Kinderheimen und Institutionen auf. Bereits als Jugendlicher schrieb er Texte und Kurzgeschichten. Mit 17 begann er intensiver zu schreiben, mit 20 beendete er seinen ersten Roman. Bis heute wurden zehn seiner Bücher veröffentlicht, darunter auch zwei Biografien berühmter Persönlichkeiten. Philipp Gurt lebt und arbeitet heute als Schriftsteller in Chur-Haldenstein im Schweizer Kanton Graubünden.
Philipp Gurt
Schattenkind
Wie ich als Kind überlebt habe
Autobiografie
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Aus Gründen der Authentizität haben wir uns entschlossen, das Schwyzerdütsch des Originals auch in der E-Book-Ausgabe beizubehalten.
Ausgabe August 2018
Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2017 by Judith Gurt-Krone
Lektorat: Karin Dobler Mayerhofer und Undine Materni
Korrektorat: Dr. Christina Grund
Qualitätskontrolle: Annemarie Grunholzer
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, in Anlehnung an die Gestaltung der HC-Ausgabe (www.deruhlig.com)
DF · Herstellung: kw
ISBN 978-3-641-22141-6V004
www.goldmann-verlag.de
Fürmeine sieben Geschwister: Mary, Irma, Claudia, Rädel, Yvonne, Charly, Maja und meinen Papa Konrad
In Erinnerung an:
Tschattis, Keck, Pingesser, Nesa, Nicole und die über zwanzig Freunde und Weggefährten, die leider nicht überlebt haben.
Tschattis – auch wenn du deine Hölle im letzten Moment nicht überlebt hast, du warst und bleibst ein wahrer Freund. »Thänks män forever!« Unser Tattoo wird mich bis zu meinem Tod begleiten – wie auch unsere Verbundenheit mit der Natur.
Ich vermisse dich noch immer, mein Blutsbruder!
»I wett so gära nu as klisas Blüamli si. Zmitzt innara einsama Wiesa zwachsa, vum warma Wind kstraichlat zwärde, um im Obigliacht friedlich zverblüah, als hetts mi gär nia geh … doch d’Monschter löhnt das nit zua!«
Waisenhaus Chur, 1978
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
als ich den Entschluss fasste, meine Biografie zu schreiben, war mir Folgendes sofort bewusst:
Erstens: Es wird Monate dauern, all die Dokumente, Beweismittel und Fotos aufzutreiben und zu sichten. Ich schätze, es werden gegen tausend Seiten sein, die ich zusammentragen muss. Ausserdem habe ich einige Personen, insbesondere Täterinnen und Täter, zu befragen, die alles andere als erfreut sein werden, dass ich dieses Buch schreibe. Von diesen auf heikle Fragen Antworten zu erhalten, wird schwierig werden – aber nicht unmöglich.
Zweitens: Es wird für mich herausfordernd sein, mich literarisch allem zu stellen, meinen Weg vom Kleinkind bis zum Heimaustritt nochmals Schritt für Schritt zu gehen und all die damit verbundenen Orte persönlich aufzusuchen. Mir hilft dabei, dass ich weder Hass noch Wut in mir trage, dafür ein grosses, wenn auch verwundetes Kämpferherz.
Ich weiss, dass in der Vergangenheit neben den Höllen mit den Monstern auch unglaublich schöne, lichtdurchflutete Erlebnisse auf mich warten. Ungeachtet der schlimmsten Umstände habe ich immer wieder getanzt, wie ein Blatt im stürmischen Herbstwind. Darauf habe ich als Kind und Jugendlicher stets meinen Fokus gelegt, um zu überleben, damit die tägliche Hoffnungslosigkeit, das hässliche Gefühl der Verlorenheit und die schwarze Angst mich nicht völlig zerstören konnten.
Dass Sie, liebe Leser, in diesem Buch gemeinsam mit mir den langen Weg gehen wollen, dafür meinen Respekt und Dank!
Philipp Gurt – Chur, 11. September 2015
Hallo Welt!
Wie wichtig ist es, herauszufinden, unter welchen Begleitumständen die eigene Zeugung stattgefunden hat? Muss man es überhaupt wissen? Reicht es nicht, dass ich weiss, an einem Dienstag im Januar 1968 im Kreuzspital in Chur geboren worden zu sein? Dass es eiskalt war und kein Sonnenstrahl durch die dicken Winterwolken drang?
Ich glaube nicht, dass sich jemand gerne vorstellt, wie die Eltern Es getan haben. Es geht auch nicht um das Wie, sondern um die Umstände. Meine Zeugung war bestimmt alles andere als romantisch. Ausserdem war ich als siebtes Kind bestimmt nicht das Wunschkind einer erst 29-jährigen Mutter, die uns, drei Jahre nach der achten Geburt, alle verlassen hatte, als wäre sie bloss irgendeine Postbotin gewesen, der eine andere Tour zugeteilt worden war.
1968 war die Zerrüttung in unserer Familie bereits weit fortgeschritten. Natürlich ist zu bedenken, dass damals in den späten 60er Jahren das Rollenbild einer Familie durch andere Werte geprägt war als heute.
In den kleinen trutzigen Dörfern, die sich in engen Tälern an die Bergflanken krallten, als drohten sie sonst mit dem Bach ins Tobel zu stürzen, war die Wunschliste möglicher Partner für niemanden lang. Die kleinen Dörfer bildeten eine eigene Welt mit vielen ungeschriebenen Gesetzen. Seilschaften wurden gesucht und gepflegt, Fehden geschürt und ausgetragen, Geheimnisse sorgsam bewahrt oder gezielt gelüftet. In den gutbürgerlichen, verrauchten Beizen, in denen tiefgebräunte, bärtige Bergler das frischgezapfte Calanda Bräu hinunterkippten, machten viele Geschichten die Runde. Ländler oder Schlager ertönten aus alten Jukeboxen. Einmal im Monat spielte eine kleine Formation aus dem Tal auf. Samstags wurden dann die Tische zur Seite gestellt, um Platz für Tanzende zu schaffen. Lachen und Prahlereien durchbrachen den Lärmpegel, der sich nur leicht senkte, wenn die alte Eingangstür von einem neuen Gast geöffnet wurde. Ein scharfer Jass wurde im Stumpenqualm geklopft und an einem Nebentisch mutmasste man, warum das Vieh vom Hassler krank war. Vielleicht war es eine gerechte Strafe, weil er mit dem jungen Hemmi aus Trimmis im Tal gewildert hatte und natürlich wie immer log, als der Landjäger1 Casotti ihn dazu befragte. Doch alle wussten, dass er es war – nicht nur diejenigen, bei denen es bereits Anfang des Sommers am Sonntag Rehpfeffer gab.
»Kumm zahl miar no ais«, hörte man den Hassler dem Landjäger Casotti spöttisch zurufen, als der sich aufmachte, die Beiz zu verlassen.
»Wird nit zfrech, Hassler, as Hirschli het miar geschtar öppis im Wolfsboda hina kflüschtarat. Miar redand denn schu no zämma uf am Poschta – warts nu ab!« Schallendes Gelächter folgte dieser Drohung.
Es war die Zeit, in welcher die Serviertochter bis zu ihrem Schichtende mindestens vier Klapse auf ihren Hintern bekam und den einen oder anderen Busengrabscher pro Woche mehr oder weniger erfolgreich abwehren konnte. Und immer mal kippte einer der Gäste volltrunken vom Stuhl. Im Streit fuhr so manche Faust wütend auf den Tisch oder ins Gesicht des Gegenübers. So ein Schpunta war das Restaurant Strela in Maladers – die Beiz, in der auch mein Papa oft zu finden war.
In solchen Dörfern war damals kein Platz für Feinfühlige. Träume hingen wie Papierdrachen festgebunden im Himmel, was aber nicht hiess, dass junge Mädchen sich nie nach einem anderen, einem besseren Leben sehnten.
Der Winter im Jahr meiner Geburt hatte die Alpen zeitig eingeschneit. Doch der vergangene Bergsommer war herrlich gewesen – der Alpkäse hervorragend. Das Essen war einfach, aber deftig: Speck, Würste und Käse aus dem Tal. Älplermakkaroni mit viel Käse, Butter und gebratenen Zwiebeln gaben Kraft, ebenso die hausgemachte Gerstensuppe. Es gab keine Alp, auf der nicht mit urigen Klängen aufgespielt wurde, keine Beiz ohne eine Rauferei – und keinen Tag ohne Gerede im Dorf.
Gewisse Behördenmitglieder von Maladers wussten damals die Fähigkeiten einiger Einwohner zu nutzen und kamen so günstig an wertvolle Kupferkessel und andere Antiquitäten, die im Museum in Sapün kurz zuvor entwendet worden waren. Eine Hand wusch die andere, solange ein Vorteil daraus gezogen werden konnte.
In so einem Dorf wurde ich gezeugt. In Maladers – oder genauer gesagt im Vagantenvorort2 von Maladers – in Sax. So steht es in den Behördenakten. Sax lag direkt oberhalb der schmalen Durchgangsstrasse im steilen Hang und bestand damals wie heute aus nur wenigen Häusern. Darüber erstreckten sich der Berg und unterhalb der Strasse ein Wald, der weit hinunter ins steile Tobel reichte.
Maladers 1972, Sax wäre etwas rechts ausserhalb des Bildes.
Sax-Maladers – Februar 2016 Unten ganz links sieht man ein wenig von unserem Stall.
Vielleicht wurde ich auch im Frühling im Wolfsboden, der First oder im Steiner, der Alp im Strassberg, gezeugt – allesamt wären schöne Ort gewesen.
FAMILIENBANDE
1966 – Alpsommer auf der First Papa hält Charly im Arm, Mary mit dem Holzstecken, Mamma mit Yvonne, Rädel, Irma und Claudia. Maja und ich kommen eineinhalb respektive zweieinhalb Jahre später zur Welt.
Als dreizehn Monate nach mir meine jüngste Schwester Maja zur Welt kam, lebten wir zu zehnt in den zwei kleinen Räumen im beengenden Holzhaus. Wir schliefen in vier Betten. Sanitäre Anlagen hatte es keine, dafür vor dem kleinen Stall ein Holzkabäuschen mit einem eingegrabenen Loch. Im unteren der beiden Stockwerke wohnte meine Nana3 väterlicherseits, Antonietta Rizzi, eine gebürtige Engadinerin aus La Punt-Chamues-ch. Ihr Mann, mein Neni4 Stefan Gurt, war bereits 1960 gestorben.
1962 – vor unserem Stall Nana Antonietta mit Rädel, Claudia, Mutter mit Yvonne
Nana und Neni: Antonietta und Stefan Gurt-Rizzi Das einzige Bild von unserem Haus in Maladers-Sax.
Zu unserer Familie zitiere ich5 aus den Akten der Vormundschaftsbehörde Arosa/Schanfigg und der Psychiatrischen Klinik Waldhaus in Chur vom 26.03.1973:
Am 09.01.1968 wurde Philipp als zweitjüngstes von acht Kindern (alle debil, teilweise imbezill6) in Maladers bei Chur in eine sozial sehr benachteiligte bis verwahrloste Familie jenischer7Abstammung geboren … sie bewohnten in Sax-Maladers eine miserable, baufällige Hütte …
Mutter Maria heiratete mit 18 Jahren gegen den Willen der Behörden Konrad Gurt, Jg. 1930, von Maladers. Sie ist eine debile, triebhafte, verstimmbare Psychopathin mit pseudologischen, hysterischen Zügen: Vagantentemperament. Ist schon wiederholt mit anderen Männern durchgebrannt, seit 12. Juli 1972 verschwunden, liess alle Kinder im Stich, wahrscheinlich nun im Ausland. Durchgebrannt mit einem gewissen Sepp Sablonier.
Der Vater von Maria Gurt: Karl Mehli, 1909, von Arvigo (Familie Mehli zwangseingebürgert 1887 in Arvigo, andere Zweige zwangseingebürgert in Maladers) lebt in Sax-Maladers, trinkt landesüblich, sozial untüchtig, Fabrikarbeiter, Biertrinker, klein und fest, wohl etwas untüchtig und debil.
Die Mutter: Barbara geb. Buschauer, 1913, von Molinis, aufgewachsen in Maladers, lebt in Sax-Maladers, früher kleine Landwirtschaft; kleine feste, schimpferische Frau, früher Serviertochter, debil, am Telephon geschwätzig. Der Grossvater Johann Buschauer, 1889–1964, lebte in Molinis, Malans und Landquart, Hilfsarbeiter, Trinker, in 2. Ehe verheiratet mit Anna Führer, verwitwet. Der Urgrossvater Josef Buschauer, 1864–1950, starb in Realta, war 3 x verheiratet. Die Grossmutter: Barbara Gurt, 1890–1932, Schneiderin, aufgeregte Frau, lebte früher in Sax-Maladers; verstarb an Pneumonie. DerenVater Josef Gurt 1851–1936, verheiratet mit Barbara Hossmann, 1857–1930, 11 Kinder. Diese Grossmutter Barbara Gurt hatte also 10 Geschwister, davon sind viele in der Nervenheilanstalt Waldhaus bekannt: z. B. Therese Schocher-Crurt, 1896–1966, Nr. 12’924 … siehe vor allem die Nachkommen Cazin, Moser und Gurt. Der Vater der Urgrossmutter Barbara Gurt-Hossmann hiess Philipp Jakob Hossmann, verheiratet mit Maria Barbara Vanconi …
Der Grossvater Johann Mehli, Waldarbeiter und Bauhandlanger, Sax-Maladers, 1879 – ca. 1936. Die Grossmutter Barbara geb. Scherrer, von Selma, Vagantin, ca. 1875–1941. Ein Bruder des Grossvaters, Josef Mehli, 1864–1947, war verheiratet mit Marie Scherrer, 1882–1955 (verstorben in der Psychiatrischen Klinik Beverin). Nachkommen dieses Johann Mehli in der Nervenheilanstalt Waldhaus bekannt. Besonders schwer belastet ist aber die Grossmutter Scherrer: Bekanntes Vagantengeschlecht aus Selma. Der Urgrossvater Scherrer, vermutlich: Ferdinand Scherrer (verheiratet mit Carolina Gruber, von Surcuolm, zahlreiche Nachkommen im Waldhaus bekannt. Weitere Geschwister der Grossmutter, Anna Stoffel Scherrer, 1876–1942, Trinkerin, Vagantin, in der Klinik Beverin verstorben. Meinrad Scherrer-Moser, 1875–1958, debiler Trinker, in der Strafanstalt Realta verstorben (verschiedene Nachkommen im Waldhaus bekannt). Von den Nachkommen der erwähnten Maria Mehli-Scherrer, 1879–1955, ist Josef Mehli-Holzer zu erwähnen, 1906 (KG der Frau: Nr. 11670) und ein Enkel Karl Mehli). Ein Muttersbruder Johann, 1916, erethischer Imbeziller war im Waldhaus, Nr. 6’123, seither dauernd in der Psychiatrischen Klinik Beverin. Der Muttersbruder Peter Buschauer, 151U, war im Waldhaus: Chron. Alkoholismus, arbeitsscheu, bevormundet, Nr. 14’951. Seine erste Frau war Hedwig Gruber, 1923, von Sta. Domaniga, eine Dirne, aus dieser Ehe gingen 5 Kinder hervor, die aber z. T. nicht von Buschauer stammen. z. B. so Peter Buschauer, 1941, Nr. 10811, Josef Andreas Buschauer, 1943, Nr. 11 ’734 und Rene Buschauer, 1945, debil im Beverin. Die zweite Frau des Peters Buschauers, Rosa Lutz 1919, lebte in Reichenau, Peter trinkte weiter, schafft nichts. Der Muttersbruder: Christian Buschauer, 1926, imbezill, schibieren, war im im Waldhaus, Nr. 8567, habe Epianfälle, dauernd im Beverin untergebracht.
Vater von Philipp Gurt: Konrad Gurt von Maladers: Hilfsarbeiter, debiler Psychopath, Lese-Schreibschwäche, chronischer Alkoholismus, seit 1953 zwei Mal in der Nervenheilanstalt Waldhaus, zuletzt im November 1971. Akten-Nr. 15’983, Der Mann ist Sohn des Stefan Gurt, 1891–1960, Trinker, Hilfsarbeiter, lebte in Sax-Maladers, zwei Mal im Waldhaus. Akten Nr. 7611, dann in der Strafanstalt Realta, bevormundet. Die Mutter von Konrad Gurt war Antonietta Rizzi, 1893–1972, aus Italien stammend. Debile, vagantenhafte Frau, zeitweise depressiv, im Alter dement geworden. Konrad Gurt und seine Frau Maria sind blutsverwand: Sein Urgrossvater Josef Johann Gurt-Hossmann, 1824–1899 (er war im Waldhaus, Aktennummer 936) ist gleichzeitig der Ur-Urgrossvater seiner Ehefrau.
Aus der Ehe von Konrad Gurt und Maria Mehli gingen acht Kinder hervor:
Maria, 1957, Linkshänderin, Werkschule in Chur, zurzeit im Waisenhaus. Besucht eine Gewerbeschule, könne lesen und schreiben.Irma, 1958, Primarschülerin, imbezill. Jetzt in Schule Chur Masans, aber untergebracht im Mädchenheim Masans. Meningitis mit 2½ Jahren. Soll aber etwas schreiben können, wahrscheinlich stark debil.Claudia, 1960, früher Primarschule Maladers, stark debil. Mädchenheim Chur-Masans untergebracht.Konrad 1962, war Primarschüler, jetzt im Waisenhaus Chur untergebracht. Legasthenie.8Yvonne, 1963 war Primarschülerin, stark debil, Legasthenie, im Mädchenheim Chur-Masans untergebracht.Karl 1964, früher blutarm, hatte Ohnmachten. Jetzt Waisenhaus Chur. Soll die Privatschule besuchen.9Philipp, 1968, geistig zurückgeblieben, früher blutarm, jetzt St. Josefheim in Chur.Maja 1969, debil. Finger zusammengewachsen. Befindet sich im Waisenhaus Chur.Wäre es nach den Behörden von damals gegangen, gäbe es überhaupt keine Familie Gurt-Mehli. Aufgrund der Erbanlagen meiner Eltern, sprich des Stammbaumes, wollten sie keine Genträger von ihnen in dieser Welt haben. Deshalb drängten die Behörden im November 1955 meinen damals erst 25-jährigen Papa zur Sterilisation. Aus eugenischen Gründen, wie es hiess!
Mein Papa ist derjenige in der Mitte, mit gefalteten Händen. Diese ruhige Sitzhaltung war typisch für ihn. Rechts Öhi Steffi, mein Onkel.
Als zusätzliches Druckmittel blockierten sie ihm die Heirat mit meiner Mutter, obschon beide damals noch nicht bevormundet waren. Gleichzeitig versuchten sie, die Bevormundung mit allen Mitteln durchzudrücken. Sieben Jahre später (1962) gelang es ihnen mit perfiden und manipulierten Zwangsgutachten.
Am 18.02.1956 wurde mein Papa von der Polizei in die psychiatrische Klinik Waldhaus zwangseingeliefert. Die Gemeindebehörden Maladers hatten dies angeordnet. Die Vormundschaftsbehörde Arosa/Schanfigg erliess daraufhin folgende Präsidialverfügung:
Auszug aus dem achtseitigen, erniedrigenden Gutachten über meinen Papa.
Ich zitiere Teile:
In der Jugend soll der Expl.10einen Starrkrampf durchgemacht haben, sonst war er angeblich immer gesund und habesich körperlich und geistig unauffällig entwickelt. Er habe auch frühzeitig gehen und sprechen gelernt, Bettnässen und Anfallskrankheiten werden negiert.
Seit seiner Schulentlassung im Jahre 1946 arbeitet Herr Gurt z. T. als Hirte und in der übrigen Zeit als Bauhandlanger oder Waldarbeiter. Nach den eigenen Angaben und den Berichten der Angehörigen soll er immer als fleissiger und zuverlässiger Arbeiter geschätzt gewesen sein. Unsere Erkundigungen am heutigen Arbeitsplatz (Baugeschäft Manzoni Chur) lassen diese Angaben als glaubwürdig erscheinen …
Papa (rechts) mit meinem Neni Stefan Gurt bei der Arbeit
Expl. hat schon frühzeitig mit dem Trinken begonnen und trieb sich häufig in einer Gruppe haltloser Jugendlicher herum. Seine Trunksucht besteht seit 6 Jahren …
Seit seiner Verlobung mit Frl. Mehli will der Expl. auch kaum mehr trinken, am Feierabend und an den Sonntagen bleibe er jetzt immer zu Hause.
Im Bericht des Gemeindepräsidenten von Maladers an die V.B. (Vormundschaftsbehörde) Schanfigg ist von der besonderen Streitsüchtigkeit des Expl. die Rede, die wir bisher aber nur an Hand von 2 Vorstrafen im Kantonalen Strafregister etwas objektivieren konnten (einfache Körperverletzung 1954, Beschimpfung 1954) Von anderen Personen wurde uns der Expl. eher als gutmütiger »Tscholi« beschrieben …
Schon 1951 hat sich die V.B. mit dem Expl. befasst, wobei es damals wie heute in erster Linie um die finanzielle Sanierung der Verhältnisse in der Familie Gurt ging.11
Die Behörde möchte die durch die Versorgung des Vaters12entstehenden Schulden nach Möglichkeit durch die eigene Familie tilgen lassen … eine Lohnverwaltung für den Expl. und dessen Bruder Stefan wurde in die Wege geleitet, die beiden haben sich aber nur wenige Monate in die Abmachung gefügt. Die Familie Stefan Gurt hat seit Jahren Schulden gemacht, indem sie in verschiedenen Läden Waren auf Kredit bezog. Expl. selbst behauptet dagegen, dass er selbst jetzt nur noch ganz geringe Schulden (angeblich 2–300 Fr. für Steuern und Krankenkasse) habe. Als am 5.1.56 der Vater Stefan erneut versorgt werden musste, stand die Behörde erneut vor dem Problem, wie dessen Aufenthalt in der Anstalt Beverin finanziert werden sollte. Eine Bevormundung des geistesschwachen und haltlosen Expl. würde der Behörde eine Handhabe bieten, diesen zur Mithilfe an der Tilgung der Schulden der Familie zu zwingen. Ausserdem besteht auch eine Gefahr, dass Herr Gurt sich mittellos verheiratet und dabei selbst in Schulden geraten könnte. Auf Grund dieser Überlegungen kam die V.B. Schanfigg am 8.2.56 erneut zum Schluss, den Expl. zur Begutachtung ins Waldhaus einzuweisen …
Unsere Diagnosen:
Imbezillität mit Lese-Schreibschwäche bei einem primitiven, verwahrlosten Bauarbeiter: Trunksucht seit 6 Jahren, die sich aber anscheinend in den letzten Jahren nicht verstärkt hat, ungünstige häusliche Verhältnisse. Expl. sieht die Notwendigkeit einer Bevormundung nicht ein und ist auch nicht bereit, die Schulden seines Vaters Stefan – insbesondere jene, die durch die behördliche Versorgungentstehen – zu bezahlen. Er sieht auch nicht ein, dass er mindestens vorläufig nicht heiraten sollte, äusserte sich aber in halb zustimmender Weise zu einer eventuellen Sterilisation (durch Vasoligatur), wodurch einer Heirat mit der ebenfalls belasteten Braut Marie Mehli, eher zugestimmt werden könnte.
… Der erhebliche Schwachsinn des Expl. (Imbezillität mit ausgesprochener Lese- und Schreibschwäche bei primitivem, verwahrlostem Bauarbeiter, der seit mindesten 6 Jahren trinkt) kommt einer Geistesschwäche im Sinne des Gesetzes gleich … vom psychiatrischen Standpunkt aus sind die Voraussetzungen zu einer Bevormundung nach Artikel 369 ZGB in vollem Umfang erfüllt. Besonders im Hinblick auf die schwierigen Verhältnisse zu Hause in Maladers-Sax und nicht zuletzt wegen allfälligen Heiratsabsichten ist eine intensive vormundschaftliche Führung und Aufsicht sehr erwünscht …
… aus eugenischen Gründen erscheint eine Nachkommenschaft des Expl. nicht wünschenswert. Wir möchten ihrer Behörde deshalb empfehlen, die Frage einer allfälligen freiwilligen Sterilisation mit dem Expl. nochmals zu erörtern, uns gegenüber hat er sich zu dieser Frage nicht völlig abgeneigt gezeigt für den Fall, dass er dadurch seine Heirat mit Frl. Mehli eher verwirklichen könne …
Gegen eine Einvernahme des am 2.3.56 nach Hause entlassenen Expl. bestehen ärztlicherseits keine Bedenken. Expl. sieht die Notwendigkeit einer Bevormundung in keiner Weise ein und will sich mit allen Mitteln dagegen zur Wehr setzten.
Mit vorzüglicher Hochachtung!Kant. Heil- und Pflegeanstalt Waldhaus
Der Direktor:Pflugfelder
07. April 1956
Papa und Mamma!
Das Gefühl steigt in mir auf, dass meine Vorfahren vorwiegend Spinner oder Delinquenten waren – oder beides, würde ich den Protokollen tatsächlich Glauben schenken. Bei vielen Namen ist die Nummer einer Krankengeschichte vermerkt. Viele meiner Verwandten sind in den psychiatrischen Kliniken oder Haftanstalten Graubündens gestorben – warum und unter welchen Umständen auch immer, weiss ich nicht. Die Häufung der Fälle lässt aber einiges vermuten über das System von damals. Wenn ich prüfe, was über meine Eltern, Geschwister und auch mich dokumentiert ist, stimmt bei weitem nicht alles – auch nicht die Diagnosen von wegen Debilität oder gar Imbezillität. Was damals wirklich geschehen ist, darüber berichtet dieses Buch. Es ist nicht nur meine Geschichte – es ist die Geschichte einer Grossfamilie.
Natürlich ist mir bewusst, dass die Psychiatrie vor 40 Jahren – und in der Zeit davor sowieso – eine ganz andere war, als sie es heute ist. Die Zeiten haben sich geändert – doch was geschehen ist, ist nun mal geschehen. Macht und Machtmissbrauch lagen schon immer sehr nah beieinander. In einem der Protokolle habe ich einen Brief an meine Mutter gefunden, in dem sie aufgefordert wird, sich sofort bei einer Amtsperson in Maladers zu entschuldigen. Falls sie dieser Aufforderung nicht nachkäme, würde sie unverzüglich in die Psychiatrie zwangseingeliefert, sprich in die Kantonale Heil- und Pflegeanstalt Waldhaus. Dass mein Papa 1956 – erst 26-jährig – bevormundet werden sollte, damit man ihm die Schulden seines Vaters aufbrummen konnte, die notabene wegen eines von den Behörden angeordneten Klinikaufenthalts entstanden waren, zeigt, wie berechnend und menschenverachtend Teile des damaligen Systems waren. Papa eine Heirat erst zu verwehren und diese dann doch in Aussicht zu stellen, wenn er sich freiwillig sterilisieren liesse, empfinde ich als grausam.
Das Ganze hatte einen Namen: fürsorgerische Zwangsmassnahmen. Dieser Begriff steht noch heute für tausende von Opfersituationen. Wie die Klinikleitung damals festhielt, war eine Nachkommenschaft nicht erwünscht – somit auch ich und meine Kinder und Kindeskinder ebenfalls nicht. Doch meine Geschwister und ich existieren. Heute nun schreibe ich über die abartigen Zustände von damals und dies, obwohl auch ich als debil und geistesschwach eingeschätzt wurde.Um meiner Familie und mir das Gesicht von damals zu geben, habe ich folgende Bilder eingefügt:13
Mary, Claudia, Rädel und Irma
Claudia, Rädel und Mary
Rädel und Yvonne
Mary und Yvonne
Rädel
Claudia und Rädel
Charly
Papa konnte tatsächlich kaum lesen oder schreiben. Legasthenie ist heute noch verbreitet und manch einer hat deswegen gegen Vorurteile zu kämpfen. Papa musste als Kind viel arbeiten, war oft in den Alpen und fehlte dementsprechend in der Schule. Doch wer ihn kannte, weiss, wie intelligent er gewesen ist, genauso wie auch meine Mutter.
Deshalb schaffte es mein Papa, sich erfolgreich gegen eine Sterilisation zu wehren, wie es diese Zeilen ja beweisen. Sieben Jahre dauerten die Versuche, ihn zu bevormunden, ehe es dann gelang.
Mir ist selbstverständlich bewusst, dass Diagnosen von früher grundsätzlich einen anderen Fokus aufweisen als heutige, ebenso ist die Wortwahl in den Gutachten anders und die Art zu kommunizieren sehr akzentuiert. Doch eines zeigen die ersten Protokolle ganz klar: Die Bedeutung, die der Herkunft einer Familie beigemessen wurde, war enorm, ebenso das, was aus sogenannten Krankengeschichten, sprich der Familienhistorie, in ganze Generationen impliziert wurde. Meine Geschwister und meine Eltern sind nicht schwachsinnig, dennoch wurden wir alle mit diesen Diagnosen abgestempelt und über Jahre entsprechend behandelt. Natürlich lebten wir in Sax in sehr ärmlichen Verhältnissen, die schwer auszuhalten waren, doch etwas zu essen hatten wir immer – und wir hatten vor allem uns!
Doch um die Frage zu beantworten, ob es wichtig ist zu wissen, wie man gezeugt wurde: Ja, denke ich, denn es sagt viel über familiäre, emotionale und bedingt auch wirtschaftliche Verhältnisse aus.
11. September 1972
Am Montag, dem 11. September 1972, wurde ich in das erste Kinderheim gebracht. Diesen Tag vergesse ich nie, solange mein Herz und mein Hirn funktionieren. Er war die logische Konsequenz einer unheilvollen Chronologie verketteter Ereignisse – absehbar und scheinbar auch nicht abwendbar. Bereits ein Jahr zuvor war ein Versuch der Maladerser Behörde unternommen worden, unsere Familie aufzulösen.
Der Schulrat von Maladers stellte deshalb 1971 diesbezüglich ein Gesuch an die Vormundschaftsbehörde Arosa, aufgrund der Beschwerde von Frau Trudi Adank-Sidler, einer Einwohnerin des Dorfes, wie die zwei nachfolgenden Protokolle belegen:
Beschwerde von Frau Trudi Adank-Sidler aus dem Jahr 1971
Der damalige Schulrat – mit dem Präsidenten H. Hassler – überschritt bei weitem seine Kompetenzen, als er in der Schulratssitzung vom 4. Februar 1971 die Heimeinweisung von mir und meinen Geschwistern veranlassen wollte. Man gewährte meinen Eltern nicht einmal die Möglichkeit einer Stellungnahme zu den von Frau Adank-Sidler erhobenen Vorwürfen. Damals schon war klar, Frau Adank-Sidler handelte aus persönlichen Motiven: Sie glaubte, ihr Mann wolle mit meiner Mutter anbandeln, deshalb sollte die ganze Familie Gurt verschwinden.
Die Antwort der Vormundschaftsbehörde auf den Vorstoss des gesamten Schulrates von Maladers, unsere Familie auseinanderzureissen.
Meine Eltern waren zu diesem Zeitpunkt schon seit einigen Jahren bevormundet – lange bevor ich zur Welt kam. Streitereien der beiden beschäftigten die Behörden seit geraumer Zeit. Meine Mutter beklagte sich gemäss der Akten über Tätlichkeiten meines Vaters, mein Vater wiederum über das ausschweifende Sexualleben meiner Mutter – mit anderen Männern, notabene. Streit wechselte sich mit Versöhnung ab – wie Sonne und Regen im April.
Am 21.06.1961, also zehn Jahre zuvor, gab meine Mutter erstmals auf der Gemeindekanzlei zu Protokoll, sie sei von meinem Vater geschlagen worden – was ich ihr glaube.
Dazu zitiere ich aus Protokollen der Behörden vom 2. August 1972. Die KESB Graubünden hat den Briefkopf beim Kopieren abgedeckt, über Umwege bin ich jedoch noch an das Original gelangt. Es stammt, wie erwartet, von der Vormundschaftsbehörde des Kreises Schanfigg:
Anfänglich schien die Ehe harmonisch zu sein. Doch schon bald kam es zu Auseinandersetzungen, Beschimpfungen und sogar zu Schlägereien. Dies gab die Frau14erstmals am 21.6.1962 zu Protokoll. Am 22.8.1962 bestätigte Maria Gurt, dass der Mann im betrunkenen Zustand sie wieder geschlagen und schrecklich randaliert habe (Protokoll, Akt. 10), weshalb sie sofort auf Scheidung klagen wollte. Dieses Verhältnis dürfte wahrscheinlich so oder ähnlich die Jahre hindurch angedauert haben, bis es am Mittwoch 12.7.1972 a.c. zur Explosion kam. Auf dem Hof in Chur liess sich der Ehemann zu erneuten Tätlichkeiten hinreissen, worauf die Frau die Familie verliess und sich nun unbekannten Ortes aufhält. In dem an die Behörde gerichteten Schreiben o. D. stellt sie fest, dass sie sich scheiden lassen wolle und es besser sei, dass die Kinder wegkommen. Es scheint uns müssig zu sein, feststellen zu wollen, wer welcher Teil dieser Schuld an dieser verfuhrwerkten Lage trägt. U. E. sind beide Eheleute nicht in Ordnung. Der Mann ist kaum voll zurechnungsfähig(siehe psych. Gutachten, speziell nicht im Zustande der Trunkenheit). Die Frau ihrerseits ist auch nicht das, was man von einer guten Ehefrau und Mutter erwarten dürfte. Eine gute Mutter überlässt nicht Knall auf Fall acht Kinder ihrem Schicksal. Mitschuldig an ihrer Kurzschlusshandlung sind sicher auch die misslichen Wohnverhältnisse und die »liebe« Umgebung. Was die Wohnverhältnisse anbetrifft, so war die Gemeinde für Remedur besorgt, indem sie der Familie zwei grössere andere Wohnungen angeboten hat. Die Gurts schlugen jedoch beide Angebote aus, da sie unbedingt in Sax bleiben wollten. Der Lokalaugenschein hat dann ergeben, dass die Verhältnisse geradezu untragbar sind. Vor allen Dingen ist die Wohnung für 10 Personen zu klein. Am meisten zu bemängeln ist jedoch, dass sie über keine Abortanlage verfügt.
Die Eheleute sind bevormundet: Der Mann seit dem 11.10.62 und die Frau seit dem 13.2.1963. Infolge verschiedener Klagen war die Behörde bereits letztes Jahr, d. h. am 13.2.1971 einmal soweit, die Familie aufzulösen. Auf Grund der inständigen Bitten und Versprechungen nahmen wir damals Umgang von Massnahmen. Nun haben sich die Verhältnisse aber derart zugespitzt, dass sich die Behörde veranlasst sieht, im Sinne von Art. 284 ZGB durchzugreifen und die Kinder in einer, oder falls nicht möglich, in mehreren Familien unterzubringen. Wenn immer möglich möchten wir aber der Heimversorgung den Vorzug geben. Mit dieser nicht leichten und angenehmen Aufgabe dürfen wir unsere Bezirksfürsorgerin, Fräulein E. Wildberger, betrauen. Fünf Kinder Gurt wurden bereits vom Schulpsychologen getestet. Auf Grund der Ergebnisse wurden Claudia, Yvonne und Karl15ins Kinderheim Masans eingewiesen. Die Frage des Wechsels des Vormundes soll geprüft werden. Die Gemeinde Maladers wird gebeten, uns einen diesbezüglichen und qualifizierten Vorschlag zu unterbreiten.
Beschluss:
Der administrative Beschluss zur Auflösung unserer Familie – verfasst von der Vormundschaftsbehörde Arosa Unter Punkt 3 »Gegen …« fehlt die Rechtsmittelbelehrung.
Irritierenderweise wird in einer weiteren Originalfassung dieser Verfügung, datiert vom 7. August 1972, die Beschwerdeführung aufgeführt und anstelle Schlägereien ist das Wort Tätlichkeiten vermerkt. Ich gehe davon aus, dass man meinen Vater diesbezüglich hintergangen hat.
Eigentlich ist jener Montag, der 11. September 1972, unter anderem die direkte Folge vom Mittwoch, dem 12. Juli 1972, dem Tag, an dem meine Mutter mit einem anderen Mann durchbrannte. Sein Name war Sepp Sablonier. Auch er liess eine vielköpfige Familie im Stich.
Meine Mutter hatte bis zu diesem Zeitpunkt schon länger eine aussereheliche Beziehung mit ihm, was Papa bestimmt ahnte und was die Streitereien noch mehr anheizte. Oder umgekehrt: Die aussereheliche Beziehung wurde aufgrund des Streits fortgeführt.
An besagtem Mittwoch, dem 12. Juli 1972, als Mamma uns alle verliess, erzählte sie meinem Papa, dass sie in Chur ein sehr schönes Dirndl gesehen habe, welches sie unbedingt kaufen wolle. Obwohl wir finanziell sehr schwach dastanden, willigte Papa ein. Das Geld für den Kauf sollte sie als Vorschuss aus dem Lohnbüro in Chur holen, wo er als Hilfsarbeiter bei der Firma Storz arbeitete und Kohle in die Keller von Häusern schaufelte. Claudia, meine drittälteste Schwester, war damals zwölf und begleitete Mamma ins nahe Dorf Maladers zur Postautohaltestelle bei der Post. Mamma drückte ihr einen Fünfliber in die Hand. Sie verabschiedete sich mit den Worten, dass Claudia zum Öhi Steffi, einem Bruder meines Vaters, gehen solle, um dort zu warten, bis sie mit dem letzten Postauto um 17:30 Uhr zurückkehren werde. Dann stieg sie ein und verschwand – und kam nie wieder zurück!
Das alte Postauto fährt mit meiner Mutter davon. Das kleine, in den steilen Berghang gepresste Dorf lässt sie hinter sich, ebenso das ärmliche Haus und damit auch ihren Mann und ihre acht Kinder im Alter zwischen dreieinhalb und fünfzehn Jahren. Ihr Blick ist dabei wahrscheinlich auf die im Taleinschnitt liegende Stadt Chur gerichtet, die sie in einer Viertelstunde erreicht. Dort wartet der Sepp auf sie.
Weg!
Alles hinter sich lassen.
Weg von den acht Gören, die sie nicht mal alle zusammen genug liebt, um zu bleiben – oder wenigstens, um eine andere Lösung zu suchen. Weg von dem Mann, der säuft, der sie im Rausch schlägt, der ihr nicht vergeben will oder kann, dass sie betrügt und lügt und in ihrer intriganten Art den Pfarrer und die Nonne gegeneinander aufwiegeln kann, und doch trägt auch er genauso Mitschuld am Zerbruch der Familie – aber mit dem entscheidenden Unterschied: Er liebt uns Kinder!
Unsere Mamma will nur eines – alles zurücklassen, wegsehen. Dies, obschon sie sehr oft alleine in die Stadt oder sonst wohin gehen konnte, da unsere Nana Antonietta auf uns achtgab. Gemäss den Aussagen von verschiedenen Seiten war Mutter immer ein Freigeist gewesen, sie war lieber unterwegs im Postauto als zu Hause. Doch diese Freiheit genügte ihr nicht mehr. Dabei hatten die Behörden sie im Jahr zuvor darauf hingewiesen, sie solle sich um uns kümmern und sich einen besseren Lebenswandel aneignen.
Punkt 3: Dies gilt speziell für die Mutter, die gleichzeitig auch angehalten wird, sich eines anständigen Lebenswandels zu befleissigen.
Sie musste einfach gehen!
Wir Kinder waren ja zäh wie Leder. Die Ältesten hatten sich zusammen mit Nana schon oft um uns Kleinste gekümmert. Die Behörden würden es nun garantiert richten, denn der Älteste, so wurde mein Papa genannt, kann’s ja alleine nicht. Doch mit Sicherheit wusste Mutter, was ihr Weggang für uns alle bedeutete. Sie verschwand!
Ob sie an diesem Mittwochmorgen auf dem Hof tatsächlich von Papa angegangen wurde, ist fraglich. Meine ältesten Geschwister können sich an diesen Tag sehr genau erinnern, da dieser sich in ihre Herzen gebrannt hat. Wahrscheinlicher ist, dass Papa Mutter zum Bleiben zu bewegen versuchte, indem er sie nach dem Mittagessen alleine nach Chur fahren liess, um dieses Dirndl zu kaufen, und das, obwohl das Geld nachher an allen Ecken und Enden gefehlt hätte. Ob in den Tagen zuvor grössere Streitigkeiten ausgebrochen waren, konnte ich nicht herausfinden.
So also verschwand damals meine Mutter.
Nur noch einmal würde ich sie als Kind, etwa sechs Jahre später für ein paar Stunden sehen. Doch diese Begegnung würde voller Beklemmung für mich sein, sodass ich mir sogar wünschte, schnell wieder ins Heim zurückkehren zu können. Danach sah ich sie erst als Sechzehnjähriger wieder.
Meine Mutter habe ich nicht eine einzige Sekunde in meinem Leben vermisst – weder als Kind noch als Erwachsener. Aber ich habe mich als Kind oft nach einer richtigen Mutter gesehnt und mir vorgestellt, wie es wäre, wenn eine solche mir beim Fussballspielen zujubeln oder mir ein Pflaster auf den Finger kleben würde. Dabei stellte ich mir immer ihre Augen vor – stolz lächelte sie mir in meinen Tagträumen zu. Es war nie das Gesicht meiner Mutter, das mir erschien. In meinen Gedanken war es eine dunkelhaarige Schönheit mit warmen Augen und freundlichen Lachfältchen. Oft schaute ich in der Primarschule zu, wenn Mütter ihre Jungs abholten und beim Davongehen kurz den Arm auf deren Schulter legten, ihnen beim Gehen den Kopf zuwandten, um etwas zu fragen oder zu sagen. In ihren Augen sah ich, wie sehr sie interessiert waren zu erfahren, was ihr Sohn am Morgen in der Schule erlebt hatte. Viele solche Szenen gab es in meiner Schulzeit. Bei jedem offiziellen Schulanlass und vor allem beim Elterntag. Dann fühlte ich Einsamkeit in mir hochsteigen, ein Schmerz blitzte auf und wollte sich breitmachen, ehe ich ihn kraftvoll nach unten kämpfte.
Was mich besonders traurig stimmte, waren die Tage vor dem Muttertag. In der Primarschule bastelten wir jedes Jahr Geschenke. Manchmal waren diese mit viel Arbeit verbunden, beispielsweise, als wir einen kleinen Korb flochten. Mir war klar, dass ich diese Geschenke nie überreichen konnte, kein Dankeschön, kein freudiges Strahlen entgegennehmen durfte. Seit meinen Kindergartentagen warf ich sie irgendwo auf dem Weg zurück ins Waisenhaus in einen Abfalleimer. Das schmerzte mich heftig, auch das Zuschauen, wie andere Kinder alles freudig und stolz nach Hause trugen. Eine schöne Bastelarbeit hatte ich unterwegs mal einer älteren Frau geschenkt, damit wenigstens jemand etwas Freude daran haben konnte. Und die hatte sie, nachdem sie begriffen hatte, warum ich die Bastelei nicht behalten wollte. Nach so traurigen Momenten fühlte ich mich erst etwas besser, wenn ich durch die schönen Wiesen zum Waisenhaus hochgegangen war. Nur dieser Grundschmerz, der alles umschloss, blieb dumpf zurück. Doch ihn hatte ich im Griff – zumindest so gut, dass ich für ein paar Jahre funktionierte.
Verstehen kann ich meine Mutter insofern, dass ihr damals alles zu viel geworden ist, dass sie nach Veränderung strebte, aber nicht, dass sie uns zurückgelassen hat, um mit einem anderen Mann ins Ausland abzuhauen, ohne auch nur einen Gedanken an uns zu verschwenden. Dass sie gegangen ist, hatte emotional für mich grundsätzlich wenig Bedeutung, schlimm waren die Konsequenzen – ich verlor meine Geschwister und meinen Papa. Eine Mamma konnte ich nicht verlieren – sie war ja zuvor schon kaum da und wenn, war sie nur oberflächlich anwesend. Mutter hatte es ja deutlich im Brief an die Behörde damals geschrieben …
Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde:
Der Brief meiner Mutter, nachdem sie uns alle verlassen hatte
Empfänger des Briefes war der damalige Gemeindepräsident Jacob Eggler, der Mann von Erika Eggler, der Vormundin meiner Eltern und zu Beginn auch von mir.
Diesen Brief sandte Mutter zwölf Tage nach ihrem Verschwinden am Montag, dem 24. Juli 1972, in Chur ab. Zu dieser Zeit wurde bereits polizeilich nach ihr gefahndet, um sie in die Psychiatrie einzusperren. Wann genau sie die Schweiz Richtung Italien verliess, konnte ich nicht ausfindig machen, da ich heute keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter habe.
Hier der exakte Wortlaut des Briefes:16
GiltGemeinde – Maladers.
Ich erlaube mich Euch ein kleines Brieflein zu schreiben. Wie Ihr schon wist bin ich von meiner Familie weggegangen aus welchen Gründe wist Ihr schon. Ich habe nun einmahl genug mitgemacht, so das ich es nicht mehr wieder ausgehalten habe. Ich habe ja schon vielmahl bei Euch geklagt aber alles nützte ja nichts. Ihr habt ja schon seit 1960 ein Schreiben erhalten von der Vormundschafts-Behörde wegen einer Wohnung, aber die Gemeinde hat ja lieber die Beissässen in den Gemeindenhäuser gehabt als uns. So viele schläge und Streit hofe ich werde ich nicht mehr bekommen. Die Ursache das ich alles gemacht habe werde ich Euch gerade schreiben. Erstens hat mein Mann gesagt zu mir ich habe den Krebs dan hat er mir im Gesicht sowie in den Teller wo das Essen von mir war hineingespeit. Er hat viele mahle mir schon die schöne Tühre geweisen nun ist es halt einmahl so gekommen. Ich mache Euch darauf aufmerksam das ich die Scheidung verlange, denn ich komm nicht mehr zurück, gehe es mir wie es will, den ich weis was Arbeiten heist ich scheue nichts kann kommen was will auch ich bin ein Mensch nicht nur ein Tier wie ihr mich bis heute behandelt haben. Ich habe schon Rechte Leute in der Hand wo ich mein?17und Kummer klagen kann. Denn ich falle wegen Euch nicht mehr auf die Knie.
Mit besten dank und frt. Gruss.Frau Maria Gurt-Mehli?
Weshalb ein Fragezeichen hinter den Namen gesetzt wurde, weiss ich nicht, doch wie es scheint, ist die Schrift diejenige von Sepp Sablonier.
Es stimmt, meine Eltern wollten nicht von Sax weg. Ihre Elternhäuser waren zwei der sechs Häuser. Mutters Elternhaus stand einige Meter über unserem im steilen Hang, in dem von Papa wohnten wir. Beide Elternteile von Mutter lebten damals noch. Im Brief fallen Vorwürfe gegen meinen Papa, die so oder ähnlich stimmten. Mutter hatte es mit Sicherheit teilweise alles andere als einfach. Das tut mir auch leid für sie. Im Brief rechnet sie aber in erster Linie mit der Gemeinde ab und am Schluss kommt klar zum Ausdruck: Egal, was kommen wird, egal, wie es ihr ergehen würde – sie kehrt niemals zurück. Kein Wort über uns Kinder, dass sie sich um uns kümmern würde oder was auch immer. Wir kommen in den Zeilen ja nicht mal vor. Natürlich hatte sie auch nicht erwähnt, wie sie ausgerechnet ihre Tochter Claudia, die am selben Tag wie sie Geburtstag feiert, geschlagen hatte – und das immer und immer wieder – so sehr, dass sich auch Irma noch mit Schrecken daran erinnert. Claudia war diejenige, die am meisten abbekam. Nana Antonietta hielt ihre Hand schützend über mich, wenn ich irgendeinen Unfug angestellt hatte. Mutter hatte auch nicht erwähnt, dass sie auf einem Alpweg von einer meiner Schwestern in flagranti beim Sex mit einem anderen Mann als Papa ertappt worden ist. Auch nicht, dass sie so viel unterwegs war und so viele Freiheiten hatte, wie damals kaum jemand. Nicht ein einziges kritisches Wort über sich selbst.
Mutter war bei ihrem Davonlaufen völlig klar, was nun mit uns geschehen würde, und dass die Zerschlagung der Familie unausweichlich damit verwoben war. Dennoch, niemand hätte sie zum Bleiben bewegen können – da bin ich mir felsenfest sicher. Meine Mutter war extrem berechnend und kalt in allem, was sie tat. Sie hätte vieles und viele manipulieren können, um eine bessere Lösung für uns alle herbeizuführen. Doch sie wollte Sepp.
Als junger Erwachsener habe ich Jahre später gesehen, wie emotional brutal Mutter mit ihren jungen Liebhabern und ihren Ehemännern umgegangen ist, die meist zwanzig und mehr Jahre jünger waren als sie. Ich behaupte mal, im Leben meiner Mutter gab’s immer nur eine Person, die ihr wichtig war – sehr wichtig sogar: sie selbst.
Erst viele Jahre später wurde mir klar: Mutter weiss nichts von Liebe zu einem Kind, obschon sie acht unter dem Herzen getragen hatte. Dort, wo die Natur in einer Mutter die Kindsliebe vorgesehen hat, ist ein Gefühlsloch in ihr, dafür ist der Bereich für Egoismus entsprechend erweitert ausgeprägt. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, waren viele Schmerzen notwendig. Nutzlose Versuche als Erwachsener säumten bis dorthin noch mehrmals meinen Weg, um mir selbst doch noch zu beweisen, dass sie nicht so ist, dass doch Liebe da ist, dass es nur die Umstände waren, die sie wie die Felsen der Alpen hart werden liessen und dass trotz des Rückenzudrehens so etwas wie Wärme da wäre. Wärme für mich, für uns alle, die wir doch damals ihre Kinder waren. Vielleicht auch nur Restfetzen von Gernhaben – wenigstens etwas, dies hätte mir schon gereicht.
Nein – es waren nicht die Umstände, die sie so werden liessen. Sie ist so gewesen. Da war nichts an Muttergefühlen und wird auch niemals etwas sein.
Ich erinnere mich an unseren letzten Versuch, miteinander ins Gespräch zu kommen:
Am 4. Februar 2014 wollte ich mich noch einmal mit ihr unterhalten. Wie gesagt, ich hasse sie nicht, aber wenigstens ihr Handeln verstehen, das wollte ich gerne. Deshalb bat ich sie, mir einfach mal während einer Viertelstunde zuzuhören. Sie konnte auswählen, ob wir uns bei ihr treffen sollten, dann hätte sie mir sagen müssen, wo sie wohnt. Oder ob sie lieber in mein Haus kommen oder gar alles nur telefonisch besprechen wolle. Sie wählte das Telefon und das sofort.
Im kurzen Gespräch erklärte ich ihr, ich könne verstehen, dass ihre Ehe mit Papa damals am Ende war. Jede Ehe kann mal enden – auch mit einem Knall. Doch das Danach – einfach zu verschwinden, sich jahrelang weder blicken, noch von sich hören zu lassen, dass sie so alles von mir als Kind verpasste, das verstehe ich nicht: Kindergarten, Einschulung, Unfälle, ein Tor im Fussballturnier, die Pubertät und meine Berufswahl. Diese und tausend andere Momente musste ich ohne sie und fast ohne Papa alleine durchleben. Auch sagte ich Mamma, dass es für mich nicht einfach gewesen sei, zwölf lange Jahre in Kinderheimen alleine durchzustehen.
Ihre Antwort brüskierte mich:
»Also los, Philipp. Jetzt sägi diar aber au amol öppis. Vor sechs Johr hani di uf Balzers kfahra, damit du din neua sacktüra Audi hesch könna hola. Dia versprochna 50 Franka für da Wäg und z’Benzin hesch miar aber nia geh, nu dass du das grad waisch!«
Einen Moment lang war ich sprachlos. Wer mich kennt, der weiss, dass dies etwas heisst. Dann entsann ich mich: Es stimmte, ich hatte tatsächlich vergessen, ihr das Geld zu geben. Damals hatte ich versucht, Kontakt zu ihr herzustellen, doch ich musste nach wenigen Tagen einsehen, dass ich mich vor ihrem Verhalten schützen musste, und so ging das mit dem Geld unter.
Das Datum unseres Telefonats von 2014 weiss ich noch so genau, weil ich danach von ihr eine solch beleidigende SMS erhielt, dass ich ihre Nummer sperrte. Diese SMS ist das Letzte, was ich von ihr gehört oder gesehen habe. Der Inhalt und der Stil, in dem die Nachricht abgefasst war – in dem Moment verstand ich emotional endlich, dass sie mich zwar geboren hatte, aber mehr nicht. Sie weiss weder, wie meine fünf Kinder aussehen, noch kennt sie deren Namen. Dieses kurze Gespräch, bei dem sie nach ihrem Statement einfach auflegte und die schriftlichen Beschimpfungen danach – das liess mich endlich loslassen. Die Frage nach meiner Mutter hatte sich somit nach vielen Jahren für mich geklärt. Ich hatte nie eine Mutter. Das ist sehr schade. Dies meine ich auch in dem Sinne, dass ich für keine Mutter da sein konnte und kann. Sehr gerne hätte ich eine richtige Mutter umsorgt, ihr eine Überraschung bereitet, ich wäre mit ihr in die Berge zu einem Picknick gefahren oder zum Arzt gegangen, und hätte sie später im Altersheim besucht und gepflegt. Vor allem aber vermisse ich die Stunden, die man gemeinsam hätte am Küchentisch sitzen können, eine Tasse Kaffee und Gebäck vor sich und einfach nur reden und zuhören. Das stelle ich mir sehr schön vor. Ja, ich wäre sehr gerne für eine Mutter der Sohn gewesen – in guten wie in schlechten Zeiten.
Da ich bereits im Alter von vier Jahren, neun Monaten und zwei Tagen von zu Hause wegkam, habe ich nur wenige Erinnerungen an mein Leben daheim, doch die sind über die Jahre immer dieselben geblieben. Einige aus der Zeit vor der Heimeinweisung bezeichne ich als Gefühlsfragmente, die aus meinem Nichts davor wie helle, farbige Bildausschnitte in einem dunklen Kinosaal an der Leinwand aufleuchten. Mit diesen wenigen Erinnerungen sind aber unglaublich tiefe Emotionen verwoben.
Da ist beispielsweise die Erinnerung an meine kleine Schwester Maja, wie wir beide in ihrem Gitterbettchen sitzen und ich versuche, ihr den Schnuller zu reichen. Dabei fühle ich die Taubheit dieses Nachmittages. Etwas wie Langeweile schwebt im Raum. Das dunkle, verstaubte Holz, aus dem unsere Hütte gebaut ist, engt mich ein, der graubraune Bretterholzboden wirkt verlassen – Zeitlosigkeit ist in mir.
Auch an den grünen Schilter von Öhi Steffi erinnere ich mich, genauer gesagt, wie wir damit zur Alp hochfahren. Der Naturweg, die Tannen, Bäume, das Rattern des Motors, der Duft von warmen Tannennadeln, Licht- und Schattenspiel, Sommer – alles ist noch da.
Ich mag diese alten Schilter noch heute sehr gerne. Sie riechen besonders: nach dem Gummi der Räder, nach Heu, Holz und Kettenschmiere.
Bild aus längst vergangenen Tagen – der Schilter fährt heute noch.
In einer weiteren Erinnerung von damals taucht lebendig ein Fest im Schulhaus von Maladers auf. Ein Ballonwettbewerb findet statt.
Freude liegt in der Luft! Ich sehe den Ballons zu, wie sie mit je einer Absenderkarte in den Himmel entschweben und ich hätte sie am liebsten eingefangen – unrhythmisch tanzende, rote Himmelsgebilde, die immer kleiner werden. Wohin sie wohl fliegen? Eine Festwirtschaft gibt es auch. Zusammen mit Yvonne, meiner zweitjüngsten Schwester, finde ich Papa im Gewühl. Er ist guter Stimmung. Angeheitert. Ländlermusik ertönt von einem Duo, das mit einem Lächeln auf den Lippen lüpfig aufspielt. Wie immer quetsche ich mich im Lärm und Durcheinander in die Nähe von Papa auf eine Festbank und wie immer reicht er mir ein Päcklein Pommes-Chips:
»Sä do – kasch au no ais meh ha, gäll, oder witt liaber as Biberli?«
Ein Fläschlein Sprudelwasser steht vor mir. Für mich allein! Papa ist so wie immer, wenn er mit dem Trinken beginnt: zuerst redselig und voll guter Laune. Seine Stimme hat so eine Leichtigkeit und Beschwingtheit – wie eine fröhliche Melodie, die in einen Sommertag hineinklingt. Die Lachfältchen umspielen seine Augen im tiefgebräunten Gesicht – als spiegelten sie alles Glück dieser Erde. Alle Menschen sind ausgelassen fröhlich, als hätten sie puren Sonnenschein in ihren Gläsern.
Das ist aber nur Phase eins!
Leider hab ich Papa noch nie bei Phase eins mit Trinken aufhören sehen und weiss deshalb, dass ein wunderbarer Sommertag mit Donnergrollen und Sturm enden kann. Diese Verwandlung werde ich vor allem im Alter zwischen vierzehn und achtzehn hundertfach sehen. Zu viele Male, sodass ich heute keine angetrunkenen Menschen in meiner Nähe ertragen kann. Ich muss ihnen aus dem Weg gehen, doch dazu später mehr.
An jenem Tag, auf diesem wunderbaren Fest in Maladers, mit den zauberhaften roten Ballons, die eben in den Himmel entschwebt sind, fühle ich, wie die Stimmung nach und nach kippt. Es ist, als würde man fast unmerklich eine leckere Gerstensuppe verwürzen, bis man sie ausspucken muss. Die Diskussionen werden ruppiger. Streit liegt in der Luft, Meinungen werden herausposaunt, als wären die Streithähne Marktschreier. Die ersten Beleidigungen und Schimpfworte kommen wie das Donnergrollen und damit die Vorboten des nahenden Sturms.
Es wird Zeit zu gehen!
Meine Schwester zieht mich deshalb an der Hand fort, doch die Angst und Spannung bleiben an mir haften. Wieso kommt Papa nicht mit? Ich drehe mich um und sehe ihn in einem Handgemenge. Stühle kippen, ein Tisch fällt zur Seite. Papa ist mittendrin, kämpft wie ein tanzendes Kriegsschiff inmitten eines Sturms. Fäuste fliegen, Flüche ertönen. Der Geruch von Bier, Zigarettenrauch, Kaffee und Schnaps erfüllt die Luft. Das Fest verschwindet in einem Wolkenmix aus wunderschönen Momenten, gepaart mit der Angst um meinen Papa, der mich plötzlich nicht mehr wahrnimmt. Jemand bringt mich nach Sax. Daheim scheint die Zeit stillzustehen. Ich fühle mich ausgeliefert. Mit vier Jahren bin ich zu jung, um etwas tun zu können, ausser darauf zu warten, dass Papa heimkommt. Verstehen kann ich das Ganze ohnehin nicht.
Nun aber geht es um die schönste Erinnerung an damals, als ich noch zu Hause in Sax wohnte.
Wir verbringen wie jedes Jahr die Sommermonate auf einer der Alpen in der Gegend: hoch oben auf der First, dem Wolfsboden oder der Steineralp – weit hinten im Strassberg. Von welcher dieser Alpen meine Erinnerung stammt, weiss ich nicht, es spielt aber auch keine Rolle. In dieser Erinnerung fühle ich mich so frei und so nah an dem Blau des Himmels, den herrlichen Bergen und mein Blick schwebt grenzenlos frei über allem, als gäbe es nur diese Welt hier oben. In der Nähe der Hütte erstreckt sich eine kleine, fast ebene Alpweide. Der Boden, auf dem das satte Grün wächst, ist von fussbreiten Furchen mosaikartig durchzogen. Durch diese vielen erdigen Kanälchen, die etwa dreissig Zentimeter tief sind, fliessen dutzende glasklare Rinnsale. Im Sonnenlicht glitzert das Nass. Es duftet nach Kühen, Kuhdung, warmem Holz und Gras, nach Alpbetrieb und Berglandschaft. So sehr liebe ich es, diesen kleinen, emsig fliessenden Bächlein zu folgen, die wie Bergkristalle glitzern, damit ich sehen kann, wohin sie führen. Breit gefächert durchziehen sie diese Alpweide, verschwinden immer wieder unter Grasbüscheln und tauchen abermals auf. Das helle Plätschern und leise Gurgeln ist so lebendig. Alles ist frei und voller Leben – umgeben von diesem endlos weiten Himmel und der frischen Alpenluft. Mir geht es richtig gut! In meinen Gummistiefelchen streife ich herum, als gäbe es keine Zäune in dieser Welt. Irgendwo höre ich die Glocken der Tiere. Nero, unser riesiger Hund, schnüffelt in der Nähe. Er beschützt mich – mir wird hier oben niemals etwas geschehen können! Niemals! Denn wenn wir hier oben sind, gibt es kein da unten mehr.
Die Berge, mit ihren in den Himmel schiessenden Gipfeln, haben mich früh schon tief geprägt. Dort war ich wirklich mal zuhause – wir waren dort oben daheim – sogar eine Familie. Das ehrliche, bodenständige und sehr harte Älplerleben, bei Wind und Wetter der Natur ausgesetzt, hat mir eine extrem robuste Konstitution verliehen, was mir in den zwölf nachfolgenden Heimjahren noch sehr hilfreich sein sollte.
Wenn ich an diese wunderbaren Alpsommer zurückdenke, die mit dem Ende unserer Familienzeit so schmerzhaft verknüpft sind, erinnere ich mich unweigerlich an das Genderlied von den Genderbüebu aus dem Wallis:
GENDERLIED
Uf ische Bärga, da isch äs wunderbars Läbu.Hie si wer zfridu, hie wellwer immer si.Hie brüf chennwer singu, hie brüf gits e Freundschaft.Äs Läbu lang, ja, wellwer zämu si.An strengi Nacht und äs Lied wa immer wird blibu.An Ewigkeit wa nisch nie los wird la.Die gmeinsamu Stunde, in ische Härzu.Die sägund dier, dü, bisch nie allei.Äs chunnt der Tag, wa schich ischers Läbu tüet trennu.Da wisse wier äs wird nit ver immer si.Da brüf uf de Gender, da wärde wier singu.Äs Läbu lang, ja, wellwer zämu si!
An die Geissen von Öhi Steffi habe ich ebenfalls schöne Erinnerungen – sehr schöne sogar! Geissen sind coole Tiere. Ihre Neugierde ist erfrischend. Ihr warmes, feines Fell verzauberte meine Hände, als ich die Geissen damals in der Sonne streichelte.
Die traurigste Erinnerung aus der Zeit zu Hause in Sax ist mit meinem Bruder Charly verknüpft.
Mit ihm war ich zu Fuss auf dem Heimweg von Maladers nach Sax. Damals fühlte ich bereits, dass unsere Familie im Wanken war, auch wenn sich ein Kind das Ende niemals vorstellen kann, denn es kennt keine andere Welt und somit auch kein Ende. Ich spürte bloss die allgegenwärtige Bedrohlichkeit, die nicht in Worte gefasst werden konnte. Es waren Schwingungen, die ich fühlte. Die Nestwärme im Herzen, mit der jedes Kind später einmal gestärkt ausfliegen sollte, hatte es für mich nie gegeben und würde es nie geben. Emotional war der Scherbenhaufen zu fühlen, Bruchstücke davon steckten ja bereits in meinem Bauch. Deswegen trotzte ich während des ganzen Heimwegs, blieb stehen, bewegte mich schliesslich keinen Meter mehr weiter. Schon damals hatte ich einen ausgeprägten Willen! Charly war damals erst acht Jahre alt und trug in dem Moment die Verantwortung für mich. Immer wieder bat er mich inständig, ich solle nun endlich weitergehen. Es nützte nichts! Meine innere Orientierungslosigkeit liess mich keinen Schritt mehr machen. Es schien, als suchte ich bei Charly eine Antwort, oder besser gesagt, die Sicherheit, dass doch alles noch gut ist. Die eine Kurve unweit von unserem Haus sehe ich noch heute vor mir. Die Tannen, die wie stumme Beobachter seitlich an der Strasse standen, Charly zehn Meter vor mir. Hin und wieder fuhr ein Auto an uns vorbei. Charly drohte, der Landjäger werde mich holen kommen, doch ich tat ihm und mir mit meinen Worten immer weiter weh. Ich schimpfte ihn an, dass er verschwinden solle, dass ich lieber keinen Bruder mehr hätte, sowieso keinen wie ihn. Immer und immer wieder verletzte ich ihn damit. Dann schrie ich ihn an, dass ich niemanden mehr sehen wolle und er einfach nur schlimm wäre und ich ihn gar nicht gern hätte. So gefangen war ich in dem Moment, so hilflos, und doch konnte ich nicht weinen oder sagen, warum ich mich so schlecht benahm. Doch dann begann Charly zu weinen. Erst seine Tränen liessen auch mich heulen. Wir umarmten uns mit Tränen im Gesicht – dadurch gewann ich endlich etwas Nähe.
Dabei hätte ich ihm doch am liebsten schon die ganze Zeit gesagt:
»Charly – ich habe dich doch so gern, halt mich bitte fest, lass mich niemals los. Am besten lassen wir uns alle niemals los! Irgendwas geschieht aber mit uns – ich habe Angst. Sehr grosse Angst!«
1973 – ein Jahr nach der Trennung der Familie Bruder Charly (mit Hund Jonny) mit Hans und Marili Brot auf der Strassberger-/Fondeier Kuhalp. Mehrere Alpsommer verbrachte er mit ihnen in den Alpen.
Danach gingen wir beide nach Hause, in unser Zuhause auf Zeit – ich fühlte, dass wir alle verloren waren, und doch hatte ich keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte.
Gefühlsmässig habe ich auch starke Erinnerungen an meine Grossmutter Antonietta, die im unteren Stock wohnte und deren Beerdigung am 5. September 1972 zugleich auch die Beerdigung unserer Familie war.
Auch an das Dorf Maladers selbst erinnere ich mich, und dass es darin nirgends eine ebene Fläche gab. Das Tobel unterhalb unseres Hauses blieb ebenfalls fest in mir verankert. Papa nahm mich hin und wieder zum Pilzesuchen mit. Eierschwämme liebte er. Der Hang war so abschüssig, dass ich Mühe hatte, nicht zu fallen, doch in den steilsten Passagen half mir Papa. In den Alpen lernten wir alle sehr früh, uns in steilstem Gelände sicher und angstfrei zu bewegen. Keinem von uns acht Kindern ist je etwas Ernsthaftes passiert. Papa und Mary wurden zwar einmal im unwegsamen Gelände von einem Gewitter überrascht. Ein Blitz traf sie beide und schleuderte sie zu Boden. Mary rappelte sich im Schock auf und flüchtete zu einer Felswand, wo Papa sie im letzten Moment vor dem Sturz in den Tod bewahren konnte.
Unser sehr einfaches Zuhause, mit der ihm eigenen Atmosphäre, ist noch fest verhaftet in mir. Die Streitereien meiner Eltern schwirren dabei wie Heuschrecken hoch in meinen Gedanken. Was ich mit Sicherheit sagen kann: Papa hat mich als Kind nie geschlagen, auch später nicht, nicht mal im grössten Suff, wenn ich ihn, als ich in der Pubertät war, bis aufs Äusserste provozierte – manchmal sogar mit unserer Vergangenheit!
Wütend konnte er schon mal werden, etwa, als Claudia und Irma während Waldarbeiten den Arbeitern deren gesamten Getränkevorrat – natürlich Bier – an die Bäume geschmettert und zu guter Letzt den Leiterwagen samt Kisten darauf ins Tobel runtergestossen hatten. Da wetterte Papa heftig – aber er schlug uns nicht.
Wenn er aber in Sax betrunken war und Mutter und er stritten, nahmen die beiden mir die Luft am alten Holztisch. Am liebsten wäre ich sofort unsichtbar geworden. Papa war dann ganz ein anderer, zu dem niemand mehr vordringen konnte. Rücksichtslos benahm er sich – genau wie Mutter. Völlig machtlos und ohne zu verstehen, was geschah, duckte ich mich, wenn gepoltert wurde – der Tisch flog einmal um, das Brüllen und der ganze Lärm, wir Kinder irgendwo mittendrin. An Weihnachten flog sogar mal der geschmückte Christbaum auf die Strasse.
Als letzte Erinnerung, die ich an unser Zuhause habe, kommt mir die Wildkatze in den Sinn, die von unserer Nana beherbergt wurde. Ein Prachtexemplar von einem Tier, mit den für Wildkatzen typischen Pinselohren. Tatsächlich war sie mir ein wenig unheimlich, wenn sie mich beäugte. Genau deshalb versuchte ich, sie herauszufordern. Eine Mischung aus Angst und Bewunderung nahm mich dann jedes Mal gefangen.
Vieles erfuhr ich aus Erzählungen meiner älteren Geschwister, wenn wir wieder mal gemeinsam assen oder uns bei einem von uns daheim trafen, was regelmässig noch immer geschieht. Vor allem die Geschichten rund um die vielen Alpsommer sind spannend und amüsant. Etwa die, als der Nebel Papa und mich verschluckt und man uns nach Stunden unweit einer steilen Bergflanke in einer Mulde gefunden hatte. Papa war sternhagelvoll, instinktiv hatte ich neben ihm ruhig ausgeharrt. Oder als Papa angetrunken versuchte, auf dem grossen Geissbock auf die Alp hochzureiten.
Doch zurück zum Verschwinden meiner Mutter:
Nach ihrem Weggang begann für meinen Papa das grosse Leiden, das erst mit seinem Tod enden sollte. In wieviel Alkohol auch immer er sich in den folgenden Jahren zu ertränken versuchte – er litt grauenhaft!
Tagelang ging er, nachdem sie an dem besagten Abend nicht heimgekommen war, den schmalen Fussweg zur Kurve hinunter und wartete auf sie. Drei geschlagene Wochen lang! In dieser Zeit ass Papa fast nichts und schlief kaum. Dann brach er zusammen. Er, der über eine so unglaubliche körperliche Kraft verfügte, war am Ende!
Der Krankenwagen holte ihn ab und brachte ihn nach Chur ins Kantonsspital. Meine ältesten Schwestern Mary, Irma und Claudia trugen danach die Verantwortung für uns und versuchten, eine Tagesstruktur aufrechtzuerhalten. Ausgerechnet dann wurde unsere Nana so krank, dass Öhi Steffi sie nach Maladers in sein Haus holte. Natürlich wussten meine ältesten Schwestern, was zu Hause zu tun war, dennoch war es eine enorme Belastung für sie, sie waren ja erst im Alter zwischen zwölf und fünfzehn. Doch sie schafften es alleine, uns alle acht die nächsten Wochen durchzubringen.
An jenen Tag, an dem Mutter verschwand, habe ich keine Erinnerungen. Keine Wut, keinen Hass liess sie bei mir zurück, schon gar keine Liebe – nur Unverständnis. Papa hingegen brauchte ich so sehr, er war meine Sonne, deren täglichen Aufgang ich nie infrage gestellt hatte, bis wir zweieinhalb Monate nach dem plötzlichen Verschwinden meiner Mutter alle auseinandergerissen wurden. Dies geschah ausgerechnet an der Beerdigung meiner Grossmutter Antonietta, am 5. September 1972. Einige Tage später, am Montag, dem 11. September, wurde ich ins erste Kinderheim gebracht.
Meine ältesten Geschwister konnten das Unausweichliche nicht abwenden, so sehr sie sich auch um uns alle kümmerten. Ich bin mir sicher, mein Papa wusste ganz genau, was nun geschehen würde. Das Damoklesschwert hing bereits seit der letzten Verwarnung 1971 über der ganzen Familie. Ausserdem gehe ich davon aus, dass ihn die Gemeinde über den Abschiedsbrief meiner Mutter informiert hatte.
Die zwei Säulen, die unser Familiendach tragen sollten, brachen auf unterschiedliche Weise weg. Beide in ihrer eigenen Art des Egoismus und in der Unfähigkeit, etwas umbiegen zu können. Wir waren eine Lebensgemeinschaft gewesen, deren einzige Sicherheit darin bestand, dass wir zusammengehörten, und doch fühlten wir, dass es Dinge gab, die erst kaputtgehen, bevor sie auseinanderbrechen.
Wir waren acht lebensfrohe, robuste Kinder, aber mit Eltern, die keine waren. Ich habe deshalb die aufgerissenen Lücken meiner kleinen Welt zu schliessen versucht, indem ich sie zu idealisieren begann. Kinder sind anpassungsfähig und grundsätzlich lebenswillig, so glaube ich. Deshalb versuchen sie, die Defizite ihrer Eltern wettzumachen. Die grosse Freiheit erlebten wir nur in den Alpsommern. Dort oben gab es Luft zum Atmen, Berge, Sonne und Gewitter – Landschaften, in denen unsere Herzen mit den Steinadlern im Wind fliegen lernten. Diese Wochen waren extrem wichtig, damit wir Kinder das Danach überhaupt überlebten.
Wenn ich an Maladers-Sax denke, das sonnigste Dorf in Graubünden, sehe ich Schatten und fühle den kühlen Hauch, der aus dem Tobel hochsteigend vor unser Haus zieht. Rauch quillt aus unserem Kamin und füllt die kalte, taube Luft in der Stille des Morgens. Die Strasse ist leer und führt nirgendwohin und kommt von nirgendwoher. Der Geruch von frischer Gerstensuppe, gemischt mit Rauch, schwebt über allem. Dann sehe ich ein rotweiss kariertes Plastiktischtuch in einem alten Raum. Holzwände, Russ, alte Pfannen, kleine Fenster, deren Glas von der Wärme der vielen Körper beschlagen ist, die gebeugt die heisse Suppe löffeln. Lärm, Lachen, Zurechtweisen und dieses Alleinsein unter vielen. Ich möchte meinen Tischnachbarn am Ärmel zupfen und sagen, er möge mich aus meiner kleinen, unsicheren Welt herausziehen, da ich nicht wisse, wie es denn richtig wäre, doch er steckt in seiner eigenen Welt und gleichzeitig der gleichen, er ist ja mein Bruder Rädel.
»Ässa muasch«, sagt er und schaut mich an. »Iss! Kusch suss nia gross, du Calöri! Iss jetzt! Do häsch no a Stuck frischas Brot!«
Warum der Dienstag, der 5. September 1972, für die ganze Familie ein traumatischer Tag werden sollte, hatte mehrere Gründe. Nana Antonietta Gurt-Rizzi, die ursprünglich aus dem Engadin stammte und nicht aus Italien, wie in den Protokollen erwähnt, starb am Samstag, dem 2. September, im Haus von Öhi Steffi in Maladers. Mein Vater liebte seine Mutter Antonietta abgöttisch – ja, er verehrte sie geradezu! Das wurde mir so richtig bewusst, als Papa im Wohnzimmer meiner Schwester Mary