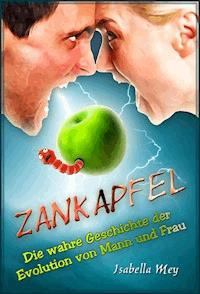3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
SchattenMeer Die romantisch-fantastische Schattentanztrilogie geht in die zweite Runde... »Ich bringe Julia nach Hause«, erklärt Sandro so bestimmt, dass niemand einen Widerspruch wagt – sollte er magisch nachgeholfen haben, wäre das wahrscheinlich nicht einmal nötig gewesen. »Ja gut, aber sie muss unbedingt untersucht werden. Eine Gehirnerschütterung ist keine Kleinigkeit«, wendet Frau Richter immerhin noch ein, als sich Sandro auch schon zu mir herabbeugt, um seine kräftigen Arme unter meine Knie und den Rücken zu schieben. »Ähm …« Das ist alles, was ich an Widerspruch zustande bringe, als ein feurig heißer Schauer meinen Leib durchflutet. Hallo! Juli! Er ist doch nur wieder hier, um dich zu bespitzeln! Sandro hebt mich hoch, als sei ich ein Federgewicht und dann liege ich in seinen Armen, sodass mein Ohr auf der Brust ruht und ich deutlich sein stürmisch pochendes Herz hören kann. ... »Wieso tauchst du plötzlich mitten in der Schulstunde auf?«, erkundige ich mich mit brüchiger Stimme, weil ich mich so lädiert fühle. Offenbar hält er es nicht nötig, mir darauf zu antworten, dafür spüre ich, wie er mich für einen Atemzug unwillkürlich an sich drückt. Wie soll ich das jetzt deuten? »Hallo!« Es sollte bestimmt klingen, stattdessen entweichen meiner Kehle nur gebrochene Laute. »Ich hab dich … was gefragt!« Doch Sandro hüllt sich noch immer in Schweigen, während er mit schnellen Schritten über den Schulhof auf die Straße zusteuert. ... Was hat dieser Sandro denn jetzt überhaupt mit mir vor? Sicher wird er sich nicht in die Höhle des Schattenlords wagen, indem er mich zu Hause abliefert. Mir ist so schwummerig zumute, dass ich fürchte, das Bewusstsein zu verlieren, aber das darf auf keinen Fall geschehen, wer weiß, wo mich dieser zwielichtige Kerl sonst noch hinbringt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
SchattenMeer
Weitere Bücher der Autorin Lichtertanz Band I – Die Magie der Glanzlichter Band II – Die Magie der Goldwinde Band III – Die Magie der Lichtkristalle (Finale) Flammentanz Band I – Funken Band II – Flammen Band III – Feuer Band IV – Brand Band V – Glut (Finale) Schattentanz Band I – Windschatten Band II – Schattenmeer (NEU) Band III – Schattenriss (noch nicht erschienen) Fabolon Band I – FarbelFarben Band II – Goldenes Glück Band III – StaubNebelNacht Band IV – RostRoter Rubin Band V – SchneeFlockenBlüten In der gleichen Welt: Romantasy Nacht der Lichter Band I – Leiser Strom Band II – Novisapiens Band III – Gewittermacht WandelTräume Ein außergewöhnliches Jugendbuch SeelenfeuerBookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenSchattentanz - Band II - SchattenMeer
Schattentanz
SchattenMeer
Isabella Mey
Band II
Weinen ist eine wertvolle Fähigkeit, sich vom Schmerz zu lösen. Und nachdem alles Leid fortgewaschen ist, scheint am Ende die Liebe hindurch.
Versuchslabor
Juli, Eppstein, Sonntag, 30. Mai
Als wäre es nie anders gewesen, hat mich der Alltag wieder fest im Griff. Lediglich die allmählich verblassende Erinnerung bindet mich noch an die Geschehnisse, die mir oft so fantastisch und unwirklich vorkommen, als wären sie in einem völlig anderen Leben geschehen. Die verstreichende Zeit bewirkt zudem, dass ich beginne, Sandro mit jedem Tag mehr zu vermissen und vielleicht auch ein wenig zu idealisieren. Egal, wie ich mich von ihm abzulenken versuche, mein Herz blutet, wenn ich nur an ihn denke und das in einer Intensität, dass ich versucht bin, mich selbst in die Behandlung eines Seelen-Klempners zu begeben.
Da ich kein Foto von ihm besitze, habe ich versucht, eine Kohlezeichnung von Sandro anzufertigen, doch keines meiner Bilder trifft ihn wirklich. Jedes Mal, wenn ich mir sein Gesicht ins Gedächtnis rufe, beginnt es vor meinem geistigen Auge bis zur Unkenntlichkeit zu verschwimmen, als würde es sich dagegen wehren, auf ein Pergament gebannt zu werden. Schließlich verbrannte ich meine unzähligen Fehlversuche während der Abwesenheit meiner Eltern im Kamin, damit mein Vater sie nicht versehentlich zu Gesicht bekommt. Ich weiß selbst nicht, weshalb ich damit ein so großes Problem habe. Schlimmstenfalls würde Papa ihm die Kommissura verpassen, was nichts anderes bedeutet, dass Sandro seine Magie nur noch wirken kann, wenn sie von wohlwollenden Gefühlen begleitet ist. Dagegen spricht doch eigentlich nichts und dennoch würde ich mich wie eine Verräterin fühlen, wenn ich meinen Vater auf seine Fährte locken würde.
Noch immer habe ich meinen Eltern nichts von meiner Schattenmagie erzählt, sie hat sich aber auch in der letzten Zeit nicht mehr gezeigt, was wohl vor allem daran lag, dass die Raben mir scheinbar aus dem Weg gingen – na ja, wohl eher flogen sie mir aus dem Weg. Jedenfalls habe ich seit meiner Rückkehr von Atlatica keinen mehr zu Gesicht bekommen.
Die Hühner fühlen sich pudelwohl in unserem Garten, den sie inzwischen recht gut durchgescharrt haben. Sie legen mehr Eier als wir essen können, daher verschenke ich regelmäßig welche an die zänkische ältere Dame in unserem Haus und tatsächlich stimmt sie diese Geste nun ein bisschen milder. Auch Mama findet, dass das der richtige Weg ist, um Frieden im Haus zu halten.
Seit meiner Rückkehr unternehmen wir wieder mehr als Familie. Neben einer Wanderung zum Kaisertempel hat mich Papa zum ersten Mal in die für andere verbotenen unterirdischen Gänge seiner Burg Sko’Falkum auf Atlatica geführt. In diesem, mit Fallen gespickten Labyrinth, wäre ich alleine absolut verloren. Diese Burg blickt auf eine Geschichte vieler hundert Jahre zurück, in denen teils recht grausame Herrscher hier gelebt haben – mit den Erzählungen darüber könnte man ganze Bücher füllen.
In der Schule hat sich wenig verändert. Die Fantastic-Girls treiben noch immer ihr lächerliches Spiel mit mir. Lediglich Lukas hält sich inzwischen etwas mehr zurück, dafür meidet er mich wie ein Vampir den Knoblauch. Mit dementsprechendem Gesichtsausdruck versieht er mich, wenn sich unsere Blicke doch einmal zufällig begegnen.
Markus’ Gedächtnislücke konnte nicht einmal mit Hilfe der Heilmagier wiederhergestellt werden, woraufhin sich die Sorgenfalten in der Stirn meines Vaters deutlich vertieften. »Dieser unregistrierte Umbro muss gefunden werden!«, rief er, wobei er seine Faust auf den Tisch niedersausen ließ.
Nachdem er mich rauf und runter nach Sandro ausgefragt hatte, war er zumindest zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich bei ihm, wenn überhaupt, lediglich um eine Nebenfigur handelte, dennoch aber keine unwichtige. »Wenn dieser Sandro wieder auftauchen sollte, gibst du mir sofort Bescheid!«, forderte Torin. »Ich bin sicher, er ist der Schlüssel, um an den Kopf des Übels zu gelangen.«
»Jaja«, brummte ich wenig begeistert.
Dieses Gespräch liegt nun schon wieder über eine Woche in der Vergangenheit und seither war Sandro zum Glück kein Thema mehr.
Das Portal nach Atlatica brauchte Torin übrigens nicht mehr zu deaktivieren, es war bereits außer Betrieb gesetzt worden, als er dort eintraf. Sicherheitshalber pulverisierte mein Vater die Steinplatte, um es endgültig zu zerstören.
Gerade sitze ich mit meinen Eltern beim Abendessen und löffele meine selbst gekochte Nudel-Gemüsesuppe mit Ei-Stich – seit wir eigene Hühner haben, gibt es sehr häufig Gerichte mit Ei. Nervös schiele ich zwischen Mama und Papa hin und her, denn schon seit geraumer Zeit drücke ich mich um eine Frage oder vielmehr eine Ankündigung herum. Ich ahne, dass die beiden nicht begeistert sein werden, aber was letztendlich bei dem Gespräch herauskommen wird, kann ich nicht wirklich vorhersehen.
»Ähm, schmeckts euch?« Das war es zwar nicht, was ich eigentlich wissen wollte, aber irgendwie muss die Unterhaltung ja in Gang kommen.
»Ja, sehr lecker, deine Suppe«, lobt Mama und prostet mir mit dem vollen Löffel zu, bevor sie ihn in den Mund steckt.
»Leicht und bekömmlich, wobei es mir doch fraglich erscheint, ob die vegetarische Kost auf Dauer keine Mangelerscheinungen hervorruft«, meint Papa.
»Quatsch! Das habe ich dir doch schon hundert Mal erklärt!«, rege ich mich mal wieder darüber auf, dass Torin meine detaillierten Ausführungen offenbar noch immer anzweifelt. Als mir jedoch bewusst wird, dass die Stimmung in eine völlig verkehrte Richtung driftet, halte ich inne. Ich nehme einen tiefen Atemzug, um mich zu sammeln. »Wir gehen nächste Woche auf Klassenfahrt«, platze ich eilig hervor, bevor ich doch wieder einen Rückzieher machen kann.
Zugegeben, normalerweise wäre diese Information keine große Sache, aber nach meiner Entführung fühle ich mich in dieser Familie absolut überbehütet. Kaum kann ich einen Schritt gehen, ohne dass meine Eltern genau Bescheid wissen wollen, wohin, wie lange ich bleibe und so weiter. Bestimmt wäre mir selbst ein wenig mulmig zumute, wenn sie sich anders verhalten würden, aber durch die Einschränkung meiner Autonomie überwiegt mein Freiheitsdrang jeglicher Angst und ich will unbedingt mit auf diese Klassenfahrt.
Schon während ich den Satz ausspreche, mustere ich lauernd die Mimik meiner Eltern: Mama lässt ihren Löffel bis in den Suppenteller sinken, wobei sich auch ihre Mundwinkel nach unten ziehen und sich ein traurig-ängstlicher Schleier über ihre Augen legt. Sie sagt nichts dazu, aber vielleicht ist es gerade das, was mich in diesem Moment besonders schuldig fühlen lässt.
Mit der grimmig in Falten gelegten Stirn meines Vaters kann ich da schon besser umgehen. »Kommt nicht in Frage!«, knurrt Torin herrisch, wie es sich für einen Schattenlord gehört. »Nach deiner Entführung sollten wir Vorsicht walten lassen, der fremde Umbro treibt noch immer sein Unwesen.« Doch dieses Argument habe ich schon vorhergesehen.
»Wo anders bin ich kein bisschen weniger sicher als hier«, protestiere ich. »Außerdem ist die Mine jetzt ohnehin gesprengt, das war doch das Motiv, weshalb ich entführt wurde und dieser Grund fällt jetzt ja weg. Der unregistrierte Schattenmagier interessiert sich doch gar nicht mehr für mich.«
»Wo geht die Klassenfahrt denn hin und wie lange wirst du weg sein?«, will Mama wissen. Sie gibt sich Mühe, gefasst zu wirken, aber ich sehe ihr trotzdem an, dass sie der Gedanke ziemlich mitnimmt, ich könnte noch einmal verschwinden.
»Es dauert zehn Tage, aber wohin es geht, ist noch nicht sicher. Zur Auswahl stehen Nordsee, Adria, Südfrankreich und Südtirol. Maila und ich haben uns für Südfrankreich beworben, aber die Plätze sind begrenzt und die Teilnehmer werden ausgelost.«
»Ausgerechnet Südfrankreich! Das sind über 1000 Kilometer Entfernung und in der Nähe gibt es keinerlei Portal nach Atlatica«, knurrt mein Vater kopfschüttelnd.
»Die Klasse von Maila kommt auch mit?«, wundert sich meine Mutter. »Also fahren mehrere Klassen zu verschiedenen Zielen? Von so etwas habe ich ja noch nie gehört.«
»Während meiner Entführung wart ihr ja leider nicht beim Elternabend, da wurde nämlich alles erklärt: Es ist so, der Vater einer Schülerin ist ein ziemlich reicher Unternehmer und der hat dem Förderverein der Schule eine großzügige Spende überlassen. So viel, dass davon Reisekosten und Unterbringung bezahlt werden können.«
»Für eine ganze Schule?«, staunt Mama. »Dieser Unternehmer muss wirklich sehr reich sein.«
»Nun, die Summe, die wir selbst dem Förderverein regelmäßig zukommen lassen, ist auch nicht unerheblich«, wendet Torin ein.
Offenbar kratzt die Sache an seinem Ego, was vielleicht ganz förderlich ist für meine Überzeugungsarbeit.
»Jedenfalls haben die Schüler über mehrere Ziele abgestimmt. Die Schulleitung hat einige davon ausgewählt und entsprechende Unterkünfte an verschiedenen Orten reserviert. Leider gibt es im Schülerheim in Port-Grimaud nur 40 Plätze, dafür aber 65 Bewerber.«
»Und wo kämst du hin, wenn du keinen Platz dort bekommst?«, erkundigt sich Mama bange.
»An den Gardasee in Südtirol.«
»Eine wesentlich günstigere Option«, brummt Papa.
»Da will ich aber nicht hin«, protestiere ich. »Ach, und Ben hat sich übrigens auch für Südfrankreich beworben«, spiele ich schließlich meinen letzten Joker aus.
»Wie dem auch sei, in der derzeitigen Lage kommt eine Klassenfahrt keinesfalls in Frage«, bestimmt Torin in einer Weise, die keinen Widerspruch duldet.
Aber das kann ich nicht gelten lassen. »Ich bin fast erwachsen und ich gehe mit«, erkläre ich mindestens ebenso bestimmt, während ich zornig aufspringe.
Mit einem herrischen »Nein!« erhebt sich Torin und donnert dabei mit der Faust auf die Tischplatte, was unser Geschirr erzittern lässt. Inea greift nach seiner Hand.
Das Gespräch ist wesentlich schlimmer gelaufen, als ich befürchtet habe und da ich keine Möglichkeit mehr sehe, meinen Vater umzustimmen, verziehe ich mich eilig aus dem Esszimmer. Meine Mutter schien zwar nicht begeistert, doch bin ich mir sicher, dass sie mir beistehen wird. Vielleicht gelingt es Mama ja noch, Torin zu besänftigen.
Statt in mein Zimmer, laufe ich in die Küche. Trotz Suppe fühlt sich meine Kehle plötzlich ziemlich trocken an, außerdem könnte ich von dort meine Eltern besser belauschen. Doch als ich durch die Küchentür trete, geschieht etwas völlig Unerwartetes: Draußen hockt ein großer schwarzer Vogel auf dem Fensterbrett. Wahrscheinlich hätte es mich noch gerettet, wenn ich sofort die Augen zusammengekniffen hätte, doch der Schreck über die Bedeutung des Raben lässt meinen Blick automatisch zu meinem Schatten auf dem Mosaik aus roten, weißen und grauen Steinen des Küchenbodens wandern.
Warum muss die dumme Flurlampe auch so hell leuchten?, denke ich, während ich mich bereits dematerialisiere und ich noch vor dem nächsten Atemzug in meinen Schatten hineingezogen werde – ein grausiges Gefühl, als würde ich mich völlig auflösen.
An diese bizarre Empfindung, als würde sich mein ganzes Sein verflüchtigen, werde ich mich sicher niemals gewöhnen können. Da das letzte Mal nun schon eine Weile her ist, kämpfe ich mal wieder mit der aufsteigenden Panik.
Ruhig bleiben, Juli, und vor allem nicht bewegen.
Noch allzu gut kann ich mich an die unvorhersehbaren Ereignisse erinnern, als ich einen Wirbelsturm verursachte oder zu einem völlig anderen Ort sprang – was vor allem aus Angst und unvorsichtiger Hast heraus passierte. So etwas könnte ich jetzt absolut nicht gebrauchen. Ich konzentriere mich darauf, mein jetziges Sein zu erkunden, das mit dem Fußbodenmosaik verschmilzt: die raue, harte Beschaffenheit des Steins, die Fugen, in denen winzige Brösel längst verspeister Backwaren ihr unentdecktes Dasein fristen. Am Fensterbrett nehme ich eine Bewegung wahr: Der Rabe schwingt sich in die Lüfte, fliegt davon und lässt mich in meiner Misere zurück. Doch plötzlich weiß ich, warum er weggeflogen ist: Ein weiterer Schatten nähert sich vom Flur her.
»Juli?«
Schlagartig wird mir klar, dass meine Mutter kurz davor ist, mich als körperlosen Schatten auf dem Fußboden zu entdecken. Obwohl ich eigentlich keinen plausiblen Grund für die Panik nennen könnte, löst das eine spontane Fluchtreaktion bei mir aus. Mein Schatten-Ich huscht in die dunkelste Ecke hinter den Kühlschrank, was einen unwillkürlichen Ortswechsel zur Folge hat: Plötzlich befinde ich mich an einer glatten Wand, die vor langer Zeit mittels Magie aus dem Felsen herausgeschält wurde – das kann ich genau fühlen. Ein von dicken Säulen gestütztes Gewölbe trägt die Decke. In regelmäßigen Abständen hängen Laternen, deren Feuer ungewöhnlich helles Licht verbreitet. Fenster gibt es keine. Wie in unserer Küche bilden auch hier Steine ein Mosaik auf dem Boden, allerdings sind sie größer und die konzentrischen Kreise abgestufter Grautöne reichen bis ins Schwarze. All das nehme ich gleichzeitig, doch eher nebenbei wahr, denn vor allem ziehen die schweren Holztische meine Aufmerksamkeit auf sich. Darauf sind verschiedene Apparaturen angebracht, die ich nicht einordnen kann.
Bei einem davon drehen sich kupferne, kleine Zahnräder und ein Gewirr bunter Kabel mündet in einen Monitor. In einem Reagenzglas blubbert eine goldene Flüssigkeit, Schläuche verbinden verschiedene Kolben und Messgefäße miteinander. An anderer Stelle steht ein Terrarium, in dem sich kleine schwarze Spinnen über Fruchtfliegen hermachen. Weiter hinten im Saal entdecke ich einen Mann in weißem Kittel. Von seinem Gesicht kann ich nicht viel erkennen, da er eine Schutzmaske trägt, die mich an einen Schweißer erinnert. Seine Hände stecken in weißen Handschuhen, mit denen er einen Kolben über einem grünlichen Feuer schwenkt. Aus der violetten Flüssigkeit perlen kleine Blasen zur Oberfläche.
Wo bin ich hier nun wieder gelandet und was ist das für ein seltsames Labor?
Plötzlich prescht ein bulliger, schwarzer Hund auf mein Schatten-Ich zu. Sein wütendes Gebell hallt von den Wänden wider. Das Tier kann mir zwar nichts anhaben, doch mir ist alles andere als wohl zumute. Dieser Typ im weißen Kittel stellt seinen Messkolben beiseite und schaut bereits zu uns herüber.
Wie ich wohl aussehe als Wandschatten? Ob er mich von dort erkennt? Bestimmt kommt er gleich herüber, um zu erkunden, was diesen Schatten verursacht oder worüber sich der Hund so aufregt.
Kaum habe ich diesen Gedanken zu Ende gedacht, setzt sich der Mann bereits in Bewegung und zieht die Maske von seinem kantigen Gesicht. Genauer kann ich ihn nicht betrachten, da ich die Flucht ergreife. Schließlich habe ich absolut keine Lust, als eines seiner Versuchsobjekte missbraucht zu werden. Mein Schatten-Ich gleitet über die Wand, wird jedoch von einem massiven Holzregal gebremst. Es fühlt sich an wie eine Barriere.
Vielleicht komme ich dort wieder nach Hause …
Doch ich hätte lieber noch mal gründlich darüber nachdenken sollen, dann hätte ich mich vielleicht daran erinnert, was mir in dieser Höhle passierte, als mein Schatten-Ich gegen den Widerstand eines Holzbalkens anrannte. Mit der Gewalt meiner Willensanstrengung überwinde ich den Gegendruck, was bewirkt, dass plötzlich mein materieller Körper aus dem Schatten herauspurzelt, gegen die Regalwand knallt und zu Boden fällt. Glücklicherweise lande ich auf den Füßen, unglücklicherweise keinen Meter entfernt von der Bestie mit den scharfen Reißzähnen. Wütend knurrend macht der Hund einen Satz auf mich zu, während ich geistesgegenwärtig in den Raum hinein hechte, wo ich unter dem nächstgelegenen Tisch abtauche. Ich bekomme noch mit, wie das Tier mit dem Kopf voraus unsanft gegen die Regalwand knallt und sich schüttelt, während ich hastig unter dem Tisch hindurchkrabble.
»Bronko! Was ist los?«, knurrt der Mann im weißen Kittel, als er das Tier erreicht hat. Der Hund antwortet mit lautem Gebell und will die Verfolgung aufnehmen. Hastig krabbele ich auf der anderen Seite wieder heraus. Das Herrchen fixiert Bronko am Halsband, was ich noch sehen kann, bevor ich schon unterm nächsten Tisch abtauche. Dass die Beute offenbar dabei ist, zu entkommen, bringt den Hund schier um den Verstand. Sein wütendes Gebell lässt mir die Haare zu Berge stehen und im Geiste sehe ich bereits, wie sich seine Fangzähne in meiner Wade verbeißen.
»Aus!« Den Geräuschen zufolge versucht der Weißkittel vergeblich, das Tier zu bändigen. »Verflucht!«
Der Tisch hinter mir gerät ins Wanken und irgendein gläsernes Gefäß zersplittert auf dem Boden. Bronko jault auf.
»Jetzt reicht es!« Das Bellen des Tieres klingt nun ziemlich frustriert, als sein Herrchen es davonschleift. »Hunde haben in einem Labor einfach nichts zu suchen …«
Eine Tür wird entriegelt, geöffnet und wieder geschlossen, dann verhallt das dumpfe Gebell in der Ferne. Es wird still im Saal. Vorsichtig krabbele ich hervor und luge über die Tischkante. Von Weißkittel ist nichts mehr zu sehen, dennoch könnte er jede Minute wieder zurückkehren. Mein Puls rennt noch immer mit meinem Atem um die Wette. Aber um diesen Schock zu verdauen, bleibt mir keine Zeit. Ich muss dringend einen Weg hier rausfinden, am besten zurück in den Schatten, aber wo bitteschön soll ich hier einen Raben hernehmen?
Etwas gedämpft dringen seltsame Geräusche an mein Ohr, als zwitscherten hier irgendwo Vögel.
Oder war das eben nicht ein Affe?
Eine schlimme Ahnung steigt in mir empor, als mein Blick auf eine beschlagene Holztür fällt, die in der entgegengesetzten Richtung zu der liegt, wo der Weißkittel verschwunden ist. Obwohl hier im Moment niemand anwesend zu sein scheint, schleiche ich auf leisen Sohlen dorthin und schiebe den schweren Riegel zur Seite. Sowohl die leicht angerosteten Nägel im Schloss als auch die metallene Klinke, welche am Ende in eine gefächerte Kugel mündet, muten recht altertümlich an. Nervös lege ich meine Hand auf das kalte Metall und drücke die Klinke nieder. Während mir die Tür leicht knarrend entgegenkommt, werden die Tiergeräusche lauter. Vor mir windet sich eine Treppe in weiten Schleifen in die Höhe, welche von Laternen an den Wänden erhellt wird. Kaum habe ich die Tür hinter mir geschlossen, ertönt auf der anderen Seite ein metallisches Geräusch.
Wurde der Riegel etwa wieder vorgezogen?
Mein Test zeigt, dass sich die Tür von dieser Seite tatsächlich nicht mehr öffnen lässt. Da sich aber niemand so schnell genähert haben kann, muss entweder ein Mechanismus oder eine Magie den Riegel zugezogen haben, der den Zugang von außen versperrt.
Es hat wohl nicht jeder Zutritt zum Labor … Aber wo bin ich hier?
Zurück kann ich sowieso nicht mehr, daher steige ich die Treppe empor. Auch hier setzt sich das Mosaik aus konzentrischen Kreisen über die Stufen hinweg fort, wobei es sich über die abgerundeten Kanten emporwölbt. Die Streben des steinernen Geländers verbinden sich zu Formen von Sternen und Monden. Je höher ich steige, umso heller wird es. In einem Haus wären es sicherlich mindestens fünf Stockwerke, die es zu erklimmen gilt, bis ich schließlich leicht außer Atem oben an einem Rundbogen ankomme. Dahinter befindet sich genau das, was ich befürchtet habe: Ich blicke in einen hell erleuchteten großen Saal, dessen Decke wie im Keller von Säulen gestützt wird, doch statt Labortische befinden sich hier unzählige Zwinger, Terrarien und Käfige, in denen unglückliche Tiere vor sich hinvegetieren: Ich sehe Schlangen, große und kleine Affen, Hunde, Katzen, Kaninchen, Frösche, Insekten und Spinnen. Aber es sind auch Wesen darunter, die ich nicht kenne: bunte Riesenschnecken mit vielen Fühlern, eine Echse mit giftig gelben Stacheln auf dem Rücken, rote Minivögel, so groß wie Hummeln, und eine Menge ziemlich bizarrer Insekten und Würmer. Die Hunde befinden sich einzeln in ihren viel zu kleinen, übereinandergestapelten Käfigen, welche wie die der Affen in die Wand eingelassen sind. Mein Blick fällt voller Grauen auf eine junge Spuckschrecke, die in einem der gläsernen Terrarien gerade eine Maus in ihr Gespinst wickelt. Bei der Erinnerung an meinen Kampf mit einem wesentlich größeren Exemplar rinnt mir ein Gruselschauer den Rücken hinab.
Bedeutet das, ich bin hier wieder auf Atlatica? Zumindest muss dieses Labor mit dem Unheilwald in Verbindung stehen, sonst gäbe es hier keine Tiere von dort.
Das Gezwitscher stammt von Vögeln in Käfigen, welche von der Decke herabhängen. Darin flattern einige bunte, mir unbekannte Vögel umher, aber wo anders entdecke ich auch Spatzen, Eulen und einen Raben.
Ein Rabe!
Hastig senke ich den Blick, um rasch aus diesem Albtraum in meinen Schatten zu flüchten, doch da ist nichts. Der Saal wird von allen Seiten viel zu hell erleuchtet, um irgendeinen Schatten zu werfen. Ich forme meine Hände zu einer Kugel und blicke vom Raben zur Dunkelheit in der Kuhle, doch das reicht als Schatten offenbar nicht aus.
Mist! Wenn schon mal der seltene Fall eintritt, dass ich Schatten sein will, dann klappt es nicht.
Es bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen Ort weiter zu erkunden und hier nach einem Ausweg zu suchen. In der Kombination mit dem Labor im Keller wird ziemlich klar, dass es sich bei diesen bedauerlichen Wesen um Versuchstiere handelt.
Mai würde ausrasten, wenn sie das sehen könnte …
Im Gegensatz zum Gewölbekeller gibt es hier sehr wohl verglaste Fenster, die bizarr und unförmig die natürlich vorhandenen Löcher der äußeren Felswand ausfüllen. Beispielsweise zieht sich ein handbreiter, verglaster Spalt vom Fußboden bis weit über die Decke hinaus. An den Rändern erkennt man, dass gut ein halber Meter massives Gestein den Innenraum von der Außenwelt trennt.
Wie es scheint, befinde ich mich hier nicht in einem normalen Haus, sondern in einem Berg.
Irgendwo muss es doch einen Ausgang geben.
Draußen breitet sich ein Meer an Baumkronen unter meinen Füßen aus, nur unterbrochen von einigen herausragenden Baumriesen, die eine äußerst ungute Erinnerung in mir hervorrufen. Die Befürchtung, die sich in meinem Hinterkopf manifestiert hat, mag ich aber noch nicht fassen und ich weigere mich, diesen Gedanken weiter nachzugehen. Jetzt muss ich mich erst einmal darauf konzentrieren, hier wieder rauszukommen.
Vielleicht wollte man mich genau hierhinbringen, als ich zusammen mit Sandro unfreiwillig nach Atlatica teleportiert wurde. Dann wäre das da unten der Unheilwald.
Jetzt habe ich doch darüber nachgedacht, obwohl ich es eigentlich vermeiden wollte.
Ob Sandro auch hier ist?
Mein dummes Herz vollführt einen kleinen Hüpfer, aber das kann ich jetzt nicht gebrauchen, ich muss mich konzentrieren.
Zur Bergseite hin gibt es eine kleine Holztür, eine weitere, aber große beschlagene Tür, befindet sich gegenüber der Wand mit dem Rundbogen. Die kleine Tür wirkt harmloser, deshalb schaue ich zunächst hier nach, was sich dahinter verbirgt. Ich trete in ein bis zur Decke gefülltes Lager mit Tiernahrung. Auch an die Entsorgung wurde gedacht: Aus den Tiefen eines Brunnenschachts entweicht der blumige Duft, den Mugoks bei der Fäkalienverwertung produzieren. Ein Wandbrunnen wird mit frischem Wasser gespeist. Zwar war es anders gedacht, als ich in die Küche gehen wollte, um ein Glas Wasser zu trinken, aber nun muss dieser Brunnen eben dafür herhalten.
Zur Not könnte ich mich in dieser Vorratskammer verstecken, bis es draußen dämmert. Dann werden sie ja wohl das Licht ausschalten und ich werfe vielleicht doch mal einen Schatten. Alle Laternen brennen auch hier drin viel zu hell und ich kann nirgends so etwas wie einen Lichtschalter entdecken.
Ich könnte alle Laternen zerstören (bis auf eine), damit diese dann einen schönen Schatten wirft.
Doch das wäre ein ziemlich rabiates und geräuschvolles Vorgehen, daher bestünde die Gefahr, entdeckt zu werden. Mit diesen Gedanken verlasse ich das Vorratslager und wende mich der anderen Tür zu. Auch sie ist nicht verschlossen und führt in einen langen fensterlosen, aber von Laternen erhellten Säulengang, von dem aus rechts und links mehrere Türen abgehen. Kaum bin ich drei Schritte gegangen, öffnet sich die Pforte am anderen Ende des Flurs. Aus dem hellen Tageslicht, das von draußen hereinfällt, tritt ein Mann, der seit unserer letzten Begegnung meine Alpträume um eine Figur bereichert: der rotbärtige Törku!
Ich stehe schon zu weit im Gang, um mich rechtzeitig zurückzuziehen, sodass mich der Handlanger des zwielichtigen Lords sofort entdeckt. Er starrt mich einen Atemzug lang genauso verblüfft an wie ich ihn.
O Gott, was mache ich denn jetzt?
Ich kann mich weder verstecken noch gibt es von hier aus eine Fluchtmöglichkeit.
Aber vielleicht kann mir ein wenig Chaos helfen …
Blitzartig wende ich mich um und kehre zurück in den Versuchstiersaal.
»Halt! Ftopp!«, ruft Törku fispelnd.
Doch ich verliere keine Zeit: Zuerst öffne ich den Käfig mit den Katzen, die offenbar schon darauf gewartet haben, denn sie verlassen eilig ihr Gefängnis. Als nächstes kommen die Hunde dran. Zum Glück lassen sich die Riegel schnell und leicht zur Seite schieben, sodass ich gut zwei Türen gleichzeitig öffnen kann. Die Tiere jagen bellend umher und aus dem Saal hinaus.
»He, waf ift denn daf?«, ruft Törku von draußen. »Weg du Köter!« Ein Hund knurrt. Offenbar hat sich Rotbart bei den Tieren nicht besonders beliebt gemacht. Akribisch fahre ich fort, auch die Affen, Kaninchen und Vögel in die Freiheit zu entlassen. Nur die Frösche und Insekten fänden es außerhalb ihres Terrariums wahrscheinlich nicht besser als drinnen und auf die Gesellschaft der Spuckschrecke, der Spinnen und Schlangen verzichte ich ebenfalls. Die unbekannten Tiere lasse ich vorsichtshalber auch lieber drinnen. Während ich die weißen Mäuse befreie, hüpft mir ein braunes Äffchen, wie das von Pippi Langstrumpf, auf die Schulter und verwurschtelt mein Haar, als wollte es mich lausen. Aber das kann ich gerade nicht gebrauchen. Ich versuche das Tier zu packen, doch es weicht mir geschickt aus und hangelt sich über meinen Rücken zur anderen Schulter. Unterdessen bricht im Flur ein ziemlicher Tumult aus. Aus dem Hundegebell und Affengekreische lassen sich die Schreie der Männer kaum noch heraushören, dennoch glaube ich, nun auch Barenaks Stimme zu erkennen. Mein Herz donnert vor Aufregung gleichermaßen wie vor Anstrengung, denn es ist gar nicht so leicht, an all die hängenden Vogelkäfige heranzukommen, um sie zu öffnen.
»Mann, Mann, Mann«, krächzt der weiße Ara, den ich gerade in die Freiheit entlasse, was verdächtig nach dem Gehilfen mit der Halbglatze klingt. Der Ara segelt auf meine freie Schulter und pickt schmerzhaft nach meinem Ohr.
»Hey! Ist das der Dank für die Rettung!?«, schimpfe ich und versuche ihn zu verscheuchen, wobei ich unerwartete Unterstützung vom Äffchen erhalte. Es schwingt sich über meinen Rücken und packt den Ara am Bein. Der Vogel pickt einmal auf den Affen ein, flüchtet dann aber fluchend auf den Käfig: »Vermoxtes Viehzeug hier drin! Euch werd’ ich’s zeigen! Porschott!«
Das lässt mich erahnen, was die Tiere hier durchmachen mussten. Kein Wunder, dass der Ara nicht gut auf Menschen zu sprechen ist. Immerhin differenzieren die Hunde und Affen da schon mehr, denn ihre Peiniger haben hörbare Probleme, mit der knurrenden, bellenden und beißenden Meute fertigzuwerden.
Ich recke mich gerade zu dem Käfig, in dem golden schillernde kleine Vögel umherflattern, als eine schwarz-braun gefleckte Katze zwischen meinen Beinen hindurchjagt, um eine Maus einzufangen. Beinahe wäre ich über sie drüber gestolpert, auf den Zehenspitzen tänzelnd kann ich mich aber doch noch irgendwie halten. Mittlerweile habe ich bestimmt über hundert Mäuse, zwanzig Kaninchen und fünfzehn Katzen befreit, die über den Fußboden wuseln. Ein Affe nutzt einen leeren Vogelkäfig als Schaukel, während die ehemaligen Bewohner zwitschernd um ihn herumflattern. Nur die Eulen verlassen ihre Käfige nicht, denen ist es wahrscheinlich zu hell hier drin. Übrig bleibt nur ein Rabe. Da ich ihn unbedingt noch brauche, möchte ich ihn mitsamt seinem Käfig mitnehmen, auch wenn dieser so eng ist, dass er darin nicht mal seine Flügel ordentlich ausstrecken kann.
Die armen Tiere, denke ich dabei immer wieder.
Um an die Aufhängung zu gelangen, stapele ich so schnell wie möglich mehrere Käfige übereinander und klettere dann obendrauf. Während ich den Ring vom Haken nehme, der an einer Kette von der Decke hängt, öffnet der Rabe angriffslustig seinen Schnabel und versucht, durch die Gitterstäbe nach mir zu picken.
»Ganz ruhig, ich tu dir nichts …«, versuche ich, ihn zu besänftigen, was mir kaum gelingt, weil ich selbst viel zu aufgeregt und außer Atem bin.
»Hey! Waf machft du da?«
Mist, die bärtige Fispelstimme hat es hereingeschafft.
Das Gebell im Flur ist verstummt.
Jetzt wird es brenzlig.
Obendrein tritt in diesem Moment der Weißkittel durch den Rundbogen. »Was geht hier vor sich?«, ruft er entsetzt wie zornig gleichermaßen, was im wütenden Gebell des schwarzen Hundes an seiner Seite untergeht.
Mehr fallend als springend klettere ich von den Käfigen herunter, wobei meine Finger den Ring des Rabenkäfigs umklammern. Der Vogel krächzt und flattert, weil ich ihn dabei leider nicht besonders sanft umherschlenkere.
»Bronko! Fass!«, befiehlt Weißkittel.
Ich bin sicher, dass er den Hund gerade auf mich loslässt, und ich kann seine Zähne fast schon in meinem Nacken spüren, was ich aber nicht sehe, denn ich hechte auf den anderen Ausgang zu, den allerdings nun Halbglatze und Rotbart blockieren. Ungute Erinnerungen durchzucken mich, wie mir diese beiden auf meiner Flucht durch Atlatica das Leben schwergemacht haben.
Mist! Wie komme ich jetzt da durch?
Für irgendwelche Manöver bleibt mir keine Zeit, deshalb renn-hüpfe ich geradewegs auf die beiden zu, indem ich mich darauf konzentriere, meine Füße auf die freien Bodenstellen zu platzieren, zwischen Kaninchen und umherwuselnden Mäusen, die noch immer von Katzen gejagt werden. Dabei quäkt der kleine Affe in mein Ohr und macht mich ganz wirr im Kopf. Die beiden Kerle strecken bereits ihre Arme aus, während sie mir entgegentreten, da fällt mir in meiner Not nichts Besseres ein, als die einzige Waffe zu nutzen, die ich im Moment bei mir trage: Ich hole mit dem Rabenkäfig aus und schleudere ihn Rotbart um die Ohren, der ohnmächtig gegen Halbglatze knallt. Diesen trifft der Käfigboden noch an der Nase. Er kippt gekrümmt zur Seite und gibt mir den Weg in den Flur frei. Der Rabe tut mir wirklich leid, weil er ziemlich blöd herumgeschleudert wurde, aber jetzt muss ich erst mal hier raus. Kaum bin ich im Flur angekommen, wende ich mich geistesgegenwärtig um, als Bronko schon abhebt, um sich auf mich zu stürzen. Ich packe die Tür und knalle sie gerade noch rechtzeitig schwungvoll ins Schloss, sodass der Hund aufjaulend gegen das Holz kracht.
Mein ganzer Leib vibriert von dem Adrenalin in meinen Adern. Ich wende mich wieder um und sprinte mit dem Rabenkäfig in der Hand zur Pforte am Flurende. Ein Schimpanse hockt dort auf der Klinke und schwingt mit der Tür hin und her. Von dort strömt helles Tageslicht herein. Die anderen Hunde und Affen sind verschwunden, nur noch einige Katzen, Vögel und Kaninchen flüchten dem Ausgang entgegen. Ich höre, wie die Tür hinter mir wieder geöffnet wird und Bronko abermals die Verfolgung aufnimmt. Sein wütendes Gebell klingt nun allerdings schon leicht frustriert.
»Bleib sofort stehen!«, ruft Weißkittel, aber so kurz vor dem Ziel denke ich gar nicht daran, mich zu ergeben. Der Affe an der Pforte hat nun ebenfalls die Flucht nach draußen ergriffen und ich folge ihm. Endlich trete ich ins Freie, doch in Sicherheit bin ich noch lange nicht.
Pips
Juli, irgendwo, Sonntag, 30. Mai
Ich stehe in der Kuhle eines Felshangs und kann gar nicht anders, als darüber zu staunen, dass man von außen rein gar nichts von den Räumlichkeiten im Inneren des Berges erahnt. Selbst die Pforte ist auf dieser Seite so mit Felsgestein verkleidet, dass man keinerlei Eingang erkennt, nachdem ich sie zugezogen habe. Nicht einmal ein ordentlicher Weg führt von hier fort. Leider steht die Sonne so ungünstig hinter einer von knorrigen Bäumen gesäumten Felsnase, dass ich an meinem Platz schon wieder keinen eigenen Schatten werfe, aber ein Stück weiter vorne müsste es gehen, zumindest, wenn mir die Wolken keinen Strich durch die Rechnung machen. Sie bedecken immerhin große Teile des Himmels und rücken bereits gefährlich nahe an die Sonne heran. Hastig kämpfe ich mich zwischen dornigen Sträuchern hindurch, quer bergauf, über raues Felsgestein. Kalter Schweiß rinnt mir über die Schläfe und mein Atem geht stoßweise.
Wann komme ich endlich fort von hier?
Auf gar keinen Fall will ich nochmal durch diesen schrecklichen Unheilwald flüchten müssen. Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich hierbei um das Hauptquartier auf Atlatica handeln muss, in das man mich ursprünglich verfrachten wollte.
Schon höre ich, wie sich die Pforte zum Versteck öffnet und Bronkos Gebell wieder anschwillt. Noch zwei Meter trennen mich vom Sonnenfleck.
Keuchend springe ich über die Felsen, dann taucht mich die Sonne endlich in ihre hellen Strahlen. Eilig stelle ich den Käfig ab und öffne das Türchen – das bin ich dem armen Vogel auf jeden Fall noch schuldig. Ungläubig legt er den Kopf schief, bevor er in die Eingangsluke hüpft. In diesem Moment ändert sich jedoch das Licht, weil sich allmählich die Ränder einer Wolke vor die Sonne schieben. Noch immer scheint sie schwach hindurch, doch Bronko ist schon gefährlich nahegekommen. Panisch schaue ich von dem Raben, der sich gerade in die Lüfte erhebt, auf meinen verblassenden Schatten. Ein Sog setzt unmittelbar ein, doch fällt er wesentlich schwächer aus, als ich es gewohnt bin. Mein Selbst dematerialisiert sich sozusagen in Zeitlupe, was vor allem auch deshalb problematisch ist, weil meine Verfolger gefährlich nahekommen und auf diese Weise den Vorgang beobachten können. Schon jagt Bronko kläffend durch mich hindurch, was ich als leichtes Ziehen in meinen Beinen spüre, doch der Hund kann den weiteren Vorgang zum Glück nicht aufhalten.
»Zum Donner!«, ruft der Weißkittel aus.
Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn die Wolke die Sonne komplett verdeckt hätte, bevor ich vollständig vom Schatten absorbiert worden wäre. Womöglich hätte mein Körper als transparentes Wesen weiterexistiert, während mein Bewusstsein schon an meinen unvollständigen Schatten gebunden wäre – eine grässliche Vorstellung.
Zum Glück blinzelt die Sonne nochmal kräftig durch, was den Rest von mir in meiner zweidimensionalen Existenz auf dem mit trockenem Gras und Flechten besetzten Felsgestein verankert. Die irre Sache ist, dass mich Bronko nun wie besessen zu fangen versucht, indem er auf mir herumspringt. Dabei gleitet jedoch ein Teil meines Schatten-Selbst über sein Fell, seine Ohren, seine gefletschten Zähne. So verschmelze ich ein wenig mit seiner Existenz, fühle die verzweifelte Wut über die entgangene Beute, das kurze schwarze Haar, das seinen muskulösen Körper bedeckt, aber auch einen Fremdkörper, der irgendwo im Inneren des Tieres sein Unwesen treibt. Bevor ich noch tiefer dort hineinfühlen kann, verschwindet die Sonne nun gänzlich hinter der Wolke, was mein Schattenbewusstsein mit einem Mal auf die gesamte Landschaft ausweitet. Eine nie dagewesene Empfindung durchflutet mich: Bäche fließen durch mich hindurch, ich bin die kleinen Käfer auf dem Boden, genauso wie die Pflanzen und Steine, ja jedes kleine Krümelchen Erde kann ich in mir fühlen. All das wirkt so dermaßen befremdlich auf mich, dass ich es schon wieder mit der Angst zu tun bekomme, außerdem will ich endlich nach Hause. Dieses Mal muss es mein Wille gewesen sein, der den Wechsel ausgelöst hat, denn plötzlich falle ich aus meinem Schatten heraus und lande rücklings in meinem Bett.
Hier bleibe ich erst einmal hechelnd liegen.
Bin ich tatsächlich wieder zurück?
Die erlebten Szenen ziehen im Zeitraffer an meinem geistigen Auge vorüber. Völlig geplättet von dem Erlebten verharre ich bewegungslos auf meinem Bett, bis mich plötzlich eine winzige Hand aus der Versenkung reist, die nach meiner Nase greift. Schockiert fahre ich hoch und starre das kleine Äffchen an, welches auf meinem Kopfkissen hockt und mit neugierigen Augen zu mir hochschaut. Ich blinzele verwirrt, um noch mal genauer hinzusehen.
»Das kann doch nicht wahr sein …«, hauche ich fassungslos.
Der Affe hockte vorher auf meiner Schulter, aber ich hatte anderes zu tun, als mich auf ihn zu konzentrieren, so habe ich nicht bemerkt, was mit ihm passiert ist, als ich in meinen Schatten gezogen wurde. Ganz offensichtlich habe ich ihn dabei mitgenommen, anders lässt sich das kleine Felltier in meinem Bett kaum erklären. Der Affe hat sich mittlerweile wohl von seinem Schock erholt und beginnt nun, mein Zimmer zu erkunden, lässt sich vom Bett auf das Parkett heruntergleiten, um an meinem flauschigen Rundteppich zu zupfen. Ein paar Fusseln steckt er sich in den Mund.
»Lass das, Pips!«, rufe ich kopfschüttelnd.
Pips! Ja, der Name passt gut.
Meine Ermahnung war aber ohnehin überflüssig, denn die Fusseln schmecken ihm nicht, deshalb streift er sie sich mit den Fingern von der Zunge ab, um sie auf meinen Parkettboden zu schmieren.
Wahrscheinlich ist er hungrig.
Pips erklimmt den Bürostuhl, um von hier aus über mein Matheheft auf dem Schreibtisch zu spazieren. Neugierig klappt er eine Seite um und zieht dann daran.
»O nein, lass das mal lieber!« Ich springe auf und eile auf ihn zu, was Pips jedoch erschreckt. Bei seiner Flucht reist er mein immerhin leeres Wasserglas von der Arbeitsplatte. Es knallt zu Boden, wobei ein Stück herausbricht, der Rest des Glases kullert übers Parkett.
Oje, das kann ja lustig werden …
Gerade, als ich die Scherbe und das kaputte Glas aufhebe, fliegt meine Zimmertür auf.
»Du bist ja doch da!«, ruft Mama verblüfft. »Hast du dich in deinem Zimmer versteckt oder wie kommst du hier herein, ohne dass wir es sehen konnten?«
»Äh, ja …«, stammele ich, als Pips plötzlich unter meinem Bücherregal hervorprescht und an meiner Mutter vorbei in den Flur flüchtet.
Mama quiekt erschrocken auf. »Was war denn das?« Ihre Stimme überschlägt sich beinahe.
»Ein Affe«, antworte ich, als würde das schon alles erklären, wobei ich meiner Mutter in den Flur folge, dem Ausreißer hinterher.
»Da, in der Küche!« Ich deute zu dem kleinen Kerl, der mit einem Möhrenstück zwischen den Zähnen über den Fußboden zur Durchreiche hüpft.
»Pips! Bleib hier!«, rufe ich. Als wir in die Küche stürmen, hockt der Affe oben auf dem Geschirrschrank und knabbert genüsslich an seiner Beute.
»Och, der ist ja goldig!«, ruft Mama entzückt. »Aber wie kommt ein Affe in dein Zimmer? Woher hast du ihn?« Inea mustert mich eindringlich.
»Ich, äh, ja … Der muss irgendwo ausgebrochen sein. Plötzlich war er auf meinem Balkon …«
»Wir können ihn auf keinen Fall behalten. So ein Tier braucht Platz und viele Klettermöglichkeiten.«
»Jaja, ich weiß …« Und doch bin ich ein bisschen traurig darüber. Pips ist so ein süßer kleiner Affe. Der lange, hellbraune Schwanz mündet in einem schwarzen Büschel und die weißen Kreise um die Augen ähneln einer Brille. Seine winzigen Finger bewegt er mindestens genauso geschickt wie ein Mensch.
Ich wundere mich, dass sich Torin noch nicht blicken lässt und luge in den Flur hinaus. »Wo ist eigentlich Papa?«
»Er trifft sich mit Markus zu Männergesprächen, aber sag mal, du siehst ja aus, als hättest du dich durch den Dschungel geschlagen.« Sie pickt ein dorniges Blatt von meinem Shirt und streicht mir das verwurschtelte Haar zurück. »Und was ist da passiert?« Inea deutet auf das Blut an meinem Ohr, wo mich der weiße Ara gebissen hat.
»Ähm, na ja, Pips ist nicht ganz zu mir gekommen, ich bin ein bisschen hinter ihm her geklettert …«, lüge ich
»Von deinem Balkon aus?«, ruft Inea entsetzt.
Wenn ich so weitermache, werde ich mich heillos in Widersprüchen verstricken.
»Nein, das nicht … ich … aber ist doch jetzt wohl auch egal«, brumme ich entnervt. »Mir geht’s gut, darauf kommts an, oder?«
»Ja, schon …« Meine Mutter seufzt. Vielleicht sollte ich ihr endlich die Wahrheit erzählen, aber andererseits würden mich meine Eltern ganz sicher nicht mehr mit auf die Klassenfahrt lassen, wenn sie wüssten, was für unkontrollierte und gefährliche Schattenreisen ich unternehme.
Bevor sie das Thema weiter vertiefen kann, wechsele ich es lieber: »Was ist denn jetzt eigentlich mit Papa? Ist er noch immer dagegen, dass ich mit auf die Klassenfahrt gehe?«
»Ich sage es mal so, mir ist auch nicht wohl bei der Sache, aber wir können dich unmöglich für immer hier einsperren. Ich habe deinem Vater klargemacht, dass das einem lebendigen Tod gleichen würde, da hat er schließlich eingelenkt. Allerdings will er Markus bitten, mitzureisen, um auf dich aufzupassen.«
Der Gedanke, dass Bens Vater mein Kindermädchen spielt, behagt mir nicht besonders, aber wenn mir diese Lösung die Teilnahme an der Klassenfahrt ermöglicht, dann soll es mir recht sein.
Ich werde schon einen Weg finden, ihn abzuschütteln.
»Prima!«, freue ich mich.
»So, aber jetzt müssen wir unbedingt eine Lösung für den Affen finden«, meint Inea. »Wir sollten eine Anzeige in der Zeitung schalten. Irgendwo muss das Tier doch vermisst werden.«
Unterdessen nehme ich einen Apfel aus der Obstschale und schneide ihn in kleine Stückchen. Eines davon strecke ich Pips entgegen. Diese Leckerei will er sich nicht entgehen lassen. Mit einem Satz landet er auf meiner Schulter und zieht das Apfelstück aus meinen Fingern.
»Was ist das überhaupt für eine Affenart?«, will Mama mit dem Telefon in der Hand wissen.
»Keine Ahnung. Lass mich mal nachforschen.« Ich kehre in mein Zimmer zurück und schalte meinen Rechner ein. Für Pips stelle ich eine Schale mit Apfelstücken auf den Boden, so ist er wenigstens beschäftigt.
Im Internet finde ich heraus, dass es sich um ein Totenkopfäffchen handelt – so ein blöder Name für das goldige Tier. Jedenfalls leben sie in großen Gruppen in Mittelamerika und dürfen nicht alleine gehalten werden. Es wundert mich wenig, dass die Affen sehr viel Freiland mit ausreichend Klettermöglichkeiten benötigen – im Grunde so ziemlich das Gegenteil der Gegebenheiten im Tierversuchslabor. Man müsste ihn also entweder in den Regenwald bringen oder in einen guten Zoo, wo es schon eine Gruppe solcher Affen gibt. Ich schaue mir die Seite vom Zoo in Frankfurt an und werde fündig: Im Grzimek-Haus halten sie Totenkopfaffen – das ist sicher nicht optimal aber doch besser als bei mir oder in diesem Tierlabor. Außerdem ist ja auch fraglich, ob er in der freien Natur überleben könnte, nachdem er womöglich sein ganzes Leben in Gefangenschaft verbracht hat.
»Mama!«
Mit dem Telefonhörer am Ohr kommt sie herein. »Ja, gut, wir kommen gleich morgen früh vorbei …« Inea legt auf und sieht mich an. »Ich habe gerade mit der Leitung vom Frankfurter Zoo telefoniert. Wir können den Affen morgen vorbeibringen. Da man Totenkopfaffen nicht ohne Genehmigung halten darf, und schon gar nicht einzeln, müsste ein privater Halter registriert sein«, erklärt sie, was ich bereits ebenfalls recherchiert habe. »Es wurde aber kein entlaufener Affe gemeldet, deshalb kann er im Zoo bleiben.«
»Ja, okay …«, antworte ich etwas traurig. Gerade habe ich angefangen, mich an Pips zu gewöhnen, aber es steht natürlich außer Frage, dass er in grünen Bäumen mit seinen Artgenossen rumklettern sollte, statt alleine in meinem Zimmer.
»Bis morgen hast du ihn ja noch. Ich hoffe nur, er lässt die Wohnung so lange heil. Dann kümmere ich mich jetzt mal um eine Transportkiste.«
»Ja, gut …« Nun schnappe ich mir das Telefon. Ich habe jede Menge Redebedarf mit meiner besten Freundin, außerdem muss ich ihr unbedingt Pips präsentieren, so lange er noch da ist.
Wie zu erwarten staunt Mai Bauklötze, als ich ihr die Geschehnisse des Tages präsentiere. Wir hocken gemeinsam quer in meinem Bett, mit dem Rücken an der Wand, und schauen Pips dabei zu, wie er Salatblätter und Bananenstücke in sich reinstopft. Maila kann sich kaum zurückhalten, meinen Bericht immer wieder durch Rufe des Entzückens über den kleinen Pips zu unterbrechen, doch als ich zum Part mit den gefangenen Labortieren gelange, reagiert sie zutiefst empört: »Wie kann man lebendigen Wesen nur so etwas antun? Du hast sie doch hoffentlich alle freigelassen, oder?«