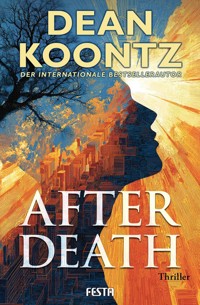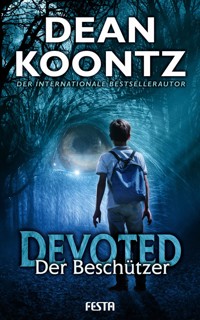7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Odd Thomas
- Sprache: Deutsch
Das Böse lauert in einem einsamen Kloster
Eine windumtoste Abtei, verlassen in den Bergen der Sierra Nevada: Dies scheint Odd Thomas nach dem gewaltsamen Tod seiner Freundin der ideale Zufluchtsort zu sein. Hier will er Ruhe finden. Doch dann verschwindet ein Mönch spurlos. Und Bodachs tauchen auf, bösartige Schattenwesen und Vorboten blutiger Katastrophen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Für ein paar Leute, die ich schon seit Langem kenne und bewundere, weil sie gute Arbeit leisten und gute Menschen sind: Peter Styles, Richard Boukes, Bill Anderson (Hallo, Danielle!), Dave Gaulke und Tom Fenner (Hallo, Gabriella, Katia und Troy!). Drüben, auf der anderen Seite, werden wir irgendwann einmal ein tolles Fest feiern – aber das hat keine Eile.
Lehre uns … zu geben und die Kosten nicht zu scheuen, zu kämpfen, ohne auf die Wunden zu achten, uns abzumühen, ohne Ruhe zu suchen …
Ignatius von Loyola
1
Umgeben von Gemäuer und in Schweigen gehüllt, saß ich an meinem hohen Fenster, während der dritte Tag der Woche in den vierten überging. Der Fluss der Nacht strömte weiter, ohne sich um den Kalender zu kümmern.
Ich hoffte, jenen magischen Augenblick zu erleben, in dem richtig Schnee zu fallen beginnt. Vor einer Weile hatte der Himmel schon einige Flocken verloren, dann war jedoch nichts mehr gekommen. Der nahende Sturm ließ sich nicht hetzen.
Das Zimmer war nur von einer dicken Kerze erleuchtet, die in einem bernsteinfarbenen Glas auf dem Ecktisch stand. Jedes Mal, wenn ein Luftzug die Flamme fand, übergoss das schmelzende Licht die Kalksteinwände mit einem buttergelben Schein, während Wellen aus flüssigen Schatten in die Ecken strömten.
In den meisten Nächten ist Lampenlicht mir zu hell. Wenn ich schreibe, leuchtet nur der Bildschirm, den ich so schwach eingestellt habe, dass graue Buchstaben auf einem marineblauen Untergrund erscheinen.
Da das Fenster nicht von Licht versilbert wurde, sah ich kein Spiegelbild meines Gesichts. Ich hatte einen klaren Blick auf die Nacht jenseits der Scheiben.
Lebt man in einem Kloster, so hat man mehr Möglichkeiten als anderswo, die Welt so zu sehen, wie sie ist, statt durch den Schatten hindurch, den man auf sie wirft. Das gilt selbst, wenn man Gast ist und kein Mönch.
Die Abtei St. Bartholomew lag mitten in der weiten Berglandschaft der Sierra Nevada, auf der kalifornischen Seite der Grenze. Der Wald, der die Hänge bedeckte, war in Dunkelheit gehüllt.
Von meinem Fenster im zweiten Stock aus konnte ich nur einen Teil des breiten Vorhofs und die Asphaltstraße erkennen, die ihn durchschnitt. Vier glockenförmige Lampen auf niedrigen Pfosten warfen einen bleichen, kreisförmigen Schein.
Das Gästehaus ist im nordwestlichen Flügel des Klosters untergebracht. Im Erdgeschoss befinden sich Gemeinschaftsräume, in den beiden oberen Stockwerken die Gästezimmer.
Während ich auf das Unwetter wartete, glitt etwas Weißes, das kein Schnee war, über den Hof aus der Dunkelheit ins Lampenlicht.
Die Abtei besitzt einen Hund, einen etwa fünfzig Kilo schweren Schäferhundmischling, zu dessen Vorfahren möglicherweise ein Labrador gehört. Er ist vollständig weiß und bewegt sich mit der Anmut eines Nebelstreifs. Sein Name ist Boo.
Mein Name ist Odd Thomas. Meine geschiedenen Eltern behaupten, bei der Ausstellung der Geburtsurkunde sei ein Fehler unterlaufen, denn ich hätte eigentlich Todd heißen sollen. Dennoch haben sie mich kein einziges Mal so gerufen.
In meinen einundzwanzig Lebensjahren habe ich nie in Betracht gezogen, meinen Namen in Todd umzuändern. Der bizarre Lauf meines Lebens deutet darauf hin, dass ein entschieden merkwürdiger Name wie Odd besser zu mir passt, egal, ob meine Eltern ihn mir absichtlich gegeben haben oder ob das Schicksal daran schuld ist.
Unter mir blieb Boo mitten auf dem Asphalt stehen und blickte den abschüssigen Fahrweg entlang, der schmaler werdend in der Dunkelheit verschwand.
Berge bestehen nicht vollständig aus Abhängen; gelegentlich macht die ansteigende Landschaft eine Pause. So steht auch die Abtei auf einer hoch gelegenen Wiese. Sie ist nach Norden ausgerichtet.
Da Boo die Ohren aufgestellt und den Kopf gehoben hatte, witterte er offenbar einen nahenden Besucher. Den Schwanz hatte er gesenkt.
Den Zustand seines Nackenfells konnte ich nicht beurteilen, doch seine angespannte Haltung wies darauf hin, dass es sich sträubte.
Die Lampen entlang des Fahrwegs brennen von der Dämmerung bis zum Morgengrauen. Die Mönche von St. Bart sind nämlich der Ansicht, man müsse nächtliche Besucher mit Licht willkommen heißen, auch wenn nur selten welche kommen.
Eine Weile stand der Hund reglos da, dann richtete er seine Aufmerksamkeit auf den Rasen rechts vom Fahrweg. Sein Kopf war nun gesenkt, die Ohren lagen eng an.
Zuerst sah ich nicht, was Boo derart beunruhigte. Dann kam eine Gestalt in den Blick, die so flüchtig war wie ein über schwarzes Wasser schwebender Schatten. Sie strich nahe genug an einem der Laternenpfähle vorbei, um kurz erkennbar zu sein.
Selbst bei Tageslicht wäre dies ein Besucher gewesen, den nur der Hund und ich wahrgenommen hätten.
Ich sehe tote Menschen. Es sind die Geister der Verstorbenen, die aus ihrem jeweils ureigenen Grund nicht bereit sind, diese Welt zu verlassen. Manche zieht es zu mir hin, weil sie Gerechtigkeit suchen, zum Beispiel, weil sie ermordet wurden, manche suchen Trost oder einfach nur Gesellschaft. Andere wenden sich aus Motiven an mich, die ich nicht immer begreifen kann.
Das macht mein Leben ganz schön kompliziert.
Ich bitte nicht um euer Mitgefühl. Wir haben alle unsere Probleme, und eure kommen euch genauso wichtig vor wie meine mir.
Vielleicht müsst ihr jeden Morgen eineinhalb Stunden lang zur Arbeit fahren, auf verstopften Autobahnen, auf denen ihr von ungeduldigen und unfähigen Leidensgenossen behindert werdet, von denen manche so wütend sind, dass ihr Mittelfinger von der häufigen Verwendung äußerst muskulös geworden ist. Stellt euch jedoch einmal vor, wie viel stressiger euer Morgen wäre, wenn auf dem Beifahrersitz ein junger Mann mit einer grausigen Axtwunde im Kopf säße und auf dem Rücksitz eine alte Frau, deren hervorquellende Augen und dunkelrotes Gesicht darauf hinweisen, dass ihr Mann sie erwürgt hat.
Die Toten sprechen nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Außerdem blutet ein von einer Axt getroffener Geist nicht aufs Polster.
Nichtsdestoweniger ist ein Gefolge aus kürzlich Verstorbenen nicht nur beunruhigend, es hebt auch nicht gerade die Stimmung.
Der Besucher auf dem Rasen war kein gewöhnlicher Geist, ja vielleicht gar kein Geist. Zusätzlich zu den auf der Erde verweilenden Geistern der Toten sehe ich noch eine andere Sorte übernatürlicher Wesen. Ich nenne sie Bodachs.
Sie sind pechschwarz, von fließender Gestalt und besitzen nicht mehr Substanz als Schatten. Obwohl sie so groß sind wie ein durchschnittlicher Mensch, schleichen sie häufig nah am Boden dahin wie Katzen. Dabei verhalten sie sich völlig geräuschlos.
Der auf dem Rasen der Abtei bewegte sich aufgerichtet fort. Er war schwarz und hatte keine erkennbaren Merkmale, und doch sah er aus wie etwas, das halb Mensch und halb Wolf war. Geschmeidig war er, glatt und finster.
Das Gras, über das er kam, regte sich nicht. Hätte er eine Wasserfläche überquert, so wäre nicht die kleinste Welle entstanden.
In der Sagenwelt der Britischen Inseln ist der Bodach ein abscheuliches Ungeheuer, das nachts durch den Schornstein ins Haus gleitet, um unartige Kinder mit sich fortzuschleifen. Man könnte fast meinen, er würde fürs Finanzamt arbeiten.
Was ich sehe, sind weder Bodachs noch Steuereintreiber. Diese Wesen schleppen auch weder unartige Kinder noch säumige Erwachsene mit sich fort. Aber ich habe gesehen, wie sie durch den Schornstein – oder auch durch Schlüssellöcher und den Spalt von Fensterrahmen – in Häuser eingedrungen sind, so anpassungsfähig wie Rauch, und ich weiß keinen besseren Namen für sie.
Ihr seltenes Erscheinen ist immer ein Grund zur Sorge. Sie scheinen eine Art übersinnliche Vampire zu sein, die sich von menschlichem Leiden nähren und in die Zukunft blicken können. Deshalb werden sie von Orten angezogen, an denen bald Gewalttaten oder schlimme Katastrophen geschehen werden.
Obwohl Boo ein tapferer Hund war, wofür er gute Gründe hatte, schreckte er vor der an ihm vorüberstreichenden Erscheinung zurück. Seine schwarzen Lippen öffneten sich und entblößten spitze weiße Zähne.
Das Phantom hielt inne, als wollte es den Hund verhöhnen. Offenbar wissen die Bodachs, dass manche Tiere sie sehen können.
Ich weiß nicht, ob sie wissen, dass auch ich sie sehen kann. Wenn sie es wüssten, würden sie wohl weniger Erbarmen mit mir haben als gewisse religiöse Fanatiker, wenn sie gerade in übler Laune sind.
Beim Anblick der Erscheinung war mein erster Impuls, vom Fenster zurückzutreten und mich zu den Staubflocken unter meinem Bett zu gesellen. Mein zweiter Impuls bestand darin, pinkeln zu gehen.
Statt der Feigheit oder dem Ruf meiner Blase nachzugeben, rannte ich aus meinem Zimmer auf den Flur. Hier, im zweiten Stock des Gästehauses, befanden sich zwei kleine Zimmerfluchten. Die andere war momentan unbewohnt.
Der Russe im ersten Stock, der immer finster blickte, tat das zweifellos gerade auch im Schlaf. Da das Kloster äußerst solide gebaut war, drangen meine Schritte sicherlich nicht in seine Träume ein.
Das Gästehaus besitzt eine Wendeltreppe aus Granitstufen, die von Steinwänden umschlossen sind. Da die Stufen abwechselnd schwarz und weiß sind, muss ich dort immer an Harlekine, Klaviertasten und einen kitschigen alten Song von Paul McCartney und Stevie Wonder denken.
Obwohl Steinstufen ziemlich hart sind und das schwarz-weiße Muster desorientierend wirken kann, rannte ich blindlings ins Erdgeschoss und nahm dabei in Kauf, den Granit zu beschädigen, falls ich stürzte und mit dem Schädel darauf aufschlug.
Vor sechzehn Monaten habe ich das verloren, was mir am meisten wert war. Seither liegt meine Welt in Trümmern, aber rücksichtslos verhalte ich mich sonst trotzdem nicht. Ich habe zwar weniger, wofür ich leben kann, als früher, doch mein Leben hat noch immer einen Zweck, und ich bemühe mich, in jedem einzelnen Tag Sinn zu finden.
Ich hinterließ die Treppenstufen in dem Zustand, in dem ich sie vorgefunden hatte, und eilte durch den großen Aufenthaltsraum, wo nur eine Nachtlampe mit perlenverziertem Schirm das Dunkel milderte. Dann stieß ich eine schwere Eichentür mit einem bunten Glasfenster auf und sah, wie mein Atem in der Winternacht eine Wolke bildete.
Der Kreuzgang des Gästehauses umgibt einen Hof mit einem spiegelnden Wasserbecken und einer weißen Marmorstatue des heiligen Bartholomäus. Der ist wahrscheinlich der am wenigsten bekannte unter den zwölf Aposteln.
Ernst steht der Heilige hier auf seinem Sockel, die rechte Hand auf dem Herzen, den linken Arm ausgestreckt. In der nach oben gewandten Handfläche dieses Arms liegt etwas, das aussieht wie ein Kürbis.
Welche symbolische Bedeutung der Kürbis hat, ist mir völlig schleierhaft.
Angesichts der Jahreszeit war das Wasserbecken leer. Auch der Duft von nassem Kalkstein, der in wärmeren Tagen von ihm aufsteigt, war nicht wahrzunehmen. Stattdessen roch ich eine Spur von Ozon, wie sie nach einem Blitzschlag im Frühlingsregen auftritt. Obwohl ich mich darüber wunderte, ging ich unbeirrt weiter.
Durch den Säulengang erreichte ich die Tür des Empfangszimmers, durchquerte den dunklen Raum und trat durch die Vordertür des Klosters wieder in die Dezembernacht.
Unser weißer Schäferhundmischling Boo stand noch genau so auf dem Fahrweg, wie ich ihn von meinem Fenster im zweiten Stock aus gesehen hatte. Während ich die breite Vordertreppe herunterkam, drehte er mir den Kopf zu, um mich anzublicken. Seine Augen waren klar, blau und ohne jede Spur des gespenstischen Glänzens, das nachts im Blick von Tieren liegt.
Da weder Mond noch Sterne schienen, verschwand der weite Hof großteils im Dunkel. Falls dort irgendwo ein Bodach lauerte, konnte ich ihn nicht sehen.
»Boo, wo ist er hin?«, flüsterte ich.
Der Hund gab keine Antwort. Mein Leben ist zwar seltsam, aber doch nicht so seltsam, dass ich mit Tieren sprechen könnte.
Allerdings trat der Hund vorsichtig vom Asphalt auf den Rasen. Dort ging er nach Osten, vorbei an dem mächtigen Bau der Abtei, die fast so aussah, als wäre sie aus einer einzigen Felsmasse gemeißelt, so eng sind die Fugen zwischen den Steinen.
Kein Windhauch zauste die Nacht, und die Dunkelheit hing mit gefalteten Flügeln da.
Das vom Winter braun gefärbte Gras knirschte unter meinen Fußsohlen. Boo bewegte sich wesentlich verstohlener, als es mir gelang.
Da ich mich beobachtet fühlte, blickte ich zu den Fenstern hoch, sah jedoch niemanden. Kein Licht brannte, bis auf die schwach flackernde Kerze in meinem Zimmer, kein bleiches Gesicht spähte durch eine dunkle Scheibe.
Ich war in Bluejeans und einem T-Shirt aus dem Gästehaus gestürmt. Nun nagte der Dezember an meinen bloßen Armen.
Wir gingen ostwärts an der Kirche entlang, die nicht allein steht, sondern sich in den Gesamtbau der Abtei einfügt.
Drinnen brannte das Ewige Licht, das jedoch nicht hell genug war, um die Farben der bunten Glasscheiben aufflammen zu lassen. Hinter einem Fenster nach dem anderen schien das schwache Funkeln uns zu beobachten wie das mürrische Auge eines Wesens, das in blutrünstiger Stimmung war.
Nachdem er mich zur Nordostecke des Gebäudes geführt hatte, wandte Boo sich nach Süden und trottete an der hinteren Mauer der Kirche entlang. Anschließend kamen wir an dem Flügel der Abtei vorbei, in dessen erstem Stock die Novizen untergebracht waren.
Solange sie noch nicht die Gelübde abgelegt hatten, wohnten die zukünftigen Mönche hier. Von den fünf Novizen, die derzeit ihre Unterweisungen erhielten, vertraute ich vieren.
Plötzlich gab Boo seine vorsichtige Gangart auf. Er rannte nach Osten, weg von dem Gebäude, und ich folgte ihm.
Als der Rasen in eine ungemähte Wiese überging, peitschte hohes Gras meine Knie. Bald würde die Last des ersten Schnees die Halme zu Boden drücken.
Etwa hundert Meter weit fiel der Boden leicht ab, bevor er dort, wo das kniehohe Gras wieder in Rasen überging, eben wurde. Vor uns im Dunkeln erhob sich die Schule der Abtei.
In gewisser Weise ist das Wort Schule ein Euphemismus. Die Schüler, die sie besuchen, sind anderswo unerwünscht, und die Schule ist auch ihr Zuhause, vielleicht das einzige, das manche von ihnen je haben werden.
Untergebracht ist das Internat in dem früheren Klostergebäude. Man hat es innen umgebaut; äußerlich ist es jedoch immer noch ein recht eindrucksvoller Steinhaufen. Hier wohnen auch die Nonnen, die für den Unterricht und die Betreuung der Schüler zuständig sind.
Hinter der alten Abtei erhoben sich die spitzen Wipfel des Waldes vor dem wolkenbedeckten Himmel. Schwarze Äste schützten unsichtbare Pfade, die weit ins einsame Dunkel führten.
Auf der Spur des Bodachs sprang der Hund die breite Treppe zum Haupteingang der Schule hinauf und verschwand im Innern.
Nur wenige Türen des Klosters werden je verschlossen. Zum Schutz der Schüler sind die der Schule jedoch grundsätzlich zu.
Lediglich der Abt, die Mutter Oberin und ich besitzen einen Generalschlüssel, mit dem man überall Zutritt hat. Kein Gast vor mir hat einen solchen Schlüssel erhalten.
Ich bin nicht stolz darauf, dass man mir so viel Vertrauen schenkt. Es ist eine Bürde. In meiner Tasche fühlt der einfache Schlüssel sich manchmal an wie ein eisernes Schicksal, das von einem tief in der Erde verborgenen Magneten angezogen wird.
Der Schlüssel ermöglicht es mir, rasch Bruder Constantine, den toten Mönch, zu suchen, wenn er sich durch Glockenläuten in einem der Türme oder durch irgendeine andere Art Lärm sonst wo bemerkbar macht.
In Pico Mundo, der Wüstenstadt, in der ich den Großteil meines irdischen Lebens verbracht habe, halten sich die Geister vieler Männer und Frauen auf. Hier jedoch haben wir nur Bruder Constantine, der nicht weniger beunruhigend wirkt als sämtliche Toten von Pico Mundo zusammen. Er ist nur ein Geist, aber einer zu viel.
Da momentan ein Bodach durch die Gegend schlich, war Bruder Constantine allerdings meine geringste Sorge.
Zitternd steckte ich meinen Schlüssel ins Schloss. Die Türangeln quietschten, während ich dem Hund in die Schule folgte.
Zwei Nachtlichter wehrten sich gegen eine völlige Finsternis in der Empfangshalle. Mit ihren Sitzgruppen aus Sofas und Sesseln sah diese wie eine Hotellobby aus.
Ich hastete an dem unbesetzten Informationstisch vorüber und kam durch eine Pendeltür in einen Flur, der lediglich von einer Notlampe und den rot leuchtenden Lettern AUSGANG über den Türen erhellt wurde.
Hier im Erdgeschoss befanden sich die Klassenzimmer, die Rehabilitationsklinik, die Krankenstation und der gemeinsame Speisesaal. Diejenigen unter den Schwestern, die eine kulinarische Begabung hatten, waren noch nicht damit beschäftigt, das Frühstück zuzubreiten. Überall herrschte Stille, und das würde auch noch einige Stunden so bleiben.
Als ich die Südtreppe erklommen hatte, sah ich, dass Boo auf dem Absatz im ersten Stock auf mich wartete. Er war immer noch in ernster Stimmung. Sein Schwanz wedelte nicht, und er grinste nicht, um mich zu begrüßen.
Zwei lange und zwei kurze Flure, die ein Rechteck bildeten, führten zu den Räumen der Schüler. Fast alle waren in Zweibettzimmern untergebracht.
Dort, wo die Flure im Südosten und Nordwesten zusammenliefen, waren die Schwesternzimmer, die ich beide sehen konnte, als ich von der Treppe in die südwestliche Ecke des Gebäudes trat.
An der Theke des nordwestlichen Schwesternzimmers saß eine Nonne und las. Aus der Entfernung konnte ich sie nicht identifizieren.
Außerdem war ihr Gesicht zur Hälfte von einem Schleier verborgen. Hier lebten keine modernen Nonnen, die sich wie Politessen kleideten. Die Schwestern trugen eine Ordenstracht alten Stils, in der sie gelegentlich so Achtung gebietend aussahen wie Krieger in voller Rüstung.
Das südöstliche Schwesternzimmer war verlassen. Offenbar machte die dort diensthabende Nonne ihre Runde oder kümmerte sich um einen ihrer Schützlinge.
Als Boo nach rechts trottete, folgte ich ihm, ohne mich der lesenden Nonne bemerkbar zu machen. Sobald ich drei Schritte gemacht hatte, war sie ohnehin aus meinem Blickfeld verschwunden.
Viele der Nonnen haben eine Ausbildung als Krankenschwester, aber sie bemühen sich, den ersten Stock so zu gestalten, dass man sich darin eher wie in einem gemütlichen Schlafsaal als wie im Krankenhaus fühlt. Da schon in zwanzig Tagen Weihnachten war, hatte man die Flure mit Girlanden aus künstlichen immergrünen Zweigen geschmückt, die mit echtem Lametta behangen waren.
Aus Rücksicht auf die schlafenden Schüler hatte man das Licht heruntergedreht. Das Lametta glitzerte nur da und dort; meist hing es matt in den bebenden Schatten.
Manche der Türen der Schlafzimmer waren geschlossen, andere standen offen. Sie waren nicht nur mit Nummern, sondern auch mit Namen versehen.
Auf halbem Weg zwischen der Treppe und dem Schwesternzimmer blieb Boo vor Zimmer 32 stehen, wo die Tür nicht ganz geschlossen war. Auf den Schildern standen in Blockbuchstaben die Namen ANNAMARIE und JUSTINE.
Diesmal war ich nahe genug, um zu sehen, dass Boos Nackenfell sich tatsächlich sträubte.
Der Hund schlüpfte hinein, doch ich zögerte. Weil es ein Mädchenzimmer war, hätte ich eine Nonne bitten sollen, mich zu begleiten.
Allerdings wollte ich es vermeiden, erklären zu müssen, was ein Bodach war. Vor allem wollte ich nicht das Risiko eingehen, von einem der bösartigen Geister belauscht zu werden, wenn ich über ihn sprach.
Offiziell wissen nur zwei Personen in der Abtei und im Nonnenkloster von meiner Gabe – falls es sich dabei tatsächlich um eine Gabe handelt und nicht um einen Fluch. Schwester Angela, die Mutter Oberin, kennt mein Geheimnis ebenso wie Pater Bernard, der Abt.
Schon aus purer Höflichkeit war es nötig gewesen, dass sie alles über die Probleme des jungen Mannes erfuhren, den sie als Langzeitgast willkommen hießen.
Um Schwester Angela und Abt Bernard klarzumachen, dass ich weder ein Schwindler noch ein Narr bin, hat Wyatt Porter, der Polizeichef meiner Heimatstadt Pico Mundo, den beiden die Details einiger Mordfälle anvertraut, bei denen ich ihm zur Hand gegangen bin.
Auch Sean Llewellyn hat für mich gebürgt. Er ist der katholische Pfarrer von Pico Mundo.
Pfarrer Llewellyn ist außerdem der Onkel von Stormy Llewellyn, die ich geliebt und verloren habe. Ich werde sie für immer in Ehren halten.
In den sieben Monaten, die ich nun in der Einsamkeit der Berge lebte, hatte ich mich nur einem weiteren der Mönche offenbart. Eigentlich heißt er Salvatore, aber wir nennen ihn meistens Knoche.
Bruder Knoche hätte an der Schwelle von Zimmer 32 sicherlich nicht gezögert. Er ist ein Mönch der Tat. In kürzester Zeit hätte er entschieden, dass die Bedrohung, die der Bodach darstellte, von größerer Bedeutung war als irgendwelche Anstandsregeln. Er wäre so beherzt wie der Hund durch die Tür getreten, wenn auch weniger anmutig und mit wesentlich mehr Lärm.
Ich drückte die Tür ein wenig weiter auf und ging hinein.
Im ersten der beiden Krankenhausbetten lag Annamarie, im zweiten Justine. Beide schliefen.
Hinter jedem der beiden Mädchen hing an der Wand eine Lampe, die mit einem Dimmer am Ende eines um die Bettstange geschlungenen Kabels reguliert werden konnte.
Annamarie, die ziemlich klein für ihre zehn Jahre war, hatte die Lampe matt brennen lassen. Sie fürchtete sich im Dunkeln.
Neben dem Bett stand ihr Rollstuhl. An einem der Handgriffe oben an der Lehne hing eine dicke Steppjacke, an dem anderen eine Wollmütze. In Winternächten bestand Annamarie darauf, diese beiden Kleidungsstücke immer in Reichweite zu haben.
Im Schlaf umklammerte sie mit ihren zarten Händen die Zudecke, als wollte sie jederzeit in der Lage sein, sich davon zu befreien. Ihr angespanntes Gesicht drückte eine besorgte Erwartung aus, die weniger als Angst, aber doch mehr als bloße Unruhe darstellte.
Obwohl sie tief und fest schlief, schien sie bereit zu sein, beim geringsten Anlass zu fliehen.
Einmal pro Woche übte Annamarie aus eigenem Antrieb, ihren Elektrorollstuhl mit geschlossenen Augen zu jedem der beiden Aufzüge zu steuern. Der eine Aufzug befand sich im Ostflügel, der andere im Westflügel.
Trotz ihrer Einschränkungen und ihrem Leiden war Annamarie ein glückliches Kind. Sich mit solchen Übungen auf die Flucht vorzubereiten, passte nicht zu ihr.
Sie weigerte sich zwar, darüber zu sprechen, aber irgendwie schien sie zu spüren, dass eine schreckliche Nacht bevorstand, eine feindselige Dunkelheit, in der sie blind ihren Weg finden musste. Vielleicht besaß sie die Fähigkeit, die Zukunft zu erahnen.
Der Bodach, den ich von meinem Fenster aus erblickt hatte, war tatsächlich hierhergelangt, aber nicht alleine. Drei der finsteren Gestalten hatten sich, schweigend wie wölfische Schatten, um das zweite Bett versammelt, in dem Justine schlief.
Ein einzelner Bodach weist auf eine drohende Gewalttat hin, die sich wahrscheinlich bald ereignen wird, vielleicht jedoch auch erst in fernerer Zukunft oder gar nicht. Treten diese Wesen zu zweit oder zu dritt auf, ist die Gefahr größer und näher.
Erscheint sogar ein ganzes Rudel, so steht die Bedrohung meiner Erfahrung nach unmittelbar bevor. Das heißt, in wenigen Tagen oder Stunden werden viele Menschen zu Tode kommen. Deshalb erschrak ich beim Anblick des Trios zwar, war jedoch dankbar, dass es sich nicht um dreißig handelte.
Sichtlich vor Erregung bebend, beugten die Bodachs sich über die schlafende Justine, als würden sie das Mädchen aufmerksam beobachten. Als nährten sie sich von ihr.
2
Die Lampe über dem zweiten Bett war ebenfalls auf die niedrigste Stufe eingestellt worden, doch das hatte Justine nicht selbst getan. Eine Nonne hatte den Dimmer entsprechend reguliert, in der Hoffnung, dass sich das Mädchen so wohlfühlte.
Justine tat nur wenig für sich selbst und bat um nichts. Sie war teilweise gelähmt und konnte nicht sprechen.
Als sie vier Jahre alt gewesen war, hatte ihr Vater ihre Mutter erwürgt. Angeblich hatte er der Toten anschließend eine Rose zwischen die Zähne gesteckt, aber so, dass der lange, dornige Stängel in den Schlund ragte.
Die kleine Justine hatte er in der Badewanne ertränkt; jedenfalls glaubte er, dass ihm das gelungen war. Doch sie überlebte, allerdings mit einem durch den langen Sauerstoffmangel hervorgerufenen Hirnschaden.
Wochenlang hatte sie damals im Koma gelegen. Inzwischen wachte sie aus ihrem Schlaf regelmäßig auf, reagierte dabei aber unterschiedlich stark auf die Personen, die sich gerade um sie kümmerten.
Fotografien der vierjährigen Justine zeigten ein Kind von außergewöhnlicher Schönheit. Auf diesen Bildern sah sie schelmisch und überaus fröhlich aus.
Acht Jahre waren seither vergangen. Nun war sie zwölf und schöner denn je. Die Schädigung des Gehirns hatte nicht zu einer Gesichtslähmung oder einem verzerrten Mienenspiel geführt. Obwohl sie ihr Leben weitgehend im Haus verbrachte, war sie nicht bleich und abgehärmt. Ihr Gesicht hatte eine gute Farbe und keinen einzigen Makel.
Justines Schönheit war so keusch wie die einer Madonna von Botticelli und genauso überirdisch. Bei allen, die sie kannten, erregte diese Schönheit weder Neid noch Begehren, sondern weckte eine erstaunliche Ehrfurcht und unerklärlicherweise auch so etwas wie Hoffnung.
Dennoch argwöhnte ich, dass die drei bedrohlichen Gestalten, die sich aufmerksam über sie beugten, nicht von ihrer Schönheit angezogen wurden. Was auf diese Wesen wirkte, waren wohl zwei Dinge: die Unschuld des Mädchens und die Erwartung, wenn nicht gar Gewissheit, dass es bald gewaltsam sterben und dann endlich hässlich sein würde.
Die drei Schatten, schwarz wie drei Flecken an einem sternenlosen Nachthimmel, hatten keine Augen, doch ich spürte ihren gierigen, höhnischen Blick; sie hatten auch keine Münder, doch ich konnte fast das gierige Schmatzen hören, mit dem sie sich an der Aussicht auf den Tod des Mädchens ergötzten.
Einmal habe ich gesehen, wie sie sich in einem Pflegeheim versammelten, wenige Stunden, bevor es durch ein Erdbeben einstürzte. Ich habe sie an einer Tankstelle gesehen, bevor eine Explosion ein tragisches Flammenmeer auslöste. Und ich habe gesehen, wie sie einem jungen Burschen namens Gary Tolliver in den Tagen folgten, bevor er seine ganze Familie quälte und ermordete.
Ein einzelner Tod zieht sie nicht an, auch zwei oder gar drei Tode tun das nicht. Sie schätzen unheilvolle Geschehnisse, die möglichst theatralisch sind und bei denen erst der Vorhang fällt, wenn möglichst viele Darsteller in Fetzen gerissen wurden.
In der Lage, auf unsere Welt einzuwirken, sind sie scheinbar nicht. Es ist, als wären sie an diesem Ort und in dieser Zeit nicht vollständig anwesend, sondern gewissermaßen nur virtuell. Es sind Reisende, Beobachter, Liebhaber unserer Schmerzen.
Dennoch fürchte ich sie, und zwar nicht nur, weil ihre Anwesenheit ein schreckliches Ereignis ankündigt. Selbst wenn sie unfähig sein sollten, diese Welt maßgeblich zu beeinflussen, habe ich doch den Verdacht, dass meine Person eine Ausnahme für diese Regeln darstellt. Das würde heißen, ich bin ihnen schutzlos ausgeliefert, so schutzlos wie eine Ameise im Schatten eines auftretenden Schuhs.
Boo, der neben den pechschwarzen Geistern noch weißer aussah als gewöhnlich, knurrte nicht, sondern beobachtete die Bodachs mit Argwohn und Abscheu.
Ich verhielt mich so, als wäre ich ins Zimmer gekommen, um mich zu vergewissern, dass der Thermostat richtig eingestellt war. Anschließend zog ich die Jalousie hoch und schaute nach, ob das Fenster gut geschlossen war, dann pulte ich etwas Schmalz aus meinem rechten Ohr und kratzte mir ein Stückchen Salatblatt aus den Zähnen, allerdings nicht mit demselben Finger.
Die Bodachs ignorierten mich – oder sie taten so, als würden sie mich ignorieren.
Das schlafende Mädchen nahm ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit in Anspruch. Ihre Hände oder Pfoten schwebten wenige Zentimeter über dem liegenden Körper, und ihre Finger oder Klauen beschrieben Kreise in der Luft. Sie sahen aus, als würden sie auf einem Instrument aus Trinkgläsern spielen, deren feuchtem Kristallrand sie eine gespenstische Musik entlockten.
Vielleicht war es die Unschuld des Mädchens, die auf die Bodachs wirkte wie ein eindringlicher Rhythmus. Vielleicht empfanden diese Wesen den reduzierten Zustand, die lammfromme Anmut und die extreme Verwundbarkeit Justines wie die Takte einer Symphonie.
Was Bodachs angeht, kann ich nur Theorien aufstellen. Ich weiß nichts Gewisses über ihr Wesen und ihre Herkunft.
Das gilt allerdings nicht nur für Bodachs. Die Akte mit dem Etikett DINGE, ÜBER DIE ODD THOMAS NICHTS WEISS ist nicht weniger gewaltig als der ganze Rest des Universums.
Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, wie viel ich nicht weiß. Vielleicht liegt Weisheit in dieser Erkenntnis. Trost habe ich darin leider nicht gefunden.
Unvermittelt richteten sich die drei Bodachs, die sich soeben noch über Justine gebeugt hatten, auf und drehten ihre wölfischen Köpfe synchron zur Tür, als reagierten sie auf einen Trompetenruf, den ich nicht hören konnte.
Boo konnte ihn offenbar auch nicht hören, denn seine Ohren stellten sich nicht auf. Seine Aufmerksamkeit galt weiterhin ausschließlich den düsteren Geistern.
Wie Schatten, die plötzlich von einem Lichtstrahl verjagt wurden, wirbelten die Bodachs vom Bett weg, stürzten zur Tür und verschwanden im Flur.
Ich wollte ihnen folgen, zögerte jedoch, als ich merkte, dass Justine mich anstarrte. Ihre blauen Augen waren wie ein durchscheinendes Gewässer, genauso klar, scheinbar ohne jedes Geheimnis und doch bodenlos.
Manchmal war man sicher, dass man von ihr gesehen wurde. An anderen Tagen, so auch jetzt, spürte man, dass man für sie so durchsichtig wie Glas war, ja dass sie durch alles auf dieser Welt hindurchblicken konnte.
»Hab keine Angst«, sagte ich zu ihr, was doppelt anmaßend war. Zum einen wusste ich nicht, ob sie sich fürchtete und ob sie überhaupt fähig war, Furcht zu empfinden. Zum anderen gaukelte ich ihr mit meinen Worten einen Schutz vor, den ich ihr in der nahenden Krise womöglich gar nicht bieten konnte.
Zu weise und demütig, um den Helden zu spielen, hatte Boo das Zimmer verlassen.
Während ich ebenfalls auf die Tür zuging, murmelte Annamarie im anderen Bett: »Odd.«
Ihre Augen blieben geschlossen, und mit den Händen umklammerte sie noch immer die Zudecke. Sie atmete flach, doch rhythmisch.
Als ich am Fußende ihres Betts stehen blieb, sagte sie noch einmal, deutlicher als zuvor: »Odd.«
Annamarie war mit einer schweren Form von Spina bifida geboren worden, bei der sich ein Spalt in der Wirbelsäule gebildet hatte. Ihre Hüften waren verrenkt, ihre Beine deformiert. Der auf dem Kissen liegende Kopf sah fast so groß aus wie der geschrumpfte Körper unter der Decke.
Obwohl sie zu schlafen schien, flüsterte ich: »Was ist denn, Liebes?«
»Komischer Kauz«, sagte sie.
Ihre geistige Behinderung war nicht schwer und drückte sich auch nicht in ihrer Stimme aus, die weder schwerfällig noch verwaschen klang, sondern hell, liebenswürdig und charmant.
»Komischer Kauz.«
Ein Schauer durchfuhr mich, so eisig wie die Winternacht draußen.
Eine Art Intuition lenkte meine Aufmerksamkeit auf das zweite Bett, in dem Justine lag. Sie hatte den Kopf gedreht, um mir zu folgen. Zum ersten Mal heftete sie ihre Augen auf meine.
Der Mund von Justine bewegte sich, brachte jedoch nicht einmal eines der wortlosen Geräusche hervor, zu denen sie angesichts ihrer stärkeren Behinderung fähig war.
Während Justine sich erfolglos bemühte, etwas zu sagen, wiederholte Annamarie erneut: »Komischer Kauz.«
Die Jalousie hing schlaff vor dem Fenster. Auf dem Regal neben Justines Bett saßen reglos ihre Plüschkätzchen, ohne auch nur ein einziges Mal zu zwinkern oder mit den Schnurrhaaren zu zucken.
Die Kinderbücher in dem Regal an Annamaries Seite des Zimmers standen ordentlich nebeneinander. Auf dem Nachttisch hielt ein Porzellankaninchen mit beweglichen Fellohren Wache. Es trug einen altertümlichen Herrenanzug.
Alles war still, und doch spürte ich eine kaum gebändigte Energie. Es wäre nicht weiter verwunderlich gewesen, wenn jeder unbelebte Gegenstand im Raum zum Leben erwacht wäre und sich in die Luft erhoben hätte, um sich dort zu drehen und von einer Wand zur anderen zu schweben.
Mitten ins Schweigen hinein versuchte Justine erneut zu sprechen, und Annamarie sagte mit ihrer liebenswert piepsigen Stimme: »Klär mich auf.«
Ich trat vom Bett der schlafenden Annamarie zu dem von Justine.
Aus Furcht, meine Stimme könnte den Bann brechen, sagte ich kein Wort.
Ich fragte mich, ob das geschädigte Gehirn des Mädchens wohl Raum für eine Besucherin geschaffen hatte, und ich wünschte mir, dass die bodenlosen blauen Augen sich in ein bestimmtes Paar ägyptisch schwarzer Augen verwandelten, die mir so vertraut waren.
An manchen Tagen fühle ich mich, als wäre ich schon immer einundzwanzig gewesen, aber die Wahrheit lautet, dass ich einmal jung war.
In jener Zeit, als der Tod etwas war, das nur anderen Leuten zustieß, hat Bronwen Llewellyn, meine Liebste, die lieber Stormy genannt wurde, manchmal gesagt: Klär mich auf, du komischer Kauz. Gemeint war damit, dass ich ihr berichten sollte, was den Tag über geschehen war, oder dass ich ihr meine Gedanken, Ängste und Sorgen anvertrauen sollte.
In den sechzehn Monaten, die vergangen waren, seit Stormy in dieser Welt zu Asche geworden war, um in einer anderen Welt den Dienst anzutreten, hatte niemand diese Worte zu mir gesagt.
Justine bewegte den Mund, ohne ein Geräusch hervorzubringen, doch im Bett neben ihr sagte Annamarie im Schlaf: »Klär mich auf.«
Das Zimmer kam mir luftleer vor. Ich verharrte in einer Stille, die so tief war wie in einem Vakuum. Mir stockte der Atem.
Noch vor einem Moment hatte ich mir gewünscht, das Blau dieser Augen möge sich ins Schwarz von Stormys Augen verwandeln und meine Ahnung bestätigen, dass sie Kontakt mit mir aufnahm. Nun jagte mir die Aussicht Furcht ein.
Wenn wir hoffen, dann hoffen wir normalerweise auf das Falsche.
Wir sehnen uns nach morgen und dem Fortschritt, den dieses Wort verspricht. Aber auch gestern war einmal morgen, und wo war da der Fortschritt drin?
Oder wir sehnen uns nach gestern, nach dem, was einmal war oder hätte sein können. Doch während wir uns danach sehnen, wird die Gegenwart zur Vergangenheit, sodass die Vergangenheit nichts ist als unsere Sehnsucht nach einer zweiten Chance.
»Klär mich auf«, wiederholte Annamarie.
Solange ich dem Strom der Zeit unterworfen bleibe, was zutrifft, solange ich lebe, gibt es keinen Weg zurück zu Stormy oder zu irgendetwas anderem. Der einzige Weg zurück führt vorwärts, flussabwärts. Der Weg hinauf ist der Weg hinab, und der Weg zurück ist der Weg voran.
»Klär mich auf, du komischer Kauz.«
Meine Hoffnung hier in Zimmer 32 durfte also nicht darin bestehen, jetzt mit Stormy zu sprechen, sondern darin, das am Ende meiner Reise zu tun, wenn die Zeit keine Macht mehr über mich hatte und eine ewige Gegenwart die Vergangenheit jedes Reizes beraubte.
Bevor ich in jener blauen Leere womöglich doch das ägyptische Schwarz sah, das ich mir erhoffte, wandte ich den Blick ab und starrte auf meine Hände, die sich an die Stange am Bettende klammerten.
Stormys Geist verweilt nicht mehr in dieser Welt, wie es der von so vielen anderen Menschen tut. Sie ist weitergezogen, wie es sein sollte.
Die heftige, unsterbliche Liebe der Lebenden kann auf die Toten wirken wie ein Magnet. Hätte ich Stormy zurückgelockt, so hätte ich ihr jedoch einen unglaublich schlechten Dienst erwiesen. Obwohl ein erneuter Kontakt meine Einsamkeit anfangs wohl gelindert hätte, bringt es letztendlich nur Elend, auf das Falsche zu hoffen.
Ich starrte auf meine Hände.
Die schlafende Annamarie war verstummt.
Die Plüschkätzchen und das Porzellankaninchen verharrten leblos, wodurch sich keine Szene einstellte, die in einen Grusel-oder einen Disneyfilm gepasst hätte.
Nach einer Weile schlug mein Herz wieder im normalen Takt.
Justines Augen waren geschlossen. Ihre Wimpern glänzten, ihre Wangen waren feucht. An der Kante ihres Kiefers hingen zwei Tränen, die zitterten und dann aufs Laken fielen.
Ich verließ das Zimmer und machte mich auf die Suche nach Boo und den Bodachs.
3
In das alte Abteigebäude, das nun als Internat diente, war eine moderne Versorgungstechnik eingebaut worden, die von einem Computer im Keller aus gesteuert und überwacht werden konnte.
Das spartanische Computerzimmer war lediglich mit einem Schreibtisch, zwei Stühlen und einem ungenutzten Aktenschrank möbliert. Genauer gesagt, die unterste Schublade des Schranks war mit unzähligen KitKat-Hüllen vollgestopft.
Bruder Timothy, der für die Haustechnik der Abtei und des Internats zuständig war, war süchtig nach KitKat. Offenbar war er der Ansicht, dass seine Gier nach Süßigkeiten gefährlich nahe bei der Sünde der Völlerei angesiedelt war, sonst hätte er sich wohl nicht bemüht, die Spuren davon zu verwischen.
Nur Bruder Timothy und von auswärts kommende Handwerker hatten Gründe, sich häufig in diesem Raum aufzuhalten. Deshalb war sein Geheimnis hier gut geschützt.
Dennoch wussten alle anderen Mönche Bescheid. Viele von ihnen hatten mir grinsend und mit einem Augenzwinkern den Tipp gegeben, einmal einen Blick in die besagte Schublade zu werfen.
Niemand konnte wissen, ob Bruder Timothy seine Völlerei dem Prior, Pater Reinhart, jemals gebeichtet hatte. Die Existenz seiner Hüllensammlung wies jedoch darauf hin, dass er erwischt werden wollte.
Seine Brüder freuten sich offenbar schon darauf, den Beweis für seine Untaten zu entdecken, allerdings erst, wenn die Sammlung noch weiter angewachsen war, und dann auch noch im richtigen Moment – das hieß, wenn es Timothy am peinlichsten war.
Alle mochten Bruder Timothy, aber zu seinem Unglück war er dafür bekannt, ungewöhnlich stark zu erröten. Dann leuchtete sein Gesicht wie ein Lampion.
Dazu hatte Bruder Roland folgende Theorie entwickelt: Wenn Gott einem Menschen eine derart prachtvolle Reaktion auf peinliche Erlebnisse geschenkt hatte, dann nur, weil es sein Wille war, dass diese Eigenschaft möglichst oft und zur allgemeinen Freude zur Schau gestellt wurde.
An einer Wand des Kellerraums, den die Mönche insgeheim als KitKat-Katakombe bezeichneten, hing eine gerahmte Stickarbeit mit den Worten: DER TEUFEL STECKT IM DATEN-DSCHUNGEL.
Mithilfe des Computers konnte ich den Leistungsverlauf und die momentane Funktion des Heiz- und Kühlsystems, der Beleuchtung, der Brandschutzeinrichtung und der Notfallgeneratoren überprüfen.
Im ersten Stock schlichen die drei Bodachs wahrscheinlich immer noch von Raum zu Raum und betrachteten die zukünftigen Opfer, um sich intensiver an deren Tod weiden zu können, wenn es so weit war. Mehr hätte ich dadurch, dass ich sie beobachtete, nicht erfahren.
Was mich in den Keller getrieben hatte, war Angst vor dem Ausbruch eines Feuers. Deshalb studierte ich auf dem Bildschirm erst einmal alle Anzeigen, die mit dem Brandschutz zu tun hatten.
In jedem Raum war mindestens ein Sprinkler in die Decke eingelassen. Die Flure waren noch großzügiger ausgestattet; hier waren die Sprinkler an der Deckenmitte in fünf Metern Abstand angeordnet.
Dem Überwachungsprogramm zufolge waren sämtliche Sprinkler in Ordnung, und in allen Wasserrohren herrschte der erforderliche Druck. Die Rauchmelder und die Feuermelder funktionierten und führten im vorgeschriebenen Abstand einen Selbsttest durch.
Ich klickte mich aus dem Brandschutzsystem und rief die Daten des Heiz- und Kühlsystems auf. Besonders interessierten mich die Heizkessel, von denen das Internat zwei besaß.
Weil man in diese abgelegene Bergwelt keine Gasleitung verlegt hatte, wurden die beiden Kessel mit Propangas betrieben. Zur Speicherung war in einer angemessenen Entfernung von den Gebäuden ein großer Drucktank im Boden vergraben.
Der Anzeige zufolge enthielt dieser Tank momentan vierundachtzig Prozent seines maximalen Fassungsvermögens. Die Durchflussmenge schien normal zu sein. Sämtliche Ventile funktionierten. Das Verhältnis der erzeugten Energie zum Gasverbrauch ließ erkennen, dass kein Leck vorlag. Auch die beiden unabhängigen Notschalter waren in Funktion.
Auf der Anzeige war jeder Punkt, an dem ein mechanisches Versagen möglich war, durch ein kleines grünes Licht gekennzeichnet. Kein einziger roter Punkt verunstaltete den Bildschirm.
Mit Feuer hatte die drohende Katastrophe also offenbar nichts zu tun.
Unwillkürlich warf ich erneut einen Blick auf die Stickerei an der Wand über dem Computer: DER TEUFEL STECKT IM DA-TENDSCHUNGEL.
Als ich fünfzehn war, haben ein paar wirklich üble Typen mit flachen, runden Filzhüten, wie Buster Keaton sie trägt, mir Handschellen angelegt, die Fußknöchel zusammengekettet, mich im Kofferraum eines alten Buicks eingesperrt, den Buick mit einem Kran angehoben und in eine hydraulische Presse von der Sorte befördert, die einstmals stolze Fahrzeuge in Blechwürfel verwandelt, bei denen man an schlechte moderne Kunst denken muss. Anschließend haben sie den Knopf gedrückt.
Nur mit der Ruhe! Ich habe nicht die Absicht, euch mit alten Kriegserlebnissen zu langweilen. Die Sache mit dem Buick soll nur verdeutlichen, dass ich zwar gewisse übersinnliche Fähigkeiten habe, aber deshalb noch lange nicht in der Lage bin, zuverlässig die Zukunft vorherzusehen.
Die erwähnten üblen Typen hatten die eisig glänzenden Augen fröhlicher Psychopathen. Ihre Gesichtsnarben zeugten davon, dass sie zumindest abenteuerlustig waren, und ihr Gang wies darauf hin, dass sie entweder an schmerzhaften Hodengeschwüren litten oder mehrere Waffen in den Hosentaschen stecken hatten. Dass sie eine Bedrohung darstellten, erkannte ich trotzdem erst, als sie mich mit einer fünf Kilo schweren Bratwurst zu Boden schlugen und damit anfingen, brutal auf mich einzutreten.
Mein Versäumnis ist dadurch zu erklären, dass ich von zwei anderen Typen abgelenkt war, die schwarze Stiefel, schwarze Hosen, schwarze Hemden, schwarze Umhänge und merkwürdige schwarze Hüte trugen. Später erfuhr ich, dass es sich um zwei Schullehrer handelte, die unabhängig voneinander beschlossen hatten, als Zorro verkleidet zu einer Kostümparty zu gehen.
Im Rückblick – das heißt, als ich bereits zusammen mit zwei toten Rhesusaffen und der Bratwurst im Kofferraum des Buicks eingesperrt war – wurde mir klar, dass ich die echten Schurken schon deshalb hätte sofort erkennen sollen, weil sie alle dieselben flachen, runden Filzhüte trugen. Wie konnte jemand, der alle Tassen im Schrank hatte, nur auf die Idee kommen, drei Typen mit solchen Hüten gute Absichten zu unterstellen?
Zu meiner Verteidigung wäre immerhin zu sagen, dass ich damals erst fünfzehn war und bei Weitem nicht so viel Erfahrung hatte wie heutzutage. Außerdem habe ich mich, um das noch einmal zu betonen, nie als Hellseher bezeichnet.
Dass ich nun Angst vor einem Feuer hatte, war vielleicht dasselbe wie mein damaliger Argwohn gegenüber den Zorro-Imitatoren: fehlgeleitet.
Obwohl die Überprüfung der Haustechnik nicht erkennen ließ, dass ein drohender Brand die Bodachs angezogen hatte, war eine Katastrophe dieser Art dennoch nicht auszuschließen. Kein anderes Ereignis stellte eine derartige Bedrohung für eine große Gemeinschaft geistig und körperlich behinderter Menschen dar.
Erdbeben waren in den kalifornischen Bergen nicht so häufig und stark wie in den Tälern und Ebenen. Außerdem war das neue Abteigebäude so solide gebaut wie eine Festung, und das alte, in dem sich das Internat befand, war so sorgfältig nachgerüstet worden, dass es selbst heftigen und lang anhaltenden Erdstößen standhalten sollte.
So hoch in der Sierra lag das Grundgestein nah unter der Erdoberfläche; an manchen Stellen ragten sogar große Granitrippen heraus. Beide Gebäude waren in diesem Gestein verankert.
Hier gab es keine Tornados, keine Hurrikane, keine aktiven Vulkane, keine Killerbienen.
Dafür gab es etwas Gefährlicheres: Es gab Menschen.
Die Mönche in der Abtei und die Nonnen im Internat entsprachen allerdings nicht gerade dem Prototyp eines Schurken. Natürlich konnte das Böse sich mit Frömmigkeit und Güte tarnen, aber es fiel mir schwer, mir vorzustellen, wie jemand von den Brüdern oder Schwestern mit einer Kettensäge oder Maschinenpistole Amok lief.
Selbst der von Schuldgefühlen wegen seiner KitKat-Sucht geplagte Bruder Timothy machte mir keine Angst, sosehr er auch von seinem übermäßigen Zuckergenuss aufgeputscht sein mochte.
Ein geeigneteres Verdachtsobjekt stellte der finstere Russe dar, der im ersten Stock des Gästehauses wohnte. Er trug zwar keinen flachen Filzhut, zeichnete sich jedoch durch seine verdrießliche Miene und sein verstohlenes Verhalten aus.
Jedenfalls waren meine Monate des Friedens und der Kontemplation zu Ende.
Die Forderungen, die meine Gabe an mich stellte, die schweigenden, aber hartnäckigen Bitten der hier verweilenden Toten und die schrecklichen Gewalttaten, die ich nicht immer hatte verhindern können – das war es, was mich in die Abgeschiedenheit der Abtei getrieben hatte. Ich hatte mein Leben einfacher gestalten müssen.
Dennoch hatte ich hier in den Bergen nicht für immer Zuflucht gesucht. Ich hatte die höheren Mächte lediglich um eine Auszeit gebeten, die mir auch gewährt worden war. Doch nun tickte die Uhr wieder.
Als ich das Überwachungsprogramm des Heizungssystems verließ, wurde der Bildschirm schwarz. Nur ein knappes Menü in weißer Schrift leuchtete noch auf. In der nun stärker spiegelnden Fläche nahm ich hinter mir eine Bewegung wahr.
Sieben Monate lang war die Abtei wie ein Ruhepunkt im Fluss gewesen, in dem ich mich träge im Kreis gedreht hatte, immer dasselbe vertraute Ufer im Blick. Nun wurde der wahre Rhythmus der Strömung erkennbar. Düster, ungezähmt und unerbittlich spülte sie das Gefühl des Friedens fort und trieb mich erneut auf mein Schicksal zu.
In Erwartung eines Schlags oder einer Stichwaffe wirbelte ich auf dem Bürostuhl herum, um mich dem zu stellen, was sich im Bildschirm spiegelte.
4
Was mein Rückgrat in Eis und meinen Mund zu Staub verwandelt hatte, war Furcht vor einer Nonne.
Batman hätte verächtlich die Nase gerümpft, und Odysseus hätte bestimmt auch kein Verständnis für mich gehabt, aber ich hätte den beiden erklärt, dass ich nie behaupten würde, ein Held zu sein. Im Herzen bin ich nur ein Grillkoch, der momentan keine Stelle hat.
Zu meiner Verteidigung muss ich zudem erwähnen, dass es sich bei der würdigen Gestalt, die soeben das Computerzimmer betreten hatte, nicht um eine beliebige Nonne handelte, sondern um Schwester Angela, die Mutter Oberin. Sie besaß zwar das liebenswerte Gesicht einer allseits verehrten Großmutter, aber die stählerne Entschlossenheit des Terminators.
Natürlich meine ich den guten Terminator aus dem zweiten Film der Serie.
Normalerweise tragen Benediktinerinnen eine graue oder schwarze Ordenstracht, doch die Gemeinschaft hier trug Weiß, weil es sich um einen zweimal reformierten Ableger eines bereits früher reformierten Ablegers von reformorientierten Benediktinerinnen handelte. Dennoch war es den Schwestern keineswegs recht, wenn man ihnen unterstellte, sich den Prinzipien der Trappistinnen oder Zisterzienserinnen angenähert zu haben.
Ihr müsst nicht verstehen, was das bedeutet. Der liebe Gott höchstselbst ist noch damit beschäftigt, das auszutüfteln.
Im Kern bedeuteten diese ganzen Reformen, dass die Schwestern orthodoxer waren als jene modernen Nonnen, die sich offenbar in erster Linie als Sozialarbeiterinnen sahen, nur dass sie sich von Männern fernhielten. Hier beteten die Schwestern auf Lateinisch, aßen freitags kein Fleisch und hätten jeden Liedermacher, der bei der Messe einen sozialkritischen Song zum Besten geben wollte, sofort mit einem vernichtenden Blick mundtot gemacht.
Laut Schwester Angela ging die Gemeinschaft auf das erste Drittel des vergangenen Jahrhunderts zurück, als die Kirche noch auf ihre Zeitlosigkeit vertraut habe und als die Bischöfe noch nicht »völlig daneben« gewesen seien. Da die Schwester erst 1945 geboren war, hatte sie die von ihr bewunderte Ära zwar nie kennengelernt, meinte jedoch, sie würde lieber in den Dreißigerjahren leben als im Zeitalter des Internets und via Satellit ausgestrahlter Verdummungsshows.
Ich sympathisiere ein wenig mit diesem Standpunkt. In jenen Tagen gab es schließlich noch keine Atomwaffen und keine organisierten Terroristen, die bedenkenlos Frauen und Kinder in die Luft sprengten. Außerdem konnte man überall Kaugummi der Marke »Black Jack« kaufen, und zwar für nicht mehr als fünf Cent pro Packung. Diese zugegeben triviale Information stammt aus einem Roman. Ich habe aus Romanen eine Menge erfahren. Manches davon ist sogar wahr.
Schwester Angela setzte sich auf den zweiten Stuhl. »Schon wieder eine ruhelose Nacht, Odd Thomas?«, fragte sie.
Aus früheren Gesprächen wusste sie, dass ich heute nicht mehr so gut schlafe wie früher. Schlaf ist eine Art Frieden, und den habe ich mir noch nicht verdient.
»Ich konnte einfach nicht zu Bett gehen, bevor es anfängt zu schneien«, erwiderte ich. »Ich wollte sehen, wie die Welt weiß wird.«
»Der Blizzard hat immer noch nicht eingesetzt. Aber abgesehen davon ist ein Kellerraum ein äußerst merkwürdiger Ort, um darauf zu warten.«
»Das stimmt, Ma’am.«
Sie verfügte über ein ganz eigenes, liebenswertes Lächeln, das sie lange und geduldig aufrechterhalten konnte. Hätte sie einem ein Schwert vor die Nase gehalten, so wäre das kein so wirksames Druckmittel gewesen wie dieses nachsichtige Lächeln.
Nach einem Schweigen, bei dem es sich um einen Test unserer jeweiligen Willenskraft handelte, sagte ich: »Ma’am, Sie machen den Eindruck, als würden Sie meinen, dass ich etwas verschweige.«
»Verschweigst du denn etwas, Oddie?«
»Nein, Ma’am.« Ich deutete auf den Computer. »Ich habe nur die Haustechnik hier im Gebäude überprüft.«
»Aha. Dann bist du also für Bruder Timothy eingesprungen. Ist der wegen seiner KitKat-Sucht endlich in eine Klinik eingewiesen worden?«
»Ich mache mich einfach gern mit den Dingen hier vertraut … um von Nutzen zu sein«, sagte ich.
»Die Pfannkuchen, die du an jedem Wochenende zum Frühstück backst, sind das größte Geschenk, das uns ein Gast der Abtei je gemacht hat.«
»So lockere Pfannkuchen wie ich macht tatsächlich sonst niemand auf der Welt.«
Schwester Angelas Augen leuchteten in demselben fröhlichen Blau wie das teure britische Porzellan meiner Mutter, das diese gelegentlich an die Wand oder auf mich geschleudert hatte. »In dem Lokal, wo du gearbeitet hast, hattest du bestimmt eine Menge treue Fans.«
»Ich war ein Star mit dem Bratenwender.«
Sie lächelte mich an. Lächelte und wartete.
»Diesen Sonntag mache ich Bratkartoffeln. Die hab ich hier noch nie gezaubert.«
Lächelnd spielte sie mit der Holzperlenkette, an der das Kreuz auf ihrer Brust hing.
»Es ist einfach so, dass ich einen schlimmen Traum hatte. Mit einem explodierenden Heizkessel.«
»Ein Traum, in dem ein Heizkessel explodiert ist?«
»Genau.«
»Also ein echter Albtraum, ja?«
»Er hat mich sehr nervös gemacht.«
»War das etwa einer von unseren Heizkesseln?«
»Schon möglich. Im Traum war nicht klar, wo sich das Ding befand. Sie wissen ja, wie Träume sind.«
Ein Zwinkern ließ ihre porzellanblauen Augen aufleuchten. »Hast du in diesem Traum etwa gesehen, wie brennende Nonnen schreiend durch die verschneite Nacht rannten?«
»Nein, Ma’am. Du lieber Himmel, nein! Nur den explodierenden Heizkessel.«
»Hast du gesehen, wie sich behinderte Kinder aus Fenstern stürzten, hinter denen Flammen loderten?«
Ich versuchte es mit Schweigen und meinem eigenen Lächeln.
»Sag mal, sind deine Albträume immer so dünn gestrickt, Oddie?«
»Immer nicht, Ma’am.«
»Ab und zu träume ich von Frankenstein, weil ich als kleines Mädchen mal den Film gesehen habe. In meinem Traum kommt eine uralte Windmühle mit zerfetzten, fauligen Flügeln vor, die sich quietschend im Sturm drehen. Tosender Regen, Blitze, die den Himmel spalten, hüpfende Schatten, Treppen aus kaltem Stein, in Bücherschränken verborgene Türen, von Kerzen erleuchtete Geheimgänge, bizarre Maschinen mit vergoldeten Gyroskopen, knisternde Lichtbogen, ein wahnsinniger Buckliger mit Laternenaugen, und direkt hinter meinem Rücken sind immer das tapsende Monster und ein Wissenschaftler im weißen Kittel, der seinen abgetrennten Kopf unter dem Arm trägt.«
Als sie fertig war, lächelte sie mich wieder an.
»Nur ein explodierender Heizkessel«, sagte ich.
»Gott hat viele Gründe, dich zu lieben, Oddie, aber auf jeden Fall liebt er dich, weil du ein derart unerfahrener und ungeschickter Lügner bist.«
»Ach, ich hab schon allerhand Leuten einen Bären aufgebunden«, versicherte ich ihr.
»Die Behauptung, du hättest jemandem einen Bären aufgebunden, ist der größte Bär, den du jemals gestemmt hast.«
»In der Nonnenschule haben Sie bestimmt den Vorsitz des Debattierklubs geführt.«
»Gestehe, junger Mann! Du hast nicht von einem explodierenden Heizkessel geträumt. Dir macht irgendetwas anderes Sorgen.«
Ich zuckte die Achseln.
»Du hast nach den schlafenden Kindern geschaut.«
Sie wusste, dass ich die auf Erden verweilenden Toten sah. Allerdings hatte ich weder ihr noch Abt Bernard etwas von den Bodachs erzählt.
Weil diese blutrünstigen Geister von Geschehnissen mit vielen Todesopfern angezogen wurden, hatte ich nicht erwartet, ihnen an einem derart abgeschiedenen Ort zu begegnen. Ihre natürlichen Jagdgründe waren Städte und Metropolen.
Außerdem neigen selbst Leute, die mir glauben, dass ich die zögerlichen Toten sehe, zu Skepsis, wenn ich sie verfrüht damit konfrontiere, dass es finstere Dämonen gibt, die sich am Anblick von Tod und Zerstörung ergötzen.
Ein Mensch, der einen Affen als Haustier hält, gilt wahrscheinlich als charmanter Exzentriker. Verwandelt jemand sein Haus hingegen in einen Affenstall, in dem eine Horde schnatternder Schimpansen durch die Zimmer tobt, dann muss er sich nicht wundern, wenn bald ein Wagen von der Klapsmühle vor seiner Tür hält.
Trotz dieser Einwände beschloss ich, Schwester Angela einzuweihen, weil sie wirklich zuhören konnte und ein gutes Ohr für Unaufrichtigkeit hatte. Zwei gute Ohren. Vielleicht war der Schleier rund um ihr Gesicht in Wirklichkeit ein Hightechinstrument, das dazu diente, alle Geräusche zu bündeln und seiner Besitzerin mehr Nuancen zu vermitteln, als gewöhnliche Leute wahrnahmen.
Damit will ich freilich nicht sagen, gewisse Nonnen hätten das technische Talent von Q, dem genialen Erfinder, der James Bond mit immer wieder neuen, abgefahrenen Spielereien ausstattet. Schon möglich, dass dem so ist, aber beweisen kann ich das nicht.
Im Vertrauen auf Schwester Angelas guten Willen und auf die Bockmist filternde Funktion ihres Schleiers erzählte ich ihr also von den Bodachs.
Sie lauschte aufmerksam und mit unbewegtem Gesicht, dem man nicht ansah, ob sie mich nun für geistesgestört hielt oder nicht.
Mit der Kraft ihrer Persönlichkeit konnte Schwester Angela ihr Gegenüber zwingen, ihr in die Augen zu schauen. Vielleicht waren manche besonders willensstarke Menschen in der Lage, dennoch den Blick abzuwenden, aber zu denen gehörte ich nicht. Nachdem ich ihr alles über die Bodachs erzählt hatte, fühlte ich mich wie in Porzellanblau eingelegt.
Als ich fertig war, betrachtete sie mich schweigend und mit undurchdringlicher Miene. Ich dachte schon, sie hätte beschlossen, für meine geistige Gesundung zu beten, da akzeptierte sie die Wahrheit meiner Worte mit der simplen Frage: »Was müssen wir nun unternehmen?«
»Keine Ahnung.«
»Das ist eine äußerst unbefriedigende Antwort.«
»Äußerst«, pflichtete ich ihr bei. »Es ist eben leider so, dass die Bodachs erst vor einer halben Stunde aufgetaucht sind. Ich habe sie noch nicht lange genug beobachtet, um raten zu können, was sie hierhergelockt hat.«
Umspielt von den geräumigen Ärmeln ihrer Kutte, ballten ihre Hände sich zu rosafarbenen Fäusten mit weißen Knöcheln. »Den Kindern wird etwas zustoßen, ja?«, fragte sie.
»Nicht unbedingt allen. Vielleicht einigen. Und vielleicht nicht nur den Kindern.«
»Wie viel Zeit bleibt uns bis … zu dem, was geschehen wird?«
»Normalerweise tauchen die Bodachs ein oder zwei Tage vor dem Geschehnis auf. Um den Anblick derer zu genießen, die bald …« Ich scheute davor zurück, mich genauer auszudrücken.
Schwester Angela vollendete meinen Satz: »… sterben müssen.«
»Wenn ein Mörder beteiligt ist, das heißt, wenn das Unheil durch Menschenhand geschieht statt durch so etwas wie einen explodierenden Heizkessel, sind die Bodachs manchmal genauso fasziniert vom zukünftigen Täter wie von den möglichen Opfern.«
»Hier gibt es keine Mörder«, sagte Schwester Angela.
»Was wissen wir eigentlich wirklich über Rodion Romanovich? «
»Du meinst den russischen Gast in der Abtei?«
»Der blickt immer so finster drein«, sagte ich.
»Das tue ich manchmal auch.«
»Ja, Ma’am, aber dann handelt es sich um einen besorgt finsteren Blick, und außerdem sind Sie eine Nonne.«
»Und er ist ein spiritueller Pilger.«
»Dass Sie eine Nonne sind, wissen wir mit Sicherheit, aber was ihn betrifft, haben wir nur sein Wort.«
»Hast du denn gesehen, dass ihm irgendwelche Bodachs gefolgt sind?«
»Noch nicht.«
Schwester Angela runzelte so stark die Stirn, dass sie tatsächlich fast finster dreinblickte. »Wenn er uns hier im Internat besucht, ist er immer sehr freundlich.«
»Ich beschuldige ihn ja gar nicht. Allerdings bin ich neugierig, wer er ist.«
»Nach den Laudes spreche ich erst einmal mit Abt Bernard darüber, dass wir ganz allgemein die Augen offen halten müssen.«
Die Laudes waren das Morgengebet und das zweite von sieben Chorgebeten, die von den Mönchen täglich verrichtet wurden.
In dieser Abtei folgten die Laudes direkt auf die Matutin, bei der Psalmen gesungen und Schriften von Heiligen gelesen wurden. Das Ganze begann um Viertel vor sechs und endete spätestens um halb sieben.
Ich schaltete den Computer aus und stand auf. »Jetzt werde ich mich erst einmal noch ein wenig umschauen«, sagte ich.
Umgeben von ihrem wallenden weißen Habit, erhob sich auch Schwester Angela von ihrem Stuhl. »Wenn sich morgen eine Katastrophe ereignet, sollte ich jetzt noch ein wenig schlafen. Denk aber daran, dass du mich im Notfall jederzeit auf meinem Handy erreichen kannst.«
Lächelnd schüttelte ich den Kopf.
»Was ist denn?«, fragte sie.
»Die Welt dreht sich und die Welt verändert sich. Nonnen mit Mobiltelefon.«
»Na und? Das ist doch leichter zu akzeptieren als die Vorstellung, dass ein Grillkoch tote Menschen sieht!«
»Stimmt. Mein weibliches Gegenstück wäre wahrscheinlich so jemand wie in dieser alten Fernsehserie – eine fliegende Nonne.«
»In meinem Kloster sind fliegende Nonnen nicht zugelassen«, erklärte Schwester Angela. »Die sind meistens zu albern, und beim Nachtflug krachen sie gern durch die Fensterscheiben.«