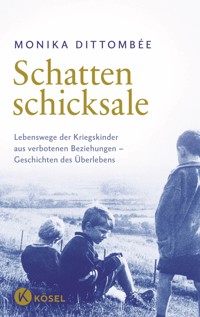
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Verheimlicht und verborgen: Die vergessenen Kinder des Kriegs und ihre Suche nach Identität
»Hurenkind«, »Russensau«, »Bastard«: Mit diesen Schimpfworten wuchsen sie auf, die unerwünschten Kinder des Zweiten Weltkriegs und der Besatzungsjahre. Kinder aus Beziehungen zwischen deutschen Frauen und Zwangsarbeitern oder Soldaten der Alliierten. Obwohl offiziell verboten, entstanden diese Kontakte dennoch, ob aus Verzweiflung, Liebe oder Gewalt. Die daraus gezeugten Kinder wurden oft versteckt, verprügelt und beschimpft.
Geboren mit einem Stigma: Was richtet das mit einer Kinderseele und dem späteren Erwachsenen-Ich an? Noch Jahrzehnte später suchen viele von ihnen nach der Lücke in ihrem Leben. Manchmal schaffen Zufälle eine neue Realität: ein zerknicktes Foto, ein belauschtes Gespräch oder eine wiederentdeckte Geburtsurkunde.
Monika Dittombée erzählt die Lebensgeschichten dieser Kinder und fragt, wie Traumata geheilt werden können, die selbst Nachfolgegenerationen spüren. Ihr Buch beleuchtet die deutsche Verdrängungskultur und verbindet persönliche Schicksale mit Fragen zu Identität, Scham und Resilienz – und zeigt Wege zur Heilung und Versöhnung.
- 80 Jahre nach Kriegsende endlich im Fokus: Das Schicksal der Kinder aus verbotenen Beziehungen zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen sowie Zwangsarbeitern
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Noch heute suchen viele Kinder aus Beziehungen zwischen deutschen Frauen und Zwangsarbeitern oder Soldaten der Alliierten nach der Lücke in ihrem Leben. Monika Dittombée zeichnet ihre bewegenden Schicksale nach – und beleuchtet damit einen wichtigen Aspekt der Nachkriegsgeschichte, der bisher nicht die verdiente Aufmerksamkeit gefunden hat. Deshalb soll es in diesem Buch auch um die deutsche Erinnerungskultur gehen: Um das offizielle Gedenken, aber auch die Spurensuche im Mikro-Umfeld der eigenen Familien.
Die Autorin
Monika Dittombée, geb. 1976, Diplom-Germanistin mit Schwerpunkt Journalismus, arbeitete als Redakteurin für verschiedene Magazine, bevor sie als freie Autorin tätig wurde. Sie schreibt unter anderem für Brigitte, Spiegel Geschichte, Merian oder P.M. History und lebt in Schleswig-Holstein.
MONIKADITTOMBÉE
Schatten-schicksale
Lebenswege der Kriegskinderaus verbotenen Beziehungen –Geschichten des Überlebens
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2025 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlag: zero-media.net
Umschlagmotiv: © Studio MPM / getty images
Alle Bilder im Innenteil wurden aus dem Privatbesitz der Protagonist*innen zur Verfügung gestellt.
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-33183-2V002
www.koesel.de
Inhalt
Vorwort
Teil Eins: Kindheit im Schatten
Aufgewachsen im Lager: »Erst als älterer Mensch bin ich darauf gekommen, diesen Narben aus der Kindheit ihren Raum zu geben«Jack-Peter Kurbjuweit, geboren 1945
Ein Waffelröllchen als Wendepunkt
Resilienz und Überleben
»Guten Abend, ich bin dein Sohn«
Die Blicke der anderen: »Ich war der Bastard von der Alb«Meggie Beck, geboren 1947
Die Unerwünschten
Ein Foto führte zum Vater
Der weiße Fleck in der Identität
Eine Narbe, lebenslang
»Wir, die menschlichen Blindgänger des Zweiten Weltkriegs«Marianne Gutmann, geboren 1945
Geprägt von einem Geheimnis
»Mein Vater erlebte die beste Zeit seines Lebens in Berlin zwischen 1943 und 1945«Ton Maas, geboren 1956
Kalter Empfang in den Niederlanden
Verloren in Europa: Die unerforschten Schicksale der Zwangsarbeiter
Teil Zwei: Das Erbe der Vergangenheit
Von offenen und geschlossenen TürenWarum manche Familien noch heute schweigen
»Welche Macht haben die Toten über die Lebenden?«Arne Øland, geboren 1945
»In Zukunft sagt ihr Vater zu ihm!«
Leben unter deutscher Besatzung
Von der Wut und der Kraft des Verzeihens
»Mutter, wir müssen reden«
Vom Recht des Kindes, seine Eltern zu kennen
Wege zur HeilungÜber transgenerationale Weitergabe
Die Folgen der »schwarzen Erziehung«
Von der Macht des Ungesagten
Die Irrwege eines Traumas
Das Forschen in der eigenen Familie
Ein emotionales Erbe: Die transgenerationale Weitergabe
Gedenkarbeit statt Erinnerungskultur?
»Ich hatte noch nicht begriffen, dass man im Leben viele Tode sterben muss, um leben zu können«Alexander Metz, geboren 1946
Eine Spur nach Jugoslawien
Sei für andere das, was du dir selbst wünschst
Nachwort
Anmerkungen
Vorwort
Jeden Tag laufe oder fahre ich an einer Sitzbank vorbei. Scheinbar eine völlig normale Bank. Doch vor einiger Zeit hat dort jemand ein metallenes Schild mit einem eingravierten fröhlichen Vögelchen angebracht. Der Vogel sieht hübsch und mutig aus, von der Bank blickt man auf eine friedliche Landschaft: geschwungene Hügel, Wiesen, Felder, eine Au. Diese Bank ist sehr idyllisch postiert, fast zu jeder Jahreszeit lassen sich dort die Spaziergänger nieder, genießen bei gutem Wetter die Aussicht. Der fröhliche Vogel, der bleibt. Niemand weiß, wer diese Gravur gefertigt und angebracht hatte und aus welchem Grund, doch ich stelle mir vor, dass dieser Jemand Freude verbreiten wollte. Doch schon wenn ich ein paar hundert Meter weiter laufe, lande ich in einem gedanklichen Parallel-Universum. Dort steht ein Gedenkstein, mit den letzten Worten eines Sohnes an seine Eltern:
»Wir werden die letzten Opfer dieses Krieges sein, und auch umsonst, wie so viele Gefallene.«*
Matrose Fritz Wehrmann, 26 Jahre
Obergefreiter Martin Schilling, 22 Jahre
Marinefunker Alfred Gail, 20 Jahre
Zwei Tage nach der Kapitulation am 10. Mai 1945 von NS-Marinekriegsrichtern wegen »schwerer Fahnenflucht« zum Tode verurteilt und an Bord des Begleitschiffes Buea vor Norgaardholz erschossen.
»Aber glaubt mir, ich bin kein Verbrecher, wenn man mir auch jetzt die Ehre genommen hat. Ich habe es lediglich getan, nachdem der Krieg ja aus war, und um Euch dann beschützen zu können.«*
*Aus dem Abschiedsbrief von Alfred Gail an seine Eltern.
Jedes Mal, wenn ich an diesem Gedenkstein vorbeilaufe, bleibe ich stehen, lese die Zeilen und spüre einen Schauer. Was für grauenhafte Zeiten, in denen ein Menschenleben nichts zählte.
Der Gedenkstein wird gepflegt, stets stehen dort frische Blumen und Friedhofslichter. Eine hölzerne Sitzgruppe mit bester Aussicht auf die Ostsee und das gegenüberliegende Dänemark lädt zur Pause ein, zum Verweilen, zum Nachdenken. Seit 80 Jahren ist der Zweite Weltkrieg vorbei, doch die Wunden klaffen weiter. Wir laufen nie über unschuldigen Boden. Immer schon tobten Schlachten, Kämpfe, Kriege, gleich um die Ecke. Manchmal reißt uns ein Mahnmal aus dem gegenwärtigen Moment, zurück in die Vergangenheit. Wir können uns gar nicht genug erinnern, auf welche Art und Weise auch immer.
Auch davon wird dieses Buch handeln, das aus einer journalistischen Auftragsgeschichte heraus entstand. Niemals hätte ich zum damaligen Zeitpunkt gedacht, dass ich mehrere weitere Monate mit diesem Thema verbringen würde, voller Informationsdrang und Freude darüber, dass aus diesem bislang kaum beleuchteten Thema wirklich ein Buch werden könnte. Die Protagonisten, über die ich schreibe, haben es verdient, dass ihnen mehr Aufmerksamkeit zuteil wird.
In diesem Buch geht es um Kinder, die aus »unerwünschten Beziehungen« stammen. Eine Liaison »mit dem Feind«, wie es in der menschenverachtenden Propaganda des Nazi-Regimes hieß, galt als Schande. Ob es sich um das Verhältnis einer deutschen Frau zu einem französischen Soldaten oder zu einem griechischen Zwangsarbeiter handelte: Dieser »Verrat«, diese »Sünde« wurde hart bestraft, in nicht wenigen Fällen erfolgten Hinrichtungen. Von der Gesellschaft wurden die Mütter diffamiert, verachtet und ausgegrenzt, selbst in der eigenen Familie. Die Kinder, so sie denn nicht abgetrieben, ausgesetzt oder weggegeben wurden, wuchsen in dem Gefühl auf, dass mit ihnen etwas nicht stimme. Viele von ihnen mussten während und nach dem Zweiten Weltkrieg versteckt und verleugnet werden, und ihre wahre Identität blieb ihnen selbst lange verschleiert. Von Geburt an waren diese Kinder mit einem Tabu belegt. Über ihre Herkunft wurde in den Familien auch im Nachkriegsdeutschland nicht gesprochen, daran erinnerte man sich einfach nicht. Teilweise hält das verzagte Schweigen bis heute an, aus Scham oder Angst vor Diskriminierung. Stammt man etwa aus einer Familie mit einem jüdischen Elternteil, wirkt die Angst um das eigene Leben nicht banal, sondern sehr real. Dennoch existieren sie, diese Kinder des Krieges.
»Children born of war«, dieser Begriff schließt alle ein, die während des Zweiten Weltkriegs oder während der folgenden Besatzungsjahre gezeugt wurden. Alle Erzähler in diesem Buch gehören zu diesen einst unerwünschten Kindern. Trotz unterschiedlicher Herkunft weisen ihre Geschichten einige Gemeinsamkeiten auf. Sie spürten schon in der Kindheit ein seltsames Gebaren ihnen gegenüber. Getuschel, seltsame Blicke, plötzliches Schweigen, wenn das Gespräch auf ein brenzliges Thema kam. Oder sie hörten Schimpfworte wie »Russenbalg«, »Bankert« oder »Moffe« zufällig im Vorbeigehen oder in der Schule, ohne zu wissen, was diese Begriffe bedeuten sollten. Doch das Gefühl der Abgrenzung war für sie direkt spürbar.
Sie fühlten sich fremd, wurden von Spielen mit anderen Kindern ausgeschlossen. Sie trugen falsche Nachnamen – häufig den des neuen und deutschen Vaters –, da ihr Dasein verschleiert werden musste. Sie lauschten nachts an Küchentüren, um etwas über sich zu erfahren, wenn etwa in der Küche die Verwandten saßen und geweint oder geschimpft wurde, über diesen unbekannten Vater. Was richten diese Heimlichkeiten in einer kindlichen Seele an? Die sehr wohl wahrnimmt, wenn etwas nicht stimmt? Wie kann trotz Lücken in der Biografie das Herausbilden einer Identität und das Reifen eines gesunden Selbstbewusstseins gelingen? Welche Rolle spielt Resilienz und wie lässt sich diese innere Stärke vertiefen? Diesen Fragen wollte ich nachgehen. Ich glaube, eine universelle Bedeutung darin zu erkennen, etwas zutiefst Menschliches: Wie wir wachsen und gedeihen können, trotz denkbar ungünstiger Umstände.
Denn kein Schicksal ist fest gemeißelt. Im Monumentalfilm Lawrence of Arabia aus dem Jahr 1962 heißt es an einer Stelle: »Nichts steht geschrieben«. Obwohl ich selbst so gerne schreibe, Dinge festhalten will und gedruckte Bücher so sehr wertschätze, gefällt mir zugleich die Vorstellung, dass jederzeit eine Korrektur erfolgen kann. Durch Menschen, die ihr Schicksal selbst bestimmen und keiner Norm folgen. Die Befehle nicht im blinden Gehorsam ausführen. Die sich nicht ängstlich verstecken lassen, sondern Mittel und Wege finden, unsinnige oder verbrecherische Gesetze zu umgehen. Die an ihren eigenen Willen glauben und diesen so weit wie möglich ausgestalten. Auch darum geht es in diesem Buch. Wie man Widerstände aushält und überwindet, in dem man sich selbst nicht aufgibt.
Eine weitere Gemeinsamkeit der Erzähler: diese schmerzhafte Sehnsucht nach dem unbekannten Vater, der in der Fantasie oft zu einem Retter, einem Erlöser hochstilisiert wurde. Der »echte« Vater würde eines Tages erscheinen und jede Wunde heilen, jedes Problem lösen, so die Hoffnung. Begleitet vom gleichzeitigen Gefühl eines Mangels, einer Lücke im Leben: »Wer ist mein Vater?«, »Was war er für ein Mensch?« und auch: »Warum hat er mich im Stich gelassen?«. Diesen Kindern wurde es verboten, derartige Fragen zu denken, geschweige denn, sie auszusprechen. Das eiserne Schweigen der Mütter hielt jahrzehntelang. In der Mehrheit der erzählten Fälle kamen erst nach dem Tod der Mutter durch Funde im Nachlass oder durch Verwandte, die sich auf einmal erinnern konnten, winzige Details an die Oberfläche. Für diese Kinder wurde jeder Schnipsel aus der Erinnerung bedeutsam. Ein Vorname, ein Foto, ein Brief oder eine handschriftliche Notiz glichen einem Goldschatz.
Noch eine weitere Gemeinsamkeit der Biografien zeigt sich in diesem Buch: Fünf der sechs »verbotenen« Kinder machten sich in ihrem mittleren Lebensalter auf die beschwerliche Suche nach dem leiblichen Vater, quer durch Europa. Auch wenn anfangs nur ein Vorname bekannt war. Es braucht wenig Fantasie, sich vorzustellen, wie kompliziert sich eine Suche mit so wenigen Anhaltspunkten gestalten kann. Es wurden Standesämter angefragt, Archive und Kirchenbücher durchforstet, Todeslisten studiert, alte Zeitungen gelesen, Übersetzer engagiert, Friedhöfe durchkämmt, verbunden mit den bangen Fragen: Werde ich überhaupt fündig? Wenn ja, wen finde ich? War er Täter oder Opfer? Bin ich überhaupt willkommen, wenn ich seine Familie kontaktiere?
Die Suche der erwachsenen Kinder in diesem Buch dauerte Jahre bis Jahrzehnte. Dafür braucht es nicht nur Disziplin und Durchhaltevermögen, sondern auch ein dickes Fell, um diese Geduldsprobe über lange Zeit hinweg auszuhalten. Ebenso kostet diese emotionale Achterbahnfahrt einfach Kraft. Misserfolg ist in jedem Stadium eine reale Möglichkeit: Absagen, amtliche Sackgassen oder gar Ablehnung, wenn eine Begegnung konkret wurde. »Ich wurde vom Hof gejagt«, dieser Satz taucht in einem der Kapitel auf und hier stellt sich die Frage, wie man mit der Wiederholung des kindlichen Dramas der Unerwünschtheit als Erwachsener neu umgeht.
Warum kann eine abwesende, fast spurlos verschwundene Person, die nichts zum eigenen Aufwachsen beigetragen hatte, derartig wichtig werden, dass man darüber die eigenen Kinder fast vergisst? »Obsession«, lautet eine Antwort in diesem Buch. Die Suche entwickelt eine Eigendynamik, einen Sog zurück in die Vergangenheit. Zurück zu den Wurzeln. Welches Grundbedürfnis verbirgt sich hinter dieser Suche? Der Wunsch nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Zugehörigkeit. Auch Pragmatismus spielt eine Rolle, wenn man über 50 Prozent der eigenen Gene nichts weiß, aber mehr erfahren möchte, um sich etwa über Erbkrankheiten oder genetisch relevante Vorbelastungen aus der väterlichen Linie zu informieren. Auch diese Faktoren spielen eine Rolle, um sich selbst im Leben besser zu verorten. Neben all diesen Gründen gewinnt seit einiger Zeit ein neues Thema an Bedeutung: die vielen Geheimnisse der transgenerationalen Traumata, also die unbewusste Weitergabe oder gar Wiederholung von Verhaltensweisen, wie sie die Vorfahren erlebt haben, die sich auch in der nächsten oder übernächsten Generation zeigen.
Transgenerationale Traumata werden seriös und sehr behutsam von interdisziplinären Wissenschaften erforscht. In Teilen stehen die Forscher vor dem gleichen Dilemma wie ein Nachkomme ohne Vater: Sie wissen, dass diese Dinge existieren. Zu viele Fallgeschichten belegen die Notwendigkeit, dieses Thema intensiver zu durchleuchten, auch wenn der endgültige Beleg sich nicht komplett in einer Kausalitäts-Kette aus »Information plus Beweis« abbilden lässt. Zumindest liefert dieses weite Themenfeld eine Erklärung dafür, warum sich die Kriegskinder – und auch die Kriegsenkel-Generation – so häufig mit seltsamen Gefühlen und Reaktionen konfrontiert fühlen, ohne einen treffenden Grund dafür aus dem eigenen Leben heraus benennen zu können. Es könnte sich um vererbte Gefühle der Eltern oder Großeltern handeln, die man unbewusst und ungewollt neu durchlebt. Biologische Forschungen – Stichwort Epigenetik – weisen auf mögliche genetisch abgespeicherte Erfahrungen und Zusammenhänge hin.
Neben den reichhaltigen wissenschaftlichen Erkenntnissen fesseln mich die individuellen Erzählungen, die Schlüsselsätze, die Wendepunkte und Zufälle, die ein Leben prägen. Darüber schwebt übergeordnet die Frage: wie sehr lässt sich ein eigenständiges Leben fernab von Dogmen, Rollenmustern und Zuschreibungen gestalten? Ich habe diesen erzählenden Personen sehr gerne zugehört. Ich habe mitgebangt, mitgefiebert, mitgelitten beim Zuhören. Es wird auch um die deutsche Erinnerungskultur gehen. Die offiziellen Gedenktage, die Mahnmale, die Gedenksteine, die Kranzniederlegungen, all das zeremonielle, offizielle Gedenken. Diese Rituale sind immens wichtig gegen das Vergessen. Doch neben dem kollektiven Gedenken sollten wir auch in unserem Mikro-Umfeld, in den eigenen Familien nachbohren und den Menschen zuhören, die diese existenziellen Erfahrungen, bedingt durch den Zweiten Weltkrieg, selbst erlebt und deren Folgen überlebt haben. Mit diesem Wissen können wir stärker werden. Für die eigenen Kinder, die Enkel und die Kinder der Enkel. Und alle danach Kommenden ebenso. Fangen wir damit an.
Teil Eins:Kindheit im Schatten
Im Lager gab es auch unbeschwerte Momente: Jack-Peter ist mittig zu sehen
Jack-Peter, rechts, mit seinem Halbbruder
Aufgewachsen im Lager: »Erst als älterer Mensch bin ich darauf gekommen, diesen Narben aus der Kindheit ihren Raum zu geben.«
JACK-PETERKURBJUWEIT, GEBOREN 1945
Am schlimmsten waren die Latrinen. Mehrere Baracken teilten sich eine Latrinenanlage, die etwa 50 Meter hinter den Gebäuden lag. Allein der Gang dahin löste Ängste aus. Was, wenn man hineinfällt? Oder von einem Monster heruntergezogen wird? Niemand wusste, was unten in der Tiefe alles waberte oder was da unten lebte. Lauter negative Gefühle für ein Kind, das ohnehin schon unter schwierigen Bedingungen aufwuchs. Den Grusel spürt er bis heute, ebenso wie er den Gestank der Latrinen noch riechen kann, der ihm schon aus meterweiter Entfernung in die Nase kroch.
Jack-Peter Kurbjuweit wurde 1945 im Flüchtlingslager Salzgitter-Watenstedt in Niedersachsen geboren, einem ehemaligen Arbeitslager. Etwa 15 000 Flüchtlinge lebten beengt in den Baracken und arbeiteten in der Stahlproduktion der ehemaligen Reichswerke Hermann Göring, die nach dem Krieg in die staatliche Salzgitter AG umgewandelt wurde. Umgeben von Krankheiten und Gewalt wuchs Jack-Peter Kurbjuweit mit seiner Mutter, zwei jüngeren Halbgeschwistern und dem vermeintlichen Vater auf. Sie lebten in einer Steinbaracke mit einem Ofen für Sägespäne und einem gemauerten Herd mit Backofen, der mit Kohle erhitzt wurde. Eine Zinkwanne für das Baden an jedem Samstag gab es auch. Das Wasser wurde auf dem Herd erhitzt. Falls die Baracken Wasserleitungen hatten, dann nur für kaltes Wasser. Seine Mutter arbeitete als Sekretärin, sein Vater in drei Schichten im Stahlwerk.
1952 wurde eine Schule im Lager Salzgitter-Watenstedt eröffnet. Jack-Peter gehörte zum ersten Jahrgang. Die Lehrer waren zumeist ehemalige Soldaten, das Lernen erfolgte auch unter dem Einsatz des Rohrstocks. Auch das Elternhaus bot ihm wenig Schutz. Im Gegenteil. Er erzählt: »Dieser Mann hat nie gelacht. In meiner Gedankenwelt hatte er seine Wehrmachtsuniform nie ausgezogen. Dieser Kurbjuweit, von dem ich glaubte, er sei mein Vater, und der mich prügelte. Mit allem, was er in die Hände bekam. In der düsteren Welt meiner Eltern hatte ich die Arschkarte gezogen«. Für den Jungen existierte nichts Positives in diesen beiden Mikrokosmen Schule oder Familie. Die Lehrer waren ähnlich hartherzig und streng wie der Vater. In der Schule schmerzte der Rohrstock, zu Hause setzte es wieder Prügel. Ein doppeltes Minenfeld.
Als Jack-Peter 13 Jahre alt war, verschwand seine Mutter plötzlich über Nacht. Wohl geflüchtet vor den Schlägen ihres Mannes, eines ehemaligen »Tapferkeitssoldaten«. Für den jungen Jack-Peter ein Drama, eine schwindelerregende Verlorenheit. Die Mutter war sein emotionaler Anker gewesen. Nun war sie verschwunden, ohne ihn. Er fühlte Verlassenheit, Einsamkeit und eine totale innere Zerstörung. Zu seinem vermeintlichen Vater hatte er nie eine innige oder gar liebevolle Beziehung aufbauen können. Immerhin durfte er in dieser Zeit zum Trost einen zugelaufenen Hund behalten. Bald darauf wurde er zu einer sechswöchigen Kinderkur in den Schwarzwald geschickt. Diese Möglichkeit existierte für besonders magere Kinder, um sie in einer Kur in Süddeutschland wieder aufzupäppeln. Diejenigen Kinder, die etwas mit den Bronchien hatten, kamen in Heime an die Ost- und Nordsee.
Nach seiner Rückkehr war der Hund verschwunden, dafür war eine fremde Frau mit zwei Töchtern in die steinerne Baracke eingezogen. »Das sei unsere neue Mutter, so wurde mir erklärt. In einigen Tagen würden wir das Lager verlassen und gemeinsam in eine neue, richtige Wohnung umziehen. Die Lager wurden Baracke für Baracke aufgelöst. In Salzgitter wurde viel gebaut, die Flüchtlinge bekamen neue Wohnungen zugewiesen. Doch mit diesen plötzlich aufgetauchten Fremden wollte ich nicht mitgehen. Im Lager hatte ich wenigstens meine Clique und Freunde. Aber heulend, in tiefem Schmerz, musste ich mit denen umziehen. Ich versuchte, mich auf die neue Situation einzustellen. Ich konnte mich aber nicht an diese neue Frau und die mitgebrachten Kinder gewöhnen. Während eines Streits – ich hatte mich schützend vor meinen jüngeren Halbbruder gestellt, als die mitgebrachten Mädchen ihn ärgerten – schrie diese Frau mich an: ›Was willst du denn? Du gehörst hier überhaupt nicht dazu! Das ist doch gar nicht dein Vater.‹ Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Mein Vater ist nicht mein Vater. Was sollte das heißen«?1
Für welches Kind würde an dieser Stelle nicht eine Welt zusammenbrechen, wenn alle Gewissheiten verlorengehen? Erst verschwand die Mutter, dann löste sich auch die Vaterfigur im Nichts auf. Was richtet dies mit einer Kinderseele an, die starke Wurzeln zum Wachsen und Gedeihen braucht?
Jack-Peter handelte pragmatisch. Er flüchtete zu seiner Großmutter Anna, die in der Nähe von Salzgitter lebte. Erst von ihr erfuhr er, dass sein leiblicher Vater ein Grieche sei, mit dem sich seine Mutter gegen Ende des Zweiten Weltkriegs verlobt hatte. In den Tagen der Vertreibung verlor sie jedoch den Kontakt zu ihrem Verlobten. Sie ließ ihn über das Rote Kreuz suchen, doch er galt als vermisst, habe die Vertreibung wohl nicht überlebt, so hieß es. Die Mutter hatte erst im Lager 1947 einen anderen Mann geheiratet. Der Ehemann, Ernst Kurbjuweit, adoptierte ihren Sohn Jack-Peter.
Wer war nun dieser unbekannte Vater? Fragezeichen im Kopf des Jungen. Er erfuhr, dass seine Mutter Edeltraut, genannt Traudel, bereits vor der Ankunft im Lager schwanger mit ihm war. Mit Baby im Bauch wurde sie im Sommer 1945 von jetzt auf gleich aus dem Sudetenland vertrieben, so wie bis zu drei Millionen Deutsche. Sie bekam einen Brief, geschrieben auf Deutsch und Tschechisch, sie solle am nächsten Morgen am Bahnhof in Teplice, ehemals Teplitz-Schönau, erscheinen. Dazu erhielt sie eine Liste mit Gegenständen, die sie mitnehmen durfte, und den Ort, wo sie Wohnungsschlüssel und Wertgegenstände zu hinterlegen habe. Von heute auf morgen. Wie es ihr gelang, das Lager Salzgitter-Watenstedt zu erreichen, bleibt unklar.
Jack-Peter Kurbjuweit besitzt ein Foto von ihr, auf dem sie wie eine strahlende junge Mutter aussieht, glücklich neben ihrem neugeborenen Baby, ganz in Weiß, auf dem Bett ausgestreckt. Die Aufnahme suggeriert Normalität, in einer Zeit und in einer Umgebung, in der ein »Normal« schlicht nicht existierte. Doch das Glück über ihr Baby überstrahlt die Umstände jener Zeit. Im Gespräch sagt er dazu:
»Was muss das für ein Druck für sie gewesen sein, das eigene Kind über Jahre hinweg anzulügen. Es waren immer die Frauen, die so viel zu tragen hatten und dies aushielten mussten. Das Nazi-Bild der idealen deutschen Frau klang in dieser Überlebenskraft noch nach. So viele andere unerwünschte Kinder haben erst nach dem Tod ihrer Mutter durch eigene Recherche, durch Verwandte oder andere Zufälle etwas erfahren und begannen zu suchen. Was muss das für die Frauen bedeutet haben, diese Last, dass sie nicht mit den eigenen Kindern während ihrer Lebenszeit noch darüber reden konnten. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Wie haben die Mütter das ausgehalten?«
Garantiert war das Schweigen mit Leid verbunden. Viele haben aus Pragmatismus geschwiegen, um die Kinder zu schützen, ohne zu ahnen, dass dieses Schweigen eine unsichtbare Mauer zwischen Mutter und Kind errichtet. In Jack-Peters Fall folgte darauf die Trennung von der Mutter. Traudel war nach Hannover gezogen, arbeitete als Chefsekretärin bei Telefunken. Weder sie noch er nahmen Kontakt auf. Jack-Peter war zu tief verletzt.
Er suchte seine wichtigsten Dinge zu Hause zusammen, lebte einige Monate lang versteckt bei der Familie eines seiner besten Freunde im Lager. »Solange sie dich nicht finden, kannst du bei uns bleiben«, sagte die Mutter seines Freundes. Er ging wieder normal zur Schule, sein Fehlen war nicht mal aufgefallen. Brauchte er eine Unterschrift der Eltern, fälschte er sie. Bis der Adoptivvater ihn aufspürte und vor die Wahl stellte, entweder bei ihm und der neuen Familie zu leben oder bei der Mutter in Hannover. Der Junge wollte beides nicht. Zu viele verletzte Gefühle, zu viel emotionales Durcheinander. Bis zum Schulabschluss 1960 lebte er bei seiner Großmutter Anna. Er begann eine Lehre als Starkstrom-Elektriker, bekam einen Vormund – ein Jugendsekretär der IG Metall –, ein Zimmer, ein eigenes Leben. Er schloss sich einer gewerkschaftlichen Jugendgruppe an, die sich einmal wöchentlich im Freizeitheim traf. Gemeinsam mit dieser Jugendgruppe besuchte er im ersten Ausbildungsjahr das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz, ein Ort, der ihn nachhaltig berührte und prägte. Er selbst nennt es seine »politische Geburtsstunde«. Dort im Lager drehte sich ihm alles im Kopf. Er dachte an den Nazi-Adoptivvater und all die Nazi-Lehrer, die für eine Gesinnung standen, deren Resultat er in Auschwitz besichtigte.
Als Neunzehnjähriger traf er beim Tanz auf einer gewerkschaftlichen Veranstaltung der IG Metall eine junge Frau, in die er sich Hals über Kopf verliebte. Beide heirateten und bekamen 1965 einen Sohn. Fortan konzentrierte sich Jack-Peter Kurbjuweit auf seine junge Familie und seine berufliche Laufbahn. Er hatte mit dem Kapitel seiner Kindheit, dieser alten Geschichte, abgeschlossen. Alles weit weg, verdrängt: »Ich sagte mir, dass ich nun eine neue Familie habe. In dem Moment, in dem man das eigene Kind in den Armen hält, schaut man ganz anders auf die Eltern. Es ist so unfassbar, wie sehr man im Stich gelassen werden kann. In einer Art und Weise, wie man dies dem eigenen Kind niemals antun könnte. Unvorstellbar«.
Der Kontakt zur Mutter blieb spärlich. Damit er als Neunzehnjähriger heiraten durfte, musste er sie einmal anfragen, um seine Geburtsurkunde zu erhalten. Damals begann die Volljährigkeit erst mit 21 Jahren. Doch auch danach blieb der Kontakt reserviert.
Wie konnte Jack-Peter trotz all dem selbst ein guter Vater werden, frage ich ihn.
»Das weiß ich nicht. Indem ich mich häufig erinnerte, wie es mir erging. Mein Kind sollte bestimmte Dinge möglichst nicht erleben müssen. Der Widerspruch meines Sohnes war manchmal nicht einfach zu ertragen und ich musste lernen, gegen diesen Widerspruch etwas zu entwickeln. Gemeinsam mit anderen. Das gehört zum Leben dazu, dass man auch dicke Bretter durchbohren muss. Das musste er lernen. Aber bestimmte Dinge, die ich im Lager erlebt hatte, waren immer in meinem Kopf und bildlich präsent. Und die muss die nächste Generation nicht mehr erleben. Das muss anders gestaltet werden. Ich bin in meiner Kindheit in einer sehr männlichen Rolle erzogen worden. Dieses Rollenbild abzulegen, dabei half mir Marianne, meine Partnerin und Ehefrau. Eine emanzipierte Frau. Wenn wir in einem Familienkonflikt steckten, formulierten wir selbstverständlich auch unsere Gefühle. Man muss bereit sein, sich auseinanderzusetzen. Das ist kein Männerthema? Derartige Aussagen halte ich für Quatsch. Wir müssen in den Austausch kommen, alle.«
Was seiner Mutter und ihm nicht mehr gelingen sollte. Erst kurz vor ihrem Tod 1971 ließ Traudel ihrem Sohn einen Zettel mit drei Namen und Geburtsdaten zukommen. Es waren die Namen von drei Brüdern aus dem Großraum Athen, die als Zwangsarbeiter in das Sudetenland deportiert wurden. Der Älteste sei sein leiblicher Vater: Pietro Dolcetti, wie seine Brüder ein Grieche mit italienischen Wurzeln. Den Zettel verwahrte Jack-Peter Kurbjuweit sorgfältig. Doch den Gedanken an richtige und falsche Väter schob er beiseite, damit wollte er sich nicht auseinandersetzen. Dieses Thema blieb für ihn über Jahrzehnte hinweg zu stark mit Scham behaftet. Er hätte gerne mehr von seiner Mutter erfahren. Doch als er sich allmählich für klärende Gespräche bereit fühlte, war Traudel bereits verstorben.
Ein Waffelröllchen als Wendepunkt
24 Jahre später. 1995 fuhr Jack-Peter Kurbjuweit mit seiner Frau in die Ferien nach Griechenland, wie so viele Jahre zuvor auch. Doch diesmal sollte der Urlaub anders verlaufen. Jack-Peter Kurbjuweit liebt bis heute eine bestimmte Sorte Waffelröllchen in einer Blechdose, gedreht und gefüllt mit Schokolade namens »Caprice«. Damals im Urlaub öffnete er wieder eine Dose davon. Dafür muss man eine metallene Verpackung aufziehen. Im Inneren der Verpackung lag ein rosa Papier, das ihm nun zum ersten Mal auffiel. Darauf geschrieben: das Wort »Dolcetti«.
Das ist Italienisch und bedeutet »Süßigkeit«. Zugleich war das der Nachname seines Vaters. Ein Schlüsselmoment:
»Dieser Zufall sollte Folgen haben. Meine Frau und ich schauten uns an. Mutter und Großmutter hatten damals alles versucht, ihn zu finden. Aber könnte mein Vater eventuell doch noch leben? Wollte ich das überhaupt herausfinden? Sollte ich mit den heutigen Möglichkeiten versuchen, etwas über seinen Verbleib zu erfahren? Ich war damals 50 Jahre alt und entschied mich für eine neuerliche Suche. Erst im Internet, dann schrieb ich die Universität Graz an, wo er studiert haben soll, kontaktierte den Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes. Alles ohne Erfolg.«2
Seit 1945 hilft der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes, vermisste Angehörige zu finden, die durch Kriege, bewaffnete Konflikte, Katastrophen oder Migration verschwunden sind. Mit Hilfe einer zentralen Namenskartei und internationalen Netzwerken vermittelt das DRK Kontakte zu vermissten Personen. Der Suchdienst ist kostenlos. Jeder kann ihn nutzen, der Klarheit über das Schicksal von Angehörigen will. Jack-Peter Kurbjuweit wollte nach diesem ersten Versuch nicht aufgeben. Er sah dicke Telefonbücher mit Adressen auf der griechischen Post rund um Athen durch. Viermal stieß er auf den Namen Dolcetti. Nach Beratung mit einer befreundeten Psychologin formulierte er einen vorsichtigen Brief mit der Frage nach möglichen Verbindungen zu den Brüdern Pietro, Nikos und Takis Dolcetti und verschickte das Schreiben an die vier verschiedenen Adressen. Mit einem leicht mulmigen Gefühl und einer inneren Anspannung. Was löst eine solche Suchanfrage in den Familien aus? Er hatte sich in dem Brief offen als Sohn von Pietro vorgestellt. Vielleicht existierten Halbgeschwister? Er erhielt keine Antwort. Ein Jahr später sendete er den gleichen Brief erneut mit Straßennamen in angepasster Schreibweise mit griechischen Schriftzeichen. Dieses Mal erhielt er sechs Monate später eine Antwort. Giacomo, der Sohn von Nikos Dolcetti, dem jüngeren Bruder des Vaters Pietro schrieb, dass der Brief zwar in der richtigen Familie gelandet sei, doch man wisse nichts über den Verbleib von Pietro. Über den Kontakt zu Jack-Peter würde man sich aber sehr freuen.
Der reagierte überglücklich. Allein das Wissen, dass eine Familie existierte. Dass es Verwandte in Griechenland gab, die sich sogar auf ihn freuen. Im nächsten Urlaub traf er in Begleitung einer befreundeten Übersetzerin erstmals seinen Cousin Giacomo auf dem Berg Lykabettus in Athen. Sie sprachen über ihre Familie, über die Kinder. In dieser Zeit begann Jack-Peter Kurbjuweits Sohn gerade ein Studium der Nautik in Flensburg, weil er Kapitän werden wollte. Jack-Peter hatte sich immer gefragt, woher sein Sohn diese Sehnsucht zum Wasser hatte, zu Hause in Hameln gab es nur einen Fluss. Nun erzählte ihm Giacomo, dass sein Großvater ebenfalls Kapitän gewesen sei und Lastschiffe von Genua nach Piräus gefahren habe. Existieren also doch geheime familiäre Ähnlichkeiten über Generationen hinweg? Oder genetische Prägungen? Das fragte sich Jack-Peter. Giacomo gab ihm die Telefonnummer seines Onkels Takis. Beim ersten Zusammentreffen von Neffe und Onkel traten beiden die Tränen in die Augen.
Für Jack-Peter fühlte sich diese Begegnung wie eine Erlösung an. Er wurde herzlich von Takis und dessen Familie empfangen. Er sollte sein Leben erzählen, seinen Werdegang. Es folgten mehrere Besuche in Griechenland. Sie feierten mit etwa 20 Verwandten gemeinsam das Osterfest, das in dieser Familie nicht groß genug ausfallen kann: mit einem kompletten Lamm am Spieß über dem Feuer, Ostergebäck und reichlich Ouzo. Jack-Peter sollte griechische Tänze lernen. Es wurde geredet, gelacht, geweint.
Umgekehrt reiste Takis nach Hameln, um Jack-Peter zu besuchen. Der hatte die Idee, gemeinsam in das ehemalige Sudetenland nach Tschechien zu reisen und die Orte zu besuchen, an denen die drei Brüder Dolcetti zwischen 1943 und 1945 als Zwangsarbeiter in deutscher Gefangenschaft überlebten. Die Hermann Göring Werke Ullersdorf, die Baumwollspinnerei Mitscherlich, das Gefängnis, das ehemalige Wohnhaus von Jack-Peters Mutter. Manche Menschen in den Dörfern drehten sich weg, wenn sie nur die deutsche Sprache hörten, andere waren offen und halfen bei der Suche nach Adressen.
Zurück in Griechenland betrachteten sie gemeinsam mit der versammelten Familie die Fotos der Reise und Takis begann zu erzählen. Immer wieder brach er in Tränen aus. »Bis dahin war ich mir unsicher, ob diese Reise in die Vergangenheit ihm guttun würde. Schließlich wurden alle schlimmen Erlebnisse wieder aufgewühlt. Jetzt aber spürte ich, dass sein Sprechen über das Erlebte ihm guttat und er endlich loslassen konnte. Auch in dieser Familie wurde also bis zu diesem Zeitpunkt nicht über die Kriegszeiten gesprochen, sie wurden verdrängt«, so Jack-Peter Kurbjuweit. Die gesamte griechische Familie hatte bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, was die Brüder während des Krieges erlitten hatten. Ohne die Mutter von Jack-Peter – ohne Edeltraut – wären die drei Brüder nicht mehr am Leben. Diese Feststellung wiederholte Takis unter Tränen mehrfach. Traudel hatte bis 1945 als Chefsekretärin beim Geschäftsführer der Betriebskrankenkasse der Hermann Göring Reichswerke im Sudetenland gearbeitet und in dieser Position die Freilassung der Brüder aus dem Zwangsarbeiter-Lager erwirken können.
Im Laufe dieses Abends weinten alle Anwesenden beim Zuhören. Nur der dritte Bruder Nikos blieb stumm. Er wollte nicht über diese Zeit sprechen, obwohl er ähnliche Erfahrungen wie seine Brüder Takis und Pietro durchlebt hatte. Für ihn war das Schweigen leichter erträglich als das Erinnern, das Erzählen, das Herauslassen. »Das Leben im Lager führte dazu, dass wir keine Gefühle mehr hatten, kein Herz. Es gab nur die Gegenwart, wir konnten nicht wissen, was in einer Stunde sein würde. Du weißt nichts, du bist nicht mehr als ein Hund. Du spürst den Schmerz gar nicht, du hast keine Gefühle, keine Empfindung«, so beschrieb es Takis.3
In den Hermann Göring Werken Ullersdorf wurde Kohle gefördert, daraus wurden Benzin und Ersatzbenzin hergestellt. Takis erinnerte sich an einen Einsatz der Lagerinsassen in Dresden, nach der Bombardierung vom 13. bis 15. Februar 1945:
»In der Stadt sahen wir viele tote Menschen liegen, es stank fürchterlich. Unsere Arbeit waren das Bergen von Leichen und die Bombenentschärfung. Dabei sind viele von uns getötet worden. Nachdem die Leichen geborgen und zu einem Platz gebracht worden waren, wurden große Gruben für sie ausgehoben. Die erste Leichenschicht wurde hineingeworfen und mit Chlor bedeckt. Den schaufelten wir von einem Auto aus in die Grube. Dann kam eine weitere Leichenschicht darüber, auch die wurde mit Chlor bedeckt. Das wurde einige Male wiederholt. Bei dieser Arbeit waren der Leichengeruch und der Chlorgeruch fast unerträglich. Obwohl wir einen Gesichtsschutz hatten, der mit Wasser gefüllt war, ging es uns sehr schlecht, denn der Gestank wurde durch die Maske nur wenig neutralisiert.«
Jack-Peter hatte die erzählten Erinnerungen seines Onkels aufgenommen und dann sieben Jahre lang an einem Buch über seine Familiengeschichte geschrieben. Für ihn war wichtig, dass Takis das Buch als Würdigung noch vor seinem Ableben erhalten sollte. Doch Jack-Peter schrieb auch für seinen Sohn, die Enkel und die Familie in Griechenland. Denn mit dem Tod eines Menschen schwinden auch dessen Erinnerungen.





























