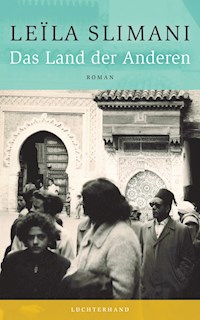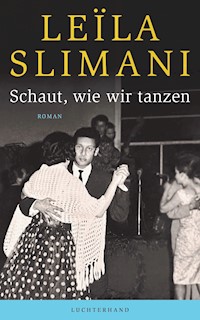
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue große Roman des literarischen Weltstars Leïla Slimani. Die faszinierende Fortsetzung des Bestsellers »Das Land der Anderen«.
Eine junge Ärztin – und die Sehnsucht einer ganzen Generation nach einem neuen Leben.
Wie viel Aufbruch ist möglich? Wie frei darf sie sein?
Im Sommer 1968 kehrt Aïcha Belhaj nach vier Jahren Medizinstudium in Straßburg nach Marokko zurück. In Frankreich gehen die Studenten auf die Straße, von den Barrikaden tönt der Ruf nach gesellschaftlicher Veränderung. Doch in ihrer Heimat trifft die angehende Ärztin auf eine erstarrte Welt. Die Farm von Aïchas Vater floriert zwar, die Familie allerdings ist zerrissen. Ihr Bruder Selim verschwindet in einer Hippiekommune an der Küste und versinkt im psychodelischen Drogenrausch. Wie soll Aïcha sich behaupten in einem Land, in dem bisher nur Männer Ärzte sind und das von einem autoritären König regiert wird? Am Abend der Mondlandung begegnet sie in einer Strandbar bei Casablanca einem Wirtschaftsstudenten, den alle nur »Karl Marx« nennen. Er ist Teil einer intellektuellen Jugend, die das Land erneuern möchte. Kann Aïcha mit ihm ihren Traum von einem unabhängigen Leben verwirklichen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Der neue große Roman des literarischen Weltstars Leïla Slimani. Die faszinierende Fortsetzung des Bestsellers »Das Land der Anderen«. Eine junge Ärztin – und die Sehnsucht einer ganzen Generation nach einem unabhängigen Leben. Wie viel Aufbruch ist möglich? Wie frei darf sie sein?
Im Sommer 1968 kehrt Aïcha Belhaj nach vier Jahren Medizinstudium in Straßburg nach Marokko zurück. In Frankreich gehen die Studenten auf die Straße, von den Barrikaden tönt der Ruf nach gesellschaftlicher Veränderung. Doch in ihrer Heimat trifft die angehende Ärztin auf eine erstarrte Welt. Die Farm von Aïchas Vater floriert zwar, die Familie aber ist zerrissen. Ihr Bruder Selim verschwindet in einer Hippiekommune an der Küste. Wie soll Aïcha sich behaupten in einem Land, in dem bisher nur Männer Ärzte sind und das von einem König autoritär regiert wird?
Am Abend der Mondlandung begegnet sie in einer Strandbar bei Casablanca einem brillanten Wirtschaftsstudenten, den alle nur »Karl Marx« nennen. Er ist Teil einer intellektuellen Jugend, die das Land erneuern möchte. Kann Aïcha mit ihm ihren Traum von einem unabhängigen Leben verwirklichen?
Meisterhaft erzählt Leïla Slimani in dieser faszinierenden Fortsetzung ihres Bestsellers »Das Land der Anderen« von einer Gesellschaft im Umbruch, von der Hoffnung auf Fortschritt und dem Wunsch nach Aufbrechen alter Strukturen.
»Leïla Slimani hat sich selbst übertroffen.« Le Mondes des Livres
»Eine großartige französisch-marokkanische Familiensaga.«
Die Literarische Welt
»Es sind diese glasklaren Sätze, die Leïla Slimani zu einer der bedeutendsten französischen Stimmen ihrer Generation machen.«
NDR Kultur
»Es ist die Familiengeschichte Leïla Slimanis und zugleich die brillante Weiterführung ihres literarischen Themas: Frauen, die versuchen, ihre Freiheitssehnsucht durchzusetzen und unabhängig zu leben.«
Mara Delius, Welt am Sonntag
Die französisch-marokkanische Autorin Leïla Slimani gilt als eine der wichtigsten literarischen Stimmen Frankreichs. Ihre Bücher sind internationale Bestseller. Slimani, 1981 in Rabat geboren, wuchs in Marokko auf und studierte an der Pariser Eliteuniversität Sciences Po. Für den Roman »Dann schlaf auch du« wurde ihr der renommierte Prix Goncourt zuerkannt. »Schaut, wie wir tanzen« ist der zweite Teil einer Romantrilogie, die auf der Geschichte ihrer eigenen Familie beruht. Zuletzt erschien im Luchterhand Literaturverlag das Memoir »Der Duft der Blumen bei Nacht«.
Amelie Thoma übersetzt Literatur aus dem Französischen, u. a. Marc Levy, Joël Dicker, François Sagan und Simone de Beauvoir.
LEÏLA SLIMANI
Schaut, wie wir tanzen
Roman
Aus dem Französischen von Amelie Thoma
Luchterhand
Die französische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Regardez-nous danser« bei Éditions Gallimard, Paris.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für seine großzügige Unterstützung ihrer Arbeit an der vorliegenden Übersetzung.
Copyright © 2022 Éditions Gallimard, Paris
Copyright © der deutschen Ausgabe 2022 Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung buxdesign / München
unter Verwendung eines Motivs
aus dem © Privatarchiv von Leïla Slimani
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-26407-9V004www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
www.twitter.com/luchterhandlit
Für Bounty, ohne den nichts möglich wäre.
PERSONENVERZEICHNIS
Mathilde Belhaj (geb. 1926) lernt Amine Belhaj 1944 kennen, als dessen Regiment in ihrem Dorf im Elsass stationiert ist. Die beiden heiraten 1945, und Mathilde folgt ihm bald darauf ins marokkanische Meknès. Drei Jahre lebt das Paar zusammen mit Amines Familie mitten in der Medina, im Berrima-Viertel, ehe sie auf eine Farm ziehen, wo Mathilde zwei Kinder bekommt, Aïcha und Selim. Während ihr Mann hart arbeitet, um die Farm zu einem blühenden landwirtschaftlichen Betrieb zu machen, eröffnet sie eine ambulante Krankenstation, in der sie die Bauern der Umgebung behandelt. Sie lernt Arabisch und den Berber-Dialekt der Gegend. Trotz aller Schwierigkeiten und obwohl ihr manche, vor allem die Stellung der Frau betreffende Traditionen zutiefst widerstreben, beginnt sie in diesem Land heimisch zu werden.
Amine Belhaj (geb. 1917), ältester Sohn von Kadour Beljah, einem Übersetzer der Kolonialarmee, und dessen Frau Mouilala, wird nach dem Tod seines Vaters 1939 zum Familienoberhaupt. Er erbt Land, beschließt jedoch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, sich bei einem Spahi-Regiment zu verpflichten. Zusammen mit seinem Adjutanten Mourad gerät er in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er fliehen kann. 1944 lernt er Mathilde kennen, die er 1945 im Elsass kirchlich heiratet. In den Fünfzigerjahren, während Marokko von Unruhen geschüttelt wird, kämpft er hartnäckig für seinen Traum, aus der Farm einen prosperierenden Agrarbetrieb zu machen. Er begeistert sich für moderne Anbaumethoden und züchtet neue Oliven- und Zitrussorten. Nach Jahren voller Enttäuschungen erlaubt ihm die Geschäftspartnerschaft mit dem ungarischen Arzt Dragan Palosi endlich, Gewinne zu erzielen.
Aïcha Belhaj (geb. 1947), Tochter von Amine und Mathilde, besucht eine katholische Mädchenschule in Meknès, wo sie hervorragende Noten bekommt. Das scheue, in sich gekehrte Kind ist der Stolz seiner Eltern.
Selim Belhaj (geb. 1951), Sohn von Amine und Mathilde, die ihn verhätschelt, geht ebenfalls auf eine katholische Schule.
Omar Belhaj (geb. 1927) hegt seit seiner Kindheit und Jugend eine Mischung aus Bewunderung und Hass für seinen älteren Bruder Amine. Insbesondere wirft er ihm vor, sich freiwillig zur französischen Armee gemeldet zu haben und der Liebling ihrer Mutter Mouilala zu sein. Impulsiv und aufbrausend, nähert Omar sich während des Zweiten Weltkriegs den Nationalisten an. In den Fünfzigerjahren wächst sein Einfluss, und er zettelt im Rahmen der Unruhen, die der Unabhängigkeit vorausgehen, Krawalle an.
Jalil Belhaj (geb. 1932), jüngster der Belhaj-Brüder, ist vom Fluch getroffen, der auf der Familie lastet: Er leidet unter einer psychischen Erkrankung und lebt zurückgezogen in seinem Zimmer, wo er sich immerzu selbst im Spiegel anschaut. Als seine Mutter krank wird und zu Amine auf die Farm zieht, wird Jalil nach Ifrane zu einem Onkel geschickt. 1959 hungert er sich zu Tode.
Mouilala Belhaj (geb. zu Beginn des 20. Jahrhunderts) ist die Ehefrau von Kadour Belhaj. Als Tochter einer Familie der Mittelschicht lernt sie weder lesen noch schreiben. Viele ihrer Vorfahren litten unter einer Geisteskrankheit und liefen nackt durch die Straßen oder redeten mit Geistern. Sie gebiert sieben Kinder, von denen vier überleben: Amine, Omar, Jalil und Selma. Die liebevolle und energische Mutter verehrt ihren Ältesten und bewundert ihre Schwiegertochter für deren Unabhängigkeit und Schulbildung. Um 1955 zeigt sie erste Symptome einer psychischen, demenzähnlichen Erkrankung. Daraufhin verlässt sie das Haus im Berrima-Viertel, in der Medina von Meknès, und verbringt ihre letzten Jahre auf der Farm. Sie stirbt 1959, ein paar Monate vor ihrem Sohn Jalil.
Selma Belhaj (geb. 1937) wird von ihren Brüdern Amine und Omar unablässig überwacht und von Omar geschlagen. Das strahlend schöne Mädchen, Liebling der Mutter, schwänzt regelmäßig den Unterricht und lernt im Frühjahr 1955 den jungen Piloten Alain Crozières kennen, von dem sie schwanger wird. Um den Skandal und die Schande zu vertuschen, verheiratet Amine sie mit seinem ehemaligen Adjutanten Mourad. 1956 bringt sie ein kleines Mädchen zur Welt: Sabah.
Mourad (geb. 1920) stammt aus einem kleinen Dorf, achtzig Kilometer von Meknès entfernt. 1939 wird er zur Armee eingezogen und an die Front geschickt, wo man ihn Amine als Adjutant zuteilt. Er empfindet für seinen Kommandanten eine ebenso brennende wie heimliche Liebe und ist eifersüchtig auf Mathilde. Bei Kriegsende bricht er mit nordafrikanischen Kolonialtruppen nach Indochina auf. Zermürbt von der brutalen Gewalt dieses Krieges desertiert er schließlich und schafft es, nach Marokko zurückzukehren und Amine zu finden. Als Vorarbeiter auf dem Belhaj’schen Gut erfüllt er seine Aufgabe mit militärischer Härte und wird von den Arbeitern gehasst. 1955 heiratet er Selma.
Monette Barte (geb. 1946), Tochter von Émile Barte, einem Flieger des Luftwaffenstützpunktes von Meknès, lernt Aïcha an der katholischen Schule kennen, die sie ebenfalls besucht. Die beiden jungen Mädchen werden enge Freundinnen und Vertraute.
Tamo, Tochter von Ito und Ba Miloud, Landarbeitern aus dem Duar in der Nähe der Farm, wird von Mathilde bei ihrer Ankunft auf dem Gut als Hausmädchen eingestellt. Obwohl ihre elsässische Herrin sie schroff behandelt, findet Tamo ihren Platz im Schoß dieser Familie, für die sie bis ans Ende ihres Lebens arbeiten wird.
Dragan Palosi, ungarische Gynäkologe jüdischer Abstammung, flieht während des Krieges mit seiner Frau Corinne nach Marokko. Nach einer schlechten Erfahrung in einer Klinik in Casablanca eröffnet er in Meknès seine eigene Praxis. 1954 schlägt er Amine eine Geschäftspartnerschaft für den Export von Orangen nach Europa vor. Er unterstützt Mathilde, die er mag und bewundert, als diese sich von ihrer Ambulanz überfordert fühlt. Außerdem nimmt er Aïcha während ihrer Schulzeit unter seine Fittiche und schenkt ihr Bücher, um ihren Wissensdurst zu stillen.
Corinne Palosi ist Dragans aus Dünkirchen stammende Gattin. Die äußerst sinnliche Frau weckt das Begehren der Männer und den Argwohn der Frauen. Sie leidet darunter, dass sie keine Kinder bekommen konnte, und führt in Meknès ein relativ einsames Leben.
ERSTER TEIL
Die Zeit nimmt keine Rücksicht auf mich und bürdet mir auf, was sie will. Also möchte ich Fakten ignorieren dürfen.
Boris Pasternak
Mathilde stand am Fenster und sah hinaus in den Garten. Ihren üppigen und wilden, fast schon unanständigen Garten. Ihre Rache an der Kargheit, zu der ihr Mann sie bei allem zwang. Der Tag war gerade erst angebrochen, und die Sonne stahl sich schüchtern durchs Blattwerk. Ein Jacaranda, dessen violette Blüten noch nicht aufgegangen waren. Die alte Trauerweide und die beiden Avocadobäume, deren Äste sich unter den Früchten bogen, die niemand aß und die im Gras verrotteten. Nie war der Garten so schön wie zu dieser Zeit im Jahr. Es war Anfang April 1968, und Mathilde dachte, dass Amine den Termin nicht zufällig gewählt hatte. Die Rosen, die sie aus Marrakesch hatte kommen lassen, waren erblüht, und über dem Garten hing ein frischer, lieblicher Duft. Zu Füßen der Bäume waren zwischen dicken Lavendel- und Rosmarinbüschen Teppiche aus Lilien und Dahlien ausgebreitet. Mathilde sagte, dass hier einfach alles wuchs. Für Blumen war dies ein gesegneter Boden.
Der Gesang der Stare drang bereits zu ihr, und sie entdeckte zwei Amseln, die durchs Gras hüpften und mit ihren orangefarbenen Schnäbeln in der Erde pickten. Eine von ihnen hatte weiße Federn auf dem Kopf, und Mathilde fragte sich, ob die anderen Amseln sie deswegen verspotteten oder ob dies, ganz im Gegenteil, den Vogel zu einem besonderen Tier machte, das von seinen Artgenossen verehrt wurde. Wer weiß schon, wie die Amseln leben?, dachte Mathilde.
Sie hörte Motorenlärm und die Stimmen der Arbeiter. Auf dem Weg zum Garten tauchte ein riesiges gelbes Monstrum auf. Zuerst sah sie den Arm aus Metall und am Ende dieses Arms eine gewaltige mechanische Schaufel. Die Maschine war so breit, dass sie kaum zwischen den Reihen von Olivenbäumen hindurchpasste, und die Arbeiter riefen dem Fahrer des Baggers, der links und rechts Zweige abriss, Anweisungen zu. Endlich hielt das Gerät, und es wurde wieder still.
Dieser Garten war ihre Höhle gewesen, ihre Zuflucht, ihr Stolz. Hier hatte sie mit ihren Kindern gespielt. Sie hatten unter der Trauerweide Mittagsschlaf gehalten und im Schatten des Kautschukbaums gepicknickt. Sie hatte ihnen gezeigt, wie man die Tiere aufspürte, die sich in Bäumen und Sträuchern verbargen. Die Eulen und Fledermäuse und Chamäleons, die sie in Schachteln steckten und manchmal unter ihren Betten sterben ließen. Und als die Kinder größer waren und nicht mehr mit ihr spielen und schmusen wollten, war sie hergekommen, um ihre Einsamkeit zu vergessen. Sie hatte gepflanzt, geschnitten, gesät, umgesetzt. Sie hatte gelernt, zu jeder Tageszeit die Stimmen der Vögel zu erkennen. Wie konnte sie jetzt Chaos und Verwüstung herbeisehnen? Die Vernichtung all dessen wünschen, was sie geliebt hatte?
Die Arbeiter betraten den Garten und kennzeichneten mit Pflöcken, die sie in den Boden trieben, ein Rechteck von zwanzig mal fünf Metern. Sie achteten darauf, die Blumen nicht mit ihren Gummistiefeln zu zertrampeln, und diese rührende, aber nutzlose Aufmerksamkeit ging Mathilde zu Herzen. Sie gaben dem Baggerfahrer ein Zeichen, der seine Zigarette aus dem Fenster warf und den Motor anließ. Mathilde zuckte zusammen und schloss die Augen. Als sie sie wieder öffnete, grub sich die gewaltige metallische Klaue in den Boden. Die Hand eines Riesen drang in die schwarze Erde ein und setzte einen moosigen Humusgeruch frei. Sie riss alles aus, was ihr in die Quere kam, und mit der Zeit entstand ein großer Haufen aus Erde und Steinen, auf dem leblose Sträucher und enthauptete Blumen ruhten.
Diese eiserne Hand war Amines Hand. Das dachte Mathilde an jenem Vormittag, den sie reglos hinter dem Wohnzimmerfenster verbrachte. Sie wunderte sich, dass ihr Mann dem Schauspiel nicht hatte beiwohnen wollen, um nach und nach die Blumen und Bäume fallen zu sehen. Er hatte ihr versichert, dass diese Grube nur hier sein könne. Dass man sie direkt neben dem Haus ausheben müsse, an der sonnigsten Stelle des Grundstücks. Ja, da, wo der Flieder stand. Da, wo früher einmal der Zitrangenbaum gewachsen war.
Zuerst hatte er Nein gesagt. Nein, weil sie nicht die Mittel dafür hatten. Weil Wasser ein rares und kostbares Gut war, das man nicht zum Vergnügen benutzen durfte. Er hatte Nein gebrüllt, weil er die Vorstellung, den bitterarmen Bauern ein derart anstößiges Spektakel zu bieten, entsetzlich fand. Was würde man über die Erziehung denken, die er seinem Sohn angedeihen ließ, über den Umgang mit seiner Frau, wenn man sie halb nackt in einem Swimmingpool baden sähe? Er wäre nicht besser als die früheren Kolonisten oder diese dekadenten Bourgeois, von denen es im Land nur so wimmelte und die ungeniert ihren glänzenden Erfolg zur Schau stellten.
Doch Mathilde gab nicht auf. Sie wischte seine Einwände vom Tisch. Jahr für Jahr versuchte sie es wieder. Jeden Sommer, wenn der Chergui blies und die erdrückende Hitze an ihren Nerven zerrte, brachte sie erneut die Idee dieses Pools aufs Tapet, die ihrem Gatten so zuwider war. Sie dachte, er, der Nichtschwimmer, der sich vor dem Wasser fürchtete, könne sie nicht verstehen. Sie versuchte es sanft, gurrend, sie bettelte. Es war keine Schande zu zeigen, was sie erreicht hatten. Sie taten nichts Böses, es war ihr gutes Recht, das Leben zu genießen, nachdem sie ihre besten Jahre dem Krieg und dann dem Aufbau der Farm geopfert hatten. Mathilde wollte dieses Schwimmbad, sie wollte es zum Ausgleich für ihre verlorene Jugend. Sie hatten die vierzig hinter sich gelassen und mussten niemandem mehr etwas beweisen. Alle Landwirte der Umgebung, zumindest die, die ein modernes Leben führten, hatten einen Pool. Sollte sie sich lieber im öffentlichen Schwimmbad allen präsentieren?
Sie schmeichelte ihm. Sie lobte seine Erfolge bei der Erforschung neuer Olivensorten und beim Export von Zitrusfrüchten. Sie dachte, sie könnte ihn erweichen, indem sie so vor ihm stand, mit heißen, roten Wangen, schweißnassen Haaren, die ihr an den Schläfen klebten, Krampfadern an den Waden. Sie erinnerte ihn daran, dass sie alles, was sie verdient hatten, ihrer Arbeit, ihrer Beharrlichkeit verdankten. Und er verbesserte sie: »Ich bin es, der hier gearbeitet hat. Ich entscheide, wie wir das Geld verwenden.«
Als er dies sagte, weinte Mathilde nicht und wurde nicht wütend. Sie lächelte in sich hinein und dachte an alles, was sie für ihn getan hatte, für die Farm, für die Arbeiter, die sie in ihrer Ambulanz behandelte. An die Zeit, die sie damit verbracht hatte, ihre Kinder großzuziehen, sie zur Tanz- und zur Musikstunde zu fahren, mit ihnen Hausaufgaben zu machen. Seit ein paar Jahren hatte Amine ihr die Buchhaltung der Farm anvertraut. Sie schrieb die Rechnungen, bezahlte Löhne und Lieferanten. Und manchmal, ja, manchmal kam es vor, dass sie die Bilanz fälschte. Sie änderte eine Zeile, erfand einen zusätzlichen Arbeiter oder eine Bestellung, die es nie gegeben hatte. Und in einer Schublade, zu der nur sie den Schlüssel besaß, versteckte sie Bündel von Banknoten, die sie mit beigefarbenen Gummiringen zusammenrollte. Das machte sie schon so lange, dass sie sich nicht mehr dafür schämte und nicht mal mehr Angst hatte, bei dem Gedanken, sie könnte erwischt werden. Die Summe wuchs, und sie fand, das sei ihr wohlverdienter Anteil, eine Gebühr, die sie zur Entschädigung für ihre Demütigungen erhob. Und um sich zu rächen.
Mathilde war gealtert, und es war zweifellos Amines Schuld, dass sie älter aussah, als sie war. Die Haut in ihrem Gesicht, die andauernd Wind und Sonne ausgesetzt war, wirkte ledrig. Stirn und Mundwinkel waren mit Falten überzogen. Selbst das Grün ihrer Augen hatte seinen Glanz eingebüßt, wie ein Kleid, das man zu viel getragen hatte. Sie war fülliger geworden. Um ihren Mann zu provozieren, schnappte sie sich an einem glutheißen Tag den Gartenschlauch und spritzte sich vor den Augen des Hausmädchens und der Arbeiter von Kopf bis Fuß nass. Unter dem Kleid, das ihr am Körper klebte, konnte man die harten Brustwarzen und das Schamhaar erkennen. An dem Tag fuhren sich die Arbeiter mit der Zunge über die schwarzen Zähne und beteten zu Gott, dass Amine nicht verrückt wurde. Warum tat eine erwachsene Frau so etwas? Sicher, man spritzte manchmal die Kinder nass, wenn sie kurz davor waren, in Ohnmacht zu fallen, wenn sie unter der sengenden Sonne delirierten. Man sagte ihnen, sie sollten Mund und Nase fest zukneifen, denn das Wasser aus dem Brunnen machte krank und konnte einen sogar umbringen. Mathilde war wie sie, und genau wie diese Kinder wurde auch sie niemals müde zu betteln. Sie erinnerte Amine an früheres Glück, die Ferien am Meer in Dragans Strandhaus in Mehdia. Und hatte Dragan sich im Übrigen nicht ein Schwimmbad an sein Haus in der Stadt bauen lassen? »Warum«, sagte sie, »sollte Corinne etwas haben, das ich nicht habe?«
Sie war überzeugt, dass dieses Argument Amine zur Kapitulation bewogen hatte. Sie hatte es mit dem Sadismus und der Unverfrorenheit eines Erpressers vorgebracht. Sie glaubte, dass ihr Mann mit Corinne im Laufe des Jahres 1967 einige Monate lang ein Verhältnis gehabt hatte. Davon war sie überzeugt, auch wenn sie nie andere Hinweise darauf gefunden hatte als einen flüchtigen Duft an seinen Hemden, eine Spur Lippenstift – jene trivialen und abscheulichen Hinweise, die das Erbe der Hausfrauen sind. Nein, sie hatte keine Beweise, und er hatte nie gestanden, aber es war nicht zu übersehen, dass zwischen den beiden ein Feuer loderte. Es würde nicht ewig anhalten, doch so lange musste sie es aushalten. Einmal hatte Mathilde ungeschickt versucht, sich Dragan anzuvertrauen. Aber der Arzt, der mit den Jahren noch gutmütiger und abgeklärter geworden war, tat, als verstünde er nicht. Er war nicht bereit, sich auf ihre Seite zu schlagen, sich zu derart kleinlichem Verhalten herabzulassen und neben der glühenden Mathilde einen seiner Ansicht nach nutzlosen Krieg zu führen. Mathilde erfuhr nie, wie viel Zeit Amine in den Armen dieser Frau verbracht hatte. Sie wusste nicht, ob Liebe im Spiel war, ob die beiden einander zärtliche Worte gesagt oder im Gegenteil – und schlimmer, vielleicht – eine stumme, körperliche Leidenschaft ausgelebt hatten.
Amine sah mit zunehmendem Alter immer besser aus. Sein Haar war an den Schläfen weiß geworden, und er hatte sich einen schmalen, graumelierten Schnurrbar à la Omar Sharif wachsen lassen. Wie die Kinostars trug er eine Sonnenbrille, die er so gut wie nie ablegte. Doch nicht nur sein gebräuntes Gesicht, das markante Kinn, die weißen Zähne, die er entblößte, wenn er – selten genug – lächelte, machten seinen Reiz aus. Das Alter brachte seine Männlichkeit zu voller Reife. Seine Bewegungen wurden weicher, seine Stimme tiefer. Seine etwas steife Art hielt man nun für Zurückhaltung, sein ernstes Gesicht ließ an jene scheinbar teilnahmslos im Sand liegenden Raubkatzen denken, die sich mit einem Satz auf ihre Beute stürzen konnten. Ihm war nicht wirklich bewusst, welche Anziehungskraft er besaß, er entdeckte sie nach und nach, während sie sich, quasi ohne sein Zutun, entfaltete. Und diese Art Verwunderung über sich selbst erklärte zweifellos seinen Erfolg bei den Frauen.
Amine hatte an Selbstsicherheit gewonnen und war zu Geld gekommen. Er lag nachts nicht mehr wach und starrte an die Decke, während er seine Schulden überschlug. Er träumte nicht mehr von seinem bevorstehenden Ruin, dem sozialen Abstieg seiner Kinder, der Demütigung, die sie erdulden müssten. Amine schlief. Die Alpträume ließen ihn in Ruhe, und in der Stadt war er zu einer geachteten Persönlichkeit geworden. Sie wurden mittlerweile zu Empfängen eingeladen, man wollte sie kennen, mit ihnen verkehren. 1965 bot man ihnen an, dem Rotary Club beizutreten, und Mathilde wusste, dass dies nicht ihretwegen, sondern wegen ihres Mannes geschah und dass die Ehefrauen daran nicht ganz unbeteiligt waren. Man umgab den wortkargen Amine mit aller Fürsorge. Die Frauen forderten ihn zum Tanzen auf, legten ihre Wange an seine, zogen seine Hand auf ihre Hüften, und auch wenn er nicht wusste, was er sagen sollte, auch wenn er nicht tanzen konnte, dachte er doch manchmal, dass so ein Leben möglich war, ein Leben, leicht wie der Champagner, den er in ihrem Atem roch. Während der Feste verabscheute Mathilde sich. Sie fand, dass sie zu viel redete, zu viel trank, und bereute ihr Verhalten anschließend noch tagelang. Sie bildete sich ein, man würde sie verurteilen, dumm und unnütz finden und dafür verachten, dass sie ihrem Mann seine Untreue durchgehen ließ.
Wenn die Mitglieder des Rotary Clubs sich um Amine bemühten, sich derart wohlwollend und aufmerksam zeigten, so lag dies auch daran, dass er Marokkaner war und der Club durch die Aufnahme eines Arabers beweisen wollte, dass die Zeit der Kolonisierung, die Zeit des Nebeneinanderher-Lebens vorbei war. Sicher hatten etliche im Herbst 1956 dem Land den Rücken gekehrt, als die aufgepeitschte Menge in den Straßen ihrem blutrünstigen Zorn freien Lauf gelassen hatte. Die Ziegelei war in Brand gesteckt worden, Menschen waren auf offener Straße getötet worden, und die Fremden hatten begriffen, dass sie hier nicht mehr zu Hause waren. Manche hatten die Koffer gepackt und ihre Wohnungen einfach zurückgelassen, deren Möbel verstaubten, bis eine marokkanische Familie sie ihnen abkaufte. Grundbesitzer verzichteten auf ihre Ländereien und die jahrelange Arbeit, die sie geleistet hatten. Amine fragte sich, ob diejenigen, die nach Hause zurückkehrten, die Ängstlichsten oder die Weitsichtigsten unter ihnen waren. Doch diese Ausreisewelle hielt nicht lange an. Sie markierte nur den Übergang zu einem neuen Gleichgewicht, ehe das Leben wieder in seine gewohnten Bahnen fand. Zehn Jahre nach der Unabhängigkeit musste Mathilde zugeben, dass Meknès sich nicht sonderlich verändert hatte. Niemand kannte die neuen arabischen Straßennamen, und man verabredete sich noch immer in der Avenue Paul-Doumer oder der Rue de Rennes, gegenüber der Apotheke von Monsieur André. Der Notar war geblieben, ebenso wie die Kurzwarenhändlerin, der Friseur und seine Frau, die Besitzer der Modeboutique auf der Avenue, der Zahnarzt, die Ärzte. Alle wollten weiterhin, vielleicht etwas diskreter und maßvoller, die Freuden dieser hübschen, blühenden Stadt genießen. Nein, es gab keine Revolution, nur eine Veränderung der Atmosphäre, eine gewisse Zurückhaltung, den Anschein von Eintracht und Gleichheit. Während der Diners im Rotary, wo sich an den Tischen wohlhabende Marokkaner und Mitglieder der Europäischen Gesellschaft mischten, schien es, als wäre die Kolonialisierung ein pures Missverständnis gewesen, ein Irrtum, den die Franzosen bereuten und die Marokkaner vorgaben zu vergessen. Manche wollten es noch einmal betonen, sie seien nie Rassisten gewesen, und diese ganze Sache sei ihnen furchtbar unangenehm gewesen. Sie beteuerten, wie erleichtert sie seien, dass die Dinge jetzt geklärt waren, und auch sie nun, da die Stadt die schwarzen Schafe vertrieben hatte, freier atmen konnten. Die Ausländer gaben Acht darauf, was sie sagten. Wenn sie selbst noch hier waren, dann nur, um das Land, das sie brauchte, nicht in den Ruin zu stürzen. Natürlich würden sie irgendwann Platz machen, würden gehen, und der Apotheker, der Arzt oder der Notar wäre dann ein Marokkaner. Aber bis dahin würden sie bleiben und sich nützlich machen. Und im Übrigen unterschieden sie sich gar nicht so sehr von den Marokkanern, die an ihrem Tisch saßen. Diese eleganten und weltoffenen Männer, diese ranghohen Militärs oder Beamten, deren Frauen westliche Kleider und das Haar kurz geschnitten trugen. Nein, sie unterschieden sich nicht so sehr von diesen Bourgeois, die sich, ohne Schuldgefühle oder Hintergedanken, von barfüßigen Kindern ihre Einkäufe vom Markt nach Hause bringen ließen. Die dem Flehen der Bettler gegenüber taub waren, »denn sie sind wie Hunde, die man unter dem Tisch füttert. Sie gewöhnen sich daran und verlieren noch den letzten Rest Arbeitswillen«. Nie hätten die Franzosen gewagt zu sagen, wie bedauerlich dieser Hang des Volkes zum Betteln und Lamentieren war. Nie hätten sie gewagt, wie die Marokkaner es taten, die Unaufrichtigkeit der Hausmädchen, die Faulheit der Gärtner, die Rückständigkeit der kleinen Leute zu beanstanden. Und sie lachten, ein wenig zu laut, wenn ihre Meknèser Freunde sich verzweifelt fragten, wie man mit einer Bevölkerung von Analphabeten ein modernes Land aufbauen sollte. Im Grunde waren diese Marokkaner wie sie. Sie sprachen dieselbe Sprache, sahen die Welt genauso wie sie, und es war schwer zu glauben, dass sie jemals zu unterschiedlichen Lagern gehört und sich als Feinde betrachtet hatten.
Amine zeigte sich zunächst misstrauisch. »Sie richten ihr Fähnchen nach dem Wind«, sagte er zu Mathilde. »Vorher war ich der Kameltreiber, der Drecksaraber, und jetzt heißt es plötzlich Monsieur Belhaj hier, Monsieur Belhaj da.« Eines Abends, bei einem Tanzdiner auf der Hacienda, begriff Mathilde, dass er recht hatte. Monique, der Frau des Friseurs, die zu viel getrunken hatte, rutschte mitten im Gespräch ein »Kanake« heraus. Sie schlug sich die Hände vor den Mund, wie um das schändliche Wort wieder hineinzuscheuchen, und stieß, mit weit aufgerissenen Augen und knallroten Wangen, ein langes »Oh« aus. Obwohl niemand außer Mathilde es mitbekommen hatte, hörte Monique gar nicht mehr auf, sich zu entschuldigen. Ein ums andere Mal versicherte sie: »Glaub mir, das wollte ich nicht sagen. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist.«
Mathilde erfuhr nie mit Gewissheit, was Amine überzeugt hatte. Doch im April 1968 verkündete er ihr, er werde das Schwimmbad bauen lassen. Nach dem Aushub wurden die Betonwände gegossen, ein Rohr- und Filtersystem installiert, und Amine überwachte alle Arbeiten streng. Um den Rand des Pools ließ er ockerfarbene Ziegel verlegen. Mathilde musste zugeben, das sah elegant aus. Sie wohnten gemeinsam der Befüllung des Beckens bei. Mathilde setzte sich auf die glutheißen Ziegel und schaute zu, wie das Wasser stieg, wartete ungeduldig wie ein Kind, dass es endlich ihre Knöchel erreichte.
Ja, Amine, lenkte ein. Im Grunde war er der Chef, der Arbeitgeber, dem die Männer auf der Farm ihr Brot verdankten, und sein Lebensstil ging sie nichts an. Als das Land unabhängig wurde, waren die besten Böden noch in Händen der Franzosen, und die Mehrzahl der marokkanischen Bauern lebte in Armut. Seit der Protektoratszeit, die enorme Fortschritte im Gesundheitswesen gebracht hatte, explodierten die Bevölkerungszahlen. In den zehn Jahren Unabhängigkeit waren die Parzellen der Kleinbauern immer weiter zerstückelt worden und so sehr geschrumpft, dass diese nicht mehr von ihren Erträgen leben konnten. 1962 hatte Amine einen Teil von Marianis Grund sowie die Ländereien der Witwe Mercier gekauft, die in eine trostlose Wohnung in der Stadt, in der Nähe der Place Poeymirau gezogen war. Er hatte die Maschinen, das Vieh und sämtliche Lagerbestände übernommen und an einige Arbeiterfamilien für moderate Summen kleine Flächen verpachtet, die sie durch offene Kanäle, die Seguias, bewässerten. In der Umgebung galt Amine als strenger, starrköpfiger, cholerischer Chef, doch niemand stellte seinen Anstand und seinen Gerechtigkeitssinn infrage. 1964 erhielt er eine beträchtliche Unterstützung des Ministeriums, um einen Teil seiner Anbaufläche zu bewässern und moderne Gerätschaften zu kaufen. Amine sagte Mathilde immer wieder: »Hassan II. hat begriffen, dass wir in erster Linie ein Agrarland sind und dass man die Landwirtschaft fördern muss.«
Als das Schwimmbad fertig war, organisierte Mathilde ein Fest für ihre neuen Freunde vom Rotary Club. Eine Woche lang bereitete sie ihre »Garden-Party«, wie sie es nannte, vor. Sie engagierte Kellner und mietete bei einem Delikatessengeschäft in Meknès silberne Platten, Limoges-Geschirr und Champagnerkelche. Sie ließ im Garten Tische aufstellen und verteilte darauf kleine Vasen mit Feldblumensträußen. Mohn, Ringelblumen, Hahnenfuß, die sie am Morgen von den Arbeitern schneiden ließ. Die Gäste machten ihr Komplimente. Die Frauen betonten, sie fänden das »entzückend, einfach entzückend«. Und die Männer klopften Amine auf die Schulter, während sie den Pool bewunderten. »Sieht aus, als hättest du’s geschafft, Belhaj.« Das Mechoui wurde mit Applaus begrüßt, und Mathilde bestand darauf, dass die Gäste mit den Händen aßen. Alle stürzten sich auf das Lamm, hoben die gegrillte Haut an und gruben ihre Finger ins Fleisch, um zarte, fette Stücke abzureißen, die sie in Salz und Cumin tunkten.
Das Festessen dauerte bis weit in den Nachmittag. Der Alkohol, die Hitze, das sanfte Plätschern des Wassers entspannten alle. Dragan nickte gemächlich mit dem Kopf, die Augen halb geschlossen. Dicht über der Wasseroberfläche flirrte ein Schwarm roter Libellen.
»Dieses Haus ist ein wahres Paradies«, begeisterte sich Michel Cournaud. »Aber pass bloß auf, mein Lieber, dass der König nicht hier vorbeikommt. Wisst ihr, was man mir erzählt hat?«
Cournauds Bauch war so dick wie der einer Schwangeren, und er setzte sich immer breitbeinig hin und legte die Hände auf seinen Wanst. Er hatte ein rotes, aufgedunsenes, sehr ausdrucksvolles Gesicht. Seine kleinen grünen Augen hatten sich etwas Kindliches bewahrt, eine Verschmitztheit und eine Neugier, die irgendwie rührend waren. Unter dem orangefarbenen Sonnenschirm, den Mathilde hatte aufspannen lassen, wirkte seine Haut noch röter, und Amine, der ihn jetzt musterte, schien es, als müsste sein neuer Freund jeden Moment platzen. Er arbeitete für die Handelskammer und hatte Verbindungen in Wirtschaftskreise. Er pendelte zwischen Meknès und der Hauptstadt, und im Rotary Club schätzte man ihn für seinen Humor, aber vor allem für sein Talent, Geschichten über den Hof und die Intrigen, die dort gesponnen wurden, zu erzählen. Er verteilte Tratsch wie Süßigkeiten an hungrige Kinder. In Meknès passierte nichts oder zumindest kaum etwas Interessantes. Die feine Gesellschaft fühlte sich von der Welt abgeschnitten, beschränkt auf ein langweiliges Dasein in der Provinz. Sie hatten keine Ahnung, was sich wirklich in den großen Küstenstädten zusammenbraute, in denen die Zukunft des Landes entschieden wurde. Die Meknèser mussten sich mit offiziellen Meldungen und Gerüchten über Verschwörungen, Aufstände, das Verschwinden Mehdi Ben Barkas in Paris oder anderer Oppositioneller, deren Namen nie laut ausgesprochen wurden, begnügen. Den meisten von ihnen war nicht mal bewusst, dass das Land sich seit drei Jahren im Ausnahmezustand befand, dass das Parlament aufgelöst, die Verfassung vorübergehend außer Kraft gesetzt worden war. Natürlich war allseits bekannt, dass der Beginn der Regentschaft Hassans II. nicht ganz reibungslos verlaufen war und der König sich einer immer radikaleren Opposition gegenübersah. Doch wer konnte schon von sich behaupten, die ganze Wahrheit zu kennen? Das Herz der Macht war ein ferner, undurchdringlicher Ort, furchteinflößend und faszinierend zugleich. Die weiblichen Zuhörer liebten vor allem die Geschichten über den Harem, in dem der König an die dreißig Frauen haben sollte. Sie stellten sich vor, dass hinter den Mauern des Mechouar Feste gefeiert wurden, wie man sie aus den Historienschinken Hollywoods kannte, und dass Champagner und Whisky bei den Nachkommen des Propheten in Strömen flossen. Genau solche Geschichten servierte Cournaud ihnen.
Er versuchte, näher an den Tisch heranzurücken, und senkte seine Stimme verschwörerisch. Die Gäste spitzten die Ohren, außer Dragan, der eingeschlafen war und dessen Lippen sacht vibrierten. »Stellt euch vor, der König ist vor ein paar Wochen an einem schönen Landgut vorbeigefahren. Im Gharb, glaube ich, also, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls hat es ihm sehr gefallen. Er bat darum, die Farm besichtigen zu dürfen, und wollte den Besitzer kennenlernen. Und hopp, ehe der sich’s versah, hatte der König ihm die Ländereien für eine von ihm selbst festgesetzte Summe abgekauft. Der Arme konnte nichts dagegen sagen.«
Im Gegensatz zu den anderen Gästen lachte Amine nicht. Er mochte es nicht, wenn die Leute Tratsch verbreiteten und schlecht über den Monarchen redeten, der seit seiner Thronbesteigung im Jahr 1961 die Entwicklung des Agrarsektors zur obersten Priorität des Landes gemacht hatte.
»Das ist doch nur Gerede«, sagte er. »Böswillige Gerüchte, von irgendwelchen Neidern frei erfunden. In Wahrheit hat dieser König als Einziger verstanden, dass man Marokko in ein zweites Kalifornien verwandeln kann. Anstatt Lügen zu erzählen, sollte man sich lieber über die Staudammpolitik freuen, über das Bewässerungsprogramm, das allen Bauern ermöglichen wird, von ihrer Arbeit zu leben.«
»Du machst dir Illusionen«, unterbrach Michel ihn. »Soweit ich weiß, ist dieser junge König vor allem mit den nächtelangen Festen beschäftigt, die er in seinem Palast ausrichtet, und mit Golfspielen. Ich möchte dich nicht enttäuschen, mein Lieber, aber sein Interesse an den Fellachen ist nur Augenwischerei. Ein billiger politischer Schachzug, um sich die Gunst der Hinterwäldler zu sichern. Ansonsten hätte er schon eine echte Agrarreform in Angriff genommen und an die Millionen besitzloser Bauern Land verteilt. In Rabat weiß man ganz genau, dass es niemals genug Äcker für alle geben wird.«
»Was glaubst du denn?«, brauste Amine auf. »Dass die Machthaber auf einen Schlag allen Grund und Boden der Kolonisten verstaatlichen und das Land ruinieren? Wenn du etwas von meiner Arbeit verstündest, dann wüsstest du, dass der Palast gut daran tut, diese Dinge nach und nach anzugehen. Was wissen sie schon davon in Rabat? Unser landwirtschaftliches Potenzial ist immens. Die Getreideproduktion wächst unaufhörlich. Ich selbst exportiere doppelt so viele Zitrusfrüchte wie vor zehn Jahren.«
»Dann solltest du lieber aufpassen. Vielleicht kommen sie bald und nehmen dir dein Land weg, um es an die Fellachen zu verteilen, die keines haben.«
»Es stört mich nicht, wenn die Armen mehr bekommen. Aber nicht auf Kosten derer, die, wie ich, durch jahrelange harte Arbeit einen funktionierenden Betrieb aufgebaut haben. Der König weiß das. Die Bauern sind und bleiben die treusten Anhänger der Krone.«
»Ach ja! Dein Wort in Gottes Ohr, wie man so schön sagt«, fuhr Michel fort. »Aber wenn du mich fragst, dann interessiert sich dieser König nur für seine Machenschaften. Die Wirtschaft überlässt er den Großbürgern, die sich dank seiner bereichern und überall verbreiten, dass in Marokko allein der König zählt.«
Amine räusperte sich. Er betrachtete einen Moment das gerötete Gesicht seines Tischnachbarn, die haarigen Hände, und bekam Lust, ihm den Kragen zuzuknöpfen und mitanzusehen, wie er erstickte.
»Du solltest besser Acht geben, was du sagst. Für solche Reden könnte man dich ausweisen lassen.«
Michel streckte die Beine von sich. Es sah aus, als müsse er jeden Moment von seinem Stuhl rutschen und auf dem Boden aufklatschen. Ein starres Lächeln klebte ihm im Gesicht.
»Ich wollte dich nicht beleidigen«, entschuldigte er sich.
»Du hast mich nicht beleidigt. Ich sage das nur deinetwegen. Du betonst immer, dass du dieses Land kennst und hier zu Hause bist. Also müsstest du wissen, dass man hier nicht alles sagen kann.«
Am nächsten Morgen hängte Amine in seinem Büro eine goldgerahmte Fotografie auf. Ein Porträt in Schwarzweiß, auf dem Hassan II. im Flanellanzug ernst zum Horizont blickt. Er hängte es zwischen eine Schautafel über den Rebschnitt und einen Zeitungsartikel über die Farm, der Amines Pionierleistung im Olivenanbau würdigte. Amine dachte, das würde Eindruck machen, wenn er Kunden oder Lieferanten empfing oder wenn seine Arbeiter kamen, um sich zu beklagen. Andauernd jammerten sie, die schmutzigen Hände auf seinen Schreibtisch gelegt, die zerfurchten Gesichter tränenüberströmt. Sie klagten über ihr Elend. Sie blickten hinaus, durch die Glastür, und schienen damit sagen zu wollen, dass er, Amine, doch wirklich ein Glückspilz sei. Er könne nicht verstehen, was es hieß, ein einfacher Arbeiter zu sein, ein Mistbauer, der nichts als ein mageres Fleckchen Land und zwei Hühner besitzt, um seine Familie zu ernähren. Sie baten um einen Vorschuss, eine Empfehlung, einen Kredit, und Amine verweigerte sie ihnen. Er sagte, sie sollten sich zusammenzureißen und sich nicht unterkriegen lassen, so wie er es zu Beginn auf der Farm getan hatte. »Woher, glaubt ihr, kommt all das?«, fragte er mit ausgestrecktem Arm. »Glaubt ihr, ich hatte Glück? Mit Glück hat das hier nichts zu tun.« Er warf einen Blick auf die Fotografie des Monarchen und fand, dieses Land erwarte zu viel vom Makhzen1 und den Mächtigen. Was der König wollte, waren fleißige Arbeiter, selbstbewusste Bauern, Marokkaner, die stolz waren auf ihre hart verdiente Unabhängigkeit.
Sein Betrieb wuchs, und er musste weitere Männer einstellen für die Gewächshäuser und die Olivenernte. Er schickte Mourad in die benachbarten Duars und sogar bis nach Azrou oder Ifrane. Der Vorarbeiter kam wieder, begleitet von einem Trupp unterernährter Jungs, die in den Zwiebelfeldern aufgewachsen waren und keine Arbeit fanden. Amine erkundigte sich nach ihren Fähigkeiten. Er zeigte ihnen die Gewächshäuser, die Schuppen, erklärte ihnen, wie man die Olivenpresse bediente. Die Burschen folgten ihm schweigend und fügsam. Sie stellten keine Fragen, nur zu ihrer Bezahlung. Zwei von ihnen wollten einen Vorschuss, und die anderen, ermutigt durch die Kühnheit ihrer Kameraden, sagten, den bräuchten sie ebenfalls. Amine konnte sich nicht beklagen über den Einsatz der jungen Männer, die bei Morgengrauen antraten und im Regen wie unter der sengenden Sonne schufteten. Doch nach ein paar Monaten verschwanden einige von ihnen. Sobald sie ihren Lohn eingestrichen hatten, sah man sie nicht wieder. Sie versuchten nicht, sich niederzulassen, eine Familie zu gründen, beim Chef einen guten Eindruck zu machen, um eine Lohnerhöhung zu bekommen. Sie hatten nur eines im Sinn: ein bisschen Geld verdienen und dann dem Leben auf dem Land und seinem Elend zu entkommen. Den armseligen Hütten, dem Gestank nach Hühnermist, der Bedrängnis regenloser Winter und im Kindbett sterbender Frauen. Während sie tagelang unter den Olivenbäumen standen und die Äste schüttelten, damit die Früchte in die Netze fielen, erzählten sie sich flüsternd von ihren Träumen, nach Casablanca oder Rabat mit ihren Bidonvilles zu gehen, wo jeder von ihnen einen Onkel, einen Cousin, einen großen Bruder hatte, der dort sein Glück gesucht hatte und nichts mehr von sich hören ließ.
Amine beobachtete sie. Er las in ihrem Blick eine Ungeduld, eine Raserei, die er noch nie zuvor gesehen hatte und die ihn erschreckten. Diese jungen Männer verfluchten die Erde. Sie hassten die Arbeiten, in die sie sich dennoch dreinschickten. Und Amine dachte, dass seine Aufgabe nicht mehr nur darin bestand, Bäume anzupflanzen und Früchte zu ernten, sondern auch darin, sie an diesem Ort zu halten. Alle wollten heutzutage in der Stadt leben. Die Stadt befiel sie, eine abstrakte, zwanghafte Vorstellung, die Stadt, von der sie meist keine Ahnung hatten. Sie kroch voran wie ein Reptil, wie eine Bedrohung. Jede Woche schien sie etwas näher zu kommen, und ihre Lichter verschlangen das Land. Die Stadt war lebendig. Sie pulsierte, sie rückte vor und brachte Gerüchte und ungesunde Träume mit sich. Manchmal hatte Amine den Eindruck, eine Welt sei im Begriff unterzugehen, oder zumindest eine Art, die Welt zu sehen. Selbst die Landwirte wollten bürgerlich sein. Die neuen, aus der Unabhängigkeit geborenen Grundbesitzer sprachen über Geld wie Industrielle. Sie verstanden nichts von Schlamm, von Frost, von violetten Morgendämmerungen, in denen man zwischen den Reihen blühender Mandelbäume ausschreitet und das Glück, in der Natur zu leben, so fraglos erscheint wie der eigene Atem. Sie hatten keine Ahnung, welche Enttäuschungen die Elemente einem bereiten konnten, und wie viel Hartnäckigkeit und Optimismus es bedurfte, um weiter auf die Jahreszeiten zu vertrauen. Nein, sie fuhren mit dem Auto über ihre Ländereien, um sie Besuchern zu zeigen, um damit zu prahlen, doch sie lernten nichts. Amine hatte nur Verachtung für diese Möchtegernfarmer übrig, die Verwalter anstellten und lieber in der Stadt lebten, Beziehungen pflegten, in der feinen Gesellschaft verkehrten. In diesem Land, das jahrhundertelang von Krieg und Ackerbau gelebt hatte, redete alle Welt nur noch über die Stadt und den Fortschritt.
Amine begann die Stadt zu hassen. Ihre gelben Lichter, ihre schmutzigen Bürgersteige, ihre muffig riechenden Läden und ihre breiten Boulevards, auf denen die jungen Burschen ziellos herumspazierten, die Hände in den Hosentaschen, um eine Erektion zu verbergen. Die Stadt und die aufgerissenen Münder ihrer Cafés, die die Tugend der Mädchen und die Arbeitskraft der Männer verschlangen. Die Stadt, wo man seine Nächte mit Tanzen vergeudete. Seit wann hatten die Männer ein solches Bedürfnis zu tanzen? War sie nicht dumm, war sie nicht lächerlich, diese Lust zu feiern, die alle ergriffen hatte?, dachte Amine. Tatsächlich hatte Amine keine Ahnung von Großstädten und war das letzte Mal in Casablanca gewesen, als die Franzosen das Land noch regierten. Er verstand auch nicht viel von Politik und verschwendete seine Zeit nicht mit Zeitunglesen. Alles, was er wusste, hatte er von seinem Bruder Omar, der inzwischen in Casablanca lebte und für den Geheimdienst arbeitete. Omar verbrachte manchmal den Sonntag auf der Farm, wo alle, die Arbeiter ebenso wie Mathilde und Selim, ihn fürchteten. Er war noch magerer als früher und gesundheitlich angegriffen. Er hatte Ekzeme im Gesicht und auf den Händen, und an seinem langen, knochigen Hals hüpfte der Adamsapfel, als versuche er vergeblich, seine Spucke hinunterzuschlucken. Omar, der wegen seiner schlechten Augen nicht selbst fuhr, ließ sich von seinem Chauffeur Brahim am Eingang zum Gut absetzen. Die Arbeiter stürzten sich auf den schicken Wagen, und Brahim verscheuchte sie schreiend. Omar hatte einen wichtigen Posten inne, über den er sich nie weiter ausließ. Er enthüllte keine Einzelheiten über seine Aufträge und hatte nur ein Mal angedeutet, dass er mit dem Mossad zusammenarbeitete und in Israel gewesen war, wo, wie er seinem Bruder sagte, »die Orangenplantagen den unseren in nichts nachstehen«. Omar gab nur vage Antworten auf Amines Fragen. Ja, er habe Anschläge gegen den König vereitelt und Dutzende Verhaftungen vorgenommen. Ja, dieses Land verberge in seinen Bidonvilles, seinen Universitäten, seinen dicht bevölkerten Medinas einen ganzen Haufen Schwachköpfe und Mörder, die zur Revolution aufriefen. »Marx oder Nitcha«, zischte er mit Bezug auf Nietzsche und den Vater des Kommunismus. Omar erinnerte voller Nostalgie die Zeiten, als sie alle für die Unabhängigkeit gekämpft hatten, geeint vom selben Ideal und einem Nationalismus, den man, so fand er, wiederbeleben sollte. Omar überzeugte Amine schließlich. Die Städte waren gefährlich und voller Gelichter. Und der König tat gut daran, die Bauern den Proletariern vorzuziehen.
Im Mai 1968 hörte Amine jeden Abend im Radio die Berichte über die Ereignisse in Frankreich. Er war besorgt um seine Tochter, die er seit über vier Jahren nicht gesehen hatte und die in Straßburg Medizin studierte. Er dachte nicht, dass ihre Kommilitonen sie beeinflussen könnten, denn Aïcha war wie er, nur auf die Arbeit konzentriert, schweigsam und beharrlich. Doch er hatte Angst um sie, sein Kind, seine Kleine, sein Stolz und sein Glück, verloren inmitten des Chaos. Er verriet es niemandem, doch er hatte nur ihretwegen in den Bau des Schwimmbads eingewilligt. Damit sie stolz auf ihn war, damit sie, die zukünftige Ärztin, sich nicht schämen müsste, ihre Freunde irgendwann auf die Farm einzuladen. Er ging mit dem Erfolg seiner Tochter nicht hausieren. Zu Mathilde sagte er schroff: »Der Neid der Leute kennt keine Grenzen. Sie würden ein Auge dafür geben, dass du blind wirst.« Durch seine Tochter, sein Kind, wurde er zu einem anderen Menschen. Sie hob ihn empor, entriss ihn der Mühsal und der Mittelmäßigkeit. Wenn er an sie dachte, schnürte ihm ein so heftiges, brennendes Gefühl die Brust zusammen, dass er mit weit geöffnetem Mund tief einatmen musste. Aïcha war die Erste in der Familie, die studierte. Wie weit man auch in der Reihe ihrer Ahnen zurückging, keiner hatte so viel gewusst wie sie. Sie alle hatten in Unkenntnis gelebt, in einer Art Umnachtung und Unterwerfung unter die anderen und die Naturgewalten. Sie hatten ein Leben der Unmittelbarkeit geführt, ein Leben, das man als gegeben hinnahm und erduldete. Sie hatten vor Königen und Imamen gekniet, vor Herren und Obersten der Armee. Seit die Belhajs existierten, so weit seine Wurzeln zurückreichten, schien ihm, waren Existenzen ohne jede Tiefe aufeinandergefolgt, in denen man nur ungeschliffenes Wissen, Binsenweisheiten weitergegeben hatte, nichts, was sich in den Büchern fand, die Aïcha las. An der Schwelle des Todes hatten sie nichts weiter gelernt als das, was sich aus ihrer Erfahrung der Welt ergab.
Er bat Mathilde, ihrer Tochter zu schreiben, sie solle so schnell wie möglich nach Hause zurückkehren. Die Prüfungen waren verschoben worden, und sie hatte nichts mehr zu tun dort in diesem Land, in dem alles zusammenbrach. Aïcha würde bald wiederkommen, und er würde mit ihr durch die Pfirsichplantagen und Mandelbaumalleen gehen. Früher hatte sie ihm, ohne sich je zu täuschen, sagen können, welcher Baum bittere Früchte tragen würde. Amine hatte sich immer geweigert, diese Bäume zu fällen, sich ihrer zu entledigen. Er meinte, man müsse ihnen eine Chance geben, die nächste Blüte abwarten, weiter hoffen. Das kleine Mädchen von früher, das Kind mit den zerzausten Haaren, war eine Ärztin geworden. Sie hatte einen Pass, sprach Englisch, und was auch immer geschah, sie würde es besser machen als ihre Mutter und nicht ihr Leben lang immer nur betteln. Aïcha würde für ihre Kinder Schwimmbäder bauen. Sie, ja, sie wüsste, was es hieß, sein Geld hart zu verdienen.
1 Abgeleitet vom Verb khazana, das »wegschließen, aufbewahren« bedeutet, bezeichnet Makhzen im Volksmund allgemein den Staat samt seiner Beamten und im Besonderen den König und seinen Hof.
Nach dem Unterricht verließ Selim die Schule und parkte sein Mofa vor dem Schwimmclub. Als er in den Umkleideraum kam, fetzte sich eine Bande nackter Jungs lachend mit ihren Handtüchern. Er erkannte ein paar von ihnen, die mit ihm die letzte Klasse des Jesuitengymnasiums besuchten. Er grüßte sie, ging zu seinem Spind und zog sich langsam aus. Er stülpte seine Socken ineinander. Er legte sein Hemd und seine Hose zusammen. Er hängte seinen Gürtel an einen Haken. Dann stand er in Unterhosen vor dem kleinen Spiegel des Metallschranks. Seit einer Weile hatte er das Gefühl, sein Körper wäre nicht mehr wirklich seiner. Er wäre in den Körper eines anderen geschlüpft, eines ihm vollkommen unbekannten Fremden, über den er nichts wusste. Seine Brust, seine Beine und seine Füße hatten sich mit blondem Flaum überzogen. Dank des Schwimmtrainings, das er unermüdlich absolvierte, hatten sich seine Muskeln entwickelt. Er ähnelte immer mehr seiner Mutter, die er inzwischen um beinahe zehn Zentimeter überragte. Von ihr hatte er die blonden Haare, die breiten Schultern und die Bewegungsfreude geerbt. Diese Ähnlichkeit störte ihn, sie zwickte ihn wie ein zu enges Kleidungsstück, das er nicht ablegen konnte. Im Spiegel erkannte er das Lächeln seiner Mutter, die Kontur ihres Kinns, und ihm war, als wäre Mathilde in ihn gefahren und hause in ihm. Nie würde er sie abschütteln können.
Sein Körper hatte sich nicht nur äußerlich verändert. Er zwang ihm Sehnsüchte, Triebe, Schmerzen auf, von deren Existenz er bis dahin nichts geahnt hatte. Seine Träume hatten nichts mehr gemein mit den heiteren Visionen seiner Kindheit, sie waren wie ein Gift, das in ihn eindrang und ihn tagelang quälte. Ja, er war groß und stark, doch diesen Männerkörper hatte er um den Preis seines inneren Friedens erkauft. Eine ständige Unruhe trieb ihn um. Sein Körper geriet wegen jeder Kleinigkeit in Verwirrung. Er bekam feuchte Hände, Schauer liefen ihm über den Nacken, sein Penis wurde steif. Sein Wachstum empfand er nicht als Triumph, sondern als Verwüstung.
Früher hatten die Arbeiter Selim gerne geneckt. Sie liefen ihm auf den Feldern nach, lachten über seine dürren Waden, seine helle Haut, die in der Sonne verbrannte. Sie nannten ihn »Knirps«, »mageres Hühnchen« und manchmal sogar »Deutscher«, um ihn zu ärgern. Selim war ein kleiner Junge wie alle anderen, er mischte sich unter sie, ohne dass jemand einen Unterschied zwischen ihnen gemacht hätte. Er bekam Läuse, weil er seine blonden Haare an den Schöpfen der Hütekinder rieb. Er war von einem Hund gebissen worden, hatte die Krätze gehabt und mit den Bengeln aus der Umgebung unanständige Spiele gespielt. Die Arbeiter und Arbeiterinnen teilten ihr Essen mit ihm und kamen dabei nicht auf die Idee, es könnte nicht gut genug sein für den Sohn des Gutsherrn. Um groß zu werden, brauchte ein Kind nichts als Brot, Olivenöl und heißen, süßen Tee. Die Frauen kniffen ihn in die Wange und bewunderten seine Schönheit. »Du könntest ein Berber sein. Ein echter Rif, mit deinen grünen Augen und den Sommersprossen.« Ein Kind, das nicht von hier war, jedenfalls, so viel hatte Selim verstanden.
Einige Monate zuvor hatte ihn ein Arbeiter zum ersten Mal »Sidi« genannt und ihn mit einer Ehrerbietung behandelt, die er nicht erwartet hatte. Selim war verblüfft gewesen. Er hätte nicht sagen können, ob er stolz war oder sich, im Gegenteil, unwohl fühlte, betrogen. Zuerst war man ein Kind. Dann wurde man zum Mann. Und man hörte: »Ein Mann tut so etwas nicht«, oder: »Du bist jetzt ein Mann, also benimm dich auch so.« Er war ein Kind gewesen, und plötzlich war er es nicht mehr, einfach so, ohne eine Begründung. Er war aus der Welt der Liebkosungen, der sanften Worte, der Nachsicht ausgestoßen worden, um ohne viel Federlesens, ohne Erklärung, in das Leben der Männer geworfen zu werden. In diesem Land existierte die Jugend nicht. Es gab keine Zeit und keinen Raum für das Zaudern dieses wankelmütigen Alters, dieser rätselhaften und unschlüssigen Phase des Übergangs. Diese Gesellschaft hasste jede Art von Zweideutigkeit, und sie betrachtete die werdenden Erwachsenen mit Misstrauen, hielt sie für jene schrecklichen Faune mit Bocksfüßen und dem Torso eines Jünglings.
In dem endlich leeren Umkleideraum streifte er seine Unterhose ab und holte die himmelblauen Badeshorts, die seine Mutter ihm geschenkt hatte, aus der Tasche. Während er sie anzog, überlegte er, dass er das Glied seines Vaters nie gesehen hatte. Er errötete bei dem Gedanken, und sein Gesicht begann zu glühen. Wie sah sein Vater aus, wenn er nackt war? Als sie klein waren, war sein Vater manchmal mit ihnen ans Meer gefahren, ins Strandhaus von Doktor Palosi und seiner Frau Corinne. Mit der Zeit hatte er sie nur noch dorthin gebracht und zwei oder drei Wochen später wieder abgeholt. Nie ging er mit an den Strand oder zog sich gar eine Badehose an. Er behauptete, er habe zu viel zu tun, und Ferien seien ein Luxus, den er sich nicht leisten könne. Doch Selim hatte Mathilde sagen hören, dass Amine Angst vorm Wasser hatte und sich nur deshalb nicht ihren sommerlichen Vergnügungen anschloss, weil er nicht schwimmen konnte.
Vergnügen. Ferien. Genauso wenig wie er das Glied seines Vaters kannte, konnte Selim sich erinnern, je gesehen zu haben, wie er etwas zum Vergnügen tat, spielte, sich entspannte, lachte oder einen Mittagsschlaf hielt. Sein Vater wurde nicht müde, die Drückeberger, Faulpelze und Taugenichtse anzuprangern, die die Arbeit nicht wertschätzten und ihre Zeit mit Jammern verschwendeten. Selims Sportbegeisterung – den Schwimmclub, aber auch die Fußballmannschaft, der er angehörte und in der er jedes Wochenende spielte – fand er lächerlich. Soweit Selim sich erinnern konnte, schien ihm, hatte sein Vater für ihn immer nur tadelnde Blicke übriggehabt.
Sein Vater lähmte ihn, ließ ihn erstarren. Er brauchte nur zu wissen, dass Amine in der Nähe war, und schon war er nicht mehr er selbst. Und um ehrlich zu sein, hatte die ganze Gesellschaft diese Wirkung auf ihn. Die Welt, in der er lebte, begegnete ihm mit derselben Strenge wie sein Vater, und es kam ihm so vor, als könne man hier unmöglich frei sein. Diese Welt war voller Väter, denen man Respekt erweisen musste: Gott, der König, das Militär, die Helden der Unabhängigkeit und die Arbeitenden. Immer, wenn man angesprochen wurde, fragte derjenige nicht, wie man hieß, sondern erkundigte sich: »Wessen Sohn bist du?«
Mit der Zeit, als immer klarer wurde, dass er nicht Landwirt werden würde wie sein Vater, fühlte Selim sich etwas weniger als Amines Sohn. Manchmal dachte er an die Handwerker in den Gassen der Medina und an die Lehrlinge, die sie in ihren fensterlosen Werkstätten ausbildeten. Die Kupferschmiede, Weber, Sticker und Tischler, deren Verhältnis zu ihren Meistern von Ehrerbietung und Dankbarkeit geprägt war. So funktionierte die Welt: Die Alten gaben ihr Können an die Jüngeren weiter, und die Vergangenheit konnte in der Gegenwart fortwirken. Deswegen musste man die Schulter oder die Hand des Vaters küssen, musste sich in seiner Gegenwart ducken und sich vollkommen ergeben zeigen. Erst wenn man selbst Vater wurde und seinerseits bestimmen durfte, war man von dieser Schuld befreit. Das Leben glich jenem zeremoniellen Treueschwur, bei dem alle Würdenträger des Reichs, alle Stammesführer, all die stolzen, stattlichen Männer in ihren weißen Dschellabas, ihren Burnussen, die Hand des Herrschers küssten.