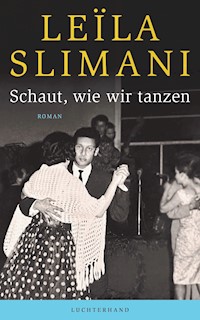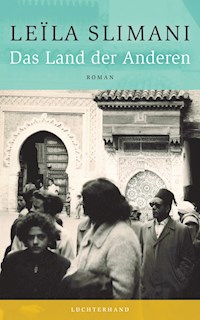
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der SPIEGEL-Bestseller des literarischen Weltstars Leïla Slimani: »Eine großartige französisch-marokkanische Familiensaga.« (Die Literarische Welt).
Mathilde, eine junge Elsässerin, verliebt sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in Amine Belhaj, einen marokkanischen Offizier im Dienst der französischen Armee. Die beiden heiraten und lassen sich in der Nähe von Meknès nieder, am Fuß des Atlas-Gebirges, auf einem abgelegenen Hof, den Amine von seinem Vater geerbt hat. Während er versucht, dem steinigen Boden einen kargen Ertrag abzutrotzen, zieht Mathilde die beiden Kinder groß. Voller Freiheitsdrang hatte sie den Aufbruch in ein neues, unbekanntes Leben gewagt und muss doch bald ernüchternde Erfahrungen machen: den alltäglichen Rassismus der französischen Kolonialgesellschaft, in der eine Ehe zwischen einem Araber und einer Französin nicht vorgesehen ist, die patriarchalischen Traditionen der Einheimischen, das Unverständnis des eigenen Mannes. Aber Mathilde gibt nicht auf. Sie kämpft um Anerkennung und ihr Leben im Land der Anderen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Der Nr.-1-Bestseller aus Frankreich – der neue gefeierte Roman von Leïla Slimani. Über das Leben in der Fremde, die Liebe eines Paares aus zwei Kulturen und eine Welt im Umbruch.
Mathilde, eine junge Elsässerin, verliebt sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in Amine Belhaj, einen marokkanischen Offizier im Dienst der französischen Armee. Die beiden heiraten und lassen sich in der Nähe von Meknès nieder, am Fuß des Atlas-Gebirges, auf einem abgelegenen Hof, den Amine von seinem Vater geerbt hat. Während er versucht, dem steinigen Boden einen kargen Ertrag abzutrotzen, zieht Mathilde die beiden Kinder groß. Voller Freiheitsdrang hatte sie den Aufbruch in ein neues, unbekanntes Leben gewagt und muss doch bald ernüchternde Erfahrungen machen: den alltäglichen Rassismus der französischen Kolonialgesellschaft, in der eine Ehe zwischen einem Araber und einer Französin nicht vorgesehen ist, die patriarchalischen Traditionen der Einheimischen, das Unverständnis des eigenen Mannes. Aber Mathilde gibt nicht auf. Sie kämpft um Anerkennung und ihr Leben im Land der Anderen.
»Ein Literaturereignis.« Der Spiegel
»Ein Meisterwerk.« Le Monde
»Leïla Slimani ist ein großer Gesellschaftsroman gelungen, voll schöpferischer Kraft und Wortgewalt.« Libération
»Eine spannende Familiensaga auf den Spuren ihrer Großeltern – ein neuer Höhepunkt in der Erfolgskarriere der Prix-Goncourt-Preisträgerin.« Le Point
»Man fiebert unweigerlich mit dieser Familie mit, die im kolonialen Marokko nach dem Zweiten Weltkrieg vom Kampf um Unabhängigkeit erfasst wird. Ein überwältigender Roman von einer zu Recht hochgefeierten Autorin.« Salman Rushdie
»Mitreißend und ergreifend!«ELLE
Zur Autorin
Die französisch-marokkanische Autorin Leïla Slimani gilt als eine der wichtigsten literarischen Stimmen Frankreichs. Slimani, 1981 in Rabat geboren, wuchs in Marokko auf und studierte an der Pariser Eliteuniversität Sciences Po. Ihre Bücher sind internationale Bestseller. Für den Roman »Dann schlaf auch du« wurde ihr der renommierte Prix Goncourt zuerkannt. »All das zu verlieren«, ebenfalls preisgekrönt, erscheint in 25 Ländern. In den Essaybänden »Sex und Lügen« und »Warum so viel Hass?« widmet Leïla Slimani sich dem Islam und dem Feminismus sowie dem zunehmenden Fanatismus. Ihr jüngster Roman »Das Land der Anderen« basiert auf der Geschichte ihrer Großeltern. Sie lebt mit ihrer Familie in Paris
Amelie Thoma übersetzt Literatur aus dem Französischen, u.a. Marc Levy, Joël Dicker, François Sagan und Simone de Beauvoir.
LEÏLA SLIMANI
Das Land der Anderen
Roman
Aus dem Französischen von Amelie Thoma
Luchterhand
Die französische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Le Pays des Autres« bei Éditions Gallimard, Paris.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Das Zitat von William Faulkner stammt aus: »Licht im August«, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 2010. Deutsch von Paul Ingendaay. Abdruck mit frdl. Genehmigung des Verlags.
Originalveröffentlichung Mai 2021
Copyright © 2020 Éditions Gallimard, Paris
Copyright © der deutschen Ausgabe 2021
Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung buxdesign | München
unter Verwendung eines Motivs aus dem
© Privatarchiv von Leïla Slimani
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-26406-2V003www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
www.twitter.com/luchterhandlit
Im Gedenken an Anne und Atika, deren Unabhängigkeit mich immer wieder aufs Neue inspiriert.Für meine geliebte Mutter
Die Verdammnis dieses Wortes: Rassenmischung, schreiben wir sie riesengroß auf die Seite.
ÉDOUARDGLISSANT, L’intention poétique
Doch sein Blut gab keine Ruhe, es ließ nicht zu, dass er es rettete. Es wollte weder das eine noch das andere sein, wollte nicht, dass sein Körper sich rettete. Denn das schwarze Blut trieb ihn zuerst zu der Negerhütte. Und dann trieb ihn das weiße Blut dort wieder hinaus, während das schwarze Blut ihn nach der Pistole greifen ließ und das weiße Blut ihm nicht erlauben wollte, sie abzufeuern.
WILLIAMFAULKNER, Licht im August
I
Als Mathilde die Farm zum ersten Mal besuchte, dachte sie: ›Das ist viel zu weit draußen.‹ Diese Abgeschiedenheit war ihr nicht geheuer. Damals, im Jahr 1947, besaßen sie noch kein Auto und legten die fünfundzwanzig Kilometer von Meknès auf einem alten Eselskarren zurück, den ein Zigeuner lenkte. Amine beachtete weder die unkomfortable Holzbank noch den Staub, der seine Frau zum Husten brachte. Er hatte nur Augen für die Landschaft und konnte es kaum erwarten, den Grund und Boden zu erreichen, den sein Vater ihm vermacht hatte.
1935, nach Jahren harter Arbeit als Übersetzer der Kolonialarmee, hatte Kadour Belhaj diese steinigen Hektar Land erworben. Er hatte seinem Sohn erzählt, dass er davon träumte, sie in einen blühenden landwirtschaftlichen Betrieb zu verwandeln, der Generationen kleiner Belhajs ernähren würde. Amine erinnerte sich an den Blick seines Vaters, an dessen Stimme, die nicht einen Moment gezittert hatte, als er ihm seine Pläne für den Hof darlegte. Einige Morgen Wein, hatte er ihm erklärt, und ganze Hektar mit Getreide. Auf dem sonnigsten Teil des Hügels müsste man ein Haus bauen, umgeben von Obstbäumen und Mandelbaumalleen. Kadour war stolz darauf, dass dieses Land ihm gehörte. »Unser Land!« Er sagte diese Worte nicht wie die Nationalisten oder die französischen Siedler, im Sinne eines moralischen Anspruchs oder eines Ideals, sondern wie ein Grundbesitzer, der sich auf sein gutes Recht beruft. Der alte Belhaj wollte hier begraben werden und dass seine Kinder hier begraben würden, dass diese Erde ihn nährte und ihm seine letzte Ruhestätte gewährte. Doch er starb im Jahr 1939, nachdem sein Sohn sich gerade freiwillig zum Spahi-Regiment gemeldet hatte und stolz Burnus und Pluderhosen trug. Ehe er zur Front aufbrach, verpachtete Amine, als ältester Sohn und nunmehr Familienoberhaupt, das Gut an einen aus Algerien stammenden Franzosen.
Als Mathilde fragte, woran dieser Schwiegervater, den sie nie kennengelernt hatte, gestorben sei, fasste sich Amine an den Bauch und schüttelte schweigend den Kopf. Später erfuhr Mathilde, was passiert war. Kadour Belhaj litt seit seiner Rückkehr aus Verdun an chronischen Magenschmerzen, und keinem marokkanischen oder europäischen Heiler war es gelungen, ihm Linderung zu verschaffen. Schließlich hatte er, der sich rühmte, ein aufgeklärter Mann zu sein, stolz auf seine Bildung und sein Talent für Sprachen, sich beschämt und verzweifelt in das Souterrain einer chouafa geschleppt. Die Hexe hatte sich nach Kräften bemüht, ihn davon zu überzeugen, dass er verflucht sei, dass jemand ihm übelwolle und dieser Schmerz das Werk eines hinterhältigen Feindes sei. Sie hatte ihm ein doppelt gefaltetes Papier mit einem safrangelben Pulver gegeben. Noch am selben Abend hatte er das Mittel, in Wasser gelöst, getrunken und war innerhalb weniger Stunden unter entsetzlichen Schmerzen gestorben. Die Familie sprach nicht gern darüber. Man schämte sich für die Naivität des Vaters ebenso wie für die Umstände seines Todes, denn der ehrenwerte Offizier hatte sich im Innenhof des Hauses entleert, die weiße Dschellaba triefend vor Kot.
An diesem Tag im April 1947 lächelte Amine Mathilde zu und drängte den Kutscher zur Eile, der seine schmutzigen nackten Füße aneinanderrieb. Mathilde zuckte zusammen, als der Kerl noch wüster auf die Mauleselin einschlug. Die Brutalität des Zigeuners empörte sie. Er schnalzte mit der Zunge, »Ra!«, und zog die Peitsche über den knochigen Rücken des Tieres. Es war Frühling, Mathilde war im zweiten Monat schwanger. Auf den Feldern blühten Disteln, Malven und Borretsch. Ein frischer Wind wiegte die Stiele der Sonnenblumen. Zu beiden Seiten der Straße befanden sich die Ländereien französischer Siedler, die hier seit zwanzig oder dreißig Jahren lebten. Ihre Anpflanzungen zogen sich auf dem sanft abfallenden Gelände bis zum Horizont hin. Die meisten von ihnen kamen aus Algerien, und die Behörden hatten ihnen die besten Böden und größten Flächen zugesprochen. Amine streckte einen Arm aus und beschirmte mit der anderen Hand seine Augen vor der Mittagssonne, um die weite Ebene zu betrachten, die sich seinem Blick darbot. Mit dem Zeigefinger wies er auf eine Zypressenallee rund um die Ländereien von Roger Mariani, der mit Wein und Schweinezucht ein Vermögen gemacht hatte. Von der Straße aus sah man weder das Gutshaus noch die Morgen voller Weinstöcke. Doch Mathilde konnte sich den Reichtum des Bauern nur zu gut vorstellen, einen Reichtum, der sie mit Hoffnungen für ihre eigene Zukunft erfüllte. Die heitere Schönheit der Landschaft erinnerte sie an eine Radierung über dem Klavier ihres Musiklehrers in Mülhausen. »Das ist in der Toskana, mein Fräulein«, hatte er ihr erklärt. »Vielleicht reisen Sie ja eines Tages nach Italien.«
Der Maulesel blieb stehen und begann am Wegrand zu grasen. Er hatte nicht vor, die mit großen weißen Steinen übersäte Steigung zu erklimmen, die vor ihnen lag. Wütend straffte der Kutscher die Schultern und ließ Flüche und Hiebe auf das Tier niederhageln. Mathilde stiegen Tränen in die Augen. Sie versuchte sich zurückzuhalten, schmiegte sich an ihren Mann, der das ganz und gar unpassend fand.
»Was ist denn los?«, fragte Amine.
»Sag ihm, er soll aufhören, diesen armen Maulesel zu schlagen.«
Mathilde legte dem Zigeuner eine Hand auf die Schulter und sah ihn an wie ein Kind, das einen zornigen Vater besänftigen möchte. Doch der Kutscher schlug nur umso brutaler zu. Er spuckte auf den Boden, hob den Arm und sagte: »Willst du auch die Peitsche spüren?«
Die Stimmung änderte sich ebenso wie die Landschaft. Sie erreichten die Kuppe eines Hügels mit abgewetzten Flanken. Keine Blumen mehr, keine Zypressen, kaum ein paar Olivenbäume, die in dem felsigen Gelände überlebten. Der ganze Hügel vermittelte ein Gefühl von Unfruchtbarkeit. Das hier war nicht mehr die Toskana, dachte Mathilde, das war der Wilde Westen. Sie stiegen vom Karren und gingen zu einem kleinen weißen Gebäude ohne jeden Charme, dessen Dach aus einem ordinären Stück Blech bestand. Das war kein Haus, sondern eine lieblose Folge enger, düsterer und feuchter Räume. Durch das einzige, zum Schutz vor Ungeziefer weit oben in der Mauer angebrachte Fenster, sickerte ein wenig Licht herein. An den Wänden bemerkte Mathilde grünliche Ränder, die die letzten Regenfälle dort hinterlassen hatten. Der alte Pächter lebte allein. Seine Frau war nach Nîmes zurückgekehrt, nachdem sie ein Kind verloren hatte, und er hatte niemals daran gedacht, aus dieser Bleibe einen heimeligen Ort zu machen, der einer Familie Geborgenheit bieten könnte. Trotz der milden Luft erstarrte Mathilde innerlich zu Eis. Die Pläne, die Amine ihr darlegte, erfüllten sie mit Sorge.
*
Dieselbe Beklommenheit hatte sie gepackt, als sie am 1. März 1946 in Rabat gelandet war. Trotz des hoffnungslos blauen Himmels, trotz der Freude, ihren Mann wiederzusehen, und des Stolzes, ihrem Schicksal entronnen zu sein, war ihr plötzlich mulmig geworden. Sie war zwei Tage unterwegs gewesen. Von Straßburg nach Paris, von Paris nach Marseille und dann von Marseille nach Algier, wo sie in eine alte Junker gestiegen war und gedacht hatte, sie würde sterben. Zwischen lauter Männern mit von all den Kriegsjahren müden Blicken hatte sie mühsam ihre Schreie unterdrückt. Während des Fluges übergab sie sich, weinte, betete. Ihr Mund schmeckte nach Galle, vermischt mit Salz. Sie war traurig, nicht so sehr, dass sie über Afrika sterben könnte, sondern weil sie nun am Flugsteig, wo der Mann ihres Lebens sie erwartete, in einem zerknitterten und vollgespuckten Kleid erscheinen würde. Endlich landete sie unversehrt, und Amine war da, schöner denn je, unter diesem Himmel, der so tiefblau war, als hätte man ihn gründlich abgespült. Ihr Mann, dem die Blicke der anderen Passagiere nicht entgingen, küsste sie auf die Wangen. Er packte ihren rechten Arm in einer zugleich sinnlichen wie drohenden Geste. Es schien, als wolle er sie im Zaum halten.
Sie nahmen ein Taxi, und Mathilde drängte sich an Amines Körper, dessen Sehnsucht und Begehren sie endlich spürte. »Wir schlafen heute im Hotel«, sagte er, an den Fahrer gewandt, ehe er, wie um seine Ehrhaftigkeit zu unterstreichen, hinzufügte: »Das ist meine Frau. Wir haben uns gerade erst wiedergesehen.« Rabat war ein sonniges weißes Städtchen, dessen Eleganz Mathilde überraschte. Entzückt betrachtete sie die Art-déco-Fassaden der Häuser im Zentrum und bewunderte, die Nase an die Scheibe gedrückt, all die schönen Frauen, die mit zu Pumps und Hüten passenden Handschuhen den Cours Lyautey hinuntergingen. Überall waren Baustellen und halb fertige Häuser, vor denen zerlumpte Männer nach Arbeit fragten. Da gingen Nonnen neben zwei Bäuerinnen, die Reisigbündel auf dem Rücken trugen. Ein kleines Mädchen mit kurzen Haaren saß lachend auf einem Esel, den ein schwarzer Mann am Zaumzeug führte. Zum ersten Mal im Leben atmete Mathilde den salzigen Wind des Atlantischen Ozeans. Das Licht nahm ab, wurde rosa und samten. Sie war müde und wollte gerade den Kopf an die Schulter ihres Mannes legen, da verkündete er, dass sie angekommen seien.
Sie verließen ihr Zimmer zwei Tage lang nicht. Mathilde, die immer so neugierig war auf die anderen und alles, was draußen geschah, weigerte sich, auch nur die Fensterläden zu öffnen. Sie konnte einfach nicht genug bekommen von Amines Händen, seinem Mund, dem Duft seiner Haut, der, das verstand sie nun, etwas mit der Luft dieses Landes zu tun hatte. Er hatte sie regelrecht verhext, und sie flehte ihn an, so lange wie möglich in ihr zu bleiben, selbst zum Schlafen, selbst zum Reden.
Mathildes Mutter sagte immer, Schmerz und Scham weckten die Erinnerung an unsere tierische Natur. Aber niemand hatte ihr je von diesen Wonnen erzählt. Während des Krieges, an den trostlosen und düsteren Abenden, befriedigte Mathilde sich selbst im eiskalten Bett ihres Zimmers in der oberen Etage. Sobald die Sirenen losgingen, die die Bomben ankündigten, sobald das Dröhnen eines Flugzeugs herannahte, rannte Mathilde nicht um ihr Leben, sondern um ihr Verlangen zu stillen. Jedes Mal, wenn sie Angst hatte, ging sie hoch in ihr Zimmer, dessen Tür sich nicht richtig schließen ließ, doch ihr war es egal, ob jemand sie überraschte. Die anderen blieben sowieso lieber alle beisammen in ihren Löchern oder im Keller, sie wollten gemeinsam sterben, wie das Vieh. Mathilde legte sich aufs Bett, und der Orgasmus war die einzige Möglichkeit, die Angst zu bezähmen, sie im Zaum zu halten, die Oberhand über den Krieg zu gewinnen. Ausgestreckt auf den schmutzigen Laken, dachte sie an die Männer, die überall durchs Land zogen, mit Gewehren bewaffnet, Männer ohne Frauen, so wie sie keinen Mann hatte. Und während sie die Hand auf ihr Geschlecht drückte, malte sie sich dieses immense ungestillte Verlangen aus, diesen Hunger nach Liebe und Unterwerfung, der die ganze Welt ergriffen hatte. Der Gedanke an diese grenzenlose Lüsternheit versetzte sie in Ekstase. Sie warf den Kopf in den Nacken, schloss die Augen und stellte sich Heerscharen von Männern vor, die zu ihr kamen, sie nahmen und ihr dankten. Für sie waren Angst und Lust untrennbar verbunden, und in Momenten der Gefahr dachte sie immer zuallererst daran.
Nach zwei Tagen und Nächten musste Amine sie fast aus dem Bett zerren, halb verhungert und verdurstet, damit sie sich endlich mit ihm an einen Tisch auf der Hotelterrasse setzte. Und selbst da dachte sie, während ihr vom Wein warm ums Herz wurde, an den Platz, den Amine gleich wieder zwischen ihren Schenkeln einnehmen würde. Aber ihr Mann war ernst geworden. Er verputzte ein halbes Hähnchen mit den Fingern und wollte über die Zukunft sprechen. Er ging nicht mit ihr zurück aufs Zimmer und war verärgert, als sie ihm vorschlug, sie könnten Mittagsschlaf halten. Ein paarmal entfernte er sich kurz, um zu telefonieren. Als sie ihn fragte, mit wem er gesprochen habe und wann sie Rabat verlassen würden, blieb er sehr vage. »Alles wird gut«, sagte er zu ihr. »Ich regele das alles.«
Eine Woche später, nachdem sie den halben Tag allein verbracht hatte, kam er nervös und verstimmt ins Zimmer. Mathilde überhäufte ihn mit Zärtlichkeiten, setzte sich auf seinen Schoß. Er nippte an dem Glas Bier, das sie ihm eingeschenkt hatte, und sagte: »Ich habe eine schlechte Nachricht. Wir müssen ein paar Monate warten, ehe wir auf unser Grundstück ziehen können. Ich habe mit dem Pächter gesprochen. Er weigert sich, den Hof vor Ablauf des Vertrages zu verlassen. Ich habe in Meknès nach einer Wohnung gesucht, aber dort sind noch immer viele Flüchtlinge und man findet nichts zu einem vernünftigen Preis.« Mathilde war verwirrt.
»Und was sollen wir dann tun?«
»Wir werden solange bei meiner Mutter leben.«
Mathilde sprang auf die Füße und begann zu lachen.
»Das ist nicht dein Ernst?« Sie schien die Situation komisch zu finden, belustigend. Ein Mann wie Amine, ein Mann, der imstande war, sie so zu besitzen, wie er es heute Nacht getan hatte, wollte ihr weismachen, dass sie bei seiner Mutter leben würden?
Doch Amine war nicht zu Scherzen aufgelegt. Er blieb sitzen, um den Größenunterschied zwischen ihm und seiner Frau nicht ertragen zu müssen. Mit eisiger Stimme, die Augen auf den Terrazzoboden geheftet, bestätigte er nur:
»So ist das hier.«
Diesen Satz würde sie noch oft hören. Und genau in dem Moment begriff sie, dass sie eine Fremde war, eine Frau, eine Ehefrau, ein Mensch, der der Gnade der anderen ausgeliefert war. Amine war jetzt auf seinem Territorium, er war es, der hier die Regeln erklärte, der sagte, wo es langging, der die Grenzen des Anstands, der Scham und der guten Sitten zog. Im Elsass während des Krieges war er ein Fremder gewesen, ein vorübergehender Gast, der sich besser zurückhielt. Als sie ihn im Herbst 1944 kennenlernte, hatte sie ihn geführt und beschützt. Amines Regiment war in ihrem Dorf, ein paar Kilometer von Mülhausen entfernt, stationiert gewesen und hatte tagelang auf den Marschbefehl gen Osten warten müssen. Von all den Frauen, die sich bei ihrer Ankunft um den Jeep geschart hatten, war Mathilde die größte gewesen. Sie hatte breite Schultern und die Waden eines jungen Burschen. Sie ließ Amine nicht aus den Augen, die grün waren wie das Wasser der Brunnen in Meknès. Während der Woche, die er im Dorf verbrachte, begleitete sie ihn auf seinen Spaziergängen, stellte ihm ihre Freunde vor und brachte ihm Kartenspiele bei. Er war einen guten Kopf kleiner als sie und hatte die dunkelste Haut, die man sich vorstellen konnte. Er war so schön, dass sie Angst hatte, man würde ihn ihr wegnehmen. Angst, sie würde sich das alles nur einbilden. Noch nie hatte sie so etwas empfunden. Weder bei ihrem Musiklehrer, damals mit vierzehn. Noch bei ihrem Cousin Alain, der seine Hand unter ihren Rock geschoben und am Rheinufer Kirschen für sie geklaut hatte. Doch hier, in seinem Land nun, fühlte sie sich hilflos.
*
Drei Tage später bestiegen sie einen Lastwagen, dessen Fahrer sich bereit erklärt hatte, sie nach Meknès zu bringen. Mathilde litt unter dem strengen Geruch des Mannes und dem schlechten Zustand der Straße. Zweimal hielten sie am Rand, weil sie sich übergeben musste. Bleich und erschöpft, den Blick starr auf eine Landschaft gerichtet, der sie weder Sinn noch Schönheit abgewinnen konnte, wurde Mathilde von Wehmut überwältigt. ›Mach‹, sagte sie sich, ›dass mir dieses Land nicht feindlich gesinnt ist. Wird mir all das eines Tages vertraut sein?‹ Als sie in Meknès ankamen, war die Nacht schon hereingebrochen, und dichter, eisiger Regen trommelte auf die Windschutzscheibe des Lastwagens. »Es ist zu spät, um dir meine Mutter vorzustellen«, erklärte Amine. »Wir schlafen im Hotel.«
Die Stadt erschien ihr kalt und feindselig. Amine erläuterte Mathilde ihre Topografie, die den von Marschall Lyautey zu Beginn des Protektorats aufgestellten Grundsätzen entsprach: eine strikte Trennung zwischen der Medina, deren traditionelle Sitten und Gebräuche bewahrt werden sollten, und der europäischen Ville Nouvelle, deren Straßen die Namen französischer Städte trugen und die sich als Labor der Moderne verstand. Der Lastwagen setzte sie weiter unten am linken Ufer des Wadi Bou Fekrane ab, am Eingang zur Altstadt, in der die Einheimischen wohnten. Auch Amines Familie lebte dort, im Berrima-Viertel, direkt gegenüber der jüdischen Mellah. Sie nahmen ein Taxi auf die andere Seite des Flusses. Es folgte einer langen, ansteigenden Straße, passierte Sportplätze und durchquerte eine Art Pufferzone, ein Niemandsland, das die Stadt entzwei teilte und auf dem nicht gebaut werden durfte. Amine zeigte ihr das Camp Poublan, die Militärbasis, die über dem arabischen Teil der Stadt aufragte und deren leiseste Zuckungen überwachte.
Sie bezogen ein anständiges Hotel. Der Rezeptionist inspizierte mit der Sorgfalt eines Beamten ihre Papiere und ihren Trauschein. Auf der Treppe zu ihrem Zimmer kam es beinahe zum Streit, da der Hotelpage mit Amine hartnäckig Arabisch redete, während der ihn auf Französisch ansprach. Der junge Mann warf Mathilde anzügliche Blicke zu. Er, der immer ein Papier dabeihaben musste zum Beweis, dass er berechtigt war, abends durch die Straßen der Ville Nouvelle zu gehen, nahm es Amine übel, dass er mit dem Feind schlief und sich frei bewegen konnte. Kaum hatten sie ihr Gepäck im Zimmer abgestellt, da zog Amine Mantel und Hut wieder an. »Ich gehe meiner Familie guten Tag sagen. Es wird nicht lange dauern.« Er ließ ihr keine Zeit für eine Antwort, warf die Tür hinter sich zu, und sie hörte ihn die Treppe hinunterrennen.
Mathilde setzte sich aufs Bett, die Beine an die Brust gezogen. Was tat sie hier? Das hatte sie allein sich selbst und ihrer Eitelkeit zuzuschreiben. Sie hatte sich nach Abenteuern gesehnt, hatte sich großspurig auf diese Ehe eingelassen, um deren Exotik ihre Freundinnen aus Kindertagen sie beneideten. Jetzt war sie jedwedem Spott, jedwedem Verrat ausgeliefert. Vielleicht traf Amine eine Geliebte? Vielleicht war er sogar verheiratet, denn schließlich, so hatte ihr Vater ihr mit verlegener Miene gesagt, lebten die Männer hier polygam. Er spielte vielleicht Karten in einem Bistro ein paar Schritte von hier und amüsierte sich mit seinen Freunden darüber, dass er seiner lästigen Ehefrau entwischt war. Sie begann zu weinen. Sie schämte sich, so in Panik zu geraten, aber es war dunkel und sie wusste nicht einmal, wo sie war. Wenn Amine nicht wiederkäme, wäre sie hoffnungslos verloren, ohne Geld, ohne Freunde. Sie kannte nicht mal den Namen der Straße, in der sie wohnten.
Als Amine zurückkehrte, kurz vor Mitternacht, fand er sie zerzaust, das Gesicht gerötet und vollkommen aufgelöst vor. Sie hatte eine Weile gebraucht, um die Tür zu öffnen, sie zitterte, und er dachte schon, es wäre etwas passiert. Sie warf sich in seine Arme, versuchte, ihm ihre Beklemmung begreiflich zu machen, das Heimweh, das sie überwältigt, diese wahnsinnige Angst, die sie gepackt hatte. Er verstand es nicht, und der Körper seiner an ihn geklammerten Frau kam ihm furchtbar schwer vor. Er zog sie zum Bett, wo sie sich nebeneinandersetzten. Amines Hals war nass vor Tränen. Mathilde beruhigte sich, ihr Atem ging wieder gleichmäßiger, sie schniefte ein paarmal. Amine holte ein Taschentuch aus dem Ärmel und reichte es ihr. Langsam streichelte er ihren Rücken und sagte: »Sei kein kleines Mädchen. Du bist jetzt meine Frau. Dein Leben ist hier.«
Zwei Tage später zogen sie in das Haus im Berrima-Viertel. In den engen Gassen der Altstadt hakte Mathilde sich bei ihrem Mann unter, sie fürchtete, sich in diesem Labyrinth zu verirren, wo sich zahllose Händler drängten und die Gemüseverkäufer ihre Waren wortreich feilboten. Hinter der schweren, mit Rundkopfnägeln beschlagenen Tür des Hauses erwartete die Familie sie. Mouilala, die Mutter, stand mitten im Innenhof. Sie trug einen eleganten Seidenkaftan, und ihr Haar bedeckte ein smaragdgrünes Kopftuch. Für diesen Anlass hatte sie alten Goldschmuck aus ihrer Zedernholztruhe geholt; Fußkettchen, eine ziselierte Spange und ein Collier, das so schwer war, dass ihr schmächtiger Körper sich leicht nach vorn neigte. Als das Paar eintrat, stürzte sie sich auf ihren Sohn und segnete ihn. Sie lächelte Mathilde zu, die die Hände der Frau in ihre nahm und das schöne dunkle Gesicht betrachtete, die ein wenig geröteten Wangen. »Sie heißt dich willkommen«, übersetzte Selma, Amines kleine, gerade neun Jahre alt gewordene Schwester. Sie stand vor Omar, einem schweigsamen Halbwüchsigen, der die Hände hinter dem Rücken und den Blick gesenkt hielt.
Mathilde musste sich an dieses Leben gewöhnen, alle miteinander in dem Haus, dessen Matratzen voller Wanzen und Ungeziefer waren und in dem es kein Entrinnen gab vor den Körpergeräuschen und dem Schnarchen der anderen. Ihre Schwägerin kam ohne anzuklopfen in ihr Zimmer und warf sich aufs Bett, wobei sie die paar Brocken Französisch wiederholte, die sie in der Schule gelernt hatte. Nachts hörte Mathilde Jalil schreien, den jüngsten Bruder, der oben eingesperrt lebte mit nur einem Spiegel als Gesellschaft, den er nie aus den Augen ließ. Er rauchte ununterbrochen Sebsi, und der Geruch des Kif breitete sich im Flur aus und machte sie ganz benommen.
Horden skelettöser Katzen schlichen den ganzen Tag lang durch den kleinen Innengarten, in dem eine staubige Bananenstaude ums Überleben kämpfte. Hinten im Patio gab es einen Brunnen, aus dem das Dienstmädchen, eine alte Sklavin, das Wasser für den Haushalt schöpfte. Amine hatte Mathilde gesagt, dass Yasmine aus Afrika kam, vielleicht Ghana, und dass Kadour Belhaj sie seiner Frau auf dem Markt von Marrakesch gekauft hatte.
In den Briefen, die sie ihrer Schwester schrieb, log Mathilde. Sie gab vor, ihr Leben gliche den Büchern von Karen Blixen, Alexandra David-Néel, Pearl S. Buck. Sie erfand Abenteuer, in denen sie ihre Begegnungen mit sanftmütigen und abergläubischen Einheimischen in Szene setzte. Sie beschrieb sich mit Hut und Stiefeln, stolz auf dem Rücken eines arabischen Vollbluthengstes. Sie wollte Irène eifersüchtig machen, wollte, dass sie bei jedem Wort litt, dass sie vor Neid und Wut platzte. Mathilde rächte sich an dieser unnachgiebigen und autoritären großen Schwester, die sie ihr ganzes Leben lang wie ein Kind behandelt und sie so oft genussvoll vor aller Augen gedemütigt hatte. »Mathilde, das Dummchen«, »Mathilde, das kleine Luder«, sagte Irène ohne Zärtlichkeit und ohne Nachsicht. Mathilde fand, dass ihre Schwester sie nie richtig verstanden und in einer tyrannischen Liebe gefangen gehalten hatte.
Als sie nach Marokko aufgebrochen war, als sie dem Dorf, den Nachbarn und der Zukunft, die man ihr versprochen hatte, entflohen war, hatte Mathilde triumphiert. Zuerst schrieb sie begeisterte Briefe, in denen sie ihr Leben im Haus der Medina schilderte. Sie hob die geheimnisvollen Gässchen von Berrima hervor, trug extra dick auf beim Schmutz in den Straßen, dem Lärm und dem Gestank der Esel, die die Männer und ihre Waren transportierten. Dank einer der Ordensschwestern des Mädchenpensionats fand sie ein schmales Bändchen über Meknès, das Reproduktionen einiger Stiche von Delacroix enthielt. Sie legte das Buch mit den vergilbten Seiten auf den Nachttisch und prägte sich jedes Detail ein. Sie lernte ganze Passagen von Pierre Loti auswendig, den sie so poetisch fand, und konnte kaum glauben, dass der Dichter nur wenige Kilometer von hier entfernt geschlafen und die Mauern und das Becken von Agdal erblickt hatte.
Sie erzählte von den Stickern, den Kupferschmieden, den Drechslern, die im Schneidersitz in ihren Werkstätten im Souterrain saßen. Sie erzählte von den Prozessionen der Bruderschaften auf dem El-Hedim-Platz, der Schar von Wahrsagern und Heilern. In einem ihrer Briefe beschrieb sie über fast eine ganze Seite den Laden eines Quacksalbers, der Hyänenschädel, getrocknete Raben, Igelpfoten und Schlangengift verkaufte. Sie dachte, das würde Irène und ihren Vater Georges mächtig beeindrucken und sie würden sie in ihren Betten oben in dem gutbürgerlichen Haus darum beneiden, dass sie die Langeweile gegen Abenteuer, den Komfort gegen ein Leben wie im Roman eingetauscht hatte.
Alles an dieser Umgebung war überraschend, anders als das, was sie bisher gekannt hatte. Sie hätte neue Worte gebraucht, ein gesamtes, von der Vergangenheit befreites Vokabular, um die Gefühle auszudrücken, das Licht zu beschreiben, das so intensiv war, dass man mit zusammengekniffenen Augen lebte, das Staunen, das sie Tag für Tag angesichts all der Geheimnisse und der Schönheit ergriff. Nichts, weder die Farbe der Bäume noch die des Himmels, nicht mal der Geschmack des Windes auf der Zunge und den Lippen war ihr vertraut. Alles war anders.
Während der ersten Monate in Marokko verbrachte Mathilde viel Zeit an dem kleinen Schreibtisch, den ihre Schwiegermutter für sie hatte aufstellen lassen. Die alte Frau begegnete ihr mit rührender Ehrerbietung. Zum ersten Mal in ihrem Leben teilte Mouilala ihr Haus mit einer gebildeten Frau, und wenn sie Mathilde über ihr braunes Briefpapier gebeugt sah, empfand sie für diese Schwiegertochter unendliche Bewunderung. Sie hatte daher jeden Lärm in den Fluren verboten und erlaubte Selma nicht mehr, durch die Stockwerke zu rennen. Sie wollte auf keinen Fall, dass Mathilde ihre Tage in der Küche verbrachte, weil sie fand, das sei nicht der richtige Ort für eine Europäerin, die imstande war, Zeitungen zu lesen und die Seiten eines Romans umzublättern. Also zog Mathilde sich in ihr Zimmer zurück und schrieb. Es bereitete ihr nur selten Vergnügen, denn immer, wenn sie sich daran machte, eine Landschaft zu beschreiben oder eine Situation, die sie erlebt hatte, fand sie ihr Vokabular beschränkt. Andauernd stolperte sie über dieselben plumpen und einfallslosen Worte, und sie ahnte verschwommen, dass die Sprache ein riesiges Feld war, eine grenzenlose Spielwiese, die sie ängstigte und benommen machte. Es gab so viel zu sagen, und sie wäre gerne Maupassant gewesen, um das Gelb an den Mauern der Medina zu benennen oder das Treiben der spielenden Knaben auf den Straßen lebendig werden zu lassen, durch die die Frauen, gehüllt in ihre weißen Haiks, wie Gespenster huschten. Sie bediente sich eines altmodischen Vokabulars, das, da war sie sicher, ihrem Vater gefallen würde. Sie sprach von Raubzügen, Fellachen, Dschinnen und Zellij-Mosaiken in allen Farben.
Doch sie hätte sich gewünscht, es gäbe keinerlei Hürde, keinerlei Hindernis für sie. Sie könnte die Dinge so darstellen, wie sie sie sah. Die Kinder mit den grindigen rasierten Schädeln, all die Buben, die durch die Straßen rannten, schrien und spielten, sich nach ihr umdrehten, stehen blieben und sie mit finsterem Blick, einem Blick, der viel älter war als sie selbst, betrachteten. Einmal beging sie die Dummheit, einem Knirps in kurzen Hosen, der noch keine fünf Jahre alt war und auf dem Kopf einen viel zu großen Tarbusch trug, eine Münze zuzustecken. Der Junge war nicht größer als die Jutesäcke voller Linsen oder Grieß, die der Lebensmittelhändler vor seine Tür stellte und in die Mathilde immer am liebsten ihre Arme eingetaucht hätte. »Kauf dir einen Ball«, hatte sie gerührt vor Stolz und Freude zu ihm gesagt. Aber der Kleine hatte einen Schrei ausgestoßen, und sofort waren aus allen umliegenden Straßen Kinder herbeigerannt und hatten sich wie ein Schwarm Fliegen auf sie gestürzt. Sie riefen Gott an, sagten Worte auf Französisch, doch Mathilde verstand nichts und musste unter den spöttischen Blicken der Passanten, die dachten: ›Das wird sie lehren, unbedacht Almosen zu verteilen‹, die Flucht ergreifen. Sie hätte dieses wundervolle Leben gern aus der Ferne beobachtet, wäre am liebsten unsichtbar gewesen. Ihre Größe, ihre helle Haut, ihr Status einer Fremden hielten sie vom Herzen der Dinge fern, von dieser Stille, die einem sagt, dass man zu Hause ist. Sie kostete den Geruch des Leders in den engen Gassen, den des Holzfeuers und des frisch geschlachteten Fleisches, die vermischten Gerüche von fauligem Wasser und überreifen Birnen, von Eselskot und Sägemehl. Aber sie hatte keine Worte dafür.
Wenn sie es leid war, zu schreiben oder Romane, die sie schon auswendig kannte, noch einmal zu lesen, legte Mathilde sich auf die Terrasse, wo die Wäsche gewaschen und das Fleisch gedörrt wurde. Sie lauschte von oben den Gesprächen auf der Straße, den Liedern der Frauen hinter den für sie bestimmten Kulissen. Manchmal sah sie sie wie Seiltänzerinnen von einer Terrasse zur anderen gehen und sich dabei fast den Hals brechen. Auf diesen Dächern, die sie nur nachts oder am Mittag, wenn die Sonne zu heiß brannte, verließen, schwatzten und tanzten die Mädchen, Dienerinnen, Ehefrauen und schütteten einander ihr Herz aus. Hinter einem Mäuerchen verborgen, wiederholte Mathilde die paar Beleidigungen, die sie kannte, und die Passanten hoben den Kopf und schimpften zurück. »Lay atik typhus!«1 Sicher dachten sie, es wäre ein kleiner Junge, der sie da verspottete, ein Schlingel, der sich an den Rockschößen seiner Mutter zu Tode langweilte. Sie spitzte immerzu die Ohren und nahm die Worte mit einer Schnelligkeit auf, die alle überraschte. »Erst gestern noch hat sie nichts verstanden!«, staunte Mouilala, und von da an achtete man darauf, was man in ihrem Beisein sagte.
Arabisch lernte Mathilde in der Küche. Sie hatte darauf bestanden, und Mouilala willigte schließlich ein, dass ihre Schwiegertochter sich zu ihnen setzte und zuschaute. Man zwinkerte und lächelte ihr zu, es wurde gesungen. Als Erstes lernte sie, Tomate, Öl, Wasser und Brot zu sagen. Sie lernte warm, kalt, den Wortschatz der Gewürze, dann den des Wetters: Trockenheit, Regen, Eis, heißer Wind und sogar Sandsturm. Mit diesem Vokabular konnte sie auch den Körper beschreiben und über die Liebe sprechen. Selma, die in der Schule Französischunterricht hatte, diente ihr als Dolmetscherin. Wenn Mathilde zum Frühstück herunterkam, fand sie Selma oft schlafend auf einer der Bänke im Wohnzimmer. Sie schimpfte mit Mouilala, der es egal war, ob ihre Tochter etwas lernte, ob sie gute Noten bekam oder fleißig war. Die Mutter ließ die Kleine schlafen und brachte es nicht übers Herz, sie in der Früh für die Schule zu wecken. Mathilde hatte versucht, Mouilala davon zu überzeugen, dass Selma durch Bildung einmal unabhängig sein könnte. Doch die alte Frau hatte nur die Stirn gerunzelt. Ihre sonst so freundliche Miene hatte sich verdüstert, und sie hatte es dieser nassrania2 übel genommen, dass sie sie belehrte. »Warum lassen Sie sie die Schule schwänzen? Sie setzen ihre Zukunft aufs Spiel.« Welche Zukunft meinte diese Französin wohl, fragte Mouilala sich. Was machte es schon, wenn Selma zu Hause blieb, wenn sie lernte, einen Schafsdarm zu stopfen und dann zuzunähen, anstatt die Seiten eines Heftes vollzuschreiben? Mouilala hatte zu viele Kinder gehabt, zu viele Sorgen. Sie hatte einen Mann und mehrere Babys begraben. Selma war ihr Geschenk, ihre Belohnung, die letzte Gelegenheit, sich sanft und nachsichtig zu zeigen, die das Leben ihr bot.
Zu ihrem ersten Ramadan beschloss Mathilde, ebenfalls zu fasten, und ihr Mann dankte ihr dafür, dass sie sich den hiesigen Gebräuchen unterwarf. Jeden Abend trank sie die Harira, deren Geschmack sie nicht mochte, und sie erhob sich vor Sonnenaufgang, um Datteln zu essen und saure Milch zu trinken. Während des Fastenmonats verließ Mouilala die Küche überhaupt nicht mehr, und die naschhafte und wankelmütige Mathilde begriff nicht, wie man nichts essen konnte, wenn man den ganzen Tag von Tajine- und Brotduft umgeben war. Vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Nacht rollten die Frauen Marzipan, tauchten frittiertes Gebäck in Honig. Sie kneteten den ölgetränkten Teig und zogen ihn, bis er so dünn war wie Briefpapier. Ihre Hände fürchteten weder Kälte noch Hitze, sie legten die Handflächen direkt auf die heißen Platten. Sie waren bleich vom Fasten, und Mathilde fragte sich, wie sie es aushielten in dieser überhitzten Küche, in der der Suppengeruch so intensiv war, dass einem ganz schwummrig wurde. Sie konnte in diesen langen Tagen der Entbehrung an nichts anderes denken als daran, was sie essen würde, sobald es dunkel wäre. Ausgestreckt auf einer der feuchten Bänke des Salons, die Augen geschlossen, ließ sie die Spucke durch ihren Mund kreisen. Sie bekämpfte ihre Kopfschmerzen, indem sie sich warme Brotscheiben, Spiegeleier mit Speck, in Tee getunkte Mandelhörnchen vorstellte.
Dann, wenn der Ruf zum Gebet erklang, stellten die Frauen eine Karaffe Milch, hart gekochte Eier, die dampfende Suppenschüssel, Datteln, die sie mit ihren Nägeln öffneten, auf den Tisch. Mouilala hatte für jeden eine besondere Aufmerksamkeit. Sie füllte Hackbällchen und gab bei ihrem jüngsten Sohn, der es liebte, wenn seine Zunge brannte, extra Piment dazu. Sie presste für Amine, um dessen Gesundheit sie sich sorgte, Orangen aus. Auf der Schwelle des Wohnzimmers stehend wartete sie, bis die Männer, mit ihren vom Mittagsschlaf verknitterten Gesichtern, das Brot brachen, ein hartes Ei schälten, sich in die Kissen zurücklehnten, ehe sie in die Küche ging und sich selbst stärkte. Mathilde war fassungslos. Sie sagte: »Das ist Sklaverei! Sie kocht den ganzen Tag und muss dann noch warten, bis ihr gegessen habt! Das begreife ich einfach nicht!« Sie machte sich Selma gegenüber Luft, die auf dem Fensterbrett in der Küche saß und lachte.
Sie schrie Amine ihre Wut ins Gesicht und tat es noch einmal nach dem Aïd el-Kebir, dem Opferfest, das zu einem furchtbaren Streit Anlass gab. Beim ersten Mal blieb Mathilde ruhig, wie versteinert vom Anblick der Schlachter mit ihren blutverschmierten Schürzen. Von der Terrasse auf dem Dach des Hauses aus betrachtete sie die stillen Straßen der Medina, durch die sich die Silhouetten dieser Henker bewegten und dann die der jungen Burschen, die zwischen den Häusern und dem Spektakel hin und her liefen. Ströme warmen, sprudelnden Blutes rannen von Haus zu Haus. Der Geruch von rohem Fleisch lag in der Luft, an eisernen Haken hängte man die Felle der Tiere an die Wohnungstüren. ›Ein guter Tag, um einen Mord zu begehen‹, hatte Mathilde gedacht. Auf den anderen Terrassen, im Hoheitsgebiet der Frauen, herrschte unermüdliches Treiben. Sie schnitten, leerten, häuteten, zerteilten. In die Küche zogen sie sich zurück, um die Eingeweide zu reinigen, die Därme vom Kotgeruch zu befreien, ehe sie sie stopften, zunähten und lange in einer scharfen Soße schmoren ließen. Man musste das Fett vom Fleisch trennen, den Kopf des Tieres kochen, denn selbst die Augen wurden gegessen, vom ältesten Sohn, der seinen Zeigefinger in den Schädel bohren und die glänzenden Augäpfel herausholen würde. Als sie Amine sagte, dass dies ein »barbarisches Fest« sei, »ein unmenschlicher Brauch«, dass das rohe Fleisch und das Blut sie zum Erbrechen ekelten, hob er die zitternden Hände gen Himmel, und wenn er sich beherrschte und sie nicht gegen seine Frau erhob, dann, weil dies ein heiliger Tag und er es Gott schuldig war, ruhig und mitfühlend zu sein.
*
Am Ende jeden Briefes bat Mathilde Irène, ihr Bücher zu schicken. Abenteuerromane, Erzählsammlungen, die in kalten, fernen Ländern spielten. Sie gestand ihr nicht, dass sie nicht mehr in die Bibliothek im Zentrum der Ville Nouvelle ging. Sie hasste dieses europäische Viertel mit seinen Klatschweibern, Siedlergattinnen und Militärs, sie hatte Mordgelüste in den Straßen, die sie mit so vielen schlechten Erinnerungen verband. An einem Tag im September 1947 war sie, im siebten Monat schwanger, die Avenue de la République entlanggegangen, die die meisten hier einfach »die Avenue« nannten. Es war heiß, und ihre Beine waren geschwollen. Sie überlegte, ins Cinéma Empire zu gehen oder auf der Terrasse des Roi de la Bière etwas Kühles zu trinken. Da hatten zwei Frauen sie angerempelt. Die dunklere der beiden hatte gelacht: »Sieh dir die an. Die hat ein Araber geschwängert.« Mathilde hatte sich umgedreht und den Ärmel der jungen Frau gepackt, die sich mit einem Ruck losgerissen hatte. Wäre ihr Bauch nicht gewesen, wäre die Hitze nicht so erdrückend gewesen, dann wäre Mathilde ihr gefolgt. Sie hätte ihr den Hals umgedreht. Sie hätte ihr all die Schläge zurückgegeben, die sie im Lauf ihres Lebens eingesteckt hatte. Als freches Mädchen, aufreizende Jugendliche, widerspenstige Ehefrau hatte sie Ohrfeigen, Zurechtweisungen, die Wut all jener abbekommen, die aus ihr eine anständige Frau machen wollten. Diese beiden Fremden hätten für sämtliche Versuche, sie zu zähmen, bezahlt, die Mathilde schon ihr ganzes Leben lang erduldete.
So seltsam es scheinen mochte, Mathilde dachte nie, dass Irène oder Georges ihr nicht glauben würden, und noch weniger, dass sie sie eines Tages besuchen könnten. Als sie im Frühjahr 1949 auf den Hof zog, fühlte sie sich frei, ihnen über das Leben, das sie dort führte, Lügen aufzutischen. Sie erwähnte nicht, dass ihr die Geschäftigkeit der Medina fehlte, dass sie sich nun nach dem engen Miteinander sehnte, das sie zuvor im Haus ihrer Schwiegermutter verflucht hatte. Oft schrieb sie: »Ich wünschte, Du hättest mich sehen können«, ohne sich bewusst zu sein, dass darin das Geständnis ihrer ungeheuren Einsamkeit lag. Sie war traurig über all die ersten Male, die niemanden außer ihr interessierten, diese Existenz ohne Zuschauer. Wozu lebte man denn, dachte sie, wenn nicht, um gesehen zu werden?
Sie schloss ihre Briefe mit »Ich liebe Euch« oder »Ihr fehlt mir«, aber sie behielt ihr Heimweh für sich. Sie widerstand der Versuchung, ihnen zu sagen, dass der Flug der Störche, die zu Beginn des Winters nach Meknès kamen, sie in tiefste Melancholie stürzte. Weder Amine noch die Leute auf dem Hof teilten ihre Tierliebe, und als sie ihrem Mann gegenüber einmal Minet erwähnte, die Katze, die sie als kleines Mädchen gehabt hatte, hob der angesichts solcher Kindereien die Augen zum Himmel. Sie nahm Katzen auf, die sie mit in Milch getunktem Brot zutraulich machte, und während die Berberfrauen sie ansahen und fanden, dass dieses Brot für die Katzen verschwendet sei, dachte sie: »Man muss doch wiedergutmachen, was ihnen an Liebe entgangen ist.«
Wozu sollte sie Irène die Wahrheit sagen? Wozu ihr erzählen, dass sie arbeitete wie eine Verrückte, wie eine Besessene, ihr zweijähriges Kind auf dem Rücken? Welche Poesie hätte sie den langen Nächten abgewinnen können, in denen sie ihren Daumen an der Nadel wund scheuerte, um für Aïcha Kleider zu nähen, die aussehen sollten wie neu? Im Kerzenschein, angewidert vom Gestank des billigen Wachses, machte sie Schnittmuster aus alten Zeitungen und nähte mit bemerkenswerter Hingabe kleine Wollhöschen. Während des glutheißen Augustes setzte sie sich im Unterrock direkt auf den Boden und nähte aus einem hübschen Baumwollstoff ein Kleid für ihre Tochter. Niemand sah, wie schön es war, niemand bemerkte das kleine Detail der Raffung, die Schleifchen auf den Taschen, das rote Futter, das dem Ganzen den letzten Pfiff gab. Die Gleichgültigkeit der Menschen gegenüber der Schönheit der Dinge brachte sie um.
Amine kam in ihren Berichten selten vor. Ihr Mann war eine Nebenfigur, die von einer geheimnisvollen Aura umgeben war. Sie wollte Irène den Eindruck vermitteln, ihre Liebe sei so leidenschaftlich, dass sie sie unmöglich teilen oder in Worte fassen konnte. Ihr Schweigen war voll schlüpfriger Anspielungen, sie gab ihre Auslassungen als Schamhaftigkeit, ja Taktgefühl aus. Denn Irène, die sich unmittelbar vor dem Krieg in einen skoliosegekrümmten Deutschen verliebt und ihn geheiratet hatte, war nach nur drei Monaten Witwe geworden. Als Amine in ihrem Dorf aufgetaucht war, hatte Irène mit neidischen Blicken zugesehen, wie ihre Schwester unter den Händen des Afrikaners erbebte. Die kleine Mathilde, deren Hals bald mit Knutschflecken übersät war.
Wie hätte sie zugeben können, dass der Mann, den sie im Krieg kennengelernt hatte, nicht mehr derselbe war? Unter der Last der Sorgen und Erniedrigungen hatte Amine sich verändert und verdüstert. Wie oft hatte sie, wenn sie untergehakt neben ihm ging, die Blicke der Passanten auf sich gespürt? Die Berührung seiner Haut erschien ihr dann brennend, unangenehm, und sie kam nicht umhin, mit einem gewissen Widerwillen zu erkennen, wie anders ihr Mann war. Sie dachte, dass es grenzenloser Liebe bedurfte, mehr Liebe, als sie zu empfinden imstande wäre, um die Verachtung der Leute zu erdulden. Es bedurfte einer beständigen, gewaltigen, unerschütterlichen Liebe, um die Scham zu ertragen, wenn die Franzosen ihn duzten, wenn die Polizisten seine Papiere verlangten, wenn sie sich entschuldigten, sobald sie seine Verdienste im Krieg oder sein perfektes Französisch bemerkten. »Bei Ihnen, lieber Freund, ist es etwas ganz anderes.« Und Amine lächelte. In der Öffentlichkeit gab er vor, kein Problem mit Frankreich zu haben, da er beinahe dafür gestorben wäre. Doch sobald sie alleine waren, verbarrikadierte er sich hinter seinem Schweigen und litt unter der Schmach, dass er feige gewesen war und sein Volk verriet. Er betrat das Haus, riss die Schränke auf und schleuderte alles zu Boden, was ihm in die Finger kam. Mathilde war ebenfalls jähzornig, und eines Tages, mitten in einem Streit, als er schrie: »Sei still! Ich schäme mich für dich!«, öffnete sie den Eisschrank und packte eine Schale reifer Pfirsiche, aus denen sie Marmelade kochen wollte. Sie warf Amine die matschigen Früchte ins Gesicht, ohne zu bemerken, dass Aïcha sie beobachtete und fassungslos mit ansah, wie ihrem Vater der Saft über Haar und Hals lief.
1 »Möge Gott dir Typhus schicken!«
2 Nazarener/-in, generelle Bezeichnung für Christen.
Amine sprach mit ihr nur über die Arbeit. Über den Getreidepreis, die Sorgen, die Wetteraussichten, die Landarbeiter. Wenn Verwandte sie auf dem Hof besuchen kamen, setzten sie sich in das kleine Wohnzimmer, erkundigten sich drei-, viermal nach ihrer Gesundheit und tranken dann schweigend Tee. Mathilde fand sie alle niederschmetternd gewöhnlich, ihre Geistlosigkeit schmerzte sie mehr als Heimweh und Einsamkeit. Sie hätte gern über ihre Gefühle geredet, ihre Hoffnungen, die Ängste, die sie umtrieben und die sinnlos waren, wie alle Ängste. ›Hat er denn gar kein Seelenleben?‹, fragte sie sich, während Amine aß, ohne ein Wort zu sagen, den Blick starr auf eine Kichererbsen-Tajine gerichtet, die das Hausmädchen zubereitet hatte und deren zu fettige Soße Mathilde ekelte. Amine interessierte sich ausschließlich für den Hof und seine Mühen. Nie gab es Lachen, Tanz, Zeit zum Nichtstun oder Reden. Hier wurde nicht geredet. Ihr Mann war streng wie ein Quäker. Er behandelte sie, als wäre sie ein kleines Mädchen, das man erziehen musste. Zusammen mit Aïcha lernte sie gute Manieren und nickte, wenn Amine erklärte: »Das tut man nicht«, oder: »Das können wir uns nicht leisten.« Bei ihrer Ankunft in Marokko war sie noch fast ein Kind gewesen. In wenigen Monaten hatte sie lernen müssen, mit der Einsamkeit und dem häuslichen Leben zurechtzukommen, die Grobheit eines Mannes und die Fremdheit eines Landes zu ertragen. Sie war vom Haus ihres Vaters in das ihres Mannes umgezogen, und trotzdem hatte sie nicht das Gefühl, dadurch an Unabhängigkeit oder Autorität gewonnen zu haben. Gerade mal über Tamo, das junge Hausmädchen, konnte sie ihre Macht ausüben. Aber Ito, deren Mutter, passte auf, und vor ihr wagte Mathilde nie, die Stimme zu erheben. Ebenso wenig gelang es ihr, ihrem Kind Geduld und eine vernünftige Erziehung angedeihen zu lassen. Sie schwankte zwischen überbordender Zärtlichkeit und hysterischen Wutausbrüchen. Manchmal sah sie ihre Kleine an, und ihre eigene Mutterschaft erschien ihr monströs, grausam, unmenschlich. Wie konnte ein Kind ein anderes Kind aufziehen? Man hatte ihren jungen Körper zerrissen, hatte ein unschuldiges Opfer aus ihm herausgezerrt, das sie nicht zu verteidigen wusste.
Als Amine sie geheiratet hatte, war Mathilde gerade zwanzig Jahre alt gewesen, und damals hatte ihn das nicht gestört. Ihre Jugend bezauberte ihn sogar, ihre großen, von allem begeisterten und überraschten Augen, ihre noch unsichere Stimme, ihre warme und weiche Zunge, wie die eines kleinen Mädchens. Er war achtundzwanzig, also nicht sehr viel älter, aber später musste er einsehen, dass der Unmut, den seine Frau manchmal in ihm weckte, nichts mit dem Alter zu tun hatte. Er war ein Mann, und er war im Krieg gewesen. Er kam aus einem Land, in dem Gott und Ehre ein und dasselbe waren, und obendrein hatte er keinen Vater mehr, was ihn zu einer gewissen Ernsthaftigkeit zwang. Was ihm charmant erschienen war, solange sie noch in Europa waren, begann ihm lästig zu werden und schließlich ihn zu reizen. Mathilde war kapriziös und leichtfertig. Amine nahm es ihr übel, dass sie nicht mehr aushielt, kein dickeres Fell hatte. Er hatte weder die Zeit, noch wusste er, wie er sie trösten sollte. Ihre Tränen! Wie viele Tränen hatte sie vergossen, seit sie in Marokko angekommen war! Sie weinte wegen der kleinsten Widrigkeit, andauernd brach sie in Schluchzen aus, und das regte ihn auf. »Hör auf zu heulen. Meine Mutter, die Kinder verloren hat und mit vierzig Jahren Witwe geworden ist, hat in ihrem ganzen Leben weniger geheult als du in der letzten Woche. Hör auf, hör auf!« ›So sind die europäischen Frauen‹, dachte er. ›Sie können der Realität nicht ins Gesicht sehen.‹
Sie weinte zu viel, sie lachte zu viel oder falsch. Als sie sich kennenlernten, hatten sie ganze Nachmittage lang am Rheinufer im Gras gelegen. Mathilde hatte ihm von ihren Träumen erzählt, und er hatte sie ermutigt, ohne über die Konsequenzen nachzudenken oder ihre Belanglosigkeit zu verurteilen. Er, der beim Lachen nie seine Zähne zeigte, immer eine Hand vor den Mund hielt, als wäre für ihn Freude die unzüchtigste und beschämendste aller Leidenschaften, fand sie amüsant. Dann, in Meknès, änderte sich alles, und die wenigen Male, die er mit ihr ins Cinéma Empire ging, verließ er die Vorstellung schlecht gelaunt, wütend auf seine Frau, die gekichert und ständig versucht hatte, ihn zu küssen.
Mathilde wollte ins Theater gehen, laut Musik hören, in dem kleinen Wohnzimmer tanzen. Sie träumte von hübschen Kleidern, Empfängen, Tanztees, Festen unter Palmen. Sie wollte samstags zum Ball im Café de France gehen, sonntags ins La Vallée Heureuse, und Freunde zum Tee bitten. Sie schwelgte in wehmütigen Erinnerungen an die Einladungen ihrer Eltern. Sie hatte Angst, dass die Zeit zu schnell verflog, dass Armut und Mühen ewig andauern würden und dass sie, wenn sie sich endlich ausruhen könnten, zu alt wäre für die Kleider und den Palmenschatten.
Eines Abends, als sie gerade auf die Farm gezogen waren, ging Amine im Sonntagsstaat durch die Küche, vorbei an Mathilde, die Aïcha zu essen gab. Verblüfft sah sie zu ihrem Mann auf, unschlüssig, ob sie sich freuen oder sich ärgern sollte. »Ich gehe aus«, sagte er. »Alte Freunde von der Garnison sind in der Stadt.« Er beugte sich über Aïcha, um sie auf die Stirn zu küssen, als Mathilde plötzlich aufstand. Sie rief Tamo, die gerade den Hof fegte, und drückte ihr das Kind in den Arm. Mit fester Stimme fragte sie: »Muss ich mich zurechtmachen, oder ist das nicht nötig?«
Amine war sprachlos. Er stammelte, das sei ein Abend unter Freunden, das schicke sich nicht für eine Frau. »Wenn es sich für mich nicht schickt, wie kann es sich dann für dich schicken?« Und ohne zu begreifen, wie ihm geschah, hatte Amine Mathilde im Schlepptau, die ihre Schürze über einen Küchenstuhl gelegt hatte und sich in die Wangen kniff, damit sie rosig wurden.
Im Auto sagte Amine kein Wort und starrte nur mit mürrischem Gesicht auf die Straße, erbost über Mathilde und seine eigene Schwäche. Sie redete, lächelte, tat, als merke sie nicht, dass sie störte. Überzeugt davon, dass er sich schon entspannen würde, wenn sie sich nicht verdrießen ließ, gab sie sich liebenswürdig, verschmitzt, unbekümmert. Sie erreichten die Stadt, ohne dass er einmal den Mund aufgemacht hatte. Amine parkte, sprang aus dem Wagen und lief eilig zu dem Café. Man hätte meinen können, er hoffe, sie in den Straßen der Ville Nouvelle abzuhängen, oder wolle sich zumindest die Schmach ersparen, am Arm seiner Frau dort anzukommen.
Sie holte ihn so rasch ein, dass ihm keine Zeit blieb, den Tischgenossen, die ihn erwarteten, eine Erklärung zu liefern. Die Männer erhoben sich und grüßten Mathilde schüchtern und respektvoll. Ihr Schwager Omar wies auf einen Stuhl neben sich. Alle Männer waren elegant gekleidet, sie trugen Westen und hatten Pomade in den Haaren. Man bestellte zu trinken bei dem leutseligen Griechen, der dieses Lokal seit beinahe zwanzig Jahren führte. Eines der wenigen Cafés der Stadt, in denen es keine Segregation gab, in denen Araber am Tisch der Europäer Alkohol tranken, in denen Frauen, die keine Prostituierten waren, die Abende aufheiterten. Die an einer Straßenecke gelegene Terrasse war durch große, dichte Pomeranzenbüsche vor Blicken geschützt. Man fühlte sich dort allein auf der Welt und in Sicherheit. Amine und seine Freunde prosteten sich zu, doch sie redeten wenig. Ausgiebiges Schweigen wurde unterbrochen von sehr leisem Lachen oder einer Anekdote, die jemand erzählte. Es war nie anders, aber das wusste Mathilde nicht. Sie konnte nicht glauben, dass Amines Männerabende so aussahen, diese Abende, auf die sie so eifersüchtig gewesen war und die ihre Gedanken derart beschäftigt hatten. Sie dachte, es wäre ihre Schuld, dass die Stimmung nun verhagelt war. Sie wollte etwas erzählen. Vom Bier ermutigt, gab sie mit schüchterner Stimme eine Erinnerung ans Elsass ihrer Kindheit zum Besten. Sie zitterte ein wenig, sie hatte Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden, und am Ende lachte niemand über ihre belanglose Geschichte. Amine sah sie mit einer Verachtung an, die ihr das Herz brach. Noch nie hatte sie sich so unerwünscht gefühlt.