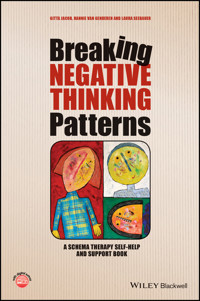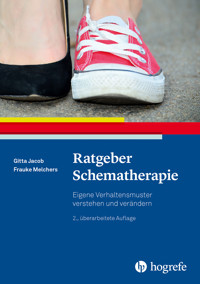16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Schematherapie ist eine wichtige Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) für Patientinnen und Patienten mit Persönlichkeitsstörungen und anderen chronischen psychischen Problemen. In Studien hat sich insbesondere die Arbeit mit dem Schemamodus-Ansatz als hoch wirksam erwiesen. In der aktualisierten Auflage des Bandes, die insbesondere auch aktuelle Befunde zur Evidenz referiert, wird die Behandlung mit dem Modusmodell praxisnah dargestellt. Zahlreiche Fallbeispiele illustrieren das therapeutische Vorgehen. Nach einer Einführung in die Kernkonzepte der Schematherapie wird auf die Diagnostik und Fallkonzeptualisierung eingegangen. Im Anschluss wird das therapeutische Vorgehen für jeden Modustyp erläutert. Wichtige Schwerpunkte bilden dabei die therapeutische Beziehung, die als begrenztes Nachbeeltern konzipiert ist, sowie emotionsfokussierende Techniken, wie z.B. Stuhldialoge und imaginative Techniken. In diesen beiden Punkten unterscheidet sich die Schematherapie besonders von der klassischen KVT. Typische Fallstricke und Probleme in einer Schematherapie sowie mögliche Variationen des Vorgehens werden ebenfalls beschrieben. Insgesamt bietet der Band eine kompakte Darstellung der Arbeit mit dem Schemamodus-Ansatz bei Persönlichkeitsstörungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gitta Jacob
Arnoud Arntz
Schematherapie
2., aktualisierte Auflage
Fortschritte der Psychotherapie
Band 53
Schematherapie
PD Dr. Gitta Jacob, Prof. Dr. Arnoud Arntz
Die Reihe wird herausgegeben von:
Prof. Dr. Martin Hautzinger, Prof. Dr. Tania Lincoln, Prof. Dr. Jürgen Margraf, Prof. Dr. Winfried Rief, Prof. Dr. Brunna Tuschen-Caffier
Die Reihe wurde begründet von:
Dietmar Schulte, Klaus Grawe, Kurt Hahlweg, Dieter Vaitl
PD Dr. Gitta Jacob, geb. 1973. 1994 – 1999 Studium der Psychologie in Würzburg und Freiburg. 2001 Promotion. 2002 – 2010 klinische und wissenschaftliche Tätigkeit an der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. 2003 Approbation zur Psychologischen Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie). 2010 – 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Freiburg. 2012 Habilitation. Seit 2013 leitende Psychotherapeutin bei der GAIA AG Hamburg. Supervisorin für Verhaltenstherapie, zertifizierte Schematherapeutin.
Prof. Dr. Arnoud Arntz, geb. 1956. 1975 – 1985 Studium der Physik, Mathematik und Psychologie in Groningen (NL). 1991 Promotion. Approbation als Psychotherapeut. 1999 – 2014 Professor für Clinical Psychology and Experimental Psychopathology sowie von 2001 – 2014 Scientific Director des Research Center of Experimental Psychopathology an der Universität Maastricht (NL). Seit 2014 Professor für Clinical Psychology an der Universität Amsterdam (NL).
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: Sina-Franziska Mollenhauer, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
2., aktualisierte Auflage 2022
© 2022 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3125-3; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3125-4)
ISBN 978-3-8017-3125-0
https://doi.org/10.1026/03125-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort und Danksagung
1 Einführung in die Schematherapie
2 Theorie und Störungsmodell
2.1 Kernkonzepte
2.1.1 Maladaptive Schemata
2.1.2 Schemamodi
3 Diagnostik und Indikation
3.1 Diagnostik
3.2 Fallkonzeptualisierung
3.2.1 Zentrale Probleme und Symptome
3.2.2 Auffällige interpersonelle Muster
3.2.3 Biografische Informationen
3.3 Störungsspezifische Moduskonzepte
3.3.1 Borderline-Persönlichkeitsstörung
3.3.2 Narzisstische Persönlichkeitsstörung
3.3.3 Histrionische Persönlichkeitsstörung
3.3.4 Selbstunsichere Persönlichkeitsstörung
3.3.5 Dependente Persönlichkeitsstörung
3.3.6 Zwanghafte Persönlichkeitsstörung
3.3.7 Paranoide Persönlichkeitsstörung
3.3.8 Forensische Patienten
4 Behandlung
4.1 Überblick
4.1.1 Kognitive Techniken
4.1.2 Behaviorale Techniken
4.1.3 Emotionsfokussierte Techniken
4.1.4 Therapiebeziehung
4.2 Erstellen des Fallkonzeptes und Psychoedukation
4.3 Umgang mit Bewältigungsmodi
4.4 Umgang mit vulnerablen Kindmodi
4.4.1 Beziehungsgestaltung mit begrenzter Nachbeelterung
4.4.2 Imaginatives Überschreiben
4.4.3 Kognitive und behaviorale Techniken
4.5 Umgang mit ärgerlichen oder undisziplinierten Kindmodi
4.6 Umgang mit dysfunktionalen Elternmodi
4.7 Stärkung des gesunden Erwachsenenmodus
4.8 Ablauf der Therapie
4.9 Varianten
4.9.1 Schematherapie bei Zwangsstörungen
4.9.2 Schematherapie in der Selbsterfahrung
4.10 Typische Probleme
4.10.1 Probleme auf Seiten der Patienten
4.10.2 Probleme auf Seiten der Therapeuten
5 Empirische Befunde
5.1 Konstruktvalidierung
5.2 Wirksamkeit
6 Weiterführende Literatur
7 Literatur
8 Kompetenzziele und Lernkontrollfragen
9 Anhang
Arbeitsblatt: Schema-Memo
Patienteninformation
Schemamodus Inventar (SMI-1)
Skalenzuordnung SMI
Karten
Schematherapie: Überblick über die Behandlung
Überblick: Imaginatives Überschreiben
Hinweise zu den Karten
|1|Vorwort und Danksagung
Die Schematherapie ist eine Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) für Patienten mit Persönlichkeitsstörungen oder anderen chronischen psychischen Problemen. Unter den zahlreichen aktuellen integrativen psychotherapeutischen Methoden hat sie einen relativ hohen Stellenwert, da in den vergangenen Jahren in mehreren Studien eine sehr gute Wirksamkeit bei verschiedenen Persönlichkeitsstörungen gezeigt werden konnte. Uns ist gerade diese empirische Fundierung und empiriegeleitete Weiterentwicklung der Schematherapie ein großes Anliegen.
In diesem Buch wird das schematherapeutische Vorgehen so dargestellt, wie es in den bisherigen Wirksamkeitsstudien, die in Kapitel 5.2 dargestellt sind, eingesetzt wurde. Zentrale Konzepte sind dabei die konsequente Arbeit mit Schemamodi, die Realisierung einer unterstützenden Therapiebeziehung mit Nachbeelterung sowie der Einsatz emotionsfokussierender Techniken. Gerade der letzte Punkt sollte nicht unterschätzt werden, daher liegt hier ein großer Schwerpunkt im vorliegenden Band.
Die Arbeiten zu diesem Buch wurden gefördert durch den Europäischen Sozialfonds sowie durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg mit einem Stipendium an Gitta Jacob und unterstützt durch eine Förderung des Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) an Arnoud Arntz. Wir danken Jeffrey Young, dem Entwickler der Schematherapie, für alles, was wir von ihm lernen durften, sowie weiteren wichtigen Schematherapeuten, die uns sehr beeinflusst und zu den beschriebenen Konzepten beigetragen haben, insbesondere Joan Farrell, Ida Shaw, Hannie van Genderen und David Bernstein. Wir danken unseren Kolleginnen und Kollegen, die mit uns in der Anwendung und Weiterentwicklung der Schematherapie zusammenarbeiten und – last but not least – unseren Patientinnen und Patienten, die zur Entwicklung der in diesem Buch beschriebenen Techniken und Vorgehensweisen entscheidend beigetragen haben und deren Rückmeldungen für uns sehr wertvoll waren und sind.
Freiburg und Amsterdam,
Gitta Jacob und
April 2022
Arnoud Arntz
|2|1 Einführung in die Schematherapie
Die Schematherapie ist eine Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) für Patienten mit Persönlichkeitsstörungen oder anderen chronischen psychischen Problemen, die zunächst von Jeffrey Young (New York) beschrieben und von der Arbeitsgruppe von Arnoud Arntz (Maastricht und Amsterdam) insbesondere zum Einsatz in störungsspezifischen Therapiestudien weiterentwickelt und empirisch untersucht wurde. Sie trifft insbesondere unter Verhaltenstherapeuten in den vergangenen Jahren auf hohes Interesse, da sie ein strukturiertes und zielorientiertes KVT-Vorgehen mit Konzepten anderer Therapieschulen verknüpft. Aus der Tiefenpsychologie wird ein Fokus auf problematische Muster anstelle auf spezifische Symptome übernommen, und großer Wert darauf gelegt, die biografische Entstehung dieser Muster zu thematisieren und in die Behandlung einzubeziehen. Die Fallkonzeptualisierung mit den sogenannten Schemamodi weist enge Bezüge zur Transaktionsanalyse und ähnlichen „Teile-Ansätzen“ wie die Ego-State-Therapy oder die Arbeit mit dem „inneren Team“ (Übersicht in Hesse, 2009) auf. Viele der eingesetzten emotionsfokussierenden Methoden sowie das handlungsleitende Konzept der Bedürfnisorientierung haben eine lange Tradition in den erfahrungsorientierten und humanistischen Therapien wie der Gestalttherapie oder der Gesprächspsychotherapie.
Elemente der Schematherapie
KVT: Zielorientierung, Transparenz, gemeinsam erarbeitetes Fallkonzept, KVT-Techniken
Tiefenpsychologie: Analyse übergreifender Muster, Betonung der Biografie und der Bedeutung früher Beziehungen mit Elternfiguren für die Entwicklung von Schemata und Bewältigungsmustern
Humanistische und erfahrungsorientierte Verfahren: Bedürfnisorientierung, Einsatz emotionsfokussierender Methoden wie Stuhldialoge oder imaginative Verfahren
Transaktionsanalyse, „Teile-Ansätze“: Fallkonzept mit Schemamodi, „Innere-Kind“-Arbeit
Bindungstheorie: Betonung der zentralen Bedeutung gesunden Bindungserlebens und der langfristigen Folgen unsicherer Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit
|3|In einer schematherapeutischen Behandlung werden die Symptomatik und die problematischen interpersonellen Muster des Patienten sowie deren biografischer Hintergrund zunächst in einem sogenannten Moduskonzept zusammengefasst. Dabei wird davon ausgegangen, dass intensive negative Gefühle (dysfunktionale Kindmodi) und Selbstabwertung oder übertriebener Perfektionismus (dysfunktionale Elternmodi) im Kern der Problematik stehen, die vom Patienten bewältigt werden mit Vermeidung, Überkompensation oder die Unterwerfung unter die Vorstellungen anderer (dysfunktionale Bewältigungsmodi). In der Therapie wird jedes Problem oder Symptom zunächst anhand der emotionalen Qualität und Funktionalität dem jeweils passenden Schemamodus zugeordnet. In der Behandlung werden dann jeweils kognitive, behaviorale und emotionsfokussierte Techniken eingesetzt, um Bewältigungsmodi zu reduzieren, dysfunktionale Elternmodi zu schwächen und dysfunktionale Kindmodi zu „heilen“.
Ein Schwerpunkt liegt auf der „Inneren-Kind“-Arbeit mit imaginativen Verfahren, insbesondere imaginativem Überschreiben. Eine zentrale Rolle spielt zudem die Beziehungsgestaltung mit „limited reparenting“, also „begrenztem Nachbeeltern“, die es der Patientin ermöglichen soll, innerhalb der Therapiebeziehung problematisches Bindungserleben gewissermaßen zu „überlernen“.
2 Theorie und Störungsmodell
2.1 Kernkonzepte
Die zentralen Konzepte dieser Interventionsmethode sind die maladaptiven Schemata sowie die daraus abgeleiteten Schemamodi. Da sich in der Arbeit mit persönlichkeitsgestörten Patienten und insbesondere in den Wirksamkeitsstudien der Ansatz der Schemamodi weitgehend durchgesetzt hat, liegt der Schwerpunkt hier darauf, während die ursprünglichen Schemata nur kurz dargestellt werden.
2.1.1 Maladaptive Schemata
Ein Schema ist grundsätzlich eine organisierte Wissensstruktur, die sich in bestimmten Verhaltensweisen, Gefühlen und Gedanken offenbart (Jacob & Arntz, 2011). Es kann nicht direkt gemessen, jedoch durch Analyse der Le|4|bensgeschichte der Patientin sowie durch eine Beobachtung der Strategien, welche sie im Umgang mit ihren Talenten und ihrem Temperament verwendet, erfasst werden. Gesunde Schemata entstehen, wenn die Grundbedürfnisse von Kindern erfüllt werden. Dies erlaubt Kindern, ein positives Bild über andere Personen, sich selbst und die Welt als Ganzes zu entwickeln.
Maladaptive Schemata sind in der Schematherapie entsprechend breit definiert als alles beeinflussende Lebensthemen, die sowohl Emotionen, Einstellungen, Gedanken, Erinnerungen und Wahrnehmungen als auch Verhaltensweisen und interpersonelle Beziehungsmuster beinhalten. Es wird davon ausgegangen, dass maladaptive Schemata in der Kindheit und Jugend – in Wechselwirkung mit dem Temperament des Kindes – entstehen, wenn grundsätzliche Bedürfnisse des Kindes nicht erfüllt wurden. Young, Klosko und Weishaar (2008) definieren eine Liste von Bedürfnissen, deren Erfüllung als zentral angesehen wird. Bezüge zum Psychotherapiemodell von Grawe (2004) sind hier zwar naheliegend, wurden von Young et al. (2008), die ihre Überlegungen zu Bedürfnissen vor allem auf klinische Erfahrungen stützen, jedoch nicht hergestellt.
Kindliche Bedürfnisse, bei deren Nichterfüllung dysfunktionale Schemata entstehen
Sicherheit und Bindung
Selbstachtung und Wertschätzung durch andere
Autonomie
Freiheit, eigene Bedürfnisse und Gefühle zu erleben und mitzuteilen
Spontaneität und Spiel
Realistische Grenzen und Selbstkontrolle
Young et al. (2008) definierten auf der Grundlage klinischer Beobachtungen 18 verschiedene Schemata, die sie in fünf inhaltlich ähnliche „Domänen“ untergliederten (vgl. Tabelle 1).
Wenn ein maladaptives Schema ausgelöst wird, entstehen in der Regel starke negative Emotionen, die für die Betroffenen sehr problematisch sind, beispielsweise Bedrohung und Hilflosigkeit beim Schema Missbrauch, oder Einsamkeit beim Schema Verlassenheit. Young et al. (2008) beschreiben drei grundlegende Bewältigungsmechanismen, die auftreten können, wenn ein Schema aktiviert wird.
|5|Tabelle 1: Schemata und Schemadomänen nach Young et al. (2008)
Schemadomänen
Bedürfnisse
Schemata
Abgetrenntheit und Ablehnung
Sichere Bindung, Akzeptanz, Versorgung
Verlassenheit/Instabilität
Misstrauen/Missbrauch
Emotionale Entbehrung
Unzulänglichkeit/Scham
Soziale Isolierung/Entfremdung
Beeinträchtigung von Autonomie und Leistung
Autonomie, Kompetenz, Identitätsgefühl
Abhängigkeit/Inkompetenz
Anfälligkeit für Schädigungen und Krankheiten
Verstrickung/Unentwickeltes Selbst
Unzulänglichkeit/Versagen
Beeinträchtigung im Umgang mit Begrenzungen
Realistische Grenzen und Selbstkontrolle
Anspruchshaltung/Grandiosität
Unzureichende Selbstkontrolle/Selbstdisziplin
Fremdbezogenheit
Freiheit im Ausdruck von Bedürfnissen und Emotionen
Unterwerfung
Selbstaufopferung
Streben nach Zustimmung und Anerkennung
Übertriebene Wachsamkeit und Gehemmtheit
Spontaneität und Spiel
Negativität/Pessimismus
Emotionale Gehemmtheit
Überhöhte Standards/Übertrieben kritische Haltung
Strafneigung
Bewältigungsmechanismen
Schemavermeidung: Die Person vermeidet Gefühle, die mit dem Schema im Zusammenhang stehen, z. B. durch soziale Vermeidung, Dissoziation oder Gebrauch von Diazepinen oder anderen beruhigenden Substanzen. Beispiel: Eine Person mit dem Schema Missbrauch fühlt sich leicht bedroht, wenn sie mit unbekannten Menschen in Kontakt treten muss. Sie besucht deshalb z. B. keine Partys; wenn sie es nicht vermeiden kann, trinkt sie in solchen Situationen Alkohol, um sich zu beruhigen.
Unterwerfung: Die Person unterwirft sich anderen Menschen in einer Weise, als gäbe es ohnehin keine Alternative zu diesem Schema. Beispiel: Eine Frau mit dem Schema Missbrauch geht immer wieder Beziehungen zu aggressiven Männern ein, von denen sie sich missbrauchen lässt. Sie hat das Gefühl, dass es für sie im Leben keine Alternativen gibt.
Überkompensation: Die Person verhält sich, als sei das Gegenteil des Schemas zutreffend. Sie tritt beispielsweise aggressiv, übermäßig selbstbewusst oder sehr kontrollierend auf, wenn sie sich eigentlich hilflos oder bedroht fühlt. Beispiel: Eine Person mit einem Missbrauchsschema neigt dazu, anderen Menschen sehr aggressiv zu begegnen, weil sie sich |6|von diesen unangemessen bedroht fühlt und mit aggressivem Auftreten einem Angriff vermeintlich vorbeugen kann.