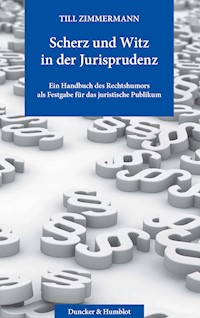
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Juristerei ist keine Witzveranstaltung (hM). Doch nicht alle Juratexte sind spaßbefreit. Im Ernst: Wer hier etwas zum Lachen sucht, der findet. Diese spaßrechtliche Untersuchung fördert Erstaunliches zum Thema Rechtshumor zu Tage. Das Genre der juristischen Situationskomik dreht sich um Gerichtsentscheidungen zu irrwitzigen Geschichten, die das Leben besser nie geschrieben hätte – mitunter hilft nur noch der Verweis an das Jüngste Gericht. Auch das Kapitel über Jura-Comedy enthüllt Unglaubliches: Während sich der Gesetzgeber nur kleine Scherze erlaubt, sind rechtswissenschaftliche Fachbeiträge oft gehaltvolle Satire zwischen Scherz und Ernst. Den Gipfel der Frechheit erklimmt die Rechtsprechung: Urteile in Form von Märchen, Rätseln, Gedichten, Kochrezepten, Krimis, Sportreportagen, Wutanfällen und Nonsens provozieren die Rechts- und Geschmacksfrage, wo der Spaß eigentlich aufhört. Dieses Buch bietet rechtswissenschaftlich fundierte Unterhaltung auf bisher ungekanntem Niveau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
[1]
TILL ZIMMERMANN
Scherz und Witz in der Jurisprudenz
[3]
Scherz und Witz in der Jurisprudenz
Ein Handbuch des Rechtshumorsals Festgabe für das juristische Publikum
Von
Till Zimmermann
Duncker & Humblot • Berlin
[4]
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation inder Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abruf bar.
Umschlag: © rcx – stock.adobe.com
Alle Rechte vorbehalten
© 2022 Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Fremddatenübernahme: L101 Mediengestaltung, Fürstenwalde
Druck: Druckteam Berlin
Printed in Germany
ISBN 978-3-428-18795-9 (Print)ISBN 978-3-428-58795-7 (E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papierentsprechend ISO 9706
Internet: http://www.duncker-humblot.de
[5]
„Humor diskreditiert“(K. Tucholsky)
„Selten so gelacht“(F. G. Nagelmann)
[7]
Vorwort
Wozu dieses Buch?
Fachleute wissen: „Jura ist leicht“.1 Gute Examensnoten sind trotzdem selten. Woran das liegt? Zum einen an den Prüfern, zum anderen an mangelnden Softskills. Beides belegt anschaulich der Sachverhalt in der Entscheidung BVerwGE 78, 55:
„Prüfer Dr. R. [hat] zu Beginn der mündlichen Prüfung im öffentlichen Recht [den] Kandidaten gefragt, wo der Staat Mali liegt, wie seine Hauptstadt heißt, welche legendäre Stadt am Hauptfluß des Landes liegt und wer in dem Land regiert.“
Die Antwort war Schweigen (also falsch), der Kandidat fiel durch. Man mag jetzt streiten, wem es im Mali-Fragen-Fall an welchen Softskills gefehlt hat. Sicher ist: Das „Elend der Juristenausbildung“2 und der „doch häufig ziemlich graue juristische Alltag“ lassen sich mit Humor und „einem Gefühl für Komik im Recht“ zumindest leichter ertragen.3
Manche meinen allerdings, in der Jurisprudenz gebe es von Natur aus nichts zu lachen. Der Bundesfinanzhof glaubt, es sei ausgeschlossen, dass der Rechtsanwaltsberuf auch Spaß machen könnte.4 Das ist falsch! Man muss den juristischen Witz nur finden, seine Technik studieren, wissen, wo er zu suchen ist. Leider zählt auch dies zu den in der Juristenausbildung vernachlässigten Softskills.
[8]
Wer soll dieses Buch lesen?
Dieses Handbuch ist für einen ganz speziellen Adressat:innenkreis5 konzipiert. Es richtet sich in erster Linie an Studierende und eignet sich für Anfangssemester genauso wie für Examenskandidatinnen; ebenso will es Referendaren eine Wiederholung des Stoffes ermöglichen. Gleichzeitig dient es der Vertiefung und soll zur wissenschaftlichen Diskussion beitragen, ferner einen raschen Überblick über die Materie erlauben. Darüber hinaus verfolgt es das Ziel, allen wissenschaftlich-praktisch mit dem Recht Befassten – insbesondere RichterInnen, Rechtsanwälten und Beamt_innen – ein Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, das trotz der Komplexität des Stoffes Präzision und Übersichtlichkeit bietet. Angesprochen sind selbstverständlich auch die Mitarbeiter*innen von Compliance-Abteilungen. Ebenfalls berücksichtigt sind die Bedürfnisse aller an der Materie interessierter Laien.
Dank?
Dieses Buch steht am Ende einer atypischen Kausalkette. Der Autor ist daher niemandem für „wertvolle Vorarbeiten“ zu Dank verpflichtet, sehr wohl aber vielen humorvollen natürlichen und juristischen Personen für Anregungen, Hinweise und das Überlassen interessanten Materials. Dank gebührt insbesondere Jens Bruns, Heinrich Stader und Klaus Wasserburg, ferner verschiedenen Staatsanwaltschaften und Gerichten sowie Andrew McClurg, dessen Website lawhaha.com ich einige der in diesem Buch verwendeten Beispiele aus dem anglo-amerikanischen Rechtskreis verdanke.
Bonn, am Ende der Corona-Pandemie
Till Zimmermann
1Seifert, „Jura ist leicht“ – Interview mit Thomas Fischer, Zeit-Campus v. 29.10.2014; jedenfalls ist die Jägerprüfung weitaus schwieriger als das juristische Staatsexamen (so Dürig, zit. nach Pöggeler, Humor im Recht, JA 1997, 977, 981).
2Großfeld, Das Elend des Jurastudiums, JZ 1986, 357; s. a. Breidenbach, Eine neue Juristenausbildung, NJW 2020, 2862.
3Weber, Unfreiwillige Komik im Recht, Jura 2004, 672, 675.
4 BFH, DStR 1998, 1299, 1300 f.: „Eine Rechtsanwaltstätigkeit aus Gründen der Liebhaberei kann nicht angenommen werden.“
5 Erklärung zur geschlechter(un)gerechten Sprache: Dieses Buch folgt keinem System.
[9]
Inhalt
Einleitung: Wo ist hier der Witz?
I.Grundproblem
II.Ironie-Problem
III.Rechthaberei
IV.Sprachbarriere
V.Ansatz zur Problem-Lösung
1. Kapitel
Juristische Situationskomik
I.Einleitung
1.Urkundenfälschung
2.Dienstunfall
3.Kampfsport
4.Pornoberichterstattung
5.Scherzerklärung
6.Beleidigung
II.Kläger …
III.… und Richter
IV.Billigkeit
V.Wunsch- und Anspruchsdenken: Abseitige Begehren
1.Verwaltungsrecht
2.Arbeitsrecht
3.Reiserecht
4.Spaghettimonster-Recht
5.Wirres Zeug
6.Reichsbürger-Klagen
7.Namensrecht: Nomen est omen
[10]
VI.Klingt komisch, war aber so
1.Klo-Unfälle
2.Tanz-Unfälle
3.Tier-Unfälle
4.Stella Awards
a)Amerikanischer Kaffee
b)Deutsche Suppe
c)Bier
d)Zucker
e)Erfolgsrezepte
5.Körperliche Reize
6.Unglaubliches
a)Fensterkletter-Sex
b)Katzenkönig
VII.Prozesssituationskomik
1.Ungebühr
2.Witz aus dem Nichts
a)Wurm
b)Lutscher
2. Kapitel
Jura-Comedy
I.In der Wissenschaft
1.In der Lehre
2.In der Forschung
a)Beispiel und Problem
b)Scherz und Ernst
c)Phantomscherz
d)Restliches
II.Witzige Gesetzgebung?
1.Beispiele feinster Ironie
2.Beispiele feinster Dichtkunst
III.Humor bei Gericht
1.Zulässigkeit
2.Empirischer Befund
3.Schriftliches Vorverfahren
[11]
4.Terminierung
5.In der Verhandlung
6.Im Urteil
a)Stilfragen
aa)Einsatzmöglichkeit
bb)Epik
(1)Krimi
(2)Märchen
(3)Parabel
cc)Lyrik
(1)Gerichtswürde
(2)Menschenwürde
(3)Akzeptanz gereimter Entscheidungen im Strafrecht
(4)Beispiel aus dem Zivilrecht
(5)Reim und Ernstlichkeit
(6)Falsch gereimt
(7)Die richtige Gedichtssprache
(8)Exkurs: Richterliche Dichtkunst im Rechtsvergleich
b)Tenorierungshumor
c)Humoristische Feststellungen (sog. Lachverhalt)
aa)Köln
bb)Bayern
cc)Kurpfalz
d)Gründe zum Lachen
aa)Stufe eins: Feinster Humor
bb)Stufe zwei: Gröberer Humor
cc)Stufe drei: Durchgeknallter Slapstick
(1)Rheinische Straßenverkehrs-Rechtsprechung
(a)Sesterpääd
(b)Spaßverbot?
(aa)Als Rechtsfrage
(bb)Als Geschmacksfrage
(c)Sportreportage
(2)Rheiner Straßenverkehrs-Rechtsprechung
(a)Vorspiel
(b)Erster Akt
[12]
(c)Zweiter Akt
(d)Schlussakt
(3)Fake-Humor
e)Abrechnung
7.Rechtsmittel für Spaßverderber?
[13]
Einleitung: Wo ist hier der Witz?
I. Grundproblem
Humor im Recht ist ein ernstes Problem. Die Juristerei ist keine Witzveranstaltung, sondern die Antwort auf die Frage, wem durch Polizei, Gerichtsvollzieher, Gefängniswärter oder gar, zumindest in anderen Ländern, durch den Henker Gewalt angetan werden darf.1 Ganz treffend heißt es in Staders wegweisender „Kleiner Einführung in den Juristenhumor“: „Zum Lachen ist hier nichts.“2 Denn:
„Sache der Justiz ist die technische Abwicklung der Sozialkatastrophen. Ihr Gegenstand ist damit […] also: das Scheitern von Mittelmaß. Das Schicksal von Gestrauchelten, die geboren sind im Aszendenten des Kleinwagens, gebeutelt von Verhältnissen, verfangen in Abzahlungskäufen. Die schiefe Bahn. Das Ende der Fahnenstange. Das Dasein in Fettnäpfen.“
Exemplarisch für das in die Sozialkatastrophe abgeglitschte Mittelmaß steht eine zivilrechtliche Entscheidung aus dem Jahr 1993. Der im Urteil mit wenigen Worten geschilderte Sachverhalt deutet die ganze Dimension des zugrundeliegenden Dramas an. Es handelt von einem Ehepaar, das häufig miteinander streitet und vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf
„unter anderem darüber, ob die Skatgewinne des Beklagten zu seinem unterhaltsrechtlich relevanten Einkommen gehören sowie ob die Klägerin ihren Unterhaltsanspruch wegen dreier Revolverschüsse, die sie am 11.5.1991 auf den Beklagten abgegeben hat, verwirkt hat. Das Familiengericht hat in beiden Fragen zugunsten der Klägerin [14] entschieden. Die Berufung des Beklagten hatte insoweit keinen Erfolg.“3
Im Klartext: Der Mann muss seinen Spielgewinn mit der (jetzt getrenntlebenden) Ehefrau teilen, obwohl diese ihn zuvor mit einer Pistole zu erschießen versucht hat. Die Sache ist tragisch und traurig. Witziges findet sich hier allenfalls in den Umständen des konkreten Einzelfalles4 oder in an den Haaren herbeigezogenen Funfacts5.
Noch katastrophaler geht es oft im Strafrecht zu. Ein BGH-Urteil beginnt so:
„Der zur Tatzeit 46 Jahre alte Angeklagte ist ausgebildeter Fleischer und war einige Jahre als Schlachter tätig. Am späten Abend des 1. Februar 2013 besuchte er beträchtlich alkoholisiert die ein Stockwerk über ihm wohnende 66 Jahre alte L. Sie tranken im Wohnzimmer Alkohol und rauchten. Im weiteren Verlauf geriet der Angeklagte aus ungeklärten Gründen in hochgradige Wut. …“6
Der in gruseligen Details geschilderte Fortgang der Geschichte ist in der amtlichen Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofs unter der Überschrift „Niedrige Beweggründe bei außergewöhnlich brutalem, eklatant menschenverachtendem Tatbild“ nachzulesen und taugt allenfalls noch als Drehbuch-Grundlage [15] für einen Splatter-Porno zum Weggucken. Gerichtsverhandlungen über derlei ernste Dinge lassen naturgemäß wenig Raum für Lacher.
II. Ironie-Problem
Erschwerend kommt ein in der Rechtswissenschaft verbreiteter Hang zur betonten Ernsthaftigkeit hinzu. Potenzielle Wortspiele müssen in Fußnoten vorsichtshalber als unbeabsichtigt gekennzeichnet werden.7 Und wer ohne Vorwarnung Ironie benutzt,8 fällt – siehe folgendes Beispiel – böse auf die Nase: Nachdem Amtsrichter Funck in der Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) ohne ausdrücklichen Ironiehinweis unkonventionelle Vorschläge für die Strafvollzugspraxis unterbreitet hatte – mit Bitterstoffen versetztes Essen für Schwerverbrecher, brühheißes Duschwasser für Brandstifter, Liebesromane als Lektüre für Terroristen –,9 nahm das selbst die FAZ für bare Münze; die ZRP-Herausgeber sahen sich zur Klarstellung veranlasst.10
Bekannter noch als Funcks ZRP-Flop und ein beredtes Beispiel für juristische Ironieblindheit ist eine Episode aus dem Kaiserreich. Der liberale Kriminalwissenschaftler Franz von Liszt kritisierte in seinem Vortrag über die „Stellung der Verteidigung in Strafsachen“ die (damals neue) Institution der Staatsanwaltschaft:
„[D]ie Parteistellung der Staatsanwaltschaft ist […] durch unsere Prozeßordnung besonders verdunkelt worden. Durch […] die dem Staatsanwalt auferlegte Verpflichtung, in gleicher Weise Entlastungswie [16] Belastungsmomente zu prüfen […] könnte ein bloßer Civiljurist zu der Annahme verleitet werden, als wäre die Staatsanwaltschaft nicht Partei, sondern die objektivste Behörde der Welt. Ein Blick in das Gesetz reicht aber aus, um diese Entgleisung als solche zu erkennen. Es genügt der Hinweis auf § 147 GVG: ‚Die Beamten der Staatsanwaltschaft sind verpflichtet, den dienstlichen Anweisungen ihrer Vorgesetzten nachzukommen.‘ Auf Anweisung hin hat der StA. auf Verurteilung zu plädieren, auch wenn er von der Unschuld des Angeklagten überzeugt ist, und umgekehrt.“11
Der sarkastische Unterton war zu subtil. Bis heute bezeichnen sich deutsche Staatsanwälte trotz Fortbestehens ihrer problematischen Abhängigkeit von der Politik12 zu jeder sich bietenden Gelegenheit und mit Stolz als „objektivste Behörde der Welt“.13
III. Rechthaberei
Gute Juristen sind penibel genau und neigen von Berufs wegen zum Rechthaben (sonst wären sie keine). Ein obergerichtlicher Leitsatz kann daher lauten:
„ ‚Er war ein Jurist und auch sonst von mäßigem Verstand.‘ stammt nicht von Kurt Tucholsky. Das Zitat stammt von Ludwig Thoma und lautet richtig: ‚Er war ein guter Jurist und auch sonst von mäßigem Verstand.‘ (aus der Kurzgeschichte ‚Der Vertrag‘ über den königlichen Landgerichtsrat Alois Eschenberger).“14
Außenstehende nehmen das oft als pedantisch-streitsüchtigen Exaktheitsfetischismus wahr – und betrachten die Juristen als „vernagelte Besserwisser“.15 Das ist selbstverständlich falsch und allenfalls insoweit richtig, als für einen guten Juristen keine [17] Frage zu unwichtig wäre, um darüber nicht einen zünftigen Meinungsstreit vom Zaun zu brechen. Die rechtswissenschaftliche Streitkultur reicht dabei vom Grundsätzlichen bis ins kleinste Detail. In Streit steht daher neben den Grundsatzfragen, ob die Rechtswissenschaft eine Wissenschaft ist16 und ob es „streitig“, „strittig“ oder „umstritten“ heißen muss,17 jede Frage überhaupt.
Ein kontrovers diskutiertes Beispiel: Unabhängig von der nachrangigen Frage, wer ihn bekommt, ist unbedingt zu klären, ob es korrekt Schaden- oder Schadensersatz heißt. Die Sache ist unklar und verworren. Sogar Möllers’ Standardwerk „Juristische Arbeitstechnik“ schwankt, je nach Auflage, hin und her18 – und selbst Bastian Sick hat keine eindeutige Lösung parat.19 Vermutlich hängt es vom Gesetz ab, nach dem man klagt: Der BGB-Kläger erhält nach § 280 „Schadensersatz“, derjenige nach § 97 WpHG nur „Schadenersatz“.
Weiteres Beispiel einer bedeutsamen, aber immer noch ungeklärten Streitfrage ist diejenige nach der Dauer eines Tages. Natürlich ist auch die Zeit gesetzlich geregelt. Tage im Rechtssinne sind, wie das Bundesarbeitsgericht exakt am 16. Juni 1966 bei der Berechnung eines Urlaubsanspruchs herausgefunden hat, aneinander angrenzende Intervalle auf einem linearen Kontinuum der Zeit, die einen Anfangs- und einen Endpunkt aufweisen.20 Wo genau diese Grenzpunkte liegen, ist Gegenstand einer vertrackten Debatte. In ihrem Zentrum steht dabei die Frage nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes. Die Formulierung von dessen Art. 145 Absatz 2 – er lautet: „Dieses Grundgesetz [18] tritt mit Ablauf des Tages der Verkündung [= 23.5.1949] in Kraft.“ – ist unklar und die möglichen Interpretationen liegen um nicht weniger als eine juristische Sekunde voneinander entfernt. Dazu Klein im Dürig/Herzog/Scholz:
„Die Formulierung hat trotz ihrer Eindeutigkeit (‚mit‘ und nicht ‚nach‘ Ablauf) – der 23. Mai lief wie jeder Tag um 24.00 Uhr ab – zu Irritationen geführt. Während die einen das Inkrafttreten des Grundgesetzes folgerichtig auf den 23. Mai 24.00 Uhr datieren, geben andere den 24. Mai 00.00 Uhr als den Tag des Inkrafttretens an. […] Das BVerfG hat sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens unterschiedlich eingelassen, es nennt sowohl den 23. als auch den 24. Mai 1949.“21
Immerhin herrscht Einigkeit, dass „[a]us naturwissenschaftlicher Sicht beide Zeitpunkte identisch [sind], weshalb dem Streit praktische Bedeutung nicht zukommt“. Für zahlreiche zeitrechtliche Spezialprobleme jenseits des Inkrafttretens der Verfassung kann indes die praktische Bedeutung des Streits um die juristische Sekunde gar nicht überschätzt werden. Beispiele: Während nach der Rechtsprechung der Finanzgerichte das Verstreichenlassen der „logischen/juristischen“ Sekunde Steuernachzahlungen im fünfstelligen Bereich auslösen kann,22 vertritt der Bundesgerichtshof im Fristberechnungsrecht die Ansicht, dass „zwischen 24 Uhr und 00 Uhr keine, auch keine logische Sekunde existiert“.23
Im Übrigen stimmt es aber auch gar nicht, dass jeder Tag um 24:00 Uhr endet.24
[19]
IV. Sprachbarriere
Ein weiteres Humor-Handicap ist das Juristendeutsch. Dieses gilt „dem sogenannten gesunden Menschenverstand gern als Vorstufe zur Geisteskrankheit“25 und erfüllt „Jeden, der Geschmack und Sinn für Klarheit hat, mit Ekel“.26
Ihr Übriges tun dann die – entgegen § 42 Absatz 5 Satz 1 GGO27 – oft unverständlichen Gesetzesformulierungen,28 die Neigung der Juristen zu lesefeindlichen Klammereinschüben und seltsamen Abkürzungen („Einen Augenblick bitte, ich schau mal eben in der BDGBIBBBMinBFAnO nach!“29) sowie eine unvermeidbare Fußnotenhuberei30 (seltener: Endnotenhuberei)31.
[20]
V. Ansatz zur Problem-Lösung
Angesichts dieser humoristischen Ödnis wird von Juristen nichts Witziges erwartet32 – und diese selbst erwarten allenfalls, verlacht zu werden:
„Jedenfalls ist es uns Juristen im Allgemeinen bekannt, dass wir ob unseres gewählten Berufes und einer damit verbundenen geistigen Prägung gelegentlich als Objekt des Spottes herhalten müssen.“33
Wie soll man bei dieser traurigen Ausgangslage ein Buch über Lustiges im Recht beginnen? Die für einen Juristen naheliegende [21] Standard-Idee – „erst einmal eine Definition“ von Humor – wurde von anderen schon ausprobiert,34 ist aber tückisch. Sie würfe ein schlechtes Licht auf den Verfasser, da „Humor bekanntlich [ist], was bestimmt nicht hat, wer ihn definiert“.35 Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) weicht diesem Vorwurf gekonnt aus, hilft für die hiesigen Zwecke aber auch nicht weiter, wenn es das Scherzhafte an der sogenannten Scherzerklärung in § 118 trocken als „Mangel der Ernstlichkeit“ bezeichnet.36
Notgedrungen muss man sich also mit einer entsprechenden Anwendung der vom Obersten Gerichtshof der USA zur Pornografie entwickelten „I know it when I see it“-Regel37 begnügen. Hilfreich ist dabei die gesicherte Erkenntnis, dass Humor vom Erwartungswidrigen lebt und der Witz im Recht da ist, wo dieses den Leser überrascht.38 Diese Art der Rechts-Überraschung entspringt drei Quellen: (1) Juristischen Fehlleistungen, (2) den Absurditäten des Lebens und (3) blanker Absicht. Der ersten Quelle kann hier allerdings schon deshalb nicht nachgegangen werden, weil Teile der Untersuchungsergebnisse die Bevölkerung verunsichern würden.39 Entsprechend ist dieses Buch in zwei Teile gegliedert: Das erste Kapitel hat kuriose Klagen zum Gegenstand, das zweite handelt von juristischen Komikern.
1 Der Verfasser schreibt das nicht zum Spaß; schließlich ist sein eigener Urgroßvater am 26.3.1926 vom LG Braunsberg zum Tode verurteilt worden (vgl. Danziger Volksstimme v. 27.3.1926, S. 4, bit.ly/3D0lHdl).
2Stader, Kurze Einführung in den Juristenhumor, 1996, S. 12.
3 OLG Düsseldorf, NJW 1993, 3078.
4 Im Düsseldorfer Fall war die Waffe nur Kaliber 4mm, der betrunkene Ehemann hatte bloß einen Streifschuss erlitten und unmittelbar nach den Schüssen „scherzend erklärt, dass er ein Projektil aus einer solch kleinkalibrigen Waffe mit den Zähnen auffange“.
5 Frauen sind bei der Ehepartnertötung mörderischer: Ausweislich einer dubiosen kriminologischen Studie aus dem Jahr 1975, die von zwei Zahnärzten durchgeführt worden ist (näher Paeffgen/Welter, Dr. jur.-dent., JZ 1978, 577), kommen sie im Durchschnitt auf 1,74 Mordmotive, während Männer durchschnittlich nur 1,56 Motive haben, ihre Ehefrauen umzubringen. Wer für diese blutige Aufgabe professionelle Hilfe in Anspruch nehmen will, muss dafür im Schnitt 12.000 € einplanen (Cameron, Killing for Money and the Economic Theory of Crime, Review of Social Economy 72 [2014], 28, 31). Die Angst vor Fehlinvestitionen ist dabei unbegründet: Macht sich der Auftragskiller vor Erledigung des Jobs mit dem Geld aus dem Staub, kann man ihn wegen Betrugs anklagen (KG, NJW 2001, 86).
6 BGHSt 60, 52, 53.
7 Vgl. Jahn/Brodowski, Das Ultima Ratio-Prinzip …, ZStW 2017 (129), 363, 364 Fn. 2: Die Erwähnung eines Autors mit dem Namen Sandherr im Zusammenhang mit Rechtsproblemen des „Sanduhrbetrugs“ ist gekennzeichnet mit dem international gebräuchlichen Entwarnhinweis „no pun intended“.
8 Ausführlich zur „Ironie im Rechtswesen“ Hamann, NJW 2020, 713.
9Funck, Schuld und Sühne im Strafvollzug, ZRP 1985, 137.
10Gerhardt, Was man Juristen so alles zutraut, oder: Ironie bitte kursiv!, ZRP 1985, 185.
11v. Liszt, DJZ 1901, 179, 180.
12 Näher Thomas, Die deutsche Staatsanwaltschaft – „objektivste Behörde der Welt“ oder doch nur ein Handlanger der Politik?, KriPoZ 2020, 84.
13 Exemplarisch Grabbe, „Objektivste Behörde der Welt“, Weser Kurier v. 10.7.2016.





























