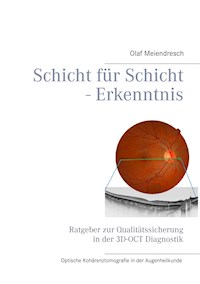
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
"Schicht für Schicht - Erkenntnis" behandelt das Thema der optischen Kohärenztomografie, basierend auf dem 3D-Spektraldomain OCT- Verfahren, bezüglich Technologie, Anwendung und Diagnostik in der modernen Augenheilkunde. Nicht zu technisch und nicht zu medizinisch, sondern praxisnah für den Alltag. Mit Tipps und Erläuterungen zum richtigen Lesen der OCT-Scans, soll dieser kleine Ratgeber, gerichtet an Fachärzte, medizinisches Fachpersonal und jeden, den diese Technologie interessiert, leicht verständlich zur allgemeinen Qualitätssicherung in der OCT-Diagnostik in Praxis und Klinik beitragen und dabei helfen, den täglichen Umgang mit OCT-Systemen zu erleichtern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 89
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1 – Grundlagen der optischen Kohärenztomografie
Kapitel 2 – Spektraldomain 3D-OCT Reflektionsverhalten
Kapitel 3 – Diagnostische Werkzeuge
Kapitel 4 – OCT Darstellungs- und Pathologiebeispiele
Kapitel 5 – Glaukomdiagnostik
Schlußwort
Quellennachweis
Vorwort
Aus der modernen Praxis für Augenheilkunde ist heutzutage eines ganz sicher nicht mehr weg zu denken – die optische Kohärenztomografie. Unzählige, immer neue Fragestellungen, Diskussionen, Erkenntnisse und Studien zu dieser Technologie lassen uns immer noch tiefer in die tägliche Diagnostik der Augenmedizin einblicken.
Bei der optischen Kohärenztomografie, kurz OCT genannt, handelt es sich um eine die Ophthalmologie immer weiter revolutionierende und sich weiterentwickelnde Technologie, die es mühelos und für den Patienten nicht invasiv, möglich macht, im frühesten Stadium Krankheiten zu erkennen. Früher als je zuvor und wesentlich sicherer, können dadurch heute die richtigen Diagnosen gestellt werden, Therapieansätze erfolgen und deren Verlauf professionell dokumentiert werden. Vom sogenannten Screening über die Diagnostik bis zur sicheren Verlaufskontrolle ist dieses kleine Wunder der Technologie mit all seinen Funktionen, Auswertungsmodulen und automatischen Analysen ein wahrer Alleskönner in der Ophthalmologie. Aber nicht nur in der Augenmedizin sind die Berichte dieser OCT-Technologie wertvoll. Gleichermaßen geschätzt werden die umfangreichen Informationen ihrer Auswertungen in der Kardiologie (Gefäßanalyse), Diabetologie und der Neurologie, und hier speziell in der Multiple Sklerose Forschung.
Man kann also durchaus behaupten, dass wir noch ganz am Anfang dieser herausragenden Technologienutzung stehen und, dass noch lange nicht alle medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.
In diesem Buch sollen nun objektiv die Technik und Funktion des OCT im Allgemeinen, seine funktionellen Analysemöglichkeiten, sowie interessante Hilfen und Tipps bei Fallbeispielauswertungen für den Einsatz in der augenärztlichen Praxis oder -Klinik dem Leser auf einfache Weise näher gebracht werden. Sicher ist, dass die Weiterentwicklung dieser Technik immer noch nicht sein Ende erreicht hat und uns fortwährend in noch tiefere Ebenen bei noch erstaunlicherer Auflösungsqualität vordringen lassen wird. Aber selbst im heutigen Stadium bereits können wir von nie da gewesenen Möglichkeiten in der ophthalmologischen Diagnostik und -Mikrochirurgie sprechen. Modernste Technologie, die wenn man es genau nimmt, in keiner augenärztlichen Praxis mehr fehlen dürfte.
Für die medizinisch-fachliche Unterstützung während der Entstehung dieses Buches und die Bereitstellung der Bildmaterialien möchte ich mich ganz herzlich bei Herrn Dr.med. Hakan Kaymak, Breyer- Kaymak-Augenchirurgie Düsseldorf, bedanken.
Kapitel 1
Grundlagen der Optischen Kohärenztomographie
>>Die Optische Kohärenztomographie (OCT) wurde entwickelt, um die Netzhaut, den Sehnerv und einen Teil des vorderen Augensegmentes, visuell ähnlich einer Schichtaufnahme mit dem aus der Radiologie bekannten CT, in einzelnen Schichten bildlich darstellen zu können. Nur werden bei diesem Verfahren Breitbandlichtquellen mit kohärentem Licht verwendet. Diese nicht-invasive, berührungsfreie, Bild gebende Technik, welche detaillierte Gewebe-Querschnittsbilder, auch ähnlich dem Bild einer Biopsie, darstellen kann, arbeitet mit einer Abtasttiefe von ungefähr 2-3 Millimetern im Gewebe bei einer Axial- und Lateral-Auflösung im Mikrometerbereich. Im Jahr 1996 wurde diese Technik erstmals vorgestellt. Damals mit einer axialen Auflösung (Tiefenauflösung) von ca. 30 μm und weniger. In ihrer weiteren technischen Entwicklung erreichten herkömmliche OCT später erstmals eine axiale Auflösung von unter l0 μm<<1.
>>Nimmt man beispielsweise den Ultraschall zum Vergleich, welcher Echos verwendet, um innerhalb des Körpers Strukturen zu erkennen, so kann man das allgemeine Funktionsprinzip des OCT als ähnlich einstufen. Nur, das hier mit Lichtquellen gearbeitet wird und die verwendete Signalgeschwindigkeit des OCT millionenfach schneller als der Ton des Ultraschalls ist. So erreicht man mit OCT Darstellungen von Strukturen mit einer Auflösung von unter 6μm, im Vergleich zum Ultraschall mit einer Auflösung von ca. 100 Mikron.
Der Schlüssel dafür sind die unglaublichen Möglichkeiten der sogenannten Niedrigkohärenz Interferometrie. Mittels einer sogenannten Superlumineszenzdiode (SLD) oder per SLO (Scanning Laser Ophthalmoscope), oft kombiniert mit einem SLP (Scanning Laser Polarimeter) zur Detektion der Nervenfaserschichttiefe, wird Licht im Bereich von ca. 820 nm erzeugt und auf die Netzhaut projiziert. Ein Spiegelsystem bricht das von der Netzhaut reflektierte Licht und sendet es an zwei Detektorenarme - den Abtastarm (zielmusterorientierter Abtastbereich) und den Referenzarm. Die Reflektionskombination beider Arme erzeugt dann ein Interferenzmuster. Die Time Domain Technologie setzte diese Art der Bilderfassung erstmals erfolgreich um. Resultierend aus der Reflexion ist ein Profil, welches als A-scan bezeichnet wird. Es enthält Informationen über die räumlichen Dimensionen und die Position der Strukturen innerhalb des Abtastbereichs. Reiht man seitlich einige dieser axialen Tiefenscans (A-scan) aneinander, so erhält man einen Querschnitt (B-Scan).
Grundsätzlich kann das OCT, als Retinatomograph allerdings nur bedingt, ebenso deutlich die Cornea, Sklera, Iris und Linse in den vorderen Abschnitten des Auges darstellen. Hierzu wäre die Verwendung von Infrarotlicht mit einer Wellenlänge von 1310 nm allerdings die beste Wellenlänge <<2.
Daher sollte klar zwischen speziell für den vorderen Augenabschnitt entwickelten OCT und den Retina-Tomographen unterschieden werden. Bei Letzteren ist der Messbereich für das vordere Segment technologisch zwar möglich, aber nicht so prägnant, wie beim speziell dafür entwickelten Anterior-OCT. Es fehlte bislang hier noch an der gesamten Bandbreite der Wellenlängenabtastung und teilweise an den Möglichkeiten zur technischen Umsetzung bei der Erfassung der gesamten Cornea (Scan-Arealbreite) mit der vollständigen vorderen Augenkammertiefe. Dieses soll sich jedoch mit der neuen zukünftigen Swept-Source Technologie ebenfalls ändern. Der Fokus der herkömmlichen SD-Retinatomographen liegt daher ganz klar im Vitreus. Somit kann der Retinatomograph bislang tatsächlich nur, entsprechend der Fokussierung und seiner Abbildungstiefe von 2-3 mm im Gewebe, Teile des vorderen Augenabschnittes, entweder die Cornea oder linsenfokussiert die Iris oder den Kammerwinkel erfassen und darstellen. (Abbildungen 1.1 – 1.3)
Abb 1.1 (Quelle: Vorderabschnitts OCT Visante (Fa. Zeiss))
Abb 1.2. Cornea 3DOCT-2000 (Topcon)
Abb 1.3 Kammerwinkel 3DOCT-2000
>>Um die Tiefenstruktur der Netzhaut am lebenden Auge derart hoch detailliert darstellen zu können, dass auch die feinsten Strukturen sichtbar werden, ist die optische Kohärenztomografie die einzige Technologie, die es möglich macht. Aus diesem Grund ist OCT auch inzwischen zu einem unabkömmlichen Diagnoseverfahren für den Umgang mit vitreoretinal erkrankten Patienten geworden. Kein anderes Bild gebendes Verfahren ist in der Lage unter der Oberfläche liegende mikroskopische Gewebeschichten in vivo derart selektiv abzubilden<<3.
(Abbildung 1.4: Quelle: 3D OCT 2000, Topcon, Querschnitt entlang der papillomakulären Achse durch die Makula. Diese benannten Schichten sind relevant für die OCT-Softwareauswertungen)
Wie funktioniert die Bildgebung am OCT genau?
>>Wie schon erwähnt, ist die Optical coherence tomography (OCT) eine Methode, bei der kohärentes Licht von einer Breitbandlichtquelle (Superlumineszenzdiode SLD) mit ca. 820 Nanometer Wellenlänge, mittels eines Strahlenteilers in zwei separate Ausleger geteilt wird. Einer der Ausleger wird über die Oberfläche des zu analysierenden Gewebeteils positioniert, wie z.B. über die Netzhaut, bevor es zu dem Sensor zurückreflektiert wird. Die zweite Hälfte des Original-Auslegers, Referenzausleger genannt, wird von einem Spiegel reflektiert, statt der Netzhaut, bevor es zu dem Lichtsensor zurückreflektiert wird. Nun wird die Distanz zwischen dem Referenzspiegel, unter Berücksichtigung Zeit, die nötig ist, bis das reflektierte Licht den Sensor erreicht, und das Resultat der beiden Strecken der Lichtausleger miteinander abgeglichen. Das Time Domain Verfahren erfasste so die optische Rückstreuung des Lichtes und stellte daraus eine Pixel-Darstellung der anatomischen Schichten innerhalb der Netzhaut dar.
Anstatt die Position des Referenzspiegels anzugleichen, was zu Lasten der Scangeschwindigkeit geht, zeigt das Spektraldomainverfahren die interferometrischen Informationen an, indem es eine Fourier Domain „spektrometrische“ Methode benutzt (Abb. 2.1.). Das bedeutet feststehende Referenzspiegel und unterschiedliche interferierende Wellenlängenresonanzen des Lichtes werden mittels Spektrometer und Photodetektor erfasst und mit Hilfe verifizierter Algorithmen ausgewertet<<4 Durch dieses Verfahren können heute Scangeschwindigkeiten von bis zu 100.000 A-Scans pro Sekunde erreicht werden, wobei die Mehrheit der Systeme derzeit noch bei rund 50.000 A-Scans pro Sekunde liegt.
(Abbildung 2.1 vereinfachte schematische Darstellung der Spektral Domain OCT Funktionsweise – allgemein bekanntes Funktionsprinzip)
Inzwischen teilt die Mehrheit der OCT-Anwender die Meinung, dass das ideale 3D-OCT aus 3 Hauptteilen besteht: dem Aufnahmesystem mit SLD-Scanner und Spektrometer, kombiniert mit einer integrierten Non-Mydriatischen Funduskamera und dem leistungsstarken PC mit der Analysesoftware. Die integrierte Funduskamera erleichtert die gesamte Diagnostik drastisch, sofern es sich um reale Fotografien handelt. Und meiner Meinung nach, sollte darauf immer geachtet werden. Nichts geht über eine reale Fotografie. So sind in den Standardausführungen Farbfundusfotografien und in der Premium Version zusätzlich Fluoreszenzangiografien und Autofluoreszenzaufnahmen möglich, die als zusätzliche reale Referenz für alle Scans dienen und die Diagnostik ganzheitlich erleichtern und perfektionieren.
Durch eine direkte Kopplung mit einer integrierten non-mydriatischen Funduskamera Abb 2.2), was eine zusätzliche wichtige simultan aufgenommene Referenz als reale Fotografie bietet, erstellt z.B. die 3D-OCT-Serie der Firma Topcon hoch aufgelöste Abbildungen von bis zu 256 B-scan-Querschnitten (mit bis zu 4096 Linien) und dreidimensionale Volumenabbildungen, welche ein Fläche von bis zu 12 x 9 mm der Netzhaut abdecken. Die erlangten 3D-OCT Daten werden von der Analysesoftware weiterverarbeitet und ausgewertet. Die Firma Topcon war hier bereits 2006 der erste Hersteller, der sich dieser Konfiguration stellte. Mit großem Erfolg für die Ophthalmologie, wie sich herausstellte. Denn heute folgen in der weiteren Entwicklung der OCT Systeme ebenso weitere namhafte Unternehmen wie die Carl Zeiss Meditech AG diesem erfolgreichen Konzept.
(Abb 2.2 Quelle 3D OCT2000 – Topcon, OCT - NonMyd Karmera-Kombination)
Auf einen Blick gestattet diese Kombination eine Ansicht des zentralen fovealen Querschnittes mit zentraler Schichtdickenangabe von der ILM bis zum RPE, die zugehörige Referenzposition (grüne Linie mit Kreuz) in der simultan aufgenommenen Fundusfotografie mit Überlagerung und Gefäßabgleich der Projektionsaufnahme der SLD (Laserprojektion), sowie einen 3D Ausschnitt des Scanareals mit Höhenprofil. Alle Darstellungen korrespondieren in μm-Abstufung im gesamten Aufnahmefeld punktgenau miteinander.
Ein Beispiel für eine Spezifikation eines derartigen 3D-OCT Systems für Scans mit Referenzfotografie ist nachfolgend beschrieben:
Bildwinkel für die Fotographie: 45° ± 7%. Digitaler Zoom: 2x und 4x
Fotografierbarer Durchmesser der Pupille unter 45°: φ 3.5 mm oder mehr





























