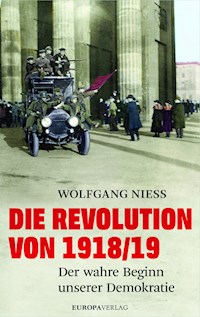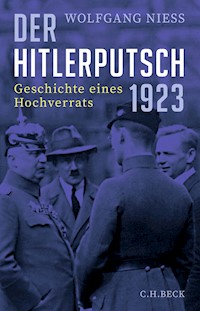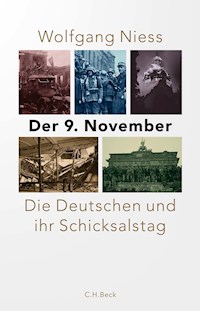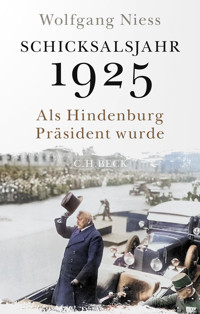
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wahlen entscheiden über das Schicksal von Demokratien. Das ist heute wieder so bewusst, wie lange nicht. Kommen die Falschen in höchste Ämter, können Demokratien scheitern. Im April 1925 wählen die Deutschen Paul von Hindenburg zu ihrem Reichspräsidenten und legen damit eine Zeitbombe, die 1933 mit zerstörerischer Gewalt explodieren sollte. Wolfgang Niess zeigt, wie es dazu kam, und warum Hindenburg zum Totengräber der ersten deutschen Demokratie wurde. Im Februar 1925 stirbt der Sozialdemokrat Friedrich Ebert, der erste von der Weimarer Nationalversammlung ernannte Reichspräsident, der Deutschland durch die Krisen der Revolutions- und Nachkriegszeit geführt hatte. Wer wird sein Nachfolger? Wolfang Niess schildert die Hintergründe der Schicksalswahl von 1925 in bisher ungekannter Tiefe. Einflussreiche Kräfte einer neuen Rechten wollten sie nutzen, um einen Keil zwischen bürgerliche Demokraten und Sozialdemokraten zu treiben. Sie suchten eine Art zweiten Bismarck, der Parteien und Parlament zurückdrängen und die Demokratie Schritt für Schritt beseitigen sollte. Doch eigentlich standen die Chancen für die Republikaner gut, die Wahl zu gewinnen. Wie konnten sie diese Chancen verspielen? Wie konnte ein Antidemokrat in das höchste Amt des Staates gelangen? Und wieso übersahen viele, was der neue Amtsinhaber langfristig vorhatte? Die genaue Analyse der Wahl von 1925 ist der Schlüssel für eine Neuinterpretation der Rolle Hindenburgs bei der Errichtung der NS-Diktatur. Denn manchmal entfalten Wahlergebnisse ihr zerstörerisches Potential nicht sofort, sondern erst nach Jahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Wolfgang Niess
SCHICKSALSJAHR1925
Als Hindenburg Präsident wurde
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
1: Schicksalsjahr 1925?
2: Tiefe Anteilnahme und maßloser Hass – Tod und Begräbnis des ersten Reichspräsidenten
3: Neuland – Wahl des Reichspräsidenten durch das Volk
4: Marsch durch die Institutionen – Friedrich von Loebell und die neue Strategie der Rechten
5: Hindenburg steht nicht zur Debatte – Schwierige Kandidatensuche
6: Republikanische Mehrheit – Der erste Wahlgang
7: Neustart – Kandidatensuche für die entscheidende Runde
8: Hindenburg – Eine notwendige Rückblende
9: Blankes Entsetzen und Siegeszuversicht – Reaktionen auf die Nominierung Hindenburgs
10: «Der Retter ist da» – Wahlkampf als Propagandaschlacht
11: «Die Alarmglocken läuten» – Hindenburgs Wahlerfolg
12: Alles halb so schlimm? – Ein Eid und seine Wirkung
13: Der Präsident drängt nach rechts – Das schleichende Gift der ersten Jahre
14: Die Zerstörung der Republik – Hindenburgs Weg von Brüning zu Hitler
15: «Wer Geschichte machen will, muss auch Blut fließen lassen können» – Hindenburg und sein «lieber Kanzler» Adolf Hitler
16: Eine Frage zum Schluss
Anmerkungen
2 Tiefe Anteilnahme und maßloser Hass – Tod und Begräbnis des ersten Reichspräsidenten
3 Neuland – Wahl des Reichspräsidenten durch das Volk
4 Marsch durch die Institutionen – Friedrich von Loebell und die neue Strategie der Rechten
5 Hindenburg steht nicht zur Debatte – Schwierige Kandidatensuche
6 Republikanische Mehrheit – Der erste Wahlgang
7 Neustart – Kandidatensuche für die entscheidende Runde
8 Hindenburg – Eine notwendige Rückblende
9 Blankes Entsetzen und Siegeszuversicht – Reaktionen auf die Nominierung Hindenburgs
10 «Der Retter ist da» – Wahlkampf als Propagandaschlacht
11 «Die Alarmglocken läuten» – Hindenburgs Wahlerfolg
12 Alles halb so schlimm? – Ein Eid und seine Wirkung
13 Der Präsident drängt nach rechts – Das schleichende Gift der ersten Jahre
14 Die Zerstörung der Republik – Hindenburgs Weg von Brüning zu Hitler
15 «Wer Geschichte machen will, muss auch Blut fließen lassen können» – Hindenburg und sein «lieber Kanzler» Adolf Hitler
16 Eine Frage zum Schluss
Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Personenregister
Zum Buch
Vita
Impressum
1
Schicksalsjahr 1925?
Es mag Jahre geben, für die das Prädikat «Schicksalsjahr» unmittelbar einleuchtet – für 1914, 1933 oder 1939 darf man das wohl annehmen. Das Jahr 1925 gehört nicht dazu. Was Deutschland angeht, steht 1925 für kulturellen Aufbruch und technische Innovation, für Sachlichkeit und Rationalität, für Modernität und Lebensfreude. 1925 beginnen die «Goldenen Zwanziger Jahre».
Im Ufa-Film Wege zu Kraft und Schönheit, uraufgeführt am 16. März 1925, wird ein neues Frauenbild sichtbar. Pompöse Kinopaläste machen Filme jetzt zum Erlebnis für ein großes Publikum. Am 7. Mai wird das Deutsche Museum in München eingeweiht, das breiten Schichten Naturwissenschaft und Technik nahebringen möchte. Am 15. Mai wird die Reichsrundfunkgesellschaft gegründet, die den Siegeszug des Radios als Massenmedium einleitet. Am 25. Mai tritt die Sam-Wooding-Jazz-Band erstmals in Berlin auf und versetzt die Hauptstadt ins Jazz- und Charleston-Fieber. US-amerikanische Kultur ist plötzlich sehr nah, der Horizont des kulturinteressierten Publikums weitet sich. Am 14. Juni wird in der Mannheimer Kunsthalle eine Ausstellung mit dem schlichten Titel «Neue Sachlichkeit» eröffnet, die weit über Nordbaden und Deutschland hinaus ausstrahlt und einer ganzen Kulturepoche ihren Namen gibt. Neue Sachlichkeit findet sich nicht nur in der bildenden Kunst der zwanziger Jahre, sondern auch in der Architektur, der Literatur oder der Mode. Neue Sachlichkeit wird zum Synonym für den kulturellen Aufbruch der zwanziger Jahre. Von Schicksalsjahr kann keine Rede sein, wenn wir die kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung betrachten.
Vordergründig gilt das auch für Politik und Wirtschaft. Als herausragendes Ereignis der internationalen Politik steht die Annäherung der ehemaligen Kriegsgegner Deutschland und Frankreich im Mittelpunkt. Sie führt zum Vertragswerk von Locarno, das im Oktober 1925 ausgehandelt wird. Deutschland erkennt seine Westgrenze an und verzichtet damit insbesondere auf alle Bestrebungen, das Elsass und Lothringen zurückzugewinnen, die es nach dem verlorenen Weltkrieg abtreten musste. Die Wirkung der Locarno-Verträge reicht aber sehr viel weiter. Mit ihnen beginnt – fast sieben Jahre nach Kriegsende – erst wirklich die Liquidierung der Kriegskonstellation und ihrer Folgen.
Verabredet wird die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund, die im Jahr darauf erfolgt. Verabredet werden auch umfangreiche Kreditzusagen amerikanischer Geldgeber, die der deutschen Wirtschaft auf die Beine helfen. Deutschland sagt zu, dass es seine Ostgrenzen nicht mit gewaltsamen Mitteln verändern wird. Die Locarno-Abkommen stellen die europäische Politik auf eine solide und weithin akzeptierte Basis. Sie bilden zugleich die Voraussetzung für eine wirtschaftliche und soziale Erholung des Kontinents. Völlig zu Recht werden die Außenminister Frankreichs und Deutschlands, Aristide Briand und Gustav Stresemann, für ihre Politik der Verständigung und Versöhnung mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Auch mit Blick auf diese Politik findet sich keine Spur von Schicksalsjahr, ganz im Gegenteil.
Völlig anders sieht es allerdings mit dem zweiten politischen Großereignis des Jahres 1925 aus, der Wahl Paul von Hindenburgs zum Reichspräsidenten. Die Präsidentschaft Hindenburgs mündet am 30. Januar 1933 in die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler und damit auch in direkter Linie in die Errichtung der NS-Diktatur und in den Zweiten Weltkrieg, die bislang größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Die Wahl Hindenburgs zum Präsidenten und deren Folgen machen das Jahr 1925 am Ende doch zum «Schicksalsjahr», auch wenn das von den Zeitgenossen zunächst nicht so wahrgenommen wurde.
Wie es zu dieser Wahl kommen konnte, ist eine der Schlüsselfragen zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Gemessen daran hat sie bislang nicht übermäßig viel Aufmerksamkeit gefunden – und diese Frage lässt sich auch nicht mit wenigen Sätzen beantworten. Klar aber ist: Es war keineswegs selbstverständlich, dass der Generalfeldmarschall a. D. Paul von Hindenburg als Kandidat aufgestellt und dann auch noch gewählt werden würde. Im Rückblick wird Geschichte oft zwangsläufiger und alternativloser gesehen, als sie tatsächlich war.
Hindenburg war 1919/20 der Traumkandidat der nationalen Rechten gewesen, als zum ersten Mal die in der Weimarer Verfassung vorgesehene Wahl eines Reichspräsidenten durch das Volk im Gespräch war. Der Monarchist Hindenburg entsprach zu diesem Zeitpunkt dem Wunsch der politischen Rechten, das Rad der Zeit zurückzudrehen, die Ergebnisse der Revolution von 1918 rückgängig zu machen und auf eine Wiederherstellung der Monarchie hinzuarbeiten.
Nach zahllosen politischen Morden und einer Reihe von Putschversuchen extrem rechter Akteure war die Stimmung 1925 eine andere. Vor allem hatte sich die Deutsche Volkspartei (DVP) unter dem Einfluss ihres Vorsitzenden Gustav Stresemann dem real existierenden Staat angenähert und war von einer Partei, die die Weimarer Republik grundsätzlich ablehnte, zu einer rechten Flügelpartei innerhalb des Systems geworden. Als die erste Volkswahl des Reichspräsidenten anstand – die Amtszeit des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert sollte am 30. Juni 1925 enden –, war Hindenburg nicht mehr der Wunschkandidat der DVP. Für sie war die Wiederherstellung der Monarchie inzwischen kein Thema mehr, und außenpolitisch setzte Stresemann ganz auf eine Politik der Verständigung und der Aussöhnung mit Frankreich.
Kreise einer «neuen Rechten» um den Präsidenten des Reichsbürgerrats Friedrich Wilhelm von Loebell hatten allerdings schon im Jahr vor der Wahl das Amt des Reichspräsidenten mit seinen weitreichenden Befugnissen als entscheidenden politischen Hebel entdeckt, mit dem sich nach ihrer Überzeugung die parlamentarische Demokratie in ein autoritäres Regime transformieren ließ. Statt weitere Putschversuche zu unternehmen oder auf parlamentarische Mehrheiten zu hoffen, setzten sie darauf, eine Art «zweiten Bismarck» für das 20. Jahrhundert ins Präsidentenamt zu bringen, der entschieden und tatkräftig die Machtmittel des Amtes nutzen sollte, um Parlament und Parteien zurechtzustutzen. Als Ziel hatten die Männer um Loebell weniger eine Wiederauflage der Hohenzollernmonarchie vor Augen als vielmehr einen Staat nach dem Vorbild von Mussolinis Italien.
Idealerweise sollte dieser Machtpolitiker als gemeinsamer Kandidat aller bürgerlichen Parteien nominiert werden. Erstes Ziel der «neuen Rechten» um den Reichsbürgerrat war es deshalb, alle bürgerlichen Parteien für eine Sammelkandidatur zu gewinnen, auch die republikanischen, die bislang mit den Sozialdemokraten zusammenarbeiteten. Es ging darum, die sogenannte Weimarer Koalition aus SPD, Zentrumspartei und Deutscher Demokratischer Partei (DDP) aufzubrechen und die bürgerlichen Parteien in eine klare Frontstellung gegen die sozialistische Linke zu führen.
Die Vorbereitungen dafür hatten längst begonnen, als Ende Februar 1925 der erste Reichspräsident verstarb, der Sozialdemokrat Friedrich Ebert. Im Grunde begann bereits mit diesem für die Öffentlichkeit unerwarteten, tatsächlich jedoch von seinen Widersachern recht zielbewusst herbeigeführten Tod die Tragödie der Weimarer Republik, denn Ebert wäre für jeden Kandidaten der politischen Rechten ein zumindest chancenreicher, wenn nicht überlegener Gegner gewesen.
2
Tiefe Anteilnahme und maßloser Hass – Tod und Begräbnis des ersten Reichspräsidenten
«Die Besserung hält an» war noch in der Morgenausgabe des Vorwärts vom 28. Februar 1925 zu lesen.[1] Die Abendausgabe erschien dann bereits mit schwarzem Trauerrand und einer Porträtzeichnung: «Reichspräsident Friedrich Ebert ist seinem schweren Leiden erlegen.» Die Bauchfellentzündung, die durch einen Blinddarmdurchbruch in die Bauchhöhle entstanden war, sei bereits im Abklingen gewesen, habe aber dann zu einer schweren Darmlähmung geführt, gegen die kein Mittel zu finden war, hieß es im Bericht der behandelnden Ärzte: «In der letzten Nacht trat gegen 5 Uhr eine plötzliche Verschlimmerung ein, die zu einem schnellen Verfall der Kräfte und um 10.15 Uhr vormittags zum Tode führte.» Ebert sei, hieß es im Vorwärts, «ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben, sanft entschlafen».[2] Er wurde nur vierundfünfzig Jahre alt.
Dem angeblich sanften Tod des bewusstlosen Reichspräsidenten ging allerdings eine wahre Tortur voraus. Schon seit Weihnachten habe er sich krank gefühlt, berichtete der langjährige Hausarzt der Familie, Rainer Arnold Freudenthal, aber erst zwei Tage nach dem traditionellen Essen für das diplomatische Korps habe Ebert am 7. Februar nach ihm rufen lassen. Im Bett liegend habe der Präsident über Mattheit, Appetitlosigkeit, Husten, Luftbeklemmung und Schmerzen geklagt. Ebert litt seit Jahren an Gallensteinen, und Freudenthal vermutete offenbar zunächst, es handele sich um Gallenkoliken. Er ordnete strenge Bettruhe sowie Diät an.[3]
Eberts Zustand schien sich dann rasch zu bessern. Vier Tage nach dem Besuch seines Hausarztes verließ er für einige Stunden das Bett und erledigte eine Reihe von Dienstgeschäften. Weitere drei Tage später empfing der Reichspräsident den französischen Botschafter, und am 17. Februar gab er sogar ein Frühstück zum Abschied des amerikanischen Gesandten. Am folgenden Tag traf Ebert bei einer Sitzung des Zentralkomitees für Krebsforschung auf Professor Friedrich Kraus, den Leiter der II. Medizinischen Klinik der Charité, und der drängte ihn, wie sein Hausarzt Freudenthal, umgehend zur Erholung in ein Sanatorium zu gehen.[4] Ebert mochte sich darauf nicht einlassen, weil er fürchtete, seine politischen Gegner könnten einen solchen Kuraufenthalt gegen ihn verwenden und eine neue Schlammschlacht inszenieren. Er steckte mitten in einem politischen Rechtsstreit, der ihn tief verletzte und nachhaltig bedrückte.
Dieser Streit hatte bereits im Juni 1922 begonnen. Bei einem Besuch Eberts in München hatte ihn auf dem Bahnhofsvorplatz Emil Gansser, einer der frühen Nationalsozialisten, schreiend als «Landesverräter» bezeichnet. Hitlers Völkischer Beobachter hatte über den Vorfall berichtet, und Ebert hatte daraufhin Gansser wegen Beleidigung verklagt. Beim Prozess vor dem Münchner Amtsgericht hatte Gansser seinen Vorwurf vor allem mit Eberts Beteiligung am Streik der Berliner Munitionsarbeiter im Januar 1918 begründet. Hundertausende von Arbeitern waren damals nach fast dreieinhalb Jahren Krieg in Streik getreten und hatten Friedensverhandlungen, bessere Ernährung und ein Ende des Belagerungszustandes gefordert. Ebert hielt die Forderungen für berechtigt, sah aber unter den gegebenen Umständen keine Chance, zu einem Erfolg zu kommen. Er war als SPD-Vorsitzender in die Streikleitung eingetreten, um zu vermitteln und den Streik zu einem erträglichen Ende zu bringen.
Daraus konstruierte die nationalistische Rechte schon früh den Vorwurf des Landesverrats, der Ebert hart traf. Als national denkender und fühlender Sozialdemokrat war er seit 1914 stets dafür eingetreten, dass seine Partei im Reichstag für die Bewilligung der Kriegskredite stimmte, hatte dafür sogar die Abspaltung der parteiinternen Gegner in Kauf genommen, die 1917 die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) gründeten. Noch schwerwiegender aber war wohl für ihn, dass im Krieg zwei seiner Söhne gefallen waren. Auch den dritten hatte er nach einer Verwundung wieder an die Front ziehen lassen. Ausgerechnet diesem Mann wurde nun von der völkischen Rechten vorgeworfen, Landesverrat begangen zu haben.
Monatelang zog sich die Auseinandersetzung mit Gansser hin, der zum Beweis seiner Anschuldigung nicht nur die Vernehmung des Reichspräsidenten, sondern auch anderer namhafter Politiker verlangte – und vom Gericht zugestanden bekam. Zunächst fanden diese Vernehmungen in den Amtsräumen des Reichspräsidenten in Berlin statt, dann aber beantragte Gansser eine weitere persönliche Vernehmung Eberts durch ihn, die aber diesmal in München durchgeführt werden sollte. Das Gericht gab auch diesem Antrag statt, und der Vorsitzende Richter drohte dem Reichspräsidenten an, ihn gegebenenfalls polizeilich vorführen zu lassen oder Ordnungsgeld bzw. Ordnungshaft wegen unentschuldigten Fernbleibens gegen ihn zu verhängen. Die Vernehmung in München erledigte sich dann allerdings vorerst, weil es am 8./9. November 1923 zum sogenannten Hitler-Putsch kam. In dessen Verlauf wurde Ebert von den Putschisten als «Novemberverbrecher» für vogelfrei erklärt. Angesichts der aufgeheizten Stimmung in München waren Unruhen und Anschläge zu befürchten, wenn der Reichspräsident in die Stadt kommen sollte. Ebert zog deshalb schließlich am 17. Januar 1924 seinen Strafantrag gegen Gansser zurück.
Falls der Reichspräsident gehofft hatte, nach mehr als eineinhalb Jahren in dieser Angelegenheit Ruhe zu finden, hatte er sich getäuscht. Gansser spielte ein politisches Spiel, das darauf abzielte, Ebert mit Unterstützung einer rechtslastigen Justiz systematisch zu drangsalieren und durchaus auch gesundheitlich zu schädigen. Er veröffentlichte nun in der München-Augsburger Abendzeitung einen Artikel – als «Offener Brief» deklariert –, in dem er den Vorwurf des Landesverrats wiederholte und den Rücktritt des Reichspräsidenten forderte. Kurz darauf wurde der Artikel unter der Überschrift «Eine bittere Pille für Fritze Ebert» in der Mitteldeutschen Presse abgedruckt, die der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) nahestand. Im Wahlkampf zur Reichstagswahl am 4. Mai 1924 griffen die DNVP und ihre Presseorgane den Fall immer wieder auf. Dass Ebert seinen Strafantrag gegen Gansser zurückgezogen hatte, schlachteten sie als angebliches Schuldeingeständnis aus.
Wenn der Reichspräsident sein Amt schützen wollte, blieb ihm kaum eine andere Wahl, als nun Strafantrag gegen Erwin Rothardt zu stellen, den presserechtlich Verantwortlichen bei der Mitteldeutschen Presse. Am 23. Dezember 1924 verurteilte das erweiterte Schöffengericht des Amtsgerichts Magdeburg den Angeklagten Rothardt wegen Beleidigung des Reichspräsidenten zu drei Monaten Gefängnis. Es stellte aber in der Urteilsbegründung zugleich fest, dass Rothardts Behauptung, Ebert habe durch die Teilnahme am Munitionsarbeiterstreik vom Januar 1918 Landesverrat begangen, im strafrechtlichen Sinne zutreffend sei. Rothardt könne deshalb nicht wegen übler Nachrede verurteilt werden.
Ebert hatte sich die Wiederherstellung seines guten Namens versprochen und war nun mit einem veritablen Rufmord konfrontiert. Auch in Magdeburg stand die Justiz der Republik und ihren Repräsentanten feindlich gegenüber. Der Vertreter der Anklage ging in die Berufung, die Reichsregierung gab eine Ehrenerklärung für den Reichspräsidenten ab, herausragende Gelehrte unterschiedlicher Disziplinen stellten sich mit einer gemeinsamen Kundgebung demonstrativ auf Eberts Seite. «Doch solche Stimmen waren die Ausnahme und ihrerseits Anlass gehässiger Kommentare von rechts. Das Magdeburger Urteil tat seine Wirkung, und die richtete sich gegen Ebert und die von ihm vertretene Republik.»[5] Die Berufungsverhandlung in diesem Verfahren war zunächst auf den 17. Februar 1925 terminiert, wurde dann aber verschoben und fand wegen Eberts Tod nicht mehr statt.
Der gehässige Feldzug der nationalen und völkischen Rechten gegen den Reichspräsidenten Friedrich Ebert und die Unterstützung dieses Feldzugs durch eine republikfeindliche und rechtsorientierte Justiz zeigen eindrucksvoll, dass die Weimarer Republik mit starken und mächtigen Feinden konfrontiert war. Friedrich Ebert starb nur scheinbar eines natürlichen Todes. Tatsächlich war er Opfer einer erbarmungslosen Hetzjagd, die von den Feinden der Demokratie in Szene gesetzt wurde.
Diesen Zusammenhang betonte auch der Chefredakteur des liberalen Berliner Tageblatts, Theodor Wolff, als er schrieb, «alle, die in die Nähe des Reichspräsidenten traten, sind überzeugt, dass die bittere Erregung das alte Gallenleiden verschärft, dem Organismus die Widerstandsfähigkeit genommen, dem Tode den Weg geebnet hat. Dieser Mann, der sich aus dem kleinen Worte ‹Pflicht› eine große Lebensregel gemacht (…) hat, sah sich plötzlich nach Banditenmanier, aus dem Hinterhalte überfallen, von einem hinter dem Busche organisierten, mit falschen Zeugen arbeitenden Komplott umlauert, von unwürdigen, ihr Amt missbrauchenden Richtern dem leichtgläubigen Pöbel ausgeliefert, von jedem Schmierenblatt in den Gossenkot gezerrt.»[6]
Die den Deutschnationalen nahestehende Neue Preußische Zeitung (Kreuz-Zeitung) konterte, die in den liberalen Blättern angestellten Vermutungen, Eberts Tod sei der von rechts initiierten Verleumdungskampagne anzulasten, diene nur dazu, den toten Reichspräsidenten «nachträglich zu einem Märtyrer» zu erheben.[7]
Ebert selbst hatte den Zusammenhang deutlich gesehen und auch formuliert. Im letzten Gespräch mit dem preußischen Ministerpräsidenten, seinem Freund und Parteikollegen Otto Braun, hatte er erklärt, er fühle sich so krank, sehne sich nach Ruhe. «Ich leide sehr und würde längst in die Klinik gegangen sein, wenn der elende Prozess mich hier nicht noch festhielte. Da hat man nun wieder ein Subjekt als Zeugen aufgetrieben, das das unglaublichste Zeug über mich bekunden will. Wie die Dinge bei den Gerichten und in der Öffentlichkeit nun einmal liegen, kann ich nicht umhin, mich auch noch darüber einer Vernehmung zu unterziehen.»[8]
In der letzten Februarwoche sei Ebert «in verbitterter Energie» mit der Vorbereitung seines weiteren Kampfes gegen das Magdeburger Urteil beschäftigt gewesen, liest man in den Memoiren seines Staatssekretärs Otto Meissner. Trotz heftigster Schmerzen habe er sich am Schreibtisch gequält, «bis der endlich herbeigeholte Hausarzt eine fortgeschrittene Blinddarmentzündung feststellte und der eiligst hinzugebetene Professor Dr. Bier die Überführung in das Westsanatorium und die sofortige Operation anordnete».[9] Noch in der Nacht führte August Bier, ein renommierter Chirurg, die Operation persönlich durch. Sie verlief zufriedenstellend. Zwei Tage bestand durchaus Hoffnung, in den Morgenstunden des 28. Februar aber verschlechterte sich sein Zustand dramatisch. Mit einer Notoperation versuchten die Ärzte, eine Wende herbeizuführen. Ohne Erfolg.
Der Tod Friedrich Eberts war ein tiefer Einschnitt in der Geschichte der Weimarer Republik. Wenn man die Zeitungen dieser Tage liest, erscheint es, als habe die Republik für einige Zeit den Atem angehalten, um zu verstehen und sich zu orientieren. Den demokratischen Parteien und Kräften wurde wohl erst jetzt wirklich bewusst, wie viel sie Ebert zu verdanken und welchen Verlust sie nun zu verkraften hatten. Schon in den Revolutionsmonaten nach dem 9. November 1918 war es Eberts primäres Ziel gewesen, eine feste und nachhaltige Grundlage für die parlamentarische Demokratie zu schaffen, um damit dauerhaft dem Willen der Mehrheit der Bevölkerung zum Durchbruch zu verhelfen. Er war auch davon überzeugt, dass eine stabile parlamentarische Demokratie nur als gemeinsames Projekt der sozialdemokratischen und der bürgerlich-demokratischen Kräfte gelingen konnte.
Es war insbesondere Eberts geradliniger und entschiedener Politik als Reichspräsident zu verdanken, dass die Weimarer Republik bislang alle Aufstände, Putsche und Staatsstreichversuche überstanden hatte und zuletzt erkennbar in ruhigeres Fahrwasser gekommen war. Das wurde inzwischen auch im national-konservativen Lager weithin anerkannt. Die rein bürgerlich zusammengesetzte Reichsregierung hob in ihrer Kundgebung am Todestag hervor, dass Friedrich Ebert «unter Einsatz seiner starken Persönlichkeit erreichte, dass in den Wirren der Revolution die Einberufung der Nationalversammlung aus freier Wahl des deutschen Volkes beschlossen und durchgeführt und damit dem deutschen Staatsleben wieder eine gesetzliche Grundlage gegeben wurde. In schwerster Zeit hat er das Amt eines deutschen Reichspräsidenten mit vorbildlicher Gewissenhaftigkeit und staatsmännischer Klugheit verwaltet und sich dabei in der Heimat wie im Ausland reiche Anerkennung erworben.»[10]
Gustav Stresemann, der Vorsitzende der Deutschen Volkspartei (DVP), betonte, dass Eberts Tod eine Lücke reiße, von der niemand wisse, wie sie ausgefüllt werden soll, «dass uns jetzt der Mann fehlt, der einmal der Träger eines großen Ausgleichs in Deutschland hätte sein können. Mir scheint dieser Verlust der schwerste, weil wir diesen Ausgleich brauchen. Es dürfen sich nicht dauernd das alte und das neue Deutschland gegenüberstehen, es darf nicht dauernd heißen ‹hie Reichsbanner, hie Stahlhelm›. Es muss eine Verschmelzung zwischen dem Alten und dem Neuen gefunden werden. Und der Verstorbene wäre sicher einer von denjenigen gewesen, die sich für diese Aufgabe voll eingesetzt hätten.»[11] Die anfängliche Skepsis in der DVP gegenüber dem Reichspräsidenten sei durch dessen sachliche Amtsführung seit langem deutlich zurückgegangen und dann am 11. August 1922 vollends dahingeschmolzen, «als der Reichspräsident den Entschluss fasste, das Deutschlandlied aus der parteipolitischen Fehde herauszuheben und es wieder zum Lied der Deutschen zu machen. Schätzen wir diese Symbolik nicht gering! Wir flaggen vielfach gegeneinander. Wie traurig, wenn wir noch gegeneinander sängen. So haben wir wenigstens ein Nationallied, das alle Deutschen eint und das Symbol unseres Sechzigmillionenvolkes ist.»[12]
Friedrich Ebert entwickelt sich zu einem volksnahen Präsidenten. Inmitten von Schulkindern dankt er 1924 für die von amerikanischen Quäkern in der Not der Nachkriegszeit organisierten Kinderspeisungen.
Es fehlte wahrlich nicht an Nachrufen, die wie «Versuche einer posthumen Wiedergutmachung»[13] wirkten. «Ein Sohn des Volkes» titelte der Vorwärts, und meinte, späteren Geschlechtern werde es wie ein Märchen vorkommen, «dass es ein Mann aus der Tiefe des Volkes, ein Mann aus der unterdrückten Arbeiterklasse war, der zu dieser Höhe geschichtlicher Aufgabe und geschichtlichen Ruhms aufstieg». Eberts Bedeutung für die deutsche Nation und die deutsche Republik sei für jeden klar, «den nicht Parteihass verblendet. Er war der Repräsentant jener Kräfte, die nach dem Zusammenbruch im Kampf gegen bolschewistische und gegenrevolutionäre Strömungen den Weg zur deutschen Demokratie gingen.» Eberts Bedeutung für die Arbeiterklasse und den Sozialismus sei dagegen mehr umstritten, hieß es im Vorwärts weiter. Aber man habe nicht aus den Trümmern des Krieges und des Bürgerkrieges in einem Schritt «ein Reich der sozialen Gerechtigkeit und Wohlfahrt» errichten können. Die Sozialdemokraten müssten «Friedrich Ebert als eine Gestalt begreifen, die an einen Anfang gestellt ist». Jetzt gehe es darum, sein Erbe zu schützen. «Der Präsident ist tot – es lebe die Republik!»[14]
Die Trauerfeierlichkeiten in Berlin zeigten von Beginn an sehr eindrucksvoll, wie groß das Ansehen war, das Friedrich Ebert im demokratisch gesinnten Teil der Bevölkerung genoss. Als mitten in der Nacht zum 1. März, einem Sonntag, der Leichnam Eberts ins Reichspräsidentenpalais überführt werden sollte, hatte sich schon vor dem West-Sanatorium «eine ungeheure Menschenmenge» versammelt. Die feierliche Überführung hatte keinen offiziellen Charakter. Eigentlich war nur daran gedacht gewesen, dass ein kleiner Kreis von Persönlichkeiten, die dem Verstorbenen verwandtschaftlich oder dienstlich nahestanden, den Trauerzug begleiten sollte.
Der Leichenwagen war mit vier schwarzverhängten Pferden bespannt, der Sarg mit der Präsidentenflagge bedeckt. Ihm folgten in Wagen Verwandte, enge Freunde, der Reichskanzler, der Reichstagspräsident sowie Vertreter des Präsidentenbüros. Der Zug wurde von berittener Schutzpolizei eskortiert, und auch eine Ehrenkompanie der Reichswehr begleitete ihn. Völlig spontan und aus eigenem Entschluss kamen dann entlang der Wegstrecke vom West-Sanatorium zum Präsidentenpalais in der Wilhelmstraße zahllose Menschen zusammen, um dem Präsidenten die letzte Ehre zu erweisen. Eine immer mehr anwachsende Trauergemeinde begleitete den Zug auf seinem etwa drei Kilometer langen Weg. Ab dem Brandenburger Tor bildeten Mitglieder des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, des Wehrverbandes zum Schutz der Republik und ihrer demokratischen Veranstaltungen, ein Spalier, ihre gesenkten Fahnen waren mit schwarzem Trauerflor versehen.[15]
Im Präsidentenpalais angekommen, wurde der Sarg im Arbeitszimmer Eberts aufgebahrt. Unteroffiziere übernahmen die Ehrenwache, den Stahlhelm auf dem Kopf und die Degenspitze neben dem Gesicht. Am Tag darauf hatte die Bevölkerung Gelegenheit, persönlich vom Reichspräsidenten Abschied zu nehmen und sich in ein Kondolenzbuch einzutragen, und sie machte in großer Zahl Gebrauch davon. Der Vorwärts sprach von einer «Massenwanderung» durch die Wilhelmstraße.[16] Es waren besonders die einfachen und bescheidenen Leute, die dabei eine «rührende und echte und unverwischte, unorganisierte, unüberredete Trauer» um den toten Präsidenten aus dem Volk zeigten, schrieb Fred Hildenbrandt in seiner Reportage auf der Titelseite des Berliner Tageblatt.[17]
An den Berliner Trauerfeierlichkeiten für Friedrich Ebert am 4. März 1925 nahmen mehrere Hunderttausend Menschen teil, es war eine «republikanische Totenfeier, zugleich eine machtvolle Demonstration für die Republik».[18] Schon vor dem Staatsakt fanden Ebert-Erinnerungsfeiern der Berliner Schulen in der Kroll-Oper am Königsplatz sowie der Universität statt.
Der offizielle Teil begann um 15 Uhr mit einer Trauerkundgebung im Reichspräsidentenpalais. Die Trauerdekoration war bescheiden und sachlich gehalten, was dem Amtsverständnis Eberts entsprach, der nie Wert auf Glanz und Gloria gelegt hatte. Einziger Redner war Reichskanzler Luther. Er zielte vor etwa vierhundertvierzig geladenen Gästen vor allem darauf ab, Ebert gegen die Anfeindungen von rechts zu verteidigen, denen der Sozialdemokrat zu Lebzeiten ausgesetzt war. Er betonte Eberts Eintreten für die sogenannte Burgfriedenspolitik der Sozialdemokratie und sein fortlaufendes Engagement für die Bewilligung von Kriegskrediten. Ebert sei es zu verdanken, wenn schon zwei Monate nach dem «Zusammenbruch» die Wahlen zur Nationalversammlung stattfinden konnten. Luther hob auch Eberts überparteiliche Amtsführung hervor: «Seine große Richtlinie als Lenker des Staatswesens zielte darauf, im ganzen deutschen Volke das Gefühl der Verbundenheit mit dem Staate wachzurufen.» Ebert sei «ein wirklicher Führer unseres Volkes und Staates in schwerster Not und Zeit» gewesen.[19]
Während der Trauerfeier läuteten zu Ehren des Verstorbenen Berliner Glocken – aber beileibe nicht von allen Kirchtürmen. Den evangelischen Gemeinden war es vom Berliner Konsistorium freigestellt worden, sich am Ehrengeläut zu beteiligen, und so hingen die meisten Glocken evangelischer Kirchen reglos im Gestühl – ein Großteil der evangelischen Kirche war noch immer tief im traditionellen preußischen Bündnis von Thron und Altar gefangen, während die katholische Kirche sich unüberhörbar zur Republik bekannte.[20]
Der Trauerzug mit dem Leichnam Eberts bei seinem Halt vor dem Reichstagsgebäude. Symbolträchtig nehmen auch die Volksvertreter Abschied vom verstorbenen Präsidenten. Reichstagspräsident Paul Löbe würdigt dessen Verdienste.
Nach der Rede des Reichskanzlers wurde der Leichnam im Trauerzug durch die Wilhelmstraße am Brandenburger Tor vorbei zum Reichstagsgebäude geleitet. Auch die Straßen dieser Wegstrecke waren nur zurückhaltend mit Trauerschmuck versehen. In der Wilhelmstraße standen Lorbeerbäume, auf dem weiteren Weg Pylonen, deren Rauch die Stimmung prägte. Vor dem Reichstag hielt der Zug mit dem Sarg an der großen Freitreppe, wo der Reichstagspräsident, der Sozialdemokrat Paul Löbe, in einer kurzen Rede den Verstorbenen würdigte und dabei besonders Eberts staatspolitische Fähigkeiten lobte. Der Halt vor dem Sitz des Parlaments war auf Wunsch der SPD und des Reichstagspräsidenten eingelegt worden. Die Totenfeier sollte so auch zur Trauerfeier des Parlaments werden – und damit des ganzen Volkes, das die Parlamentarier repräsentierten.
«Das Volk» war am 4. März 1925 tatsächlich auf den Beinen. Staatssekretär Meissner schätzte in einem Bericht vom 10. März die Menge alleine auf dem Königsplatz und am Rande des Tiergartens auf bis zu eine Million Menschen.[21] Auch auf der letzten Berliner Strecke, dem Weg vom Reichstagsgebäude zum Potsdamer Bahnhof, hatte sich eine schier unüberschaubare Menschenmenge versammelt. Dort stand ein Sonderzug für «Friedrich Eberts letzte Fahrt»[22] bereit, der den Sarg im Verlauf der Nacht nach Heidelberg brachte, in die Heimatstadt Eberts. Unzählige Menschen kamen zur Bahnstrecke, die über Magdeburg, Göttingen, Bebra und Frankfurt am Main führte, um Abschied vom Reichspräsidenten zu nehmen. An den Haltestellen fanden sich Abordnungen der Städte, der SPD und des Reichsbanners ein, um ihm die letzte Ehre zu erweisen.[23]
Am 5. März um 9.32 Uhr kam der Sonderzug in langsamer Fahrt am Bahnsteig 1 in Heidelberg an. Polizeibeamte trugen den Sarg von dort zu einem Trauerwagen auf dem Bahnhofsplatz. Auch in Eberts Heimatstadt hatte man alles getan, um dem Empfang, dem Trauerzug durch die Stadt und der Beisetzung einen ernsten und würdigen Rahmen zu geben. Der Teilnahme der Bevölkerung war enorm – und keineswegs auf Heidelberg beschränkt. Mit neunundzwanzig Sonderzügen hatte die Reichsbahn Auswärtige nach Heidelberg gebracht, die zusammen mit den Einheimischen die Plätze und Straßen um den Bahnhof füllten. Der Trauerzug musste sich in drei Teilen in verschiedenen Straßen aufstellen. Etwa dreißigtausend Menschen folgten dann bei frühlingshaften Temperaturen dem Trauerwagen auf seinem Weg zum etwa einen Kilometer entfernten Bergfriedhof, wo Friedrich Ebert in der Nähe seiner Mutter Katharina seine letzte Ruhestätte finden sollte.
Die Gewerkschaften hatten vorgeschlagen, zur Stunde der Bestattung Eberts am 5. März um 11 Uhr im ganzen Land die Arbeit für eine Viertelstunde ruhen zu lassen[24] – und so kam es dann auch. Deutschland stand still, als der Sarg des Reichspräsidenten in die Erde gesenkt wurde. Vor Ort in Heidelberg waren Entscheidungs- und Würdenträger aus Berlin dabei, das diplomatische Korps und Vertreter der Länderregierungen, daneben viel regionale und lokale Prominenz. Bemerkenswert aber war vor allem die überwältigende Beteiligung der Bevölkerung. Nur zwei der drei Trauerzüge fanden während der Beisetzung auf dem Friedhof Platz, der dritte konnte erst ans Grab, als nach der Feier die beiden anderen Züge den Friedhof wieder verlassen hatten.
«Der so plötzliche Tod des Reichspräsidenten», fasste Otto Meissner, der Staatssekretär des Reichspräsidenten, das Geschehen zusammen, «rief im deutschen Volke, das sich erst jetzt bewusst wurde, was es in den Stürmen der letzten sechs Jahre diesem seinem Reichsoberhaupte verdankte, tiefe Anteilnahme und ehrliche Betrübnis hervor.»[25]
Ein Nachspiel mit bitter-galligem Geschmack erfuhren die Trauerfeierlichkeiten allerdings im Reichstag, als dort am 9. März 1925 über einen Gesetzentwurf zur Übernahme der Kosten beraten wurde, die durch das Ableben des Reichspräsidenten entstanden waren. Für die Kommunistische Partei (KPD) erklärte der Abgeordnete Hermann Remmele: «Wir sind der Auffassung, dass die Beerdigungskosten von denen übernommen werden sollen, in deren Interesse und in deren Auftrag der verflossene Reichspräsident seines Amtes gewaltet hat. Das ist die deutsche Bourgeoisie, die sich Ebert als den Diktator gegen das Proletariat, gegen die kämpfende Arbeiterklasse in Deutschland auserkoren hatte.» Mit Ebert sei «der Fluch des deutschen Proletariats ins Grab gegangen».[26] Schon seit der Niederschlagung von Räterepubliken und Arbeiteraufständen im Winter und Frühjahr 1919 schlug Ebert in der kommunistischen Bewegung blanker Hass entgegen.
Auch die DNVP lehnte es ab, die Kosten für das Begräbnis Friedrich Eberts aus der Staatskasse zu bezahlen.[27] Das war durchaus konsequent. Auch aus ihren Reihen kamen schließlich diejenigen Kräfte, die Ebert mit aller Energie unter Druck gesetzt und schließlich in den Tod getrieben hatten.
Am Ende beschloss das Parlament am 9. März 1925 gegen die Stimmen der extremen Linken und Rechten mit großer Mehrheit die Übernahme der Kosten. Sie betrugen 354.500 Reichsmark.[28]
3
Neuland – Wahl des Reichspräsidenten durch das Volk
Der Tod des ersten Reichspräsidenten Ende Februar 1925 kam überraschend, dass aber im Frühjahr 1925 die erste Wahl eines Reichspräsidenten durch das Volk anstehen sollte, war seit mehr als zwei Jahren bekannt. Eberts Amtszeit war am 24. Oktober 1922 vom Reichstag mit verfassungsändernder Mehrheit auf die Zeit bis zum 30. Juni 1925 begrenzt worden. Bis zum Tod des Amtsinhabers wurden allerdings keinerlei organisatorische Vorbereitungen für die anstehende Wahl getroffen. Offenbar nahmen die politischen Entscheidungsträger in Berlin den bevorstehenden Termin nicht wirklich ernst.
Das mag auf die Dauerbelastung des politischen Systems durch den Kampf gegen die Ruhrbesetzung, die Hyperinflation und die Staatsstreichpläne zur Errichtung einer Rechtsdiktatur im Jahr 1923 zurückzuführen sein. Man hatte bis ins Jahr 1925 hinein auch aufgrund der äußerst schwierigen Regierungsbildung nach den Reichstagswahlen am 4. Mai 1924 und am 7. Dezember 1924 genügend drängendere politische Probleme zu lösen. Es ist aber durchaus auch denkbar, dass die maßgeblichen politischen Parteien bis zum letzten Moment darauf spekulierten, dass die Volkswahl am Ende doch nicht im Frühjahr 1925 stattfinden, sondern ein weiteres Mal verschoben werden würde. Die vorangegangene Geschichte des Präsidentenamtes und seiner Besetzung gab zu solchen Spekulationen durchaus Anlass.
Ebert selbst war am 11. Februar 1919 von der in Weimar tagenden Verfassunggebenden Nationalversammlung mit 277 von 379 abgegebenen Stimmen zum Reichspräsidenten gewählt worden. Eine verbindliche Verfassung gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie wurde erst im Verlauf der folgenden Monate von der Nationalversammlung erarbeitet und verabschiedet.
Bei den Beratungen über den Verfassungsentwurf waren in der Nationalversammlung recht unterschiedliche Vorstellungen über das Amt eines Reichspräsidenten zutage getreten. Die USPD lehnte ein solches Amt rundweg ab und wollte «ein vom Parlament gewähltes mehrköpfiges Direktorium an die Spitze des Reiches stellen».[1] Alle bürgerlichen Parteien forderten dagegen geschlossen «einen plebiszitär legitimierten Präsidenten als massives Gegengewicht zum Parlament, zum Reichstag. Diese Position wurde von den bürgerlichen Parteien bei den Beratungen im Plenum der Nationalversammlung und im Verfassungsausschuss mit Entschiedenheit verfochten, ohne das geringste Schwanken, auch ohne Bereitschaft, Abstriche an ihrer Konzeption zu machen.»[2]
Dieselbe Position vertrat Friedrich Meinecke, einer der wenigen Vernunftrepublikaner unter den renommierten zeitgenössischen Historikern. Deutschland brauche «eine starke Zentralgewalt, die auch gegenüber dem Parteitreiben festen Kurs steuern konnte». Meinecke sprach von einem «Ersatzkaisertum» und war hocherfreut, als er feststellte, dass auch Friedrich Naumann und Max Weber «genau dieselbe Idee der starken plebiszitären Präsidentschaft aufgriffen und vertraten».[3]
Die Haltung der SPD war im Verlauf der Beratungen schwankend und inkonsequent. Bei der ersten Lesung des Verfassungsentwurfs im Plenum am 28. Februar 1919 sprach Richard Fischer als Hauptredner für die Partei, ein langjähriger SPD-Parlamentarier und ein grundsätzlicher Gegner der Institution eines Reichspräsidenten. Er benannte deutlich die Vorbehalte seiner Fraktion gegen einen «starken» Reichspräsidenten, kritisierte «u.a. die Volkswahl, die Amtsdauer von sieben Jahren und die Möglichkeit unbegrenzter Wiederwahl, den Oberbefehl über die Wehrmacht, das dem Reichspräsidenten zugestandene Recht zur Reichsexekution gegen Gliedstaaten und zur Aufhebung von Grundrechten sowie die Befugnis, den Reichstag aufzulösen.»[4] Fischers kritisches Fazit: «Die jetzige Verfassungsvorlage gibt also dem Reichspräsidenten eine höhere, uneingeschränktere Macht, als sie früher der Kaiser besaß, jedenfalls eine höhere Macht als sie der Präsident der französischen Republik oder der Präsident der Vereinigten Staaten von Nordamerika besitzt.» Fischer mahnte, nicht nur an Friedrich Ebert zu denken, wenn man über die Verankerung des Amtes in der Verfassung spreche: «Wir müssen mit der Tatsache rechnen, dass eines Tages ein anderer Mann aus einer anderen Partei, vielleicht sogar aus einer reaktionären, staatsstreichlüsternen Partei an dieser Stelle stehen wird. Gegen solche Fälle müssen wir uns doch vorsehen, zumal die Geschichte anderer Republiken höchst lehrreiche Beispiele in dieser Beziehung geliefert hat.»[5]
Die Sozialdemokratie unternahm allerdings keine ernsthaften Versuche, Bedenken aus ihren Reihen in den Verfassungstext einfließen zu lassen. Offenbar hielt man das angesichts der klaren und scheinbar unverrückbaren Position der bürgerlichen Parteien, auch der eigenen Koalitionspartner, für aussichtslos. Im Juli kam es mit Blick auf die Schlussberatungen noch zu einem zaghaften Versuch, wenigstens die Volkswahl des Reichspräsidenten zu verhindern. Ein Antrag der SPD-Fraktion sah vor, dass der Reichspräsident gemeinsam vom Reichstag und vom Reichsrat gewählt werden sollte. Doch dieser Antrag wurde schließlich zurückgezogen.[6] Es blieb bei der Volkswahl des Reichspräsidenten, die dem Amtsinhaber eine gesonderte, eigenständige demokratische Legitimation neben der des Reichstags bescherte und die Möglichkeit eröffnete, das Präsidentenamt zum Gegenpol des Parlaments zu machen.
Die Ausgestaltung des Amtes verstärkte diese Tendenz noch. Artikel 25 der Verfassung räumte dem Reichspräsidenten das Recht ein, den Reichstag aufzulösen, allerdings «nur einmal aus dem gleichen Anlass». Der Reichspräsident ernannte und entließ den Reichskanzler, auf dessen Vorschlag auch die Reichsminister (Art. 53). Ein Kanzler oder Minister musste allerdings zurücktreten, wenn der Reichstag das verlangte (Art. 54). Der Präsident vertrat das Reich völkerrechtlich (Art. 45) und hatte den Oberbefehl über die Streitkräfte (Art. 47). Er konnte ferner ein vom Parlament beschlossenes Gesetz, mit dem er nicht einverstanden war, einem Volksentscheid unterwerfen (Art. 73).
Besonders brisant waren die Bestimmungen des Artikels 48 der Verfassung, die den Reichspräsidenten ermächtigten, Maßnahmen gegen ein Land zu ergreifen, das die Verfassung oder Reichsgesetze verletzte. Auch militärisches Eingreifen, die sogenannte «Reichsexekution», war dadurch abgedeckt. Nach diesem Artikel konnte der Präsident auch den «Ausnahmezustand» feststellen und dann, wenn er «die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet» sah, Militär im Inneren einsetzen und elementare Grundrechte (u.a. Freiheit der Person, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit) «vorübergehend» außer Kraft setzen. Maßnahmen des Reichspräsidenten mussten allerdings von einem Mitglied der Reichsregierung gegengezeichnet werden, und der Reichstag konnte mit Mehrheit eine Aufhebung solcher Maßnahmen verlangen. Um diktatorischen Missbrauch des Artikels 48 zu verhindern, war ein Ausführungsgesetz geplant, das allerdings nie zustande kam.
Der Reichspräsident wurde in direkter Wahl für die Dauer von sieben Jahren vom Volk gewählt. Eine Wiederwahl war möglich (Art. 43). Eine Abwahl war nur durch eine Volksabstimmung zu erreichen; diese konnte der Reichstag mit Zweidrittelmehrheit auf den Weg bringen (Art. 43). Erhielt der Reichspräsident in der Volksabstimmung allerdings das Vertrauen des Volkes, so galt er als erneut für sieben Jahre gewählt, und der Reichstag wurde aufgelöst. Der Reichstag hatte das Recht, den Reichspräsidenten wegen schuldhafter Verletzung der Verfassung oder eines Reichsgesetzes vor dem Staatsgerichtshof anzuklagen. Den Antrag mussten mindestens hundert Abgeordnete unterzeichnen. Ein entsprechendes Urteil hatte die Absetzung des Präsidenten zur Folge (Art. 43).
Mit der Verabschiedung der Verfassung stand im August 1919 sofort die Frage im Raum, wann die erste Wahl eines Reichspräsidenten nach den Bestimmungen dieser Verfassung durchgeführt werden sollte. Friedrich Ebert war ja im Februar «nur» durch die Nationalversammlung zum vorläufigen Präsidenten gewählt worden. Im Zusammenhang mit der Verabschiedung der Verfassung war allerdings weder ein Termin für die Wahl des Reichspräsidenten noch ein Termin für die Wahl eines Reichstages festgelegt worden. Die Nationalversammlung konnte folglich völlig frei mit einfacher Mehrheit darüber entscheiden, wie lange sie selbst als Parlament tagen wollte und wann die erste Reichspräsidentenwahl durch das Volk stattfinden sollte.
Friedrich Ebert strebte schon bald nach Verkündung der Verfassung am 14. August 1919 eine Volkswahl an, um der Verfassung zu genügen und seiner Präsidentschaft die entsprechende Legitimation zu verschaffen. Auch im Lager der politischen Rechten begann man sofort auf die Volkswahl zu drängen, weil man gute Chancen für einen rechtsorientierten Kandidaten sah. Bereits am 24. August, nur drei Tage nach der Vereidigung des amtierenden Reichspräsidenten auf die Verfassung, beschäftige sich die Führungsspitze der Deutschen Volkspartei mit der Volkswahl und war einhellig der Meinung, «dass nur eine Kandidatur, die das ganze Volk hinter sich habe, in Frage kommen könne, nämlich die Hindenburgs».[7] Man beschloss, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, und so erschien in der Nationalliberalen Correspondenz am 26. August eine Notiz zu «der nach der Verabschiedung der Reichsverfassung bevorstehenden Wahl des deutschen Reichspräsidenten». Sie gipfelte in der Aussage, für «alle deutschbewussten Männer und Frauen» komme nur ein Name in Betracht, «der uns Sinnbild deutscher Pflichttreue im Krieg, Sieg und Not bedeutet: Hindenburg. Das deutsche Volk muss die Pflicht in sich fühlen, den Generalfeldmarschall zu bitten, die höchste Würde, die es zum ersten Mal in seiner Geschichte zu vergeben hat, als vaterländischen Dank entgegenzunehmen.»[8] Der «Sieger von Tannenberg» und «Nationalheros» des Weltkriegs sollte Reichspräsident der deutschen Republik werden. Gustav Stresemann, der Parteivorsitzende, stand voll und ganz hinter diesem Vorstoß. Er hielt es, wie er in einem Brief an den Feuilletonredakteur der Kölnischen Zeitung, Otto Brües, schrieb, «für ganz selbstverständlich, dass die DVP von jedem Gedanken absieht, über irgendeine andere Präsidentschaft überhaupt zu diskutieren».[9] Die DNVP schloss sich dieser Initiative der DVP an.
Hindenburg selbst war keineswegs abgeneigt. Er war Anfang Juli 1919 aus dem Militärdienst als Chef der Obersten Heeresleitung ausgeschieden und hatte sich nach Hannover zurückgezogen, wo er bereits vor dem Beginn des Weltkriegs mit seiner Frau als Pensionär gewohnt hatte. Sein letzter Generalquartiermeister Wilhelm Groener hatte ihn in einer Abschiedsrede als «Träger der großen stillen Kräfte der Vergangenheit für die Zukunft unseres Volkes» gewürdigt[10] – und so sah sich Hindenburg wohl auch selbst. Gerhard Schneider, der Hindenburgs Jahre in Hannover intensiv untersucht hat, kommt zu dem Urteil: Hindenburg strebte «fast vom ersten Tag seiner Rückkehr nach Hannover als Gegner dieser Republik das höchste Amt in dieser Republik an».[11]
Konkret wurden Hindenburgs Ambitionen, nachdem er am 18. November 1919 vor dem Untersuchungsausschuss aufgetreten war, den die Nationalversammlung eingesetzt hatte, um die näheren Umstände der deutschen Niederlage im Krieg zu klären. Hindenburg hatte bei diesem ersten Auftritt im Reichstag erklärt, Ursache der Niederlage sei «die heimliche planmäßige Zersetzung von Flotte und Heer und die revolutionäre Zermürbung der Front» gewesen. Ein englischer General habe zu Recht gesagt: «Die deutsche Armee ist von hinten erdolcht worden.» Die politische Wirkung dieses aufwändig inszenierten Auftritts war enorm. «Hindenburgs Äußerungen schlugen ein wie eine Bombe.»[12] Der Feldmarschall a. D. galt als nahezu unanfechtbare Autorität und versetzte mit seiner Aussage die Dolchstoßlüge in den Stand der «Wahrheit» – was ein Jahrhundert später, in Zeiten von fake news, von erschreckender Aktualität ist.
Hannover stellt dem «Nationalheros» kostenfrei eine Villa in der Seelhorststraße zur Verfügung, in die Hindenburg nach seinem Ausscheiden aus dem Militärdienst am 4. Juli 1919 einzieht. Hier wohnt er bis zu seinem Amtsantritt als Präsident.
Unmittelbar nach seinem Auftreten im Untersuchungsausschuss empfing Hindenburg im Haus des DNVP-Rechtsaußen und ehemaligen Vizekanzlers Karl Helfferich, wo er anlässlich seines Auftritts im Reichstag eine Woche logierte, die Führer der DNVP und der DVP, Hergt und Stresemann. Auf deren Bitten hin erklärte er sich schließlich bereit, sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen zu lassen. Allerdings verlangte er, dass «außer den beiden nationalen Parteien sämtliche nationalen Kreise hinter ihn treten» müssten, und machte seine Zusage noch von der Einwilligung des ehemaligen Kaisers abhängig.[13]
Um die Jahreswende signalisierte Wilhelm II. sein Einverständnis, aber Hindenburg zögerte noch mehr als zwei Monate. Er war nicht wirklich entschieden, «weil er befürchtete, dass sein symbolisches Kapital durch eine Reichspräsidentschaft aufgezehrt werden könnte.»[14] Solche Befürchtungen waren durchaus berechtigt. Der Status des Nationalheros konnte im Alltagsgeschäft der Politik leicht auf der Strecke bleiben. In einem Brief an seinen König und Kaiser äußerte Hindenburg am 5. Januar 1920 aber auch «große Bedenken» im Hinblick auf den Zeitpunkt und die Zusammenarbeit mit Regierung und Parlament: «Ich kann mich von der Überzeugung nicht freimachen, dass mit meiner Wahl die letzte Patrone zu früh und dafür vergeblich verschossen würde, dass ich selbst, da ich in meiner Stellung allem Übel gegenüber nahezu machtlos wäre, also den an mich geknüpften Erwartungen nicht voll entsprechen könnte – bald auch derartig von meinen Freunden aufgegeben würde, dass das letzte Ideal des deutschen Volkes kläglich unterginge.»[15]
Wir wissen nicht, warum er am Ende dennoch einer Kandidatur zustimmte. Am 6. März 1920 teilte er jedenfalls Wilhelm II. seine endgültige Bereitschaft mit, weil nur so, wie er schrieb, «dem Vaterlande Zucht und Ordnung im Innern und Ansehen nach außen wiedergegeben werden können».[16] Noch am selben Tag kommentierten die Zeitungen der Rechtsparteien in ihren Abendausgaben Hindenburgs Bereitschaft zur Kandidatur: «Wenn einer geeignet ist, die Hoffnungen zu erfüllen, die das Volk in den neuen Reichspräsidenten setzt, so ist es Hindenburg, der, über allen politischen Gegensätzen und allem Streit der Parteien stehend, das Vertrauen des ganzen Volkes genießt und in seiner Person den Einheits- und Ordnungswillen aller wahren Freunde unseres Vaterlandes verkörpert.»[17]
Ab dem 7. März berichten auch alle großen demokratischen Blätter über die Hindenburg-Kandidatur und setzten sich mit ihr auseinander. Die linksliberale Frankfurter Zeitung erklärte, diese Kandidatur sei eine «deutschnationale Parteisache», das Berliner Tageblatt sprach von einer «rein monarchistischen Kandidatur» und ergänzte: «Es wäre für die innere wie für die auswärtige Politik folgenschwer, wenn der Wahlkampf durch diese aussichtslose monarchistische Kandidatur verschärft würde.» Die Vossische Zeitung meinte: «Der Generalfeldmarschall sollte allen guten Deutschen zu hoch stehen, als dass er in die parteipolitischen Kämpfe hineingezogen wird».[18]
Über einen Wahltermin war zu diesem Zeitpunkt noch nicht ernsthaft gesprochen worden. Die Parteien der Weimarer Koalition hatten keine Eile damit, ein neues Parlament und den Reichspräsidenten wählen zu lassen.[19] Bei der Wahl der Nationalversammlung im Januar 1919 hatte die demokratische Aufbruchsstimmung SPD, Zentrum und DDP eine Dreiviertelmehrheit beschert. Seither hatte sich die Stimmung im Land jedoch stark verändert – die katastrophale wirtschaftliche Lage, der Versailler Vertrag und die Dolchstoßlüge hinterließen deutliche Spuren. Jetzt ging es um die Frage, wie tief die demokratischen Parteien bei einer Neuwahl abstürzen würden. Da in die Verfassung keine Wahltermine aufgenommen worden waren, konnte die Nationalversammlung mit einfacher Mehrheit entscheiden, wann die erste Volkswahl des Reichspräsidenten und die Wahl des Reichstages stattfinden sollten. Man konnte sich dabei durchaus noch Zeit lassen. Ein Verstoß gegen ungeschriebene Gepflogenheiten parlamentarischer Demokratien lag zu diesem Zeitpunkt bei beiden Wahlakten nicht vor.
Dennoch begann insbesondere die Presse der Deutschen Volkspartei unmittelbar nach dem 6. März für Hindenburgs Wahl zu trommeln und baute damit zugleich Druck auf, die erste Volkswahl des Reichspräsidenten möglichst bald durchzuführen. Hindenburg, hieß es, sei als Einziger in der Lage, das deutsche Volk wieder zu vereinen und aus der Not zu führen. Hindenburg, der Retter, nicht nur im Krieg, sondern auch in Friedenszeiten.
Hindenburg war ein durchaus ernstzunehmender Konkurrent für Friedrich Ebert. Der sozialdemokratische Vorwärts reagierte wohl auch deshalb erkennbar gereizt und drohend: «Wir haben niemals Lust verspürt, dem geschlagenen Feldherrn seinen Misserfolg vorzuhalten und würden es auch jetzt nicht tun, wenn er in der Haltung verharrte, die einem Manne geziemt, der den größten und verlustreichsten Krieg der Weltgeschichte zum unglücklichen Abschluss für Deutschland gebracht hat. Erhebt dieser Mann aber den Anspruch, an die Spitze des Landes zu treten, so zwingt er uns, dem Hindenburg der deutschnationalen Legende den wirklichen Hindenburg öffentlich gegenüberzustellen.»[20]
Am 11. März brachte der Vorwärts die Idee einer Verfassungsänderung ins Spiel, die das Ziel hatte, den Reichspräsidenten durch den Reichstag und nicht direkt durch das Volk wählen zu lassen. Die Presse der politischen Rechten reagierte in höchstem Maß empört.[21]
Die Kontroverse endete schlagartig, als in den frühen Morgenstunden des 13. März 1920 der Kapp-Lüttwitz-Putsch begann, ein Staatsstreich, der von der extremen Rechten seit langem vorbereitet worden war. Gerüchte über einen bevorstehenden Putsch hatten sich in den Tagen vor dem 13. März immer mehr verdichtet, so dass es dem Reichspräsidenten und den Sozialdemokraten in der Regierungsspitze gelang, einer Verhaftung zu entgehen und rechtzeitig aus Berlin zu fliehen – zunächst nach Dresden, dann nach Stuttgart. Truppen der Reichswehr weigerten sich, gegen die Putschisten vorzugehen. Mitglieder der DNVP unterstützten den Staatsstreich, auch Teile der DVP zeigten Sympathie. Die Parteiführung der DVP unter Gustav Stresemann beschloss, den Putsch nicht zu verurteilen, forderte aber die schnelle Wiederherstellung geordneter Verhältnisse.
Groener war zwar inzwischen nicht mehr im Dienst, wandte sich aber aus politischen Erwägungen dennoch an Hindenburg, den er nach wie vor als den einzigen Fels in der Brandung der Übergangszeit sah. Im Interesse einer geordneten Weiterentwicklung des Staates musste der Putsch nach Groeners Überzeugung beendet werden, und er sah in Hindenburg den Einzigen, der dies rasch erreichen konnte. Groener sandte ein Telegramm nach Hannover, «in dem er der Hoffnung Ausdruck gab, dass ein Wort des Feldmarschalls genüge, die Reichswehr auf den verfassungsmäßigen Boden zurückzuführen».[22] Offensichtlich sah sich Groener noch immer in der Rolle des politischen Beraters, der Hindenburg den Weg wies – wie schon in der Zeit von Oktober 1918 bis Juli 1919.
Hindenburg ließ sich Zeit bis zum 17. März, als das Scheitern des Putsches bereits offensichtlich war, bevor er aktiv wurde. Und selbst dann war er nicht imstande, sich in klaren Worten von den Putschisten zu distanzieren und die Reichswehr aufzufordern, sich verfassungsgemäß zu verhalten. Die Erklärung, die er durch das Wolff’sche Telegrafenbüro verbreiten ließ, lautete: «Die Truppe ist verpflichtet, die Ruhe und Ordnung aufrecht zu erhalten. Ich hoffe daher als alter Soldat fest, dass das Offizierkorps (sic!) und die Mannschaften sich für Erfüllung dieser ernsten Pflicht frei von allen Nebengedanken und jedem Parteiinteresse vertrauensvoll geschlossen hinter ihre Führer stellen. Einigkeit in Volk und Heer sind unerlässlich für unser Fortbestehen.»[23] Kein Wort über den Putsch, kein Wort über die Verpflichtung der Reichswehr auf die Verfassung, kein Wort über den Reichspräsidenten, der nicht zuletzt auch Oberbefehlshaber der Reichswehr war. Die Reichswehr, an die Hindenburg sich wandte, war ein Staat im Staat, völlig losgelöst von der Republik, der die Truppe eigentlich zu dienen hatte.
Hindenburg war es jedenfalls nicht zu verdanken, dass der Putsch rasch zusammenbrach. Der Staatsstreich scheiterte aufgrund eines Generalstreiks, zu dem Gewerkschaften und Sozialdemokratie aufriefen, sowie an der abwartenden Haltung der Ministerialbürokratie, die sich weigerte, Kapps Anordnungen nachzukommen. Innerhalb kürzester Zeit stand das Land still, und nach fünf Tagen waren die Putschisten gezwungen aufzugeben.
Das Land rückte dennoch weiter nach rechts, und als Erfolg für die Putschisten muss wohl verbucht werden, dass die ursprünglich frühestens für den Herbst vorgesehene Reichstagswahl nun bereits auf den 6. Juni 1920 terminiert wurde. Auch im Hinblick auf die erste Volkswahl des Reichspräsidenten gab es jetzt Bewegung. Die Nationalversammlung beschloss am 22. April 1920 das Gesetz über die Wahl des Reichspräsidenten, und die Parteien verständigten sich darauf, dass der neue gewählte Reichstag den Termin für die Volkswahl festsetzen solle.
Hindenburg legte freilich den Gedanken einer Kandidatur nach und nach zu den Akten und wies in Briefen darauf hin, dass er alle Bedenken teile, die von Freunden in den vorangegangenen Wochen vorgebracht worden seien. Er habe nur aus «Pflichtgefühl» zugesagt, und aufgrund der Folgen des 13. März würde nun seine Wahl «mehr schaden als nützen». Er könne jetzt «nicht mehr, wie geplant, der beruhigende und einigende Mittelpunkt werden».[24]