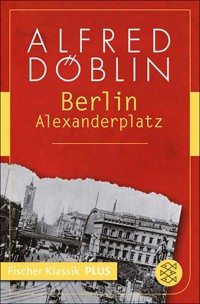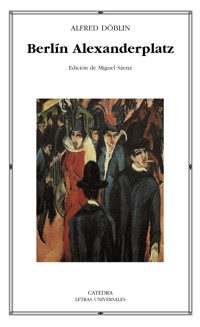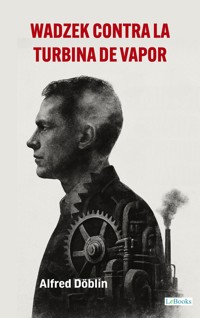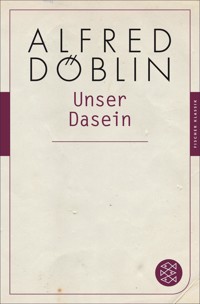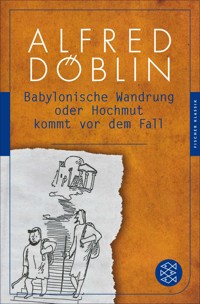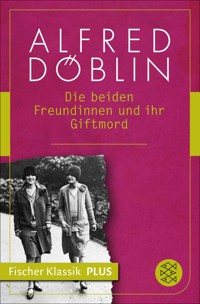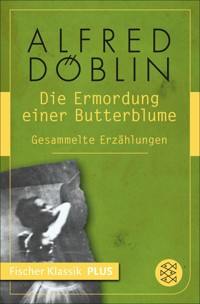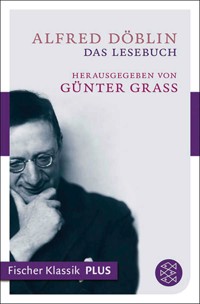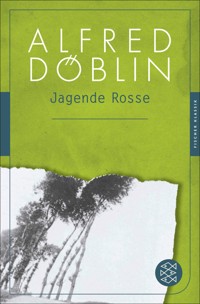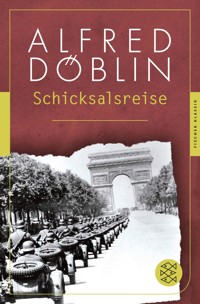
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Döblins bewegendes Zeugnis aus dem Exil Frankreich, Spanien, Portugal, Amerika – mit großer erzählerischer Kraft schreitet Döblins ›Schicksalsreise‹ die Orte des Exils ab und gibt uns eine Vorstellung von Verfolgung, Ungewissheit und Verlust. Exil – das ist für Döblin die Erfahrung radikaler Kontingenz. Halt bietet ihm dabei die christliche Religion, aber auch das Schreiben dieses für die Nachwelt so wichtigen Buchs. Mit einem Nachwort von Susanne Komfort-Hein
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Alfred Döblin
Schicksalsreise
Fischer Klassik PLUS
Über dieses Buch
«Das Dach über unserm Kopf wurde vom Sturm abgerissen, der Fußboden unter uns brach zusammen. In alle Winde wurden wir zerstreut.« – Alfred Döblins ›Schicksalsreise‹ aus dem Jahr 1949 ist ein bewegender autobiographischer Text über die Haltlosigkeit und Verlorenheit des Exils. Auch wenn der Ich-Erzähler als assimilierter deutscher Jude im Exil zum Katholizismus konvertiert und Halt im christlichen Glauben sucht, zieht sich die Erfahrung von Verlorenheit und Kontingenz doch über alle Stationen hinweg, von Frankreich über Kalifornien bis hin zur Rückkehr ins fremd gewordene Nachkriegsdeutschland, durch den gesamten Text. Von einem fundamentalen Vertrauensverlust ins autobiographische Genre geprägt, erweist sich ›Schicksalsreise‹ als vielschichtige und widersprüchliche Verbindung von »Bericht und Bekenntnis«, mit der Döblin der Katastrophe des 20. Jahrhunderts ein beeindruckendes literarisches Denkmal setzt.
Alfred Döblinwurde am 10. August 1878 in Stettin an der Oder geboren. Nach dem Studium der Medizin arbeitete er fünf Jahre lang als Assistenzarzt und eröffnete 1911 in Berlin eine eigene Praxis. Nach der Veröffentlichung erster Erzählungen, darunter ›Die Ermordung einer Butterblume‹, erschien Döblins erster großer Roman, ›Die drei Sprünge des Wang-lun‹, im Jahr 1915/16 bei S. Fischer. Sein größter internationaler Erfolg war der 1929 ebenfalls bei S. Fischer publizierte Roman ›Berlin Alexanderplatz‹. 1933 flüchtete Döblin vor dem Nationalsozialismus nach Zürich. Die meiste Zeit seiner Jahre im Exil verbrachte er in Frankreich und den USA. Aus dem Exil zurückgekehrt, lebte Döblin zunächst wieder in Deutschland, zog dann aber 1953 mit seiner Familie nach Paris. Alfred Döblin starb am 26. Juni 1957.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403014-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Erstes Buch Europa, ich muß dich lassen
Teil I Die Fahrt ins Unbekannte
1. Kapitel Paris in Erwartung des Schlages
2. Kapitel Flucht durch Frankreich
3. Kapitel Auf der Suche nach meiner Familie
Teil II Gestrandet
4. Kapitel Im Flüchtlingslager
5. Kapitel Bilder aus den Baracken
6. Kapitel Ich prüfe und befrage mich
7. Kapitel Ein Zeitungsartikel und anderes
8. Kapitel Der Bann löst sich
9. Kapitel Und dies war das Lager
10. Kapitel Eine andere Flucht
Teil III Rettung
11. Kapitel In Toulouse
12. Kapitel Marseille oder die Jagd nach Visen
13. Kapitel Liebliches Spanien
14. Kapitel Portugal
Zweites Buch Amerika
15. Kapitel Wie es uns in Hollywood erging
16. Kapitel Es ruht nicht in mir
17. Kapitel Kirche und Religion von innen
18. Kapitel Nachher
19. Kapitel Kriegsende und eine Nachricht
20. Kapitel Das Abfahrtssignal
Drittes Buch Wieder zurück
21. Kapitel Europa
22. Kapitel In Baden-Baden
23. Kapitel Wie das Land 1946 aussieht
24. Kapitel Sie hätten Chancen gehabt
25. Kapitel Kleine Fahrt nach Mainz
26. Kapitel Wiedersehen mit Berlin
27. Kapitel Gang vom Bahnhof Friedrichstraße nach den Linden
28. Kapitel Am Alexanderplatz
Rede und Gegenrede
29. Kapitel 1948
30. Kapitel Ende des Berichts und Ausklang
Das Vergehen der Bäume
Das Vergehen der Menschen
Der Wille aller Zeitlichkeit
Glück, Schönheit, Liebe in diesem Leben
Einer neuen besseren Aufklärung entgegen
Anhang
Editorische Notiz
Daten zu Leben und Werk
Nachwort
»Wer ich bin, was ich bin, was mit mir ist, das weiß ich nicht.«
»Wir waren aus einem kleinen Paradiese vertrieben worden«
»Die Fahrt ins Unbekannte« – Exil und Odyssee einer Selbstsuche
»Und was war mit dem Judentum?«
»Als ich wiederkam, da – kam ich nicht wieder«
Literaturhinweise
1. Texte von Alfred Döblin
2. Texte über Alfred Döblin und sonstige Literatur
Alfred Döblin Gesammelte Werke Herausgegeben von Christina Althen
Diese Schrift widme ich
meiner Frau Erna,
die den schiffbrüchigen Robinson,
wie man lesen wird,
am Strand aufhob und ihn,
dazu sich selbst
und unsern Jüngsten rettete.
Es war unser Schmerz,
dass wir nicht noch andere,
die uns am Herzen lagen,
mitnehmen konnten.
Erstes Buch der Schicksalsreise geschrieben 1940–1941 in Hollywood in Kalifornien, zweites und drittes Buch 1948 in Baden-Baden
Erstes BuchEuropa, ich muß dich lassen
Teil IDie Fahrt ins Unbekannte
1. KapitelParis in Erwartung des Schlages
Das Radio meldet
Am 16. Mai 1940, einem Donnerstag, schloß ich vormittags eine Arbeit ab, die mich lange Monate beschäftigt hatte. Das Radio tönte aus dem Nebenzimmer. Der Ansager meldete: die »Tasche« an der Nordfront der französischen Armee hätte nicht geschlossen werden können. Die Meldung sagte nichts von einem Durchbruch, von einem Zerreißen der Front, aber wer Ohren hatte zu hören, hörte. Die Feder wurde mir aus der Hand geschlagen.
Ich war nicht unvorbereitet. Tagelang vorher hatten sich schon seltsame Gestalten durch unsern Wohnort, St-Germain bei Paris, bewegt. Der herrliche Park stand in sommerlicher Blüte, die Wege waren voller Ausflügler und Spaziergänger, die Kinder spielten auf den Plätzen. Aber auf den breiten Chausseen, die den Park und die kleine Stadt durchzogen, rollten merkwürdige, unheimliche Wagen, nicht Tanks, nicht Kanonen, sondern – Autos, sonderbar bepackt und verschnürt, mit Betten und Matratzen auf den Dächern, mit Hausrat behangen. Und im Innern, zusammengedrängt, ganze Familien.
Das waren Flüchtlinge aus Belgien und Nordfrankreich. Sie trugen den Schrecken in unsere friedliche Landschaft. Zwischen den Matratzenautos fuhren langsame Bauernwagen, mit Pferden und mit Ochsen bespannt. Darauf lagen und saßen im Heu die Alten und die kleinen Kinder, und voran und hinterher marschierten die kräftigen Männer und Frauen mit großen Schritten. Offenbar waren ganze Dörfer in Bewegung. Viele Männer und Frauen, Bauern in Schaftstiefeln, schoben Karren vor sich mit ihren kleinen Kindern und dem Arbeitsgerät. Das alles hielt vor dem Bahnhofsplatz und wurde verpflegt.
Und einmal hielten auf dem Bahnhofsplatz am späten Abend auch militärische Kraftwagen. Oben hockten junge Soldaten und rauchten. Sie sprachen nicht und sangen nicht. Sie blickten stumm und trübe auf uns herunter. Es hieß, sie kamen von der Front und gingen in Ruhestellung. Aus einem siegreichen Kampf kamen sie offensichtlich nicht.
Als nun am 16. Mai der Speaker mit verschleierter Stimme den schrecklichen Durchbruch im Norden meldete und im Heeresbericht der verhängnisvolle Name »Sedan« auftauchte, fuhr ich nach Paris und setzte mich mit einem Freund in Verbindung, der bei einer Behörde arbeitete, mit der ich selbst in loser Verbindung stand. Wir berieten zusammen, was tun. Er hatte einen hohen Offizier zum Verwandten und war immer gut orientiert. Sein eigener Fall lag einfach. Im Ernstfall würde er mit den Behörden abtransportiert werden.
Mir riet der sehr ernste, kluge Mann, jedenfalls das Schlimmste ins Auge zu fassen und die Abreise von Paris nicht zu lange hinauszuziehen. Denn Paris könne von einem Tag zum andern »Kriegsgebiet« und evakuiert werden. Und wie im letzten Augenblick der Abtransport von Hunderttausenden aussehen werde, das könnte ich mir ausmalen, nach den Erlebnissen des letzten Jahres. Als mein Freund mich so drängte, mit meiner Familie sofort abzureisen und ich mich nicht geneigt zeigte, kamen wir zu folgendem Abkommen: Er würde mich sofort benachrichtigen, sobald ihm etwas Schlimmes zu Ohren käme. Alsdann sollten meine Frau und das Kind unter allen Umständen abreisen. Mir selbst schlug er vor, dazubleiben und mit der Behörde im letzten Augenblick abzufahren. Die Behörden waren damals angewiesen, ihren Platz nur im äußersten Fall und nur auf Befehl der Regierung zu räumen. Dabei verblieben wir. Und so wartete ich unruhig und mit wachsender Spannung in St-Germain, bis am 25. abends der verabredete Anruf kam. Wir rüsteten uns schon zum Schlafengehen. Mein Freund trieb mich mit erregter Stimme, sofort den letzten Zug in die Stadt hinein zu nehmen. Es könnte passieren bei der ungeheuren Geschwindigkeit der feindlichen Panzerwagen, daß wir schon morgen von der Stadt abgeschnitten seien. Aber – wir blieben noch die Nacht über. Wir setzten uns am frühen Morgen in Bewegung, zu dritt, zur Flucht aus unserm Zufluchtsort. Einen schweren Koffer hatten wir vorausgeschickt, wir hofften, daß er ankam. Wir selbst gingen jeder mit einem Handkoffer bewaffnet, der Junge mit Rucksack und mit einer Decke für die Nacht.
So sah auf dieser Flucht unsere Habe aus: ein großer Koffer, zwei kleine und der Rucksack. Wie ein Tier, das sich häutet, hatten wir seit Kriegsbeginn alles von uns geworfen: zuerst die Möbel einer ganzen Wohnung mit der Bibliothek – sie lagerten irgendwo – dann die Wäsche, Kleidungsstücke, einen restlichen Bücherbestand; sie blieben in St-Germain. Wir schrumpften immer mehr auf das direkt von uns Tragbare ein. – Aber wir trugen noch zuviel.
Wir sind vormittags in Paris angekommen, in dem alten heiteren Paris. Die wunderbare Stadt nahm uns mit dem gleichen Lächeln wie immer auf. Sie schien noch nicht zu bemerken, was vorging – und ihr bevorstand. Die Menschen saßen auf den Terrassen der Cafés und beobachteten verwundert einige schwer bepackte Matratzenautos, die sich unter die anderen mischten.
Es werden aber nicht zwei Wochen vergehen, da wird die prächtige und glänzende Stadt von einem Todeshauch berührt werden. Aus zahllosen Garagen werden sich ähnlich beladene Fahrzeuge lösen. Und nach drei Wochen wird sich eine schwere Menschenwelle aus der Stadt erheben und sich über dieselben Chauseen werfen, die jetzt die Belgier ziehen.
Wir hielten uns an diesem Tage in einer Wohnung im Zentrum der Stadt auf, wo mein Freund Möbel abgestellt hatte. Dann spät abends begleitete ich meine Frau und den Jungen zur Bahn.
Unheimlich der Anblick des Riesenbahnhofs bei Nacht. Er lag in Kriegs Verdunklung scheinbar verlassen. Bei seinem Betreten aber wurden wir hineingerissen in ein wildes Menschengetriebe. Das waren hier fast alles Familien. Es sah aus, als drängten sie zu Ferienzügen. Aber hier gab es keine Spur von Fröhlichkeit. Man hatte im Innern der Stadt den Eindruck haben können: es ist ja alles nicht so schlimm, die Zeitungen übertreiben, der Krieg ist noch weit entfernt. Hier – sah es anders aus.
Jeder Zug nach dem Süden lief mit einem Vor- und Nachzug. Die Menschen stürzten in die Wagen, saßen und standen mit ihren Kindern auf den Korridoren. Familien, die sich sonst mit der billigsten Klasse begnügten, hatten ihr Geld für die erste und zweite hingeworfen, um noch mitzukommen.
Die Schaffner rannten den Bahnsteig entlang. Sie riefen »en voi-ture«. Ich nahm herzlich Abschied von meiner Frau. Das Kind weinte an meinem Gesicht. Es hielt mich fest und sagte: »In einer Woche kommen wir wieder.« Es wollte gar nicht weg, es dachte an seine Spielgefährten in St-Germain und an seinen lieben Hund, die Zita. Wir beiden Erwachsenen dachten: Die Reise ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Man tut es des Kindes wegen, vielleicht sind wir zu ängstlich.
Aber ein dunkles Vorgefühl, eine Ahnung überfiel mich, als ich dann allein aus dem Bahnhof wieder auf die finstere Straße trat: »Es ist Krieg, man kann bei einem Krieg nie wissen, was geschieht, man sollte sich eigentlich in solchen Zeiten nicht trennen.«
Aber sie fuhren schon, nach dem Süden.
Die letzten Pariser Tage
Ich habe dann mehr als zwei Wochen in jener Wohnung gehaust, die mein Freund als Möbelspeicher benutzte. Er hatte da noch einen seiner Bekannten untergebracht, einen Lehrer, der in Paris als Soldat irgendeinen Dienst versah. Da saß ich in der staubigen Stube, ohne Teppich, ohne Gardinen, las wenig, schrieb wenig, besuchte die und jene Bibliothek.
Und wie ich eines Morgens das Fenster aufmachte, um den Lautsprecher des Concierge unten auf dem Hof zu hören, tönte aus dem Apparat die Stimme Paul Reynauds, des Ministerpräsidenten. Seine Worte konnte ich im zweiten Stock nicht gut verstehen. Aber Reynauds Stimme, die sonst so jugendlich scharf, ironisch und angriffslustig klirrte, tönte diesmal dumpf und erregt.
Ich laufe Hals über Kopf die Treppe herunter. Die Conciergeloge ist von Menschen umlagert. Ich komme gerade recht, um zu vernehmen, was sich gestern ereignet hat, was uns geschehen ist, in Belgien. Der junge König, der Sohn des tapferen »Roi-Chevalier« Albert des Ersten, hat seiner Armee, 900000 Mann, befohlen, die Waffen niederzulegen. Er hat das getan, hören wir, ohne seine verantwortlichen Minister zu befragen, er hat nicht einmal seine Verbündeten, die Fanzosen und Engländer, verständigt, die er noch vor kurzem flehentlich um Beistand angegangen ist. Er hat seine Verbündeten von gestern in eine furchtbare, ja verzweifelte Lage gebracht. Das Wort »Verrat« fällt nicht, aber es tönt aus Reynauds Anklagerede.
Wir am Lautsprecher verstehen. Es geht um Leben und Tod. Frauen neben mir weinen. Eine junge Frau schluchzt: ihr Mann sei dabei. Die Concierge stützt den Kopf auf: sie hat einen jungen Verwandten bei der Armee.
Ich trotte langsam zurück über den Hof. Es ist ein strahlend heller Tag. Ich steige in meine staubige Wohnung, in die Gerümpelkammer, und sitze vor meinem Manuskript, über das ich ein Zeitungsblatt breite. Was soll das Manuskript, was soll die ganze verflossene Arbeit.
Es bricht über uns herein. Wir können keinen Widerstand leisten. Der Deutsche ist überstark. Seine Art hat etwas Grauenhaftes, Unheimliches an sich. Erst die Österreicher, dann die Tschechen, Polen, dann die Dänen und Norweger, dann die Holländer und Belgier, sie werden alle spielend umgelegt. Sie fallen, als wenn sie erstarren wie der Vogel vor der Schlange, von selbst dem Feind zu. Es ist, als ob sie sich als Opfer anbieten. Nein, das ist kein bloß materieller, militärischer Sieg. Es steckt etwas dahinter, das Grauen einflößt. Vielleicht ist aber allemal ein Krieg kein bloß materieller, militärischer Vorgang.
Nun folgen die Tage, an denen sich die Zeitungen auf ihren zwei kleinen Seiten qualvoll winden, um nichts zu sagen. Man stellt sich aber selber aus den kleinen Meldungen die Vorgänge zusammen, bis man durchschaut, was in Flandern eigentlich vorgeht: Der deutsche Generalstab will sich in den Besitz der französischen Küste setzen, um Frankreich von England zu trennen, und will jedes Land einzeln schlagen, in derselben Weise, wie er vorher Polen, Norwegen geschlagen hat. Jetzt sind wir an der Reihe. Das abgeschnittene Heer aber will der Deutsche vernichten. Wir erleben atemlos den Wettlauf zum Meere nach Dünkirchen. Das unglückliche Heer strebt dem Hafen zu. Man erfährt von den tragischen Kämpfen, die sich in Flandern abspielen, zwischen einem aufgelösten Heere ohne Nachschub und dem riesenstarken fest geführten und organisierten Feind. Der Feind engt die Zugangsstraßen zu den Häfen ein. Die Heeresteile müssen sich in geschlossenen Carrees einzeln durchschlagen. Überall werden Scharen tapferer Männer hingeopfert, um den Feind aufzuhalten.
Was aber im Hafen von Dünkirchen vor sich geht, das ist nun sichtbar ganz und gar kein kriegerischer Vorgang mehr, sondern ein allgemein menschlicher, ein urmenschlicher. Im Hafen von Dünkirchen haben sich alle verfügbaren Schiffe der Alliierten versammelt, um die Trümmer der unglücklichen Armee aufzunehmen. An der englischen Küste haben sich auf den Ruf der Regierung Tausende Fischerboote aufgemacht. Sie haben die Fahrt an die andere Küste unternommen, um zu retten, was zu retten ist, die befreundeten Männer und die Männer vom eigenen Volk. Und der Himmel, der unterscheiden kann, was menschlich und was nicht menschlich ist, hat ihren Willen gesegnet und hat in diesen Tagen voller Kriegsgreuel alles getan, um die Geschlagenen zu retten und für andere Dinge aufzubewahren. In der Tat, an diesen Tagen lag das Meer, der sonst so stürmische Ärmelkanal, völlig glatt. Und wie über einen Fluß konnten die kleinen englischen Boote und Dampfer zwischen den beiden Ufern hin- und herfahren. Und um die Geretteten den feindlichen Fliegerbomben zu entziehen, legte sich zugleich ein ungewöhnlich dichter beständiger Nebel über das Wasser.
Kriegsschiffe deckten den Rückzug. Ihre Verluste waren schwer. Aber sie waren gebaut, um zu kämpfen.
Erschöpft und in Lumpen kamen die Soldaten des großen Heeres drüben an. Erbitterung brachten sie mit. Siehe da: Kein Hauch der Entmutigung ging von ihnen aus.
Ich blieb noch in Paris. Wir erfuhren aus den Zeitungen, der Deutsche richte jetzt seine Wut auf uns. Stiller und stiller wurde es in Paris. Im Norden des Landes, an der Somme und Aisne bereitete sich die Entscheidungsschlacht vor. Eine Prozession unter freiem Himmel fand vor der Kathedrale Notre-Dame statt. Tausende nahmen daran teil. Priester und Gläubige beteten unter freiem Himmel und flehten die heilige Genoveva an, die schon einmal die Stadt gerettet hatte.
Täglich ging ich auf die Straße, kaufte die Zeitung und ging mit ihr in den nahen Tuileriengarten, um zu lesen. Da gab es auch etwas Merkwürdiges zu sehen. Eine Baggermaschine arbeitete, sie schaufelte, jetzt, noch jetzt, Unterstände zur Flugabwehr aus. Mehrmals erlebten wir Fliegeralarm; ich mußte öfter laufen, um zu den Häusern zu kommen, denn diese Unterstände wurden nie fertig. Sie waren auch nicht fertig, als wir Paris verließen.
Es kam der Tag des Bombardements von Paris. Die Sirenen heulten wie gewöhnlich, es war mittags, die Polizeiautos sausten durch die Straßen, wir saßen zu fünfzig in dem Keller unseres Hauses, das Abwehrschießen war stark, entfernte sich aber bald, ein paar wuchtige Einschläge erfolgten. Dann, nach einer dreiviertel Stunde, war der Alarm zu Ende. Paris sah aus, als wäre nichts geschehen. Man flanierte, die Autos flitzten wie immer. Im Westen, in der Richtung auf den Eiffelturm, sah man eine weiße Rauchwolke aufsteigen. Es hieß, große Werke, auch das Luftfahrtministerium seien getroffen. Schlimmeres sah ich ein paar Tage später, als ich nach St-Germain, unserem letzten Wohnsitz, hinausfuhr. Auf dem Wege dahin gab es Fabriken, die für das Heer arbeiteten. Da sah man abgehobene Dächer und Häuser ohne Fenster. Ein langes neues Fabrikgebäude war sehr genau getroffen: Aus dem weißen Kasten war wie mit dem Messer das Mittelstück herausgeschnitten. Und in dem Haus, das wir selber in St-Germain bewohnt hatten, empfing mich die alte bucklige Haushälterin und zeigte mir lachend eine Handvoll Granatsplitter, die in unsere Straße geflogen waren.
Die Zahl der Geschäfte, die wegen Abreise der Besitzer schlossen, wurde größer. Immer mehr Matratzenautos fuhren durch die Stadt. Die Bahnhöfe wurden nicht leer. Auf den Straßen vor den Lebensmittelgeschäften begann das »Schlange stehen«, das nun glücklich auch zu uns gekommen war. Man suchte Fett, Kaffee und Zucker, besonders Zucker.
Die Zeitungen brachten einen alarmierenden Heeresbefehl des Generals Weygand. Er ermahnte die kämpfenden Truppen im Norden von Paris; die letzte Viertelstunde vor der Entscheidung sei gekommen.
Und diese Entscheidung kam, so rasch wie alles in diesen furchtbaren Tagen. Eigentlich hatte man auf keine Entscheidung mehr zu warten, sie war schon gefallen, und im Grunde hatte eine zynische deutsche Propagandaschrift recht, welche schon im Winter unter dem Titel: »Warum wir siegen werden« schlicht konstatierte: »Die Entscheidung über den Ausgang des kommenden Kampfes ist gefallen an dem Tage, wo Frankreich und England die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland und die militärische Besetzung des Rheinlandes zuließen.«
Aufbruch aus Paris
Es war der heiße Sonntag des 9. Juni. Da kam am Vormittag in die leere, stille Wohnung mein Feund, um mir mit zwei Worten mitzuteilen, daß wir morgen aufbrechen würden. Ich sollte das Notwendigste packen und den Koffer heute abend gegen zehn auf sein Büro bringen. Ich konnte nichts Näheres von ihm erfahren.
Ich sehe mich am Abend dieses Sonntags mit meinem Koffer über den stillen mondhellen Hof wandern. Die Concierge und zwei Krankenschwestern sitzen in der Loge und sehen mich an, wie ich mit dem Koffer komme. Die Concierge fragt ängstlich, ob mein Feund, der Beamte, auch gehe. Ich bejahe und gebe den Wohnungsschlüssel ab. Sie läßt sich noch einmal bestätigen, daß mein Freund auch geht, das heißt, daß die Behörden Paris verlassen. Dann steht sie mit den Krankenschwestern zusammen vor der Haustür, und sie blicken mir verstört nach.
Ein Auto ist nicht zu haben. Ich schleppe meinen Koffer langsam durch die völlig leere Rue de la Paix. Der Vendôme-Platz liegt ausgestorben da. Einige camouflierte Lampen brennen. Rechts das Restaurant Ritz ist ohne Licht; vor wenigen Tagen sprangen da noch galonierte Diener die Treppe herunter und halfen eleganten Herrschaften aus dem Wagen. In der Mitte des Platzes erhebt sich eine Säule. Sie bietet einen kläglichen Anblick. Sie hat sich gegen Bomben sichern wollen, und hat sich dazu in ihrem untern Drittel mit Brettern bekleidet, auf die man schwere Sandsäcke packte. Es hat aber in den letzten Tagen geregnet, der Sand ist gequollen, die Säcke sind geplatzt, das Ganze ist ins Rutschen geraten und auf den Platz gesunken. Nun liegt der Unrat auf dem herrlichen Platz, in der gepflegten, reichen Umgebung. Man hat Stricke darumgelegt. Niemand hält es für nötig, die Massen wegzuräumen.
Ich schleppe in der Dunkelheit meinen Koffer weiter, zur Rue Rivoli. Schwarz der Tuileriengarten. Ich komme in das Ministeriumsviertel. Da blitzt es mir entgegen, Scheinwerfer. Ich höre Stimmen. Soldaten bewegen sich mit mir in gleicher Richtung.
Und dann stehe ich schwitzend vor dem Hauptportal des Gebäudes, an das mich mein Freund bestellt hat. Ich blicke um mich. Die stille vornehme Straße ist in ein Feldlager verwandelt, Lastwagen und Autos, die mit Kisten und Säcken beladen werden, Soldaten und Zivilisten, die schleppen und hin- und herrennen. Befehle schallen, gegeben von Offizieren, die auf dem Trottoir stehen, Schreie, Autohupen.
In dem halbdunklen Hof des Gebäudes belädt man Lastwagen. Immer neues Gepäck, auch ganze Schränke werden hinten die Treppe heruntergetragen und auf den Hof gestellt. Man entleert das Riesenhaus. Dieses Wimmeln auf dem Hof. Auf der Straße hat man plötzlich im zweiten Stock eines Privathauses gegenüber Licht gemacht. Zwei mächtige Fenster werfen breite Lichtbündel über die Straße und enthüllen, was da vorgeht. Sofort setzt ein Geschrei ein: »Lumière«, man hört zu schleppen auf, man droht nach oben, aber da rührt sich nichts. Schließlich laufen brüllend zwei Soldaten in das Haus; man wartet, was sie ausrichten; dann ein erleichtertes »Ah«: an einem Fenster oben zeigt sich ein Soldat, schließt das Fenster, läßt Vorhänge herunter, dann verdunkelt sich auch das zweite Fenster; die Straße liegt im Dunkel, man beruhigt sich und arbeitet.
Jetzt sausen Privatautos vor, von Militär geführt, man belädt sie, Offiziere überwachen die Arbeit, die Offiziere setzen sich selber zwischen die Papierbündel und Kisten in die Wagen.
Endlich kommt mein Freund. Er gibt meinen Koffer einer Ordonnanz. Dann spazieren wir die Straße auf und ab. Er hat noch die Abendsendung um 10 Uhr gehört, auch Fernstationen. Er meint, die Lage habe sich etwas gebessert; es sei noch eine Möglichkeit, Paris zu halten. Also auf morgen zehn Uhr.
Zum letzten Mal habe ich in meiner Gerümpelkammer geschlafen. Es ist Montag, Paris ist zum Leben erwacht. In den vornehmen Amtsstraßen ist der Spuk von gestern verschwunden. Noch immer stehen vor dem gebieterischen Gebäude Doppelposten der schwarz uniformierten Garde mobile in Stahlhelmen mit Bajonetten. Aber sie haben nichts mehr zu bewachen.
Das Amtsgebäude, das ich nun betrete, macht einen unheimlichen Eindruck. Es ist über Nacht verwüstet, ausgeleert, ausgeweidet worden. Man hat die prächtige Schale stehen gelassen. Von der mächtigen Arbeit sieht man noch die Spuren: Zeitungsfetzen und Stroh auf den Treppen, auf dem Teppich, hier hat man leere Kisten stehen gelassen, dort lehnen gegen die Wand eines Korridors hohe Bücherstapel, die man vergessen wird.
Die Türen stehen offen. Wie schwer war es sonst hier einzudringen. Jetzt können wir überall hineinblicken, ja hereinspazieren. Wer ist drin? In den meisten Räumen niemand. Auf den Gängen steht man beieinander, diskutiert, flüstert. Viele Türen trugen noch gestern Schilder und Namen, – sie sind abgerissen.
Ich komme zu den Räumen, wo mein Freund mit andern arbeitete. Da stehen Damen in Hut und Mantel, reisefertig, und an einem Tisch sitzen Damen und schreiben eilig Briefe, – Briefe an Verwandte und Freunde, um ihnen den großen Auszug anzukündigen. Sie werden angeben, daß ihre alte Adresse nicht mehr gilt, daß sie hoffen, bald wieder zurück zu sein, aber sie werden Schwierigkeiten haben, ihre neue Adresse anzugeben. In diesen hoheitlichen Räumen werden nun eilige und erregte Privatgespräche geführt, und es wird heftig telephoniert.
Von diesen Herren und Damen kenne ich einige. Manche Damen sind Stenotypistinnen, Sekretäre und Frauen der Beamten. Aber viele Herrschaften haben geglaubt, noch ein Übriges tun zu müssen, und haben nahe und fernere Verwandte mitgeschleppt, Mütter, Schwiegermütter. Und mein Freund, der die Zahl der Mitläufer überblickt, sorgt sich, wir würden gefährlich anschwellen, man verfüge nur über eine bestimmte Anzahl Wagen.
Wir erhalten einen getippten Zettel in die Hand gedrückt: Rendezvous um 2 Uhr Bahnhof Port d’Ivry. Wir haben den Namen dieses Bahnhofs nie gehört. Der Chauffeur, der uns gegen 12 Uhr hinausfährt, kennt diesen Bahnhof auch nicht, aber die Adresse ist präzis und erweist sich als der Eingang zu einem Güterbahnhof.
Wir gehen in ein kleines Restaurant, wo Eisenbahn- und Transportarbeiter déjeunieren. Es geht lustig zu, auf das Radio hat man verzichtet. Wir selber erörtern, wie die Welt aussehen wird, wenn wir zurückkehren und – so sind wir, und so sah damals die Welt aus: wir beschließen, sobald wir wieder da sind, uns hier abermals zu einer Feier einzufinden. Es soll ein Einzug in Paris, freilich nicht über die Champs Elysées, sondern am Güterbahnhof Port d’Ivry werden. So beschließen wir, mehr laut als ehrlich. Wir tun so, als merkten wir nichts.
Es ist halb zwei. Wir ziehen zur Bahn herüber und treffen den ersten Vortrupp der Dienststelle meines Freundes, Männlein und Weiblein. Auch ein junger Abbé, ein Mitarbeiter, ist dabei und drückt allen die Hand, um sich zu verabschieden. Er hat nicht die Erlaubnis seiner geistlichen Vorgesetzten, mit uns zu reisen. Paris, sagt er ernst, werde in den nächsten Wochen Hilfe brauchen. (In den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren –.) Ich stehe in dem Haufen und werde gequält von einem elenden Gefühl: wie unrecht, wie schäbig, erbärmlich ist es, hier wegzulaufen und seine persönliche Sicherheit zu suchen. Verflucht, daß man in diese Lage gekommen ist, fliehen zu müssen, fliehen, abermals fliehen. Welch schändliches, unwürdiges Los. Wer hat mich dahin gebracht.
Ich bin nicht der einzige, der diese Bitterkeit empfindet. Ich erfahre in der ersten halben Stunde beim Herumstehen, aus hingeworfenen Äußerungen, wie es auch die andern revoltiert und sie quält. Dabei diese ängstliche Unruhe und Spannung. Man diskutiert die Frage der Verpflegung; jeder gibt Menge und Art des mitgebrachten Proviants an. Darüber belebt sich langsam die Stimmung und es kommt einem auf Minuten vor, als ob man eine gewöhnliche, improvisierte Reise mache.
Zu den Zügen. Wo sind sie? Übrigens ist dies hier kein Bahnhof. Es ist eine ins Unendliche ausstrahlende Geleis- und Weichenmasse. Man stolpert und fällt, bis man, angerufen von einem anrollenden Zug, auf eine Schuppenreihe stößt, vor der alte Personenwagen halten. Sie sehen kläglich aus, diese Wagen. Sie sind leer, und warten mit offenen Türen anscheinend auf Passagiere. Aber wer möchte in solchen Wagen fahren? Wir stehen davor. Unser ahnungsvolles Herz flüstert: das scheint der Zug zu sein.
Man hat diese Waggons mit Kreidebuchstaben und Zahlen bemalt. Der Kapitän, unser Transportleiter, rennt wild, sein himmelblaues Käppi in der Hand, diesen traurigen Zug entlang, um die Anschrift unserer Dienststelle zu entdecken. Aber da ist nichts zu sehen. Schon nehmen andere uns fremde Personen, in dem Zug Platz, der plötzlich in unserer Achtung steigt. Der Kapitän verschwindet erschrocken, und stürmt nach kurzer Zeit wieder an, sein Käppi in der Hand, das er zum Fächeln benutzt: dieser Zug ist richtig, es ist unser Zug, nur unsere Zeichen – oder unsere Waggons –, eins von beiden fehlt!
Da muß, weil es eilt und weil niemand logisch dieses Rätsel lösen kann, ein Entschluß gefaßt werden. Denn in einer Viertelstunde fährt dieser finstere Zug ab, und wir sind schon von der Sonne geschmolzen und in Schweiß aufgelöst, und wenn wir nicht bald fahren, so fließen wir davon.
Der kleine Kapitän schreit nach Kreide. Und nun sehen wir, was eine Tat ist: er wischt an mehreren Waggons die fremden feindlichen Zeichen aus und malt unsere an! Und sofort sitzen wir in den schattigen Wagen, und es wird keinem gelingen, uns daraus zu vertreiben.
Und während wir noch lächeln: »Das hat er fein gemacht«, fahren wir schon. Und ganz ohne daß wir es wahrnehmen, gleiten wir sanglos, klanglos, gedankenlos, aus Paris heraus –.
Vor einiger Zeit erzählte in einer Pariser Zeitung der Henker aus einer berühmten französischen Henkerdynastie, wie er es machte, um die ihm Anvertrauten rasch auf die Bank und unter das Fallbeil zu bringen. Er gab dem bis zur Bank feierlich geführten und zu sentimentalen Gefühlen geneigten Opfer plötzlich einen kräftigen Stoß in den Magen und einen ebensolchen harten Stoß von hinten. Bevor sich der Mann von der Empörung über diesen Angriff erholt hatte, lag er schon waagerecht und war nicht mehr vorhanden. Er war mit der kleinen Wut über den Henker über den schweren Augenblick hinweggehüpft – Narkoseersatz. Ähnlich verfuhr das Geschick mit uns, dort an der Port d’Ivry. Es erleichterte uns den Abschied, es ließ die Unruhe, den Ärger, die Bitterkeit, den Gram zurücktreten, es schenkte uns fehlende Wagen und das kleine Vergnügen über die Heldentat unseres Kapitäns.
Nun endloses Manövrieren, eine kilometerlange Fahrt an Güterschuppen vorbei. Ja, das Letzte, was uns Paris zeigte, waren diese seine Magazine voller Lebensmittel, bestimmt für den »Bauch von Paris«.
Sie füllten auch einen anderen Magen.
2. KapitelFlucht durch Frankreich
Nach Tours
Wenn ich jetzt, in Amerika, jenseits des großen Wassers, an der Pazifischen Küste, an diesen Tag und die folgenden Wochen denke, an Flucht und Herumirren, an die endlose Spannung, das Warten und Drängen, das bald kam, so erscheint mir dieser ganze Abschnitt meines Lebens unwirklich. Ich erinnere mich nicht, je zu irgend einer Zeit meines Lebens so wenig »ich« gewesen zu sein. Ich war weder »ich« in den Handlungen (meist hatte man nicht zu handeln, man wurde gerieben oder blieb liegen), noch war meine Art zu denken und zu fühlen die alte.
Ich hatte das dunkle Gefühl: etwas stimmt hier nicht, etwas hat sich verändert. Vielleicht komme ich einmal dazu, es herauszufinden. Und wenn ich im Folgenden die Ereignisse der kommenden Wochen schildere, so tue ich es nicht wegen ihres besonderen, historischen Charakters, sondern um das Auffällige, Eigentümliche, Unheimliche dieses Zeitabschnittes festzuhalten.
Ich hatte während dieser Wochen die Gewißheit, sehr wichtige Dinge zu erfahren – wider meinen Willen – und eine Einsicht zu erlangen, die über meiner gewöhnlichen lag. Zu dieser Einsicht will ich wieder dringen. Sie will ich festhalten und sicherstellen. Darum schreibe ich dies auf. Denn es darf nicht sein, daß solch außerordentliches Geschehen nur wie ein Lichtschein über mich huscht, um mich wieder in Nacht und Nebel zu lassen.
Wir fuhren den ganzen Tag. Der Zug lief langsam. Es ging nach Tours. Im Grunde war es aber nur bei der Abfahrt sicher, daß wir nach Tours fuhren. Im Laufe der Fahrt konnte sich ein anderes Ziel ergeben. Das hing von irgendwelchen Meldungen ab, die uns bei der Fahrt erreichten –, uns, das heißt den Kapitän und den Zugführer. Wir anderen saßen im Zug, passiv. Etwas Entferntes hatte die Hand auf uns gelegt. Wir entfernten uns von Paris und wußten nur, wir würden »irgendwo« ankommen.
Das Land weitete sich. Je länger man fuhr, um so mehr sah man Dinge, die man in Paris nicht gesehen hatte. Es hatte der erste Abschnitt unserer Reise begonnen. Wir wurden in das Land hinausgeführt, nun behütet und versorgt, jetzt noch als Zuschauer und Interessenten. Es war uns aber zugedacht, bald den Zuschauerplatz zu verlassen und selber in die Arena herabzusteigen.
Draußen das weite schöne Land war von schwarzen Linien durchzogen. Näherte man sich diesen Linien, so erkannte man, daß sie sich bewegten. Und fuhr man in ihre Nähe und konnte Einzelheiten unterscheiden, so hatte man vor sich das Bild, das einem bald vertraut wurde: die Chausseen verwandelt in ein Kinderspielzeug, das nicht recht funktionierte. Sie waren ein zusammenhängendes Band, auf dem Wagen und Fußgänger zuckten und ruckten. Das schob sich von der Stelle, stand plötzlich still. Wir hörten in der Nähe ein ungeheures nervöses Hupen. Ob es etwas änderte? Die Chausseen waren grauenhaft verstopft: Flucht.
Auf den Eisenbahnschienen rollten unaufhörlich Züge vorbei, mit Soldaten und Kriegsmaterial beladen, auch mit Scheinwerfern und Flugabwehrgeschützen. Als wir an einigen Stationen zugleich mit Soldatenzügen hielten, sahen wir, die Leute waren frisch und gut ausgestattet. Soldaten, die an unsern Zug herantraten und die wie wir Wasser holten, erzählten, sie kämen aus Dünkirchen! Woran hätte es da nur gelegen? »Wir hatten keine Tanks und keine Flugzeuge.«
Immer mehr Soldatenzüge, sie trugen allemal kräftige und frische Männer. Sie hatten größtenteils nicht im Feuer gestanden. Sie wuschen sich und forschten unentwegt nach Neuigkeiten. Alles steckte voller trüber Ahnungen. Aber niemand mochte das Furchtbare wahrhaben. Denn schließlich stand noch alles in Blüte, man war kräftig, man hatte vielleicht nicht alle Waffen, aber man war bewaffnet und man war eine große Armee in einem reichen Land!
Gespräche in unserem Zug: es kann wohl eine Niederlage erfolgt sein, Paris kann vorübergehend besetzt werden, aber das Land quillt über von Soldaten, und von Mutlosigkeit ist keine Rede. Das Heer hat seine eigentlichen Reserven überhaupt noch nicht eingesetzt. Was alle quälte, war der Mangel an einem Impuls. Wenn jemand doch jetzt dem Land einen Ruck gäbe! Ich hatte schon während der ganzen vergangenen Monate, die seit September Kriegsmonate waren, keinen Kriegsenthusiasmus im Lande bemerkt. Aber ich dachte wie andere, man kann auch Krieg ohne das führen, und zwar gerade dann, wenn man friedlich ist und wider seinen Willen zur Verteidigung gezwungen wird. Man wird dann erbittert kämpfen. So dachten wir wieder im Fahren. Ein schmerzlicher Krampf zog das Land zusammen. Das Nächste müßte der Ausbruch und ein fanatischer Kampf sein.
Fragt man aber, warum dieser Ausbruch nicht erfolgte, frage ich mich selbst danach, so habe ich im selben Augenblick die Antwort, die einfache Antwort: weil es so rasch ging, und weil auf den Überfall eine fast tödliche Umschnürung erfolgte. Ehe im Volk sich noch das Bewußtsein von seiner Lage entwickeln konnte, ehe sich nach dem Gefühl des Leidens der natürliche Widerstandswille einstellte – war man gelähmt, erstickt. Der Krieg, die Überrumpelung verlief so rasch, daß man erst aus dem Stadium der Betäubung herauskam, als schon eine andere Situation vorlag.
Wir fuhren, es wurde dunkel, die Wagen blieben dunkel. Genau um Mitternacht hielt der Zug. Es hieß, hier sei ein Bahnhof und wir waren in Tours.
In Tours
Man konnte aber weder einen Bahnhof noch die Stadt Tours bemerken. Eine unvorstellbare Schwärze hüllte uns ein. Wir mußten uns erheben und unsere Sachen an uns nehmen. Mein Koffer lag bei dem großen Gepäck; ich brauchte mich nicht um ihn zu kümmern. Ich hatte nur ein sonderbares Paket zu ergreifen, das oben im Gepäcknetz lag: ein Paar Schuhe und ein handgeschriebenes Manuskript. Ich wollte beides in Paris nicht in den Koffer stecken, weil ich dem Koffer ein schlimmes Schicksal voraussah. Und die Schuhe hatte ich in meiner Pariser Gerümpelkammer am Morgen vergessen und zuletzt noch unter dem Bett hervorgeholt. Ich drückte jetzt beides, Schuhe und Manuskript, an mich und stieg aus.
Es war wirklich schwer auszusteigen. Die Nacht war komplett. Endlich blinkten Taschenlampen. Hier war ein Bahnsteig. Viele Menschen, Männer, Frauen und Kinder, standen und hockten herum. Sie lagen auf ihrem Gepäck. Der mitternächtliche Bahnhof war in eine Karawanserei verwandelt.
Wenig Lärm ging von diesen vielen Menschen aus. Die Ursache erfuhr ich bald, auch die Ursache der kompletten Verfinsterung des Bahnhofs: Ein Fliegerangriff. In unmittelbarer Nähe von Tours lag ein großer Flugplatz, der eigentlich ununterbrochen angegriffen wurde. Als wir fragten, wie lange man denn warten sollte, gab man zur Antwort: warten sei überflüssig, man müsse sehen, in ein Haus zu kommen. Da wir erwogen, daß eine Bahnhofshalle bei einem Fliegerüberfall kaum einen Schutz biete, setzten wir uns sofort in Bewegung. Man mußte sich durch den Haufen der Leute am Boden schlängeln. Das gelang, mit Schwierigkeit; das Schwerste war, sich nicht zu verlieren. Der Kapitän mit der jetzt unsichtbaren himmelblauen Mütze führte. Wir riefen ihn alle paar Schritte an, sein Name flog ihm etappenweise von hinten nach vorne zu und wurde von ihm mit einem kräftigen »Hier« in Empfang genommen.
Draußen lagen die stummen Massen auf der Straße. Zum Teil schliefen sie, erwarteten einen Morgenzug. Man hörte ferne Schüsse.
Vor den Autobussen trat unser Kapitän in Funktion. Er befahl: »Zuerst Damen und Ehepaare, später die andern.« Ich kam mit einem späteren Wagen mit; wir wurden vor einem großen Hotel abgesetzt.
Beim Eintritt überbrachten uns die Erstankömmlinge die Nachricht, es sei alles besetzt, und zwar nicht von ihnen, sondern von noch anderen. Als wir trotzdem in eine große Halle eindrangen, hatten da schon viele das Stadium der Enttäuschung verlassen und schliefen, auf Stühlen und am Boden. Während so hier der Schlafbetrieb schon voll im Gange war, blickten wir uns um und suchten. Es war der Moment unseres Kapitäns. Er hatte in der Tat ein anderes Hotel ermittelt, in dem es sonderbarerweise noch Platz gab. Natürlich, setzte er hinzu, um dieses Wunder auf ein normales Maß herabzudrücken, nicht Zimmer für alle, sondern nur für Damen und Ehepaare, für die andern gibt es Stühle.
Es schien mir übrigens wider die ewige Gerechtigkeit, daß Ehepaare, die schon das Pläsier hatten, gemeinsam zu reisen und sich zu helfen, sich nun auch noch gratis und franco mitten während des Krieges auf Staatskosten zu Bett legen sollten, während wir einsamen Männer, die das Los der Verlassenheit trugen, noch zu stundenlangem Stuhlsitzen verurteilt wurden. Schon in unserm Zug hatten sich die Bänke, obwohl von Natur aus Holz, unter uns zu Stein und Granit verhärtet. Ich konnte, da ich nicht über die Gesäßschwielen eines Affen verfügte, meine Verurteilung nicht ohne Protest hinnehmen. Also protestierte ich und hielt meine Auffassung nicht zurück, daß jemand, der seine Frau mithabe, nicht dafür noch belohnt werden müßte. Dem Kapitän leuchtete das ein, obwohl er das Recht hatte, Befehle zu geben und nichts zu verstehen. Darauf bestieg ich den Autobus mit den Auserwählten.
Dieses Hotel war nun keineswegs frei, wie verkündet war, vielmehr, wie man uns schon mitteilte, komplett besetzt – aber nur bestellt, und zwar für die französische Kammer, und die betreffenden Herren könnten jeden Augenblick eintreffen. Wir beruhigten die Hoteldame, die uns so am Empfangstisch informierte: die Herren würden kaum noch heute nacht eintreffen, denn es war schon ein Uhr. Und außerdem, wer wüßte, ob sie überhaupt eintreffen und nicht gleich nach Bordeaux fahren würden?
Die Dame, so von uns in Unsicherheit versetzt, überließ uns dann alle verfügbaren Zimmer auf Gedeih und Verderb. Und wir verschliefen diese erste außerpariserische Nacht einzeln und gepaart bis in den hellen Morgen hinein und segneten die örtliche Tradition, keinen Fliegeralarm zu schlagen. Denn natürlich waren Flieger dagewesen.
Wir sahen uns vormittags in der Stadt um und schwärmten in Gruppen aus. Die Behörde, von der ich mitgenommen war, hatte große Rosinen im Kopf. Es trafen am Vormittag höhere Herren des Amts ein, in Dienstautos oder in requirierten, und waren von einem hohen Amtseifer befallen. Sie wollten schnurstracks darangehen, das alte Amt zu installieren. Das schwere Gepäck des Amts wollten sie abwarten, einen Teil jener ungeheuren Papiermassen, die ich am Sonntagabend hatte abschleppen sehen. Dann wollten sie, so schien es, wieder mit der Arbeit beginnen. Und darum verließen sie die zentrale Partie von Tours und besichtigten ein Haus, wo sie sich provisorisch niederzulassen gedachten. Es befand sich in der breiten nördlichen Einfallstraße der Stadt und war eine einstöckige Villa, völlig leer. Ich begleitete meinen Freund dahin. Das Häuschen war im Moment zu nichts nutz als zum Übernachten, und wie man an den Strohhaufen in den unteren Räumen sah, übernachtete man hier schon. Man befahl nun, das Haus gründlich zu lüften und zu reinigen.
Am nächsten Morgen trat die Hotelverwalterin vor uns, um uns zu offenbaren, sie müßte den größten Teil der gestern okkupierten Zimmer frei haben, denn das Parlament sei nunmehr wirklich im Anmarsch. Wir, von Skepsis erfüllt, ungläubig bis an den Rand, ließen uns in dem weiten geschlossenen Hof des Hotels nieder und erwarteten stundenlang diesen Anmarsch. Statt des Parlaments stellten sich schließlich mit großem Gepäck, Hutschachteln, Taschen und Koffern eine Anzahl Damen ein, die uns als die Gattinnen von Parlamentariern bezeichnet wurden. Die Parlamentarier selbst blieben unsichtbar und bald verschwanden auch die Damen wieder.
Im Hotel wohnte ich nur eine Nacht. Wir sollten und mußten Platz machen, wir wußten nicht, für wen. Und so ging ich in Begleitung anderer am späten Abend in das Dunkel hinaus, in jenes völlige Dunkel, an dem ich Tours erkannte. Es hatten sich wieder Flieger eingestellt und gerade wie wir uns der großen Loirebrücke näherten, fing es an zu blitzen und zu krachen. Wir hörten das Dröhnen und Brummen von Motoren. Wohin? Meine Begleiter, geübte Tours-Männer, Touristen, sagten kühl: »Weitergehen!« Darauf marschierten wir los, die Brücke erwies sich ernorm lang. Oben am schwarzen Himmel gab es ein blendendes Feuerwerk. Das Ganze spielte sich mehr rechts ab.
Wir klopften und klingelten, in dem Häuschen schlief man sehr fest, man öffnete, das kleine Häuschen sah wie ein lieber Stall aus. Man gab auch mir Stroh. Ich zog mich oberflächlich aus und schlief genau so (schlecht und gut) wie sonst.
Die Stadt schluckte Flüchtlingsscharen. Wir waren die ersten gewesen. Jetzt kam das Gros. Eine unglaubliche Menschenfülle wurde über die Stadt geschüttet. Die Straßen wurden Tag und Nacht nicht leer. Einmal zeigte sich eine sonderbare Gruppe von Wagenkolossen. Da sah man, auf Schienen ruhend, mächtige, blitzblanke Maschinen. Was für Maschinen das waren und was sie sollten, verstanden wir erst nicht, bis uns klar wurde, daß es sich um Fabriken handelte, die man evakuierte, um sie irgendwo anders neu aufzubauen. Man rechnete also auf einen langen Krieg. Die Maschinen, die großes Aufsehen erregten, waren von Arbeitern und Arbeiterinnen begleitet.
Aber dahinter der alle Deiche durchbrechende Strom der Flüchtlinge. Wir hörten kein Radio, nur gelegentlich fiel einem ein Zeitungsblatt in die Hände. Aber was vorging, sah man, man sah es mit eigenen Augen: der Gegner war nicht aufzuhalten. Niemand hielt ihn auf. Man war wehrlos. Und die Menschen fuhren und gingen, sie wußten nicht, wohin; sie kamen bald hier, bald dort unter, dann fuhren und gingen sie weiter –, und keine Stimme, die Aufklärung gab, die zusprach und Mut einflößte. Wo war die Spitze, was beschloß sie? Das Volk war verlassen, war sich selbst überlassen.
Und das Volk benahm sich großartig. Es wurden im Lande nie weniger Verbrechen begangen als in diesen Tagen. Mit Selbstverständlichkeit wurden alle örtlichen Anordnungen befolgt. Niemand kam auf den Gedanken, private »Requisitionen« vorzunehmen, selbst wo man entbehrte. Das französische Volk liebt keine behördliche Disziplin, aber es zeigte in all diesen Wochen eine große eigene Disziplin, seine Ausgeglichenheit. Es zeigte sich als ein erwachsenes Kulturvolk, ein selbständiges Volk. Man kann sicher sein, daß es keinem gelingen wird, es lange im Stand der Unmündigkeit zu halten.
Wir flanierten noch in Tours durch die Hauptstraße, spazierten die Loire entlang und betrachteten den großen Fluß und erwiesen ihm unsere Reverenz. Wir aßen umständlich und teuer nur am ersten Mittag im Hotel; dann wurde von Damen und Herren eine neue Küchenregelung beschlossen. Man bestimmte eine Damengruppe, einzukaufen und in der Nähe einen Raum für uns zu mieten. Da würde man billig und bequem speisen. Wir aßen in der Tat ein paarmal gut und vollständig in einem nahen Lokal. Bevor sich aber diese Kriegsblüte einer Essensgenossenschaft entfaltete, mußte sie welken. Es verlief alles noch rascher, als wir für möglich hielten.
Nach drei Tagen war es aus. Der zivile Flüchtlingsstrom wurde immer breiter und breiter. Der Prozentsatz des mitreisenden Militärs wuchs. Die Stadt, besonders in den nördlichen Partien, dröhnte vom Lärm der Wagen und Menschen. Und dann wurde es ganz schlimm, als der Zivilstrom von den Hauptstraßen abgelenkt wurde und über diese Straßen und die große Loirebrücke Militär brauste. Das Dröhnen und Rasseln dauerte den ganzen Tag und die Nacht. Ein ganzes Heer, keineswegs in Auflösung, schien sich heranzuwälzen. War das eine Rückzugsarmee oder handelte es sich darum, hinter der Loire die neue Front aufzubauen?
Und da gab es schon ein Flüstern bei uns. Bieder putzten die Soldaten noch ihr Haus und hängten ihren Dienstplan auf. Mich hatte man zu guter Letzt in einem Häuschen untergebracht, an dessen Tor wenig vertrauenerweckend Granatsplitter lagen. Da – kam die Weisung, sich am nächsten Vormittag vor dem präsumptiven Dienstgebäude mit Gepäck einzufinden. Man packte hastig ein, was man voreilig ausgepackt hatte. Die Schreibmaschinen verschwanden wieder in ihren Kästen. Die Säcke wurden aus dem Keller geholt und nahmen wieder die Papiermassen auf. Wieder Verschnüren und Hämmern. Das Häuschen, eben erst geputzt, wurde in seinen alten Zustand, mit Unordnung, Schmutz und Stroh, zurückgestoßen.
Und durch das Chaos sehe ich einen ernsten Beamten der Stadt schreiten und sich dem derzeitigen Chef der Dienststelle nähern. Man hatte schon Beleuchtung eingerichtet, Tische standen. »Und das wollen Sie alles im Stich lassen?« fragte der Magistratsbeamte. Der Chef konnte die Achseln zucken: Glühbirnen und Tische in diesem Augenblick.
Man schleppte die Kisten und Papiersäcke wieder hinaus. Ich hatte den Eindruck, die Akten verloren mit jedem Umzug mehr an Wert. Jetzt warf man sie schon auf die Lastwagen. Ich sah den Tag kommen, wo die Lastwagen mit dem Papier irgendwo auf einer Chaussee stehen blieben. Ja, ich hielt es für nicht ausgeschlossen, daß man das Papier von den Wagen herunterwarf und über den Boden verstreute, und sich nur um sich und die Lastwagen kümmerte.
Wir versammelten uns, dreißig Männlein und Weiblein, vor dem Häuschen und stellten Betrachtungen an. Was war aus unserer schönen Küchengemeinschaft geworden? Das Schießen auf dem Flugplatz war eigentlich nicht so schlimm gewesen.
Es ging weiter nach Süden. Würde also die Armee an der Loire Widerstand leisten?
Der Wagen für uns fuhr vor, er war ein einfacher Lastwagen. Man hob unsere Koffer herauf. Eine Anzahl amtlicher Kisten kam nach, das war aber nicht schlimm, man konnte darauf sitzen und sie als Rückenlehne benutzen. Bevor wir selbst aber einstiegen, hieß es Abschied nehmen, denn einige Herren, Offiziere der Dienststelle, erklärten, nach Bordeaux gehen zu müssen. Das mußten sie zweifellos. Sie hatten sicher Anweisung dafür. Aber wie der Mensch einmal ist, entstand bei uns, den Zurückgebliebenen, nach dem freundlichen Abschied ein unsicheres Gefühl – und man formulierte diskret: »Sie gehen lieber gleich nach Bordeaux.« Auch lieblose Worte fielen. In solchen Augenblicken bringen auch devote Naturen wenig Respekt auf.
Wir nahmen dann, statt mit bequemen Dienstautos abzusausen, von unserem Mammut, dem schwer bepackten Lastwagen, Besitz. Man half uns herauf, und da saßen wir, saßen und fuhren.
Oh, jetzt waren wir nicht mehr Beobachter und Reisende. Jetzt waren wir Masse. Es war der erste Schritt in der Verwandlung.
Moulins
Es dauerte lange, bis wir die Stadt hinter uns hatten. Schließlich befreite unser Chauffeur unsern Wagen aus der Umklammerung durch die anderen Wagen. Noch einmal warf man von der Brücke herunter einen Blick auf die breite Loire und ihre Sandinseln. Nun wurde die Landschaft offen. Er fuhr am Rand des allgemeinen Flüchtlingsstromes. Wir sahen aus der Nähe, wie andere Autofahrer kämpften, um aus dem Strudel herauszukommen. Dann schlugen wir uns seitlich in die Büsche.
Wir kreuzten Hauptstraßen, alle gestopft voll mit wanderndem Volk und Soldaten. Einmal hielten wir, um Wasser zu holen, in einem Dorf. Standen da Wagen mit Soldaten, zum Teil verwundeten und verbundenen, sie trugen die Nummern verschiedener Regimenter. Ein älterer Soldat hinkte von drüben zu uns herüber und sah sehr ernst aus. Er fragte, wo wir herkämen und was es Neues gäbe. Er wies auf sich und seine Kameraden: »Meine Herren, es hat sich einiges im Lande geändert.«
Es fing an zu regnen. Unser Wagen war ungedeckt. Man half sich gegen die Nässe so gut man konnte, zog sich Mäntel über den Kopf, schlüpfte zusammen und versteckte sich hinter den Kisten. Wir fuhren über ein breites Wasser.
Es war noch hell, als wir uns einer Stadt, Moulins, näherten. Unser Wagen schlängelte sich durch einige Straßen und fuhr an einem Gebäude vor, in dessen Nähe wir einige Herren unserer Reisegesellschaft sahen, die Tours vor uns verlassen hatten.
Man leitete unsern Wagen in einen weiten, viereckigen Hof, offenbar ein Schulhof. Dies war die höhere Schule für Knaben. Auf dem Hof standen andere Wagen, und die Reihe der Zimmer unten nach dem Hof trug Aufschriften mehrerer Dienststellen, die sich offenbar hier schon eingerichtet hatten. Ich sah es und dachte trübe an unsere Erfahrung in Tours.
Man lud unsern Wagen ab, und wir machten den Inspektionsgang durch das Gymnasium. Es bildete eine weitläufige Anlage. Man stieg Treppen zu den Gebäuden herauf, stieg zu Speisesälen in Kellerräumen herunter, und auf der Hinterseite des Hauses gab es ein freies Gelände mit Busch und Baum. Ich verlief mich bei diesem Berg- und Treppensteigen.
Wirklich begann man auch hier auszupacken und zu tun wie in Tours, als ob man seinen alten Betrieb wieder aufziehen wollte. »Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten.« Man verteilte Zimmer, gehorsam schleppten Soldaten Kisten dahin und dorthin. Man stieg in geschlossenem Zuge in die unteren Räume und nahm das Abendessen zu sich. Es waren angenehme, weite Speiseräume. Männer und Frauen saßen hier, aßen und tranken. Man sagte, sie seien Flüchtlinge. Wir kannten sie nicht.
Zum Schlafen wurden wir, Männlein und Weiblein getrennt, in große weite Schlafsäle im ersten Stock geführt. Auch da hatten sich schon Leute installiert, dabei ein Junge, der das erste Anrecht auf diesen Platz hatte, denn wir befanden uns im »dortoir« des Gymnasiums. An seiner Längswand, erhöht, durch einen weißen Vorhang vom übrigen Raum getrennt, stand das Bett des »surveillant«, des wachhabenden Lehrers.
Es sah wirklich so aus, als ob die Ämter und Dienststellen hier arbeiten wollten. Mein Freund wurde gerufen und stand auf dem Hof mit anderen zu einer langen »Konferenz« zusammen. Ich flanierte mit seiner Frau und anderen Damen in der Landschaft herum. Wir drangen in die Stadt ein.
Es ging hier nicht so tumultuös zu wie in Tours. Nur an der Post drängte man sich; denn alles wollte telegraphieren. Die wenigen Beamten glühten und mußten sich zerreißen. Erfreulicherweise konnten sie sich immer einer Hälfte der Zudringenden entledigen, denn die Telegramme mußten ja zunächst nach der Polizei getragen, um genehmigt und gestempelt zu werden, wobei viele Leute die Lust zu telegraphieren verloren. Ich telegraphierte an meine Frau, nach Mittelfrankreich. Andere versuchten es mit Orten mehr nördlich und – fielen damit sofort ab.
Moulins sah freundlich verschlafen aus. Ich dachte, wie ich eine halbe Stunde allein durch die sauberen engen Straßen spazierte (die Damen kauften vorsorglich Lebensmittel ein): wozu in die Ferne schweifen, wozu mich an Behörden hängen, warum nicht in alter Weise Einzelgänger spielen und mich hier verkrümeln? Ein bißchen Fahnenflucht – aber es war nicht einmal Fahnenflucht. Kein Hahn würde nach mir krähen. Aber – das waren doch nur Träume. Wahrscheinlich würden ja morgen oder übermorgen auch diese friedlichen Kleinstädter fliehen. Morgen würde auch diese verschlafene Straße erwachen. Ich konnte mir schon vorstellen, wie –.
Und ich stieß wieder zu unserer Horde zurück und fand nach einigem Herumirren das Gymnasium wieder. Und fand – eine völlig veränderte Situation.
Aus Gründen, die ich nicht ermitteln konnte, hatte sich während unseres so behaglichen und optimistischen Spazierganges der Herren eine völlig andere Auffassung von der Weltlage bemächtigt.
Ich sah mehrere ältere Herren, die noch vor einer Stunde fröhlich Dispositionen für den Dienst und Arbeitsplätze entworfen hatten, verfroren und blaß beieinander stehen und die Köpfe zusammenstecken. Ich sah, wie sie sich voneinander trennten und mit ihren Damen konferierten. Das Interesse floh mit großer Schnelle aus dem Dienstlichen ins Private. Es ging so rasch. Das Amtliche schien einen lebensgefährlichen Charakter anzunehmen. Ich sah, wie rapid das Interesse an dem schweren dienstlichen Gepäck, das ich am Sonntag abend in Paris hatte aufladen sehen, nachließ, erlahmte, erschlaffte, um sich ruckartig der privaten Bagage zuzuwenden. Ich hörte schreckliche Bemerkungen betreffend jenes feierliche amtliche Gepäck: Man hatte vor, es – jedenfalls teilweise – zu verbrennen!
Am Nachmittag wurde deutlich, daß ich mich nicht verhört hatte. Soldaten ergriffen eine Anzahl Säcke beim Hals und schütteten den Inhalt hinter dem Gymnasium auf dem buschigen Terrain ohne viel Federlesen aus. Sie häuften den gestempelten geheiligten Inhalt zu kleinen Hügeln, mit rohen Handgriffen und Fußtritten, als wenn es sich um Kloben Holz handelte, und zündeten den Haufen an. Ja, man entledigte sich eines beträchtlichen Teils unserer ehrwürdigen, behüteten Bagage, zweifellos um sie nicht in die Hände des Feindes fallen zu lassen.
Lustig flackerte der Brand. Das Feuer erleuchtete eine trübe Situation. Ja, wir waren stark im Gedränge.
Und daß wir es waren, gab nicht nur das Feuerchen zu verstehen. Wenn ich über den großen Hof ging, so sah ich, nunmehr blaß, erregt und finster Herren mit ihren Damen auf- und abwandern. Unnahbar, vertieft schritten sie dahin. Gegen Abend erfuhr man das Ergebnis ihrer Diskussionen: Es fehlten mehrere Herren und mehrere Damen. Wo waren sie? Nach Hause gefahren. Sie hatten gehandelt. Sie hatten sich Autos zu teuren Preisen in der Stadt beschafft, und waren auf und davon.
Es wurde nunmehr offen proklamiert, daß hier unseres Bleibens nicht mehr wäre. Für keinen. Wo die Deutschen eigentlich ständen, wußte man nicht, es wurde aber auch nicht so sehr auf diesen Punkt Gewicht gelegt, als darauf, daß wir wegmußten, rein militärischen Formationen Platz zu machen. Zugleich ging in unserem Kreis ein Wort um, das der himmelblaue Kapitän, dem ich nicht grün war, in die Welt gesetzt hatte. Er gebrauchte es oft. Das Wort war »dégonfler«. Das bedeutet: »zum Abschwellen bringen«. Was oder wen wollte der Himmelblaue abschwellen? Niemand kam sich hier geschwollen vor. Aber unsere Gruppe war geschwollen. Wir waren zu viel. Der Kapitän wußte nicht, wo Wagen herbekommen, um uns davonzuschleppen. Verbrennen wie das Gepäck konnte er uns nicht. Zu seinem Entsetzen erfuhr er jetzt, wir wollten alle mit.
Darauf ging er von einem zum andern und pries jene, die davongegangen waren – weil sie nämlich in Frankreich im noch nicht besetzten Gebiet ein Zuhause hätten, oder weil ihnen eine Familie beschert war. Er pries Familiengefühle. Er horchte, wie es da um jeden stand. Sie hörten ihn alle mißtrauisch an. Sie verbargen ihre Familiengefühle. Zunächst schwieg man. Man versprach, es sich zu überlegen und sich zu prüfen.
Er aber brauchte rasche Entschlüsse. Eine tiefe, eine zähe Nachdenklichkeit hatte sich aller bemächtigt.
Er kam nicht von der Stelle. Es war übrigens nicht klar, wodurch wir plötzlich so viele geworden waren. In Tours konnte man uns noch gut in einen einzigen Wagen hineinstopfen. Jetzt waren wir ganz erheblich mehr. Offenbar waren andere Dienststellen zu uns gestoßen, aber »Dienststellen« war ein zu feierlicher Ausdruck. Wenn man sich umblickte, so hatte man mehr das Gefühl, sich mit lauter neuen Anhängseln beladen zu haben, mit Gemahlinnen, Schwägerinnen, Schwiegereltern.
Der Himmelblaue wandte sich an mich. Und siehe da: Ich ärgerte mich. Er ärgerte mich. Und das freute ihn. Während alle andern sich in ein hartnäckiges Nachdenken hüllten, das sie wie eine Tarnkappe über sich zogen und ihre Entscheidung auf später, auf »nach dem Krieg« verschoben, beunruhigten mich die liebevollen Worte des Kapitäns. Er sagte: »Sie haben doch wohl Ihre Familie in Le Puy, nicht wahr? Es ist viel richtiger, viel natürlicher, glauben Sie mir, daß Sie jetzt zu Ihrer Familie gehen, als daß Sie sich weiter hier zwecklos herumtreiben. Wer weiß, wie lange wir noch zusammenbleiben.« Das senkte einen Stachel in meine Seele. Nämlich eigentlich hatte er nicht unrecht. Andererseits war die Zukunft reichlich dunkel. Und weggraulen wollte ich mich auch nicht lassen.
Aber der Brand war in meine Seele geworfen. Die Anregung des Himmelblauen war auf vorbereiteten Boden gefallen. Ich hatte Tagesberichte des französischen Generalhauptquartiers gelesen, und da war von Kampfhandlungen die Rede, die sich bedenklich Mittelfrankreich näherten. Was würden meine Frau und das Kind machen? Ich konnte sie nicht ihrem Schicksal überlassen.
Es gärte in mir. Ich besprach mich mit meinem Freund und seiner Frau. Sie hatten selbst vor, aufzubrechen. Zu einem konkreten Entschluß waren sie noch nicht gelangt.
Nun stieg ich mit meinem Freund in den Schlafsaal hinauf. Der lag schön und friedlich da. Einige ruhten auf den Betten und lasen. Ich packte meinen Koffer. Wir würgten das Manuskript hinein und trennten es von seinem Zwilling, meinen Schuhen. Meinen schweren Wintermantel nahm ich über den Arm. Ich verabschiedete mich von keinem Menschen, am wenigsten von dem Kapitän. Dem Mann würde meine Abwesenheit allein hinreichend Genugtuung bereiten.
Mein erster Ausbruch
Es fand sich in der Nähe ein Zivilist, der meinen Koffer zur Bahn trug. Ich selbst lief erst einmal voraus, um mich über Züge zu orientieren.
Wie ich nun nach einem gewaltigen Zickzack in der Hauptstraße, die zum Bahnhof führte, landete, erschrak ich. Es war phantastisch, was ich da sah. Ich war an Menschen-Gewimmel und Getümmel gewöhnt. Dies hier aber stellte alles in den Schatten. Das war der Gipfel.
Sie waren nur Zivilisten. Zu Fuß bewegten sie sich oder lagen in Wagen. Die überfüllten und überschwemmten Straßen, Riesenplätze und Anlagen. Die Sonne schien prall auf sie. In dem grellen Licht, in der Hitze wimmelten die Menschen, zu Hunderten, zu Tausenden, bis ganz nach hinten, wo der Bahnhof lag. Rechts wurde grade ein Kino ausgeräumt als Quartier für Flüchtlinge.
Ich drängte mich zum Bahnhof durch und gelangte an einen Schalter. Der Beamte schrieb mir die beiden nächsten Züge nach Le Puy auf, einer in einer halben Stunde, ein Vorzug, der andere in anderthalb Stunden. Beide Züge über Vichy. Das klang ja herrlich. Ich war entschlossen, zu fahren.
Ich lief zurück und dachte froh: mit dem ersten Zug schwimme ich ab. Das Getümmel hier hatte mich entsetzt. Ich verlief mich, verlief mich immer wieder. Als ich endlich in der Schule ankam und mein Freund und der Kofferträger sich zu mir gesellten, war es gerade Zeit, um zum zweiten Zug zu gelangen. Wir machten uns unverzüglich auf den Weg. Und standen bald, mein Freund und ich, mit vielen, vielen vor der Tür, die auf den Bahnsteig führen sollte. Mein Billet hatte ich gekauft (ich trage es noch heute in meiner Brieftasche). Wir warteten wie die anderen, im Gedränge, schwitzend. Ab und zu wurde einer vorne hereingelassen; Gott weiß, warum grade der. Die angegebene Zeit der Abfahrt war längst verstrichen. Es ereignete sich nichts. Man stand und wartete. Man drängte und wurde gedrängt. Zwischen die Füße wurden einem von hinten Koffer geschoben, man mußte balancieren und sich aufrecht halten.
Ein junger Bursche stand rechts von mir. Er stand, sprach und schwitzte. Und wenn er genug gesprochen und geschwitzt hatte, nahm er sein Taschentuch, wischte sich hinten seinen Nacken, dann vorn die Stirn und warf schließlich mit einem kräftigen Ruck des Kopfes das Haar aus der Stirn. Er hatte lange blonde Haare, die über dem Scheitel liegen sollten, sich aber immer wieder nach vorn verirrten. Daß ich hinter ihm stand, war dem Jüngling nicht interessant. Ungefähr alle fünf Minuten fuhr sein Kopf gegen meine Nase und seine frisch genäßten Haare schlugen gegen meine Brille. Ich seufzte, ich duldete.
Wieder erwachte in mir der Zorn auf den himmelblauen Kapitän. Er hatte, kam mir vor, mich in diese Lage gebracht, hinter diesen Jüngling. Ich, allein ich sollte den Transport zum Abschwellen bringen. Der Zorn brachte mich zu einem Entschluß, wie mich vorhin der Zorn zu einem Entschluß gebracht hatte. Diesmal entschloß ich mich, drüben Kaffee zu trinken, weiter nichts, Kaffee trinken, allen Kapitänen zum Trotz. Mein Freund, der treu wartete, billigte es. Er meinte, zu solchem Kampf um einen Eisenbahnplatz müßte man die Nerven seiner Frau haben. Ich kannte die Nerven seiner Frau nicht, aber er mußte es wissen. Er müsse auch Kaffee trinken.
So war ich befreit und gerechtfertigt. Und so bugsierte ich meinen Koffer aus dem Gedränge und überließ die unglückliche Menge, diesen gärenden Teig, sich selbst. Von weitem sah ich noch den Jüngling zucken. Da tranken wir schon den beschlossenen Kaffee. Ich rauchte zur Vervollständigung zwei Zigaretten. Den Koffer gab ich am Büffet ab. Wir hatten die ganze Abreiserei satt. Erleichtert zogen wir uns zurück.
Im Lycée empfingen uns unsere Bekannten. Sie schüttelten den Kopf, nicht über die mißglückte Aktion, sondern daß ich sie überhaupt unternommen hatte. Ihnen hatte der Himmelblaue ja auch zugesetzt, zum »Dégonflement« seiner Gruppe beizutragen, aber bei ihnen sei er abgefallen. Denn welches Interesse, meinten sie kaltherzig, haben wir daran, ihm sein Geschäft zu erleichtern? Das Bequemste wäre ihm, wir würden uns alle verlaufen.