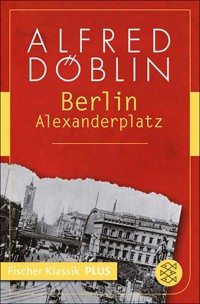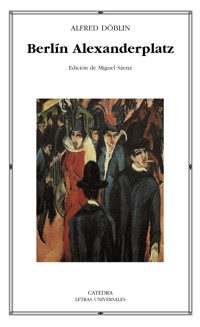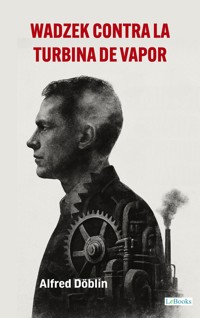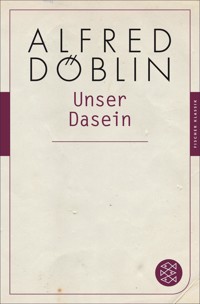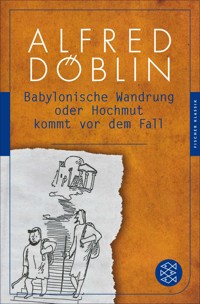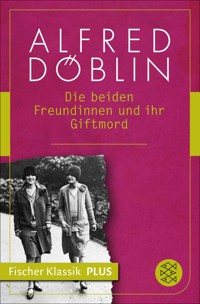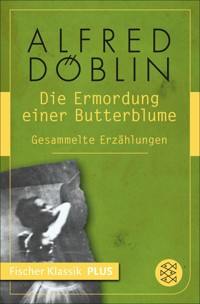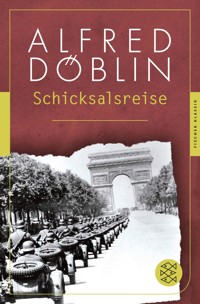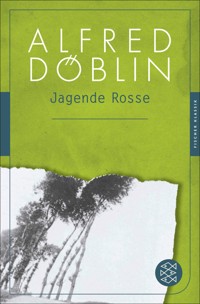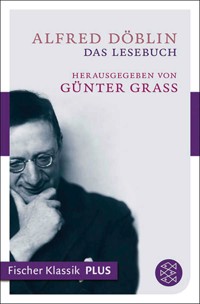
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit einer ausführlichen Zeittafel zu Alfred Döblins Leben und Werk. Ein großer Fabulierer, ein scharfzüngiger Publizist, ein leidenschaftlicher Intellektueller – dieses Lesebuch, das Nobelpreisträger Günter Grass zu Ehren seines ›Lehrers‹ Alfred Döblin zusammengestellt hat, erinnert daran, dass Döblin lange vor seinem Erfolgsroman ›Berlin Alexanderplatz‹ ein höchst vitaler Autor der Avantgarde war und mit seinen großen Exilromanen maßgeblich zur Aufklärung des 20. Jahrhunderts beigetragen hat. Neben Auszügen aus den wichtigsten Erzähltexten enthält das Lesebuch zahlreiche Beispiele aus Döblins kritischer Publizistik und zentrale autobiographische Dokumente.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 995
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Alfred Döblin
Das Lesebuch
Fischer Klassik PLUS
Über dieses Buch
Ein großer Fabulierer, ein scharfzüngiger Publizist, ein leidenschaftlicher Intellektueller – dieses Lesebuch erinnert daran, dass Alfred Döblin lange vor seinem Erfolgsroman ›Berlin Alexanderplatz‹ ein höchst vitaler Autor der Avantgarde war und mit seinen großen Exilromanen maßgeblich zur Aufklärung des 20. Jahrhunderts beigetragen hat. Neben Auszügen aus den wichtigsten Erzähltexten enthält das Lesebuch zahlreiche Beispiele aus Döblins kritischer Publizistik und zentrale autobiographische Dokumente. Eingeleitet wird der Band mit Grass’ berühmter Rede ›Über meinen Lehrer Döblin‹.
Alfred Döblin, 1878 in Stettin geboren, arbeitete zunächst als Assistenzarzt und eröffnete 1911 in Berlin eine eigene Praxis. Döblins erster großer Roman erschien 1915/16 bei S. Fischer. Sein größter Erfolg war der im Jahr 1929 ebenfalls bei S. Fischer publizierte Roman ›Berlin Alexanderplatz‹. 1933 emigrierte Döblin nach Frankreich und schließlich in die USA. Nach 1945 lebte er zunächst wieder in Deutschland, zog dann aber 1953 mit seiner Familie nach Paris. Alfred Döblin starb am 26. Juni 1957.Günter Grass, 1927 in Danzig geboren, wurde nach einer Ausbildung als Bildhauer und Grafiker freier Schriftsteller. Mit dem Roman ›Die Blechtrommel‹ wurde er 1959 schlagartig berühmt. Im Jahr 1999 erhielt Günter Grass den Nobelpreis für Literatur. Sein Engagement für das Werk Alfred Döblins begann Grass mit der hier einleitend zitierten Rede (1967) und setzte es u.a. mit der Stiftung des Alfred-Döblin-Preises (seit 1979) und der Übereignung seines ehemaligen Wohnhauses in Wewelsfleth an das Land Berlin fort (1985); seitdem dient das ›Alfred-Döblin-Haus‹ als Refugium für Schriftstellerstipendiaten.
Dieter Stolz, Jahrgang 1960, studierte Germanistik und Geschichte in Münster und Berlin. Er promovierte mit einer Arbeit über Günter Grass, war Assistent an der TU Berlin, anschließend Programmleiter beim LCB und Redakteur der Zeitschrift ›Sprache im technischen Zeitalter‹. Stolz ist Mitherausgeber der Günter Grass-Werkausgabe und arbeitet seit 2006 als Hochschullehrer und freier Lektor.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Alfred Döblin, 1878 in Stettin geboren, arbeitete zunächst als Assistenzarzt und eröffnete 1911 in Berlin eine eigene Praxis. Döblins erster großer Roman erschien im Jahr 1916 bei S. Fischer. Sein größter Erfolg war der 1929 ebenfalls bei S. Fischer publizierte Roman »Berlin Alexanderplatz«. 1933 emigrierte Döblin nach Frankreich und schließlich in die USA. Nach 1945 lebte er zunächst wieder in Deutschland, zog dann aber 1953 mit seiner Familie nach Paris. Alfred Döblin starb am 26. Juni 1957.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402067-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Döblin über Döblin
Autobiographische Skizze
Erster Rückblick
Dialog in der Münzstraße
Ankunft in Berlin
Man bereite sich auf eine baldige Katastrophe vor
Die Geschichte wird noch einmal erzählt
Zum dritten Mal!
Übrigens hatte er eine Schwester
Ehre, dem Ehre gebührt
Vom Schicksal der entwurzelten Familie
Lebensabschluß meiner Mutter
Vermittlung der Bekanntschaft mit einem Familienmitglied
Zwei Seelen in einer Brust
Der Nervenarzt Döblin über den Dichter Döblin:
Der Dichter Döblin über den Nervenarzt Döblin:
Selbstporträt
Dichten heißt, Gerichtstag über sich selbst halten
Romane, Erzählungen und Erfahrungsberichte
Modern
Die Ermordung einer Butterblume
Die drei Sprünge des Wang-lun
Zueignung
Wang-lun
Das westliche Paradies
Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine
Die Verschwörung
Der schwarze Vorhang
Wallenstein (1920)
Schweden
Ferdinand
Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord
Epilog.
Berge Meere und Giganten (1924)
Island
Die Enteisung Grönlands
Die Giganten
Die Zeitlupe (1926)
Reise in Polen (1926)
Warschau
Die Judenstadt von Warschau
Berlin Alexanderplatz
Erstes Buch
Viertes Buch
Siebentes Buch
Kleine Alltagsgeschichte (1930)
Unser Dasein (1933)
Vorspruch
Zwischenspiel Sommerliebe
Babylonische Wandrung
Vorspiel im Himmel
Konrad wacht auf und vermißt sein Frühstück
Von den Kolbennasen der Himmlischen und ihrer Diät
Der Oberräuber beschuldigt einen andern und läßt ihn holen
Einholung des Entflohenen und Festkonzert im Himmel
Verhör des Flüchtlings, schreckliche Neuigkeiten von der Erde, ein Fluch von unbekannter Seite
Vergebliches Parlamentieren. Es muß geschieden sein
Abfahrt, erster Achsenbruch, die alten Beförderungsmethoden
Astronomiestunde
Die Erde kommt, sie riecht penetrant, aber nicht schlecht
Erklärung des Autors in eigener Sache
Der Autor blickt in Konrads Zukunft Er vertraut auf den Trichter und die Schraube
Pardon wird nicht gegeben (1935)
Armut
Die Fahrt ins Land ohne Tod (1937)
Flucht in den Wald
Das Ende
Sukuruja
Tije und Guarikoto
Rückkehr der Amazonen
November 1918
Bürger und Soldaten
Karl und Rosa
Abschied und Wiederkehr (1946)
Als ich Abschied nahm …
Als ich wiederkam …
Schicksalsreise
EUROPA, ICH MUSS DICH LASSEN
Hamlet oder
[Auszug]
Essays und kleine Schriften
Futuristische Worttechnik
An Romanautoren und ihre Kritiker
Der deutsche Maskenball (1921)
Die Drahtzieher
An die Geistlichkeit
Die Verirrung der mathematischen Naturwissenschaft (1923)
Der Bau des epischen Werks (1928)
Das epische Werk berichtet von einer Überrealität
Das epische Werk lehnt die Wirklichkeit ab
Die Epik erzählt nichts Vergangenes, sondern stellt dar
Der Weg zur zukünftigen Epik
Unterschied der heutigen individualistischen Produktionsweise von der früheren kollektiven
Schilderung des Inkubationsstadiums im heutigen epischen Produktionsprozeß
Die Sprache im Produktionsprozeß
Kunst ist nicht frei, sondern wirksam: ars militans (1929)
I
II
III
Katastrophe in einer Linkskurve (1930)
Sexualität als Sport? (1931)
Der historische Roman und wir (1936)
Jeder Roman hat einen Fonds Realität nötig
Die Allgemeinheit der Realität im Roman
Der historische Roman ist erstens Roman und zweitens keine Historie[.]
Was ist Historie? Mit Historie will man was[.]
Die neue Funktion des Romans: Bericht von der Gesellschaft und von der Person. Jeder gute Roman ist ein historischer Roman[.]
Der Autor ist eine besondere Art Wissenschaftler. Dichtung ist niemals eine Form der Idiotie[.]
Der sonderbare Entstehungsprozeß eines historischen Romans
Der historische Roman in der Literatur unserer Emigration. Welches ist heute die Parteilichkeit des Tätigen?
Epilog (1948)
Briefe
Briefe
An Fritz Mauthner
An Herwarth Walden
An Herwarth Walden
An Herwarth Walden
An Erna Döblin
An Ferdinand Lion
An Bertolt Brecht
An Thomas Mann
An Thomas Mann
An Hermann Kesten
An Elvira und Arthur Rosin
An Thomas Mann
An Elvira und Arthur Rosin
An Bertolt Brecht
An Heinrich Mann
An Theodor Heuss
An Hans Henny Jahnn
An Walter Molo
An Hans Henny Jahnn
An Ludwig Marcuse
An Elvira und Arthur Rosin
An Claus Döblin
An Peter Rühmkorf
Erna D. an Peter Huchel
Erna D. an Theodor Heuss
Erna Döblin an Sascha und Ludwig Marcuse
Die menschliche Position
Merkwürdiger Lebenslauf eines Autors
Eine kassenärztliche Sprechstunde
Ich nähere mich den Vierzig
Ohne Weltbild?
Schriftsteller und Politik
Im übrigen bin ich ein Mensch und kein Schuster
Tod
Die Gans
ANHANG
Zeittafel zu Alfred Döblins Leben und Werk
Editorischer Hinweis
Quellenverzeichnis
Alfred Döblin
Döblin über Döblin
»Ich halte nichts von den sogenannten Autobiographien«
Autobiographische Skizze
In Stettin 1878 geboren, als Knabe nach Berlin gekommen, bis auf ein paar Studienjahre dauernd in Berlin ansässig und an dieser Stadt hängend. Gymnasialbildung, Medizinstudium, eine Anzahl Jahre Irrenarzt, dann zur Inneren Medizin; jetzt im Berliner Osten spezialärztlich praktizierend.
Als Pennäler schon literarisierend; der erste Roman, lyrisch, Ichroman, in der Prima. Als Student der Roman ›Der schwarze Vorhang‹, der vor zwei, drei Jahren gedruckt wurde. Mir war aber die ganze Literatur zuwider; ich hatte keine Lust, mich mit den Verlegern herumzuschlagen; Medizin und Naturwissenschaft fesselten mich außerordentlich. Ich habe in einer verbissenen Wut, doch nicht durchzudringen, nicht einmal in meiner Umgebung, dazu auch in Hochmut und Gewißheit: ›Ich weiß schon, was ich kann, ich habe Zeit‹, ein ganzes Jahrzehnt nichts Rechtes vorgenommen. Sondern mich in Psychiatrie und Klinik herumgetrieben, bis in die Nächte bei Laboratoriumsarbeit biologischer Art; es gibt eine Handvoll Publikationen von mir dieser Art. 1911 wurde ich aus dieser Tätigkeit gerissen, mußte in die mich erst fürchterlich abstoßende Tagespraxis. Von da ab Durchbruch oder Ausbruch literarischer Produktivität. Es war fast ein Dammbruch; der im Original erst fast zweibändige ›Wang-lun‹ wurde samt Vorarbeiten in acht Monaten geschrieben, überall geschrieben, geströmt, auf der Hochbahn, in der Unfallstation bei Nachtwachen, zwischen zwei Konsultationen, auf der Treppe beim Krankenbesuch; fertig Mai 1913. Vorher hatte ich die tröpfelnden Novellen des verflossenen Jahrzehnts zum Bande ›Ermordung einer Butterblume‹ zusammengefaßt; erschien bei Müller-München. 1913/14 schrieb ich den Novellenband ›Die Lobensteiner‹ als Erholung von der ›Wang-lun‹-Arbeit. August bis Dezember 1914 der Roman ›Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine‹. Dann kam der Krieg; ich flottierte in Lothringen und im Elsaß herum. Mitte 1916 warf ich mich in den ›Wallenstein‹; ich schrieb in großer Ruhe; monatelang Krankheitspausen; fertig Ende 1918. Rückkehr in die Praxis. Seit da Kleineres: Die Szenenreihe ›Lusitania‹ (Genossenschaftsverlag Wien), Essays und politische Satire (Linke Poot: ›Der deutsche Maskenball‹), ein Schauspiel ›Die Nonnen von Kemnade‹. Seit zwei, drei Monaten über einer neuen großen epischen Arbeit: Nichthistorie, aber zukünftige, aus der Epoche um 2500 – Höhegewalt der Technik und ihre Begrenzung durch die Natur. – Von meiner seelischen Entwicklung kann ich nichts sagen; da ich selbst Psychoanalyse treibe, weiß ich, wie falsch jede Selbstäußerung ist. Bin mir außerdem psychisch ein Rühr-mich-nicht-an und nähere mich mir nur in der Entfernung der epischen Erzählung. Also via China und Heiliges Römisches Reich 1630.
Alfred Döblin (2. von links) mit seinen vier Geschwistern Hugo, Meta, Kurt und Ludwig
Erster Rückblick
Dialog in der Münzstraße
Es ist Mittag. Ich sitze in einem kleinen Café am Alexanderplatz, und mir fällt ein: in dieser Gegend, hier im Osten Berlins, sitze ich nun schon, seit ich nach Berlin kam, seit vierzig Jahren. Hier bin ich zur Schule gegangen, es kamen kleine Lücken, Studienzeit, Assistentenzeit, Krieg, aber immer wieder ging es zurück zwischen Alexanderplatz und Jannowitzbrücke, später noch östlicher, bis nach Lichtenberg hinaus. Mir fällt ein: ich möchte hier manchmal weg, nach dem Westen. Es gibt da Bäume, der Zoo ist da, das Aquarium und dann gar der Botanische Garten mit den Treibhäusern, die dampfen, – ah, das sind leckere Dinge. Guten Tag, Herr Doktor. – Guten Tag. – Wie geht’s Ihnen? Im Café am hellen Tag? – Ist so meine Stunde (wenn ich bloß wüßte, wer der Kerl ist). – Was macht die Praxis? – Danke, danke, ein Jahr wie das andere. Man kommt so durch. – Und die Kinder? Wissen Sie, Sie müßten weg von hier, für Sie ist doch das eigentlich nichts. Sie müßten nach dem Westen, unter die Menschen. – Hm, und wie? – Soll ich Ihnen sagen, Herr Doktor, hab Sie ja schon öfter hier gesehen, hatte zu tun, ja, ich wüßte schon was für Sie, aber Sie wollen nicht. – Na nu, warum denn nicht? – Nee nee, machen Sie keine Fisemantenten. Sie wollen nicht. Kann mir schon denken, wenn ich Sie ansehe. Ist nicht wegen der Praxis oder so. – Nu bin ich aber schwer neugierig. – Können Sie auch (setzt sich an meinen Tisch, den Hut nimmt er nicht ab, das ist hier so üblich). Hat mir ein Doktor gesagt, Kollege von Ihnen, sind ganz andere Dinge. Ja. Wissen Sie, haben Sie mal gehört: sexuelle Erniedrigung der Frau? – (Ich staune Bauklötze, ich kriege einen Schreck, Donnerwetter, was ist das.) – Na ja, hängt damit zusammen. Manche Menschen wollen nicht, wollen durchaus nicht, was sie sollten, obwohl sie’s könnten. Man soll’s nicht für möglich halten. Mir hat’s der Doktor auf den Kopf zugesagt. Ist nicht Impotenz, im Gegenteil. Erst sagt man: schlapper Kerl, keine Traute, dann kommt’s heraus: er will gar nicht. Man erniedrigt sich. Aus Vergnügen, aus Spaßvergnügen. Komisch, was? Das gibt’s. – Donnerwetter (das sind die Freudbrüder, damit gehn sie hausieren). – Na, was sagen Sie nun? – Da muß ich mal erst meine Tasse austrinken. So. Nun sagen Sie mir, was soll denn da für ein Vergnügen bei sein? – (Er tuschelt an meinem Ohr, schiebt den Hut zurück, grinst.) Sadismus! Gegen sich selbst! – (Ich hab’s erwartet, platze heraus, ich lache meilenlang. Das Café geht in Stücke.) Großartig. So was passiert einem in der Münzstraße. – (Er strahlt). Na, was sagen Sie, Doktorchen? – (Jetzt sagt er Doktorchen, nachher machen wir Güterteilung.) Da stecke ich mir erst ’ne Zigarette an. Sie auch? Also, wie gesagt, also es ist sehr, wirklich sähr schön! Warten Sie noch einen Moment, ich muß noch mal lachen, es sind meine Restbestände. So, das wäre heraus. Jetzt habe ich mich bis zur Siegessäule hingelacht. – Wie steht’s also mit der Sache, Doktorchen? – Ausgezeichnet. Bloß bei mir ist kein Geschäft damit zu machen. – (Der Kerl kneift das Auge.) Sagt jeder. – Sehen Sie mal durchs Fenster, neben dem Ober vorbei. Da sehen Sie Leute, lauter graue, einfache Leute, die vorbeilaufen und was tun. Das sind wir Arbeitsmänner, das Proletariat. Sehen Sie sich die an und dann mich. – Gemacht. Den Unterschied möchte ich in preußischen Pfandbriefen haben. – Passen Sie auf, jetzt kommt die Bibel: das ist mein Herz, und das ist mein Blut, oder so ähnlich. Ist Neues Testament. Diese Leute hier und diese Straße, das ist das Blut. Und hier sitzt das Herz. Diese Leute, das ist die Luft, und ich bin die Lunge. Und dann: das ist die Armee, und hier sitzt ein Soldat. – (Er schnüffelt, beobachtet mich verdächtig, kratzt sich das Kinn.) Verstehe ich nicht. – Wenn Sie mein Leben kennen würden, – ich meine, mein ganzes Leben, früher, würden Sie es schon verstehen. Ganz ohne Sadismus. Wie sich das so zusammenläppert, was man Leben nennt. Wenn man es hinterher betrachtet, steckt eine klare Logik drin, der Sinn. Sie erzählen da von Freud, mit der Erniedrigung, oder Adler. Nach denen entwickelt sich die ganze Welt aus Defekten. Erst ist ein Loch da, und dann entsteht was drum rum. Aber bei mir ist prinzipiell damit nichts zu machen! Defekte, die habe ich wie jeder anständige Mensch. Im übrigen steht bei mir geschrieben: ich bin hier zu Haus, und es geht mir gut, es geht mir vorzüglich. (Obwohl ich gern ins Grüne möchte, einmal einen Baum zu sehen oder einen kleinen See.) Ich bin eine Kröte und kröte hier vergnügt herum. Ohne Sadismus. Auch ohne Masochismus. Die liefere ich nur in Romanen. Ich bin ein Arbeitsmann und ein Proletarier. Übrigens, wenn Sie mich nach dem Kurfürstendamm bringen, kröte ich da auch herum. Ich bin gar nicht kleinzukriegen. Ich bin nämlich vom lieben Gott geschaffen, und der hat mich aus einem fetten Stück Erde gemacht. Einige andere Herren, ich will keine Namen nennen, hat er aus Irrtümern hergestellt, die ihm so zwischendurch unterlaufen sind, am Schabbes, bei der Nachspeise. – (Der Kerl schnüffelt, wischt raus.) –
Ankunft in Berlin
Wollen Sie bitte, Herr Doktor, statt dieser Dialoge, die ja schrecklich interessant sein mögen, nicht lieber etwas von sich erzählen? –
Also, ich bin vor vierzig Jahren nach Berlin gekommen, nachdem ich vorher geboren bin. Ich kam in Berlin in einem Zustand an, der sich nicht sehr unterscheidet von meiner Geburt, zehn Jahre vorher, in Stettin. Es war gewissermaßen eine Nachgeburt. Es hat aber keiner etwas davon gemerkt. (Ich bin ja wirklich in Stettin nur vorgeboren.) Wir fuhren also von Stettin nach Berlin. Meine Mutter unterhielt sich im Zug mit Leuten, die die Stadt kannten. Unsere Gegend, die Blumenstraße, wurde sehr schlechtgemacht, da sind viele Fabriken und Rauch, das Gespräch war sehr lebhaft und in einem Fluß. Ich wagte nichts zu sagen, genauer, etwas zu fragen. Ich saß in Geburtswehen. Mir wurde bänglich und immer bänglicher. Es betraf meinen Bauch. Die Wehen nahmen an Heftigkeit zu. Und als wir uns den Häusern Berlins näherten, war ich am Ende meiner Kraft. Ich stand am Fenster, es war finster, spät abends, ich gab nach. Das Kind war da, es lief in meine Hose, mir wurde wohler, ich stand in einer Pfütze. Dann setzte ich mich beruhigt. –
Nachher fuhren wir durch die fremde große Stadt, und da geschah das zweite Wunder. Wir setzten uns in einen Zug auf einem hellen Bahnhof. Der fuhr ab, durch die Nacht, fuhr ein paar Minuten, dann hielt er, und – wir waren wieder auf demselben Bahnhof. Ich glaubte mich zu irren. Aber das Spiel wiederholte sich zwei-, dreimal. Wir fuhren, derselbe Bahnhof kam, und nachher stiegen wir aus und waren bald zu Hause. Ob wir im Kreis gefahren sind? Aber warum und wozu, und schließlich sind wir doch angekommen. Erst als gereifter Mann habe ich den rätselhaften Vorgang durchschaut. Es wurde mir klar und klarer: wir waren Stadtbahn gefahren. Die Bahnhöfe sehen sich abends ähnlich in Berlin, besonders wenn man aus Stettin kommt. Wir waren von Friedrichstraße nach Jannowitzbrücke gefahren. Aber es war mir ein unvergeßbares Erlebnis; es übt seine beruhigende Wirkung noch heute auf mich aus. Wir waren sechs Personen, die da so zauberhaft reisten: meine Mutter, zweiundvierzig Jahre alt, und wir fünf Geschwister, lauter Stettiner Vollheringe, vier Jungen und ein Mädchen, ich der vorjüngste. Wir hatten den Staub, ich auch das Wasser Stettins von uns geschüttelt. Denn da war uns etwas geschehen. Wir waren aus einem kleinen Paradiese vertrieben worden.
Man bereite sich auf eine baldige Katastrophe vor
In Stettin an der Oder lebte einmal mein Vater. Der hieß Max Döblin und war seines Zeichens ein Kaufmann. Da das aber eigentlich kein Zeichen ist, so war er Inhaber eines Konfektionsgeschäftes, welches nicht ging. Worauf er eine Zuschneidestube eröffnete, die einen guten Verlauf nahm. Dieser Mann war verheiratet und hatte es im Laufe der Jahre, wenn auch nicht zu Geld, so doch zu fünf Kindern gebracht. Auch ich war darunter. Er war mit vielen Neigungen und Begabungen gesegnet, und man kann wohl sagen: was ihm seine Begabungen einbrachten, nahmen ihm seine Neigungen wieder weg. So daß also die Natur in diesem Mann ein merkwürdiges Gleichgewicht hergestellt hat. Eines Tages nun wurde dieses Gleichgewicht auf eine besonders heftige Weise gestört; wie und wodurch, das werde ich gleich erzählen. Jedenfalls beschloß der Mann in seiner Unruhe, nach Mainz zu fahren. Dies wird alle Kenner Stettins in Erstaunen versetzen. Denn wenn man in Stettin aus dem Gleichgewicht gerät, fährt man nicht nach Mainz. Bisweilen nach Gotzlow oder Podejuch oder, wenn es schlimm wird, in die nahegelegene Klapsmühle. Aber Mainz ist ungewöhnlich. Und es war in der Tat ein Haken dabei, den niemand merkte, nicht einmal ich, obwohl ich schon über neun Jahre war. Der Haken war: wie mein Vater nach Mainz fuhr, kam er da nicht an. Das lag an der Richtung seines Zuges. Der nämlich nach Hamburg fuhr.
Und als der Zug in Hamburg hielt, ging die Bewegung in meinem Vater noch weiter. Auch Hamburg war nicht das Richtige. Nicht Mainz, nicht Hamburg, es sollte und mußte noch weiter sein. Es war Amerika. Das Wasser liegt zwischen Hamburg und Amerika. Neunundzwanzig Ozeanflieger sind schon in dem Wasser ertrunken. Mein Vater wollte und mußte herüber, der Drang in ihm war zu groß. Er nahm sich ein Schiff. Obwohl das Gleichgewicht in meinem Vater gestört war, war er doch so besonnen, kein Flugzeug zu nehmen, – vielleicht darum nicht, weil es damals keine Flugzeuge gab. Jedenfalls: er fuhr zu Schiff, wie schon Kolumbus, und darum kam er an. Ob die Freiheitsstatue schon 1888 im Hafen von New York stand, weiß ich nicht. Bestimmt richtete sie mein Vater damals in Gedanken auf. So weit also hatte der Stettiner fahren müssen, um sein Gleichgewicht wieder herzustellen. So sonderbar war das Schicksal. Er hatte gesagt, er wolle nach Mainz fahren, aber schon das Billett stimmte nicht, der Zug fuhr anders, das Wasser kam, und nun saß er in Amerika.
Und er war auch nicht allein gefahren. Er hatte sich einen Mechaniker, einen Doktor, zur Herstellung seines Balancements mitgenommen, einen Leibdoktor, Leibmechaniker. Es tut nichts zur Sache, daß es ein junges Mädchen war. Frauen eignen sich ja für viele Berufe, sie werden Juristen, Abgeordnete, Minister, warum nicht auch Mechaniker. Ja, man erkennt die Besonnenheit unseres Amerikareisenden auch daran, daß er sich ein Mädchen und keinen Mann mitnahm. Denn wer versteht sich besser auf Herstellung des Gleichgewichts, auf alle Schwankungen der horizontalen und vertikalen Lage, als junge, unschuldige Mädchen. Das Mädchen, das mit ihm über den gewaltigen Ozean fuhr und von ihm erkoren war, hieß Henriette, und mit Nachnamen – sagen wir – Hecht. Es war merkwürdigerweise ein Fischname, wie das die Wasserkante mit sich bringt. Aber sie war – ein rätselhaftes Spiel der Natur, eine Paradoxie – vollkommen Fleisch. Offenbar hatten die Hechte im Laufe der Generationen ihre Natur verändert, und so stand sie lieblich vor dem Mann, der mein Vater war, und er fand Wohlgefallen an ihr.
Mein Vater hatte zwei Augen, ein linkes und ein rechtes. Mit dem rechten Auge blickte er immer auf seine Familie. Das linke aber war bei ihm weitgehend selbständig. Während das rechte Auge stets von Sorgen getrübt war, schwer bewölkt und zu Regengüssen geneigt, freute sich und lachte das linke, und das Hochdruckgebiet war weit entfernt. Damit man nicht die sonderbare Verschiedenheit seiner beiden Augen erkannte, trug er eine goldene Brille. Die deckte alles, und dadurch wurde er ein ernster Mann, der er ja auch war, ein vielseitiger Mann. Meine Mutter war eine einfache Frau. Und da sich ihr Mann zu Hause öfters die Brille abnahm, so wußte sie, daß er schielte. Und sie war, wie das nun einmal Frauen sind, neugierig, wohin er schielte. Für das rätselhafte Naturspiel an sich hatte sie gar kein Interesse. Die reine Wissenschaft war ihr egal. Wie sie auch später gar kein Organ dafür hatte, den wunderbaren, schon erzählten Vorgang zu ergründen, der darin bestand, daß ihr Mann nach Mainz fuhr, aber es kam ein Zug auf dem Bahnhof an, der fuhr nach Hamburg an der Elbe – blinde Gewalt der technischen Kraft –, und kaum war der Zug dort angelangt, wird der Mann von einem Ungestüm erfaßt, muß nach St. Pauli an den Hafen, wird in ein Schiff verstaut und soll und muß über den Ozean, obwohl dieser so tief ist und später viele darin ertranken. Nichts davon interessierte meine Mutter. Sie blieb bis an ihr Ende dabei: der Mann ist mit einem Weib ausgerückt. Eine schrecklich einfache Formulierung. Mein Vater hat später sehr darunter gelitten. Sagen wir: etwas gelitten. Sagen wir: gar nicht. Er ist vorsichtigerweise nämlich nicht wiedergekommen.
Meine Mutter also interessierte sich heftig in Stettin, wohin mein Vater schielte. Und je mehr sie die Geheimnisse seines linken Auges zu ergründen suchte, um so dunkler wurden die Schatten über seinem rechten. Aber das schreckte sie nicht. Es war nicht Heroismus bei ihr, es war Temperament und Unbesonnenheit, die leicht in Heroismus ausarten, wobei ihnen aber gar nicht wohl ist.
Mein Vater bemerkte mit dem linken beweglichen Auge in Stettin viele Menschen, Einwohner und Einwohnerinnen, Steuerzahler und Steuerzahlerinnen. Aber nicht das interessierte ihn, ob und wieviel sie Steuer zahlten, sondern ob sie männlich oder weiblich waren. Er nahm eine simple naive Trennung vor. Er war eine Art Fleischbeschauer. Die männlichen fielen gleich ab. Blieben die weiblichen. Die waren in großer Zahl in Stettin vorhanden. Ich kann mich nicht genauer auf sie besinnen, denn ich war damals so klein. Aber ich erinnere mich, wie ich öfter als ganz kleiner Junge von einem Dienstmädchen an der Hand ins Freie geführt wurde, Kinderwagen fuhren mit, es ging in ein Tanzlokal draußen. Da saß ich dann auf der Bank, und im Saal tanzten viele erwachsene Menschen, große Männer und große Frauen, die Frauen kenntlich an den Röcken, die Männer meist in Uniform, mit Schnurrbärten, Soldaten, gewaltige Männer, die stark schwitzten. Solche Mädchen muß auch mein Vater in Stettin entdeckt haben, und die Entdeckerfreude ließ ihm keine Ruhe. So gehen berühmte Gelehrte noch nachts in ihre Laboratorien, blicken in ihre Mikroskope oder rechnen oder stellen noch einmal ihre Apparate zusammen, fangen mitten in der Nacht an zu destillieren, den Schmelzpunkt zu bestimmen. Schließlich: ist die Entdeckung eines Menschen, einer Menschensorte nicht ebenso merkwürdig und beunruhigend und aufregend, wenigstens für den, der sie macht? Und andererseits: ist die Entdeckung eines neuen Elements oder einer chemischen Verbindung seelisch anders, beglückt sie anders, erregt, entflammt sie anders als die eines neuen Menschen? So hängt die Liebe mit der Entdeckerfreude zusammen. Mein Vater muß viel gesucht und viel entdeckt haben. Er betrieb die Wissenschaft gründlich und mit Ausdauer, und es hätten sich ihm da große Perspektiven eröffnet, wenn diese Wissenschaft staatlich anerkannt gewesen wäre. Es war offenbar die Disziplin, für die er am begabtesten war.
Aber während meine Mutter sonst keinen Anteil nahm an seinen vielen anderen Neigungen – er komponierte ja, dichtete, zeichnete –, in dieser einen Passion wurde sie mitgerissen. Wenigstens hier knüpfte sich zwischen ihr und dem Mann ein gewisses eheliches Band. Wenn der Mann auf seinen Kriegspfad ging und sein linkes Auge in Aktion trat, dann geriet auch sie in Erregung. Der Geschichtschreiber muß leider feststellen, daß sie sich auf dem Pfad nicht ebenso bewaffnete wie der Mann. Er trug Rosen, sie aber schwang einen Regenschirm. Er war geladen mit Zärtlichkeit und hohen männlichen Gaben, sie aber mit Zorn. Er ging einsam wie ein Hirsch Wasser suchen, sie aber trug Geschosse, ihn beim Trunk zu stören. Das waren die Unterschiede zwischen den Ehegatten. Sie dachte an ihre Kinder, die Familie und daß dies ihr angetrauter Mann war; er aber: wie schön es sich in der Sonne spazieren ging Arm in Arm, – ach, es war nicht der Arm seiner Frau. Es war überhaupt nicht immer derselbe Arm. Der Mann lebte in starker Unruhe. Er hatte die Weite der Natur entdeckt und die Mannigfaltigkeit der Stettinerinnen. Er wechselte die Quellen seiner Erquickung. Erst spät gewöhnte er sich an eine, und das war das Allerschlimmste, denn diese Quelle war nun zufälligerweise nicht seine Frau. Eigentlich muß man sagen, das Gegenteil wäre ein Zufall gewesen. Denn es gibt notorisch Millionen Frauen auf der Welt; warum soll ein Mann grade seine eigene Frau lieben? Das wäre doch ein höchst merkwürdiges Zusammentreffen! So war es bei meinem Vater. Die Frau, die starke Frau mit dem Regenschirm, nahte. Gerüstet mit Zorn und mit der entschiedenen Abneigung, hier irgendwie etwas zu ›verstehen‹. Sie trug mit sich Legitimität, Pathos, Ansprüche. Die Tragödie war eingeleitet. Der donnernde Jupiter zeigte sein Dasein. So wandeln Menschen im Grünen, und eine Wolke zieht sich zusammen, und sie regnen ein. Man glaubt im Grünen zu wandeln, und schon hat man den Regenschirm vergessen.
Als damals in Stettin in unserem Hause das Gewitter in Aktion getreten war und nicht aufhören wollte, dachte der Mann, so scheint es, an die Wilden in Afrika. Sie haben nichts an, aber sie haben ein Strohdach über sich. Wenn ein Mann an einen andern Arm denkt, so ist es schlimm; wenn er aber an ein anderes Dach denkt, dann ist es gefährlich, und das Verhängnis ist kaum aufzuhalten. Mein Vater fing unter den ständigen Gewittern an zu träumen, vorwiegend von Mainz, der Zug fuhr aber nach Hamburg, dann kam das Meer und Amerika. Was weiter kam, träumte er nicht. Es ist das Schlimme an den Träumen, daß sie zu früh aufhören. Er hätte auch träumen sollen, was nach Amerika kam.
Die Geschichte wird noch einmal erzählt
Erzähle noch einmal die Geschichte. – Wer, ich? Warum? – Frage nicht.
Erzähl sie mir noch einmal. Bitte. –
Hm. Also, wenn es durchaus sein soll. –
Es gab eines Morgens in Stettin einen furchtbaren Tumult bei uns im Hause, Weinen und Geschrei, meine Mutter lief eine Treppe hinauf, Gespräche mit den älteren Geschwistern, fremde Leute kamen. Ein Brief war aus Hamburg eingetroffen, mein Vater, damals zweiundvierzig Jahre alt, war auf der Fahrt nach Amerika. Er schrieb in seinem pathetischen, großartigen Stil – der Mann konnte Ihnen schreiben, die rührendsten Briefe –: ›Goldene Berge werde ich euch bieten.‹ Vorausgegangen waren jahrelange Streitigkeiten zwischen Mann und Frau, Weibergeschichten. Zuletzt drehte es sich, wie gesagt, um ein junges Mädchen, eine seiner Arbeitnehmerinnen, zwanzig Jahr jünger als er, ein Nähfräulein mit dem Vornamen Henriette. Meine Mutter hatte ihr aufgelauert, Tätlichkeiten waren vorgekommen – wenn ich mich recht besinne, auch zwischen den Eheleuten. Es gab ein Tohuwabohu bei uns in Stettin, Verwandte der Mutter kamen, Geschäftsfreunde des Vaters, die Bestände wurden aufgenommen, an den hinterlassenen Schulden hatte meine Mutter noch viele Jahre abzuzahlen. Wir Kinder natürlich sofort aus den höheren Schulen genommen und provisorisch zu einer kleinen Privatlehrerin geschickt. Das ist das Leben. Rette sich, wer kann. Während bei uns alles drunter und drüber ging, der Tag mit Unruhe, Sorgen und Weinen anfing und ebenso endete, während meine Mutter ihre Verwandten alarmierte und für uns bettelte – trieb sich der Mann, der diese Familie gegründet hatte, in New York mit dem jungen Mädchen herum, das zwanzig Jahre jünger war als er, saß mit ihr in Tingeltangels, bewachte sie eifersüchtig, und er lebte da monatelang in New-York in Liebe und Freude, bis das Geld alle war.
Er ist dann nach Europa zurückgekehrt und hat mit dem Mädchen bis an sein Lebensende zusammen in Hamburg gelebt. Meine Mutter hat ihn einen Bigamisten genannt, aber das ist nicht wahr. Sie hat sich erst spät, als sie eine Erbschaft machte, von ihm scheiden lassen. Er hat in Hamburg ein kleines, sehr ärmliches Dasein geführt, zuletzt mußte er unterstützt werden. Uns hat er einmal nach Hamburg kommen lassen – war ein Streit mit der Henriette vorausgegangen oder besann er sich auf seine Pflichten? Aber das Wort Pflicht kam in seinem Lexikon nicht vor – er hatte geschworen, es sei nun alles aus mit dem Mädchen. Der Eid hielt kein halbes Jahr. Dann kamen anonyme Briefe, und wir saßen wieder im Osten Berlins. Er tat auch einmal so, als wolle er sich Arbeit in Berlin suchen, hatte schon Stellung, dann behagte ihm dies und jenes nicht, er verschwand ohne Abschied, es kam ein Telegramm vom Lehrter Bahnhof, und – er saß in Hamburg, am alten Fleck.
Der Mann hat sich wohlgefühlt in Hamburg in seiner Armut und Kümmerlichkeit. Mein ältester Bruder hat ihn gelegentlich besucht, hat auch die Gefährtin des Mannes gesprochen, sie wohnten zusammen in einem armen Stadtteil, proletarisch in sauberen Räumen. Der Mann hatte zuletzt einen ehrwürdigen weißen Bart, trug seine goldene Brille und sah wie ein alter Volksschullehrer aus. Er hat sich viel mit Freimaurerei beschäftigt. Am Ende befiel ihn ein Halsleiden. Es war der Kehlkopfkrebs. Daran starb er. Mein Bruder hat die Leiche im Regen auf den Friedhof begleitet, es ging sonst keiner mit, und hat das Grab richten lassen. Er, der am schwersten von all dem Unglück getroffen war, hatte damals noch eine schreckliche Aussprache mit der Frau. Sie war selbst leidend, konnte sich wenig bewegen. Sie sagte, daß sie an allem unschuldig gewesen wäre.
– Der Mann hat sich in verbrecherischer Weise aus einer wahrscheinlich schweren Situation gerettet. Er war roh genug, seine ganze Familie den Verwandten seiner Frau aufzubürden. Er dachte sich: verkommen werden sie nicht, das Hemd ist mir näher als der Rock. Über Nacht hatte er uns alle in Not gestoßen und zu Bettlern gemacht. Er war ein Lump, nehmt alles nur in allem.
– Es ist nicht recht, meinen Sie, so streng über einen nahen Verwandten, den eigenen Vater, einen Toten zu urteilen? Ich müßte nicht Sohn meiner Mutter sein und nicht alles mitgemacht haben, wenn ich diesen Ton unterdrückte. Ich kann so urteilen nur mit Worten, er hat mit Taten über uns geurteilt so streng wie möglich: Ihr seid mir schlechte Luft, und hat sich allen Herzenspflichten und juristischen Pflichten eines Vaters entzogen. Ich habe nicht den Eindruck, daß ihm das schwergefallen ist. Der Vater hat über seine Familie geurteilt, es war aber, unter Berücksichtigung aller Umstände, nicht nötig, so hart, so wegwerfend grausam über die Familie zu urteilen. Alles Recht der Persönlichkeit in Ehren, aber man macht es sich zu leicht, wenn man glaubt zur Persönlichkeit zu kommen, indem man die Verantwortung zerbricht. Wir leben in keinem Beduinenstaat, der Vater hat nicht Allmacht über die Familie, er muß sich meine Antwort gefallen lassen. Wenn die Sünden der Väter heimgesucht werden an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, so haben die Kinder das Recht, die Väter vor ihr Tribunal zu ziehen und Klage zu erheben. Der Mann ist tot. Vor dem großen Reinigungsfilter, in das wir alle eingehen werden, will ich haltmachen und still sein.
Zum dritten Mal!
Du mußt ran, zum drittenmal. Du sollst noch einmal davon sprechen. – Aber was denn? Von dieser Sache? Ich hab es schon zweimal gesagt. Warum denn? – Du wirst es schon sehen, du weißt es schon, fang nur an. – Ich weiß nicht. – Fang an. –
Seine Eltern waren sehr strenge Leute. – So ist’s recht. Fang mit den Eltern an. – Sie verheirateten ihn mit fünfundzwanzig Jahren. – Sieh mal, wie du alles weißt, mein Junge. Immer sachte so weiter. – Er war schwach, nachgiebig. Er widerstrebte wenig, er ließ sich verheiraten, er macht eine gute Partie mit der Freudenheim, eine schöne Person und Geld. Du lieber Gott, das sind doch alles keine Entschuldigungen. – Wir wollen doch einmal sehen. Nur weiter. – Es ist nicht viel weiter. Sie kriegen Kinder, sein Geschäft geht kaputt, er macht eine Konfektionsstube auf. Dann –. – Was ist dann? – Dann sterben seine Eltern. – Ah. So. Dann sind also die Eltern tot. – Ja. – Das ist wohl ein wichtiger Punkt? – Ich muß einmal sehen. Ich muß doch einmal sehen. Also die Eltern sterben. Sie haben ihn verheiratet. Der Mann ist allein. Daraus ergibt sich eine gewisse Schwierigkeit für die Frau. Aber ich habe etwas vergessen. – Bitte. – Es wird mir schwer, davon zu sprechen, aber ich muß es wohl sagen. Also: der Mann und die Frau stimmten nicht gut zusammen. – Wegen der Partie? Ich meine, weil seine Eltern das Ding gedreht hatten? – Auch deswegen, von ihm aus. Aber das ist es nicht. Sie stimmten nicht zusammen. Überhaupt nicht. – Hm, hm. – – Ja. Es ist wohl nicht schön, wenn ich davon spreche. – Ich denke, man soll Wahrheiten ruhig aussprechen. Es klärt. Man sieht vielleicht dann auch anderes besser. – Die Frau nämlich, meine Mutter, war nüchtern, aus einer Kaufmannsfamilie. Er, der Hamburger, war ein Luftikus, ein begabtes Wesen. Er war sehr begabt. – Nun, und? – Er verfügt über ein ganzes Arsenal von Begabungen. Er spielt Violine, Klavier, ohne Unterricht gehabt zu haben. Wir selbst hatten bei ihm ja die ersten Musikstunden. Das Klavier, weiß ich noch, war eine Zeitlang ein Kasten ohne Beine; oben auf der Platte wurde bei Tag meist zugeschnitten. Es fiel Staub zwischen die Tasten von den Stoffen, man mußte einen Blasebalg nehmen, um ihn zu entfernen. Der Mann komponierte. Ein Stück von ihm setzte sogar der Musiklehrer unserer Schule, des Friedrich-Wilhelmstädtischen Realgymnasiums, für Orgel. Er saß über Büchern auf Kompositionslehre. Er sang, und nicht schlecht. Er schrieb Gelegenheitsgedichte, war ein fixer Zeichner. Er war geschickt im Entwerfen von Kostümen. Eigentlich ein unheimlich talentierter Knabe; lauter künstlerische Dinge. Die Begabungsfülle war, glaub ich, von mütterlicher Seite auf ihn gekommen. Seine Mutter war eine geborene Jessel; der Komponist des ›Zinnsoldat‹ und anderer Operetten: Léon Jessel, ist sein Vetter. Aber bei meinem Vater gedieh nichts recht.
Erstens war er ein Luftikus und trieb nichts beständig, dann hatten sie ihn zu Hause natürlich nichts lernen lassen – das hat ihn sehr gegrämt –, und nachher hing die Familie an seinem Bein. Das waren wir, fünf Stück, und die Frau. Er war auch ein triebhaftes Wesen, ohne allen Ehrgeiz. In dem Mann, ja ich seh ihn noch vor mir, war etwas Weichliches, Schlaffes, Schwächliches und Ruhendes. Er lebte so hin mit seinen Gaben. Er schlenderte, fühlte sich nie eigentlich unglücklich. Ein Windhund, nehmt alles nur in allem. Aber kein unedles Tier.
– Dies ist alles sehr gut, was du sagst. Du siehst, wie nötig es war, daß du noch mal anfingst. Also ruhig weiter. – Es sind schlimme Dinge, die ich spreche. Ich weiß sie gut, aber ich erinnere mich ungern daran. Es führt geradewegs zu mir. – Aber bitte, wir haben Zeit. Ich dränge gar nicht. Wird es sehr schwer? – O nein, es geht schon. Also, wovon sprach ich, meine Mutter, ja. Meine Mutter hatte nicht viel Respekt vor ihm. Sie nannte ihn: ›gebildeter Hausknecht‹. Ein böses Wort. Ein schlimmes Kapitel, dieser Kaufmanns- und Geldstolz in der Familie meiner Mutter. Das waren alles sehr lebhafte, aktive, praktische Leute, Verdiener und einige auch Genießer. Was darüber lag, war unbekannt! Nein, nicht bloß unbekannt, sondern lächerlich! Es war Anlaß zum Höhnen, zum Ironisieren. Wie wenn Indianer oder Neger zu uns kommen und die Kinder sie ausspotten. Eine fürchterliche Sache. Von dieser Seite her kam eine der Minen, über der die Ehe meiner Mutter mit diesem vielbegabten weichlichen Mann aufflog. Das ist es. Ich muß es schon sagen. Ich kann davon sprechen, denn ich habe diesen Hohn, diese Borniertheit, diese bittere, anmaßende Härte selbst kennengelernt. Ich hätte nicht gewagt, nicht wagen dürfen, meine Schreibereien zu Hause zu zeigen. Es wußte lange Jahre niemand zu Hause, daß ich schrieb. Und als 1906 von mir ein kleines Theaterstück in einer Matinee zusammen mit einem Stück von Paul Scheerbart aufgeführt wurde, da kam es nicht unter meinem Namen, dem meiner Familie, heraus, sondern unter einem Pseudonym. Aber schon vorher, etwa 1902, war mir unter diesem häuslichen Druck etwas fast Schweres, eigentlich nur Tragikomisches, passiert. Da ich vermied, meinen Namen unter meine Schreibereien zu setzen, hatte ich meinen ersten Roman, er liegt noch in meinem Rollschrank, an Fritz Mauthner, der damals Kritiker in Berlin war – es ist seitdem kein Theaterkritiker seines Ernstes in Berlin erschienen –, geschickt unter einem Pseudonym. Mauthner war augenleidend, er lebte im Grunewald, schrieb mir nach der Anatomie, wo ich damals arbeitete, an meine Deckadresse: ich möchte ihn besuchen, ihm selbst aus dem Manuskript vorlesen, er sei augenleidend. Eine ganz sonderbare Scheu und Furcht hielt mich zurück davor, ihn zu besuchen. Ja, ich weiß, woher ich diese Scheu habe. Ich hatte also schon ein schlechtes Gewissen vor meinen Arbeiten. So hatte sich das eingeprägt. Bis ins zweite Glied. Ich fuhr einmal bis zum Grunewald, um ihn aufzusuchen. Dann hatte ich es geschickt eingerichtet, daß es schon dunkel war und ich in der Finsternis den Weg zu ihm nicht fand. Vom sichern Hafen schrieb ich ihm einen Brief, worin ich ohne Angabe der Gründe um Rücksendung meines Manuskriptes bat. Und jetzt fängt die eigentliche Tragikomödie an. Mauthner schickte das Manuskript an meine Deckadresse an ein Paketpostamt. Oranienburger Straße. Und als ich dort erschien, um mein Manuskript abzuholen, gab man es mir nicht. Pakete werden nur gegen Legitimation ausgehändigt. Aber wie sollte ich mich legitimieren. Ich zeigte Mauthners Karte vor. Das genügte nicht. Ich war ratlos – und ich blieb ratlos. Das Gegebene, nämlich den Tatbestand, zu erklären, wagte ich nicht. Das schlechte, das grausam schlechte Gewissen! Das zweite Glied! Oh, das ist ein Leiden. Daß so etwas möglich ist. Man hätte mein Manuskript geöffnet, ich – hätte mich zu Tode geschämt. So ist dies Manuskript unabgeholt auf dem Paketamt liegengeblieben. Lange Monate habe ich darunter gekrankt. Die Handschrift meines ersten Romans (die ›Jagenden Rosse‹) ist auf diesem Paketpostamt weggeworfen oder eingestampft. Eine Abschrift hatte ich nicht. Ich faßte einen Entschluß: ich schrieb nach den Skizzen, Entwürfen und aus der Erinnerung das Ganze noch einmal, mit Bitterkeit, über mich verzagend. Ganz schwarz wurde ich darunter.
Ja. Es ging so weiter und blieb so. Als ich schon Arzt war und ein Buch von mir erschien, fragte meine Mutter: »Wozu machst du das? Du hast doch dein Geschäft.« Sie meinte die ärztliche Praxis. Um sie zu beruhigen, mußte ich ihr sagen, daß ich etwas damit verdiene. Es war nicht wahr (übrigens finde ich jetzt, wo sie nicht mehr lebt: die Frau hatte nicht so unrecht. Eigentlich – hätte ich’s lassen sollen –). Es war ihr eine Spielerei, das Schreiben, eine Zeitvergeudung, unwürdig eines ernsten Menschen. Das war noch ganz ein Charakterzug der Menschen, die aus kleinen Verhältnissen in das Reich kamen und Geld verdienen mußten, und sonderbar, es war ganz und gar nicht das, was ich später in Polen bei den Juden traf und was mich da so sehr tief erfreute, die Ehrfurcht vor dem Buch, die Ehrfurcht vor dem Geist. Mein Vater hatte solche verschütteten Gaben mit sich getragen. Er war – ethnologisch das Opfer der Umsiedlung. Alle seine Werte waren umgewertet und entwertet. Darum, darum also gedieh seine Ehe nicht. Erst in meiner Generation ist wieder die Besinnung, auch die freudige Besinnung auf die Herkunft und die alte Ehrfurcht schwer und langsam wieder aufgekommen. Ich – habe die große Umsiedlung überstanden.
Meine Mutter, ich kann jetzt ruhig weitersprechen, es war doch gut, daß ich es sagte, meine Mutter hatte keinen Respekt vor ihrem Mann. Er galt auch bei ihrem Brüdern nichts. Da fängt, jetzt seh ich besser, fängt der Mann, der im übrigen ein Schürzenjäger ist, an, außerhalb des Hauses Luft zu schnappen, nämlich die Luft, die ihm im Hause fehlt. Der Mann wird langsam ein verlogner Rebell, – verlogen; er wagt sich nicht heraus. Solange seine Eltern leben, duckt er sich. Dann wird er frech. Ich kann auch sagen: mutiger, entschlossener. Er wird oft erwischt. Er vernachlässigt ganz evident seine Frau. Er ist außerdem älter geworden, er ist an die gefährlichen Vierzig geraten, und da muß er die H. treffen. Das legt das Schicksal wie ein Experiment auf ihn. Er gerät in Flammen, der Mann wird das noch nicht gekannt haben, es ist offenbar eine wirkliche, ganz starke Liebesleidenschaft. Er ist reif dafür. Es wird vieles damals in ihm die Leidenschaft geschürt haben und Holz zum Feuer gewesen sein. Es war die Krise in seinem Leben. Nun kommt sein Wagen ins Rutschen und Rollen. Zu Haus wächst die Kälte, die Unfreiheit, der Streit. Da – rückt er einfach aus. Endlich, endlich. – Was sagst du: endlich? – Es kam mir so. – Du bist blaß. Es trifft dich wohl sehr. Vielleicht hören wir jetzt auf. – Nein, danke. Ich kann sprechen. Ich bin doch kein Jüngling mehr, daß mich Einsichten umwerfen. Ich sehe alles klar. Ich sprech es jetzt gern aus. Es fürchte die Götter das Menschengeschlecht! Sie halten die Herrschaft in ewigen Händen und können sie brauchen, wie’s ihnen gefällt. – Können wir weitersprechen? – Doch. Es war die Krise im Leben meines Vaters. Er rückt, er rückt einfach aus, dieser Mann. Es tut mir wohl, das so zu sehen. Jetzt bitte ich etwas aufhören zu dürfen. – Gut, gut. Wir haben ja Zeit. – (Eine lange Pause, geschlossene Augen. Dann:) Fahren wir fort. Also mein Vater, der war abgeschwommen von Stettin.
Das kann er jetzt. So weit ist er. Es geht ganz leicht. Es ist dann gar kein Grund anzunehmen, daß dieser Mann jemals wiederkehren wird. Denn warum? Gewissensbisse, wenn sie überhaupt auftreten, treten zurück hinter dem Gefühle des neuen Daseins, der Freiheit. Wird sich seine Frau ändern? Nicht die mindeste Chance. Sie hängt an ihm, er ist ihr Mann, aber ihre Naturen sind sich fremd. Es findet keine Berührung statt. Bei dem blutjungen Mädchen drüben ist er aufgeblüht. Er fühlt sich da wohl. Es ist sein, unbegrenzt sein Element. Seine Existenz. Er wird bei ihr bleiben. Es wird aus ihm vielleicht nichts werden mit allen seinen Gaben. Sein Vater hatte ihn zwingen wollen, etwas Falsches zu werden. Resultat: Desertion, der Mann um sein halbes Leben betrogen, seine Familie Bettler. Man hätte ihn jung laufen lassen sollen oder ihm eine derbe oder sehr kluge Frau geben, Kandare oder ganz lose Zügel. Jetzt ist er deklassiert. Immerhin aber: er lebt, lebt, man verstehe, er lebt in dieser Klasse, auf einem andern Kontinent, seiner Natur entsprechend. – Nun wollen wir aufhören. Es ist wohl alles gesagt. Für jetzt. – Ja. Was soll ich aber zu dem Ganzen sagen.
Unanfechtbar wie sein hartes Urteil über seine Familie ist das Urteil seiner Familie über ihn. Ich kann daran nicht rühren. Für den, der noch andere Taten hinzunimmt, die Taten anderer, seiner Eltern, wird das Urteil schwer. Man gelangt zu keinem Urteil. Nur zu einem Kopfsenken. Zu einer Anklage vielleicht nach einer andern Richtung. Schließlich bleibt, bleibt eine Einsicht, eine Lehre, eine Warnung, für jetzt, für uns, die wir leben.
Übrigens hatte er eine Schwester
Der Mann, von dem ich sprach, hatte übrigens eine Schwester, die in vieler Hinsicht ganz sein Gegenteil war. Sie war von der strengen Art seiner Eltern. Diese Frau hätte vorzüglich zu ihm gepaßt. Sie hieß Henriette, merkwürdigerweise auch Henriette, und hatte einen Mann, einen höchst weichen, etwas trottelig lebendigen Herrn mit viel Gemüt und Herz. So weit ich sah, hatte er es nicht gut bei ihr. Sie war höllisch klug. Sie hatte mächtig und stramm zu Hause die Hosen an. Als sie an einem Herzschlag starb, noch nicht alt, es kam ganz rasch und unerwartet, verheiratete sich der Mann, man möchte sagen stehenden Fußes, weiter. Er lebte selig auf. Der hätte es wagen sollen auszurücken. Sie hätte ihn vom Nordpol, von den Fidschiinseln, vom Kap der allerbesten Hoffnung an ihre liebende Brust zurückgeholt.
Ehre, dem Ehre gebührt
Meine Mutter habe ich in der Erinnerung als eine Frau, die bis in ihr Alter ansehnlich war. Sie gab viel auf ihr Äußeres, ließ sich noch in ihrer letzten Krankheit frisieren, liebte Schmuck und Putz. Sie war von großer Wärme für ihre Kinder und später für ihre Enkel. Das Besorgen von Wäsche und Unterzeug war ihr eine Herzenssache. Sie war nicht sehr klug, ihre Schwester war viel klüger. Das schulmäßige Bildungsniveau ihrer Familie stand im allgemeinen nicht hoch. Sie war in Samter, in der Provinz Posen, geboren, wo ihr Vater, den ich als kleinen Mann mit einer weißen Halsbinde in Erinnerung habe, kleiner Kaufmann war, Dorfkaufmann mit Materialwaren. Seine Kinder sprachen Deutsch, aber auch Polnisch und schon etwas abgeschwächt Jiddisch. Wenn meine Mutter an Verwandte schrieb, schrieb sie gern in jiddischen Buchstaben, die an Türkisch oder Arabisch erinnern; von meinem Vater ist mir das nicht bekannt. Übrigens stammte auch er aus Posen, aus der Stadt Posen selbst. In Samter war meine Mutter aufgewachsen, ihre Brüder waren schon früh, um 1865, nach Breslau und Berlin gezogen, sind begüterte Holzhändler geworden, die Firmen florieren noch heute. Meine Mutter, im Exil in Berlin, war mit uns und dem Haushalt von morgens bis abends beschäftigt. Eine Zeitlang vermietete sie Zimmer. Sie wusch selbst, ein Mädchen konnte sie sich nicht halten. Sie war tapfer und rüstig. Man ist nicht lange Zeit sehr unglücklich. Sie hatte eine eigentümlich skeptische und resignierte Lebensauffassung. Ihre Kernsprüche verraten eine bedauerlich gute Bekanntschaft mit dem Dasein: ›Wie einem ein Haus einfällt, fällt’s mir auf den Kopf‹ und die mehr beruhigenden Sätze: ›Wie einer will‹ und: ›Es ist schon immer wie geworden, es wird auch weiter wie werden...‹ Sie konnte großartig deklamieren, und wir können noch das herrliche Gedicht auswendig, das sie an trauten Abenden aufsagte. Man muß es laut aufsagen, mit heroischen Gesten, so dringt man am ehesten in seinen Geist ein:
›Geh Meister, nimm mich auf zum Schüler,
Ist’s einem ernst, so ist es mir.
Ich werde nicht nach Wochen kühler,
Mich treibt nicht eitle Ruhmbegier.
Nach andern, ja nach schönern Reizen
Verlangt’s allmächtig meinen Sinn:
Drum, Meister, laß mich Maler werden –‹
Weiter weiß ich nicht. Außerdem übermannt mich die Rührung. Ich weiß nur, es endet kolossal schmerzreich mit den Worten: ›Vom Liebchen auf das Leichenbett.‹
Vom Schicksal der entwurzelten Familie
Der älteste Sohn, Ludwig, reüssierte großartig. Er war echtes Kaufmannsgewächs mit dem Familiensinn der Mutter, der Musikneigung des Vaters. Er wurde der Ernährer der Familie, der zweite Vater. Er kam ins Geschäft zu den Holzonkels, machte sich selbständig und verließ erst die Familie, als er sich verheiratete. Auf ihn fiel die Hauptlast, die der entflohene Familiengründer abgeworfen hatte, und er trug sie brillant. Wir Jüngeren besuchten in Berlin Gemeindeschulen, ich allein bog nach drei Jahren ins Gymnasium zurück. Bei uns allen schlug das Blut des Vaters stark durch. Hugo, der zweitälteste Sohn, hielt es nur kurze Zeit als Kaufmannsstift in einem Geschäft aus, dann mußte er zum Theater. Rasch hatte sich auch der lustige Knabe in die Tochter seines Lehrers verliebt, das war Paul Pauli, der alte Baumert aus den Webern, und die Tochter, Martha, geheiratet. Man kennt ihn von Berliner Bühnen und vom Film.
Im jüngsten Bruder, Kurt, steckte die Musikleidenschaft, er kam vom Klavier nicht los, wurde ein ausgezeichneter Pianist. Aber da war keine Möglichkeit zum regelrechten Studium, er blieb im Geschäft. Er verband sich zuletzt mit dem ältesten Bruder.
Die Schwester Meta ist schon tot. Sie wurde 1919 bei den Lichtenberger Unruhen von einem Granatsplitter getroffen, als sie vormittags aus ihrem Haus trat, um Milch für ihre kleinen Kinder zu holen. Sie konnte noch, den Splitter im Leib – sie wußte nicht, was ihr passiert war – die Treppe hinaufgehen. Da blieb sie dann liegen. Auf dem Bett fand man Blut an ihrem Mantel. Sie lebte noch einen Tag.
Ich war damals nicht weit von ihr in Lichtenberg und habe diesen Putsch und die grausigen, unerhörten, erschütternden Dinge der Eroberung Lichtenbergs durch die weißen Truppen miterlebt. Um dieselbe Zeit, wo in unserer Gegend die Granaten und Minenwerfer der Befreier ganze Häuser demolierten, wo viele in den Kellern saßen und dann, schrecklich, wo viele füsiliert wurden auf dem kleinen Lichtenberger Friedhof in der Möllendorfstraße – man muß die Leichen da vor der Schule liegen gesehen haben, die Männer mit den Mützen vor dem Gesicht, um zu wissen, was Klassenhaß und Rachegeist ist –, um dieselbe Zeit wurde im übrigen Berlin lustig getanzt, es gab Bälle und Zeitungen. Nichts regte sich, als dies in Lichtenberg geschah, und die vielen Zehntausend Arbeiter in Berlin blieben alle still. Damals habe ich gesehen, wie notwendig es war, daß diese sogenannte Revolution zurückgedrängt wurde. Ich bin gegen die Unfähigkeit. Ich hasse die Unfähigkeit. Diese Leute waren unfähig zu einer Handlung. Mit Schlappschwänzen, Dummköpfen und Phrasendreschern muß man Fraktur reden. So ist es damals gegangen, und wer Fraktur geredet hat, ob er links oder rechts ist, ich steh auf seiner Seite. Es war um diese Zeit – ich muß weiter davon sprechen – einmal eines Mittags die ganze Siegesallee, die Bellevuestraße, der Potsdamer Platz gestopft voll mit Menschenzügen. Wer diese Menschenmassen gesehen hat und bei ihnen Wagen mit Maschinengewehren, Tausende kräftiger Männer, und diese Masse, Arbeiter, tat nichts als Hoch und Nieder schreien, und eine andere große Arbeitermasse zog neben ihr, in anderer Richtung, sang auch die Internationale und schrie ›Nieder‹, wo die drüben ›Hoch‹ schrien – wer dies erlebt hat, der wird wissen, welchen Widerwillen ich gegen solche erbärmliche ›Revolution‹ empfand. So fremd, so feindlich mir die weißen Truppen waren, ich trat zurück und sagte entschlossen: dies ist gut, sie sind besser als die drüben. Hier geschieht ein gerechtes Gericht. Entweder sie wissen, was Revolution ist, und sie tun Revolution, oder ihnen gehören Ruten, weil sie damit spielen.
Ich wollte von meiner Schwester sprechen. Ich konnte an dem schrecklichen Vormittag, wo die Beschießung von der Warschauer Brücke her einsetzte, nicht zu ihr. Das Feuer aus schwerer Artillerie auf die Frankfurter Allee war zu stark. Sie war auch rasch in eine nahe chirurgische Klinik gebracht worden. Als die Zeichen einer inneren Verblutung deutlich wurden, machte man ihr noch einen Leibschnitt. Umsonst. Ein großes Gefäß war angerissen, sie starb in der Narkose. Meine Mutter war damals schon schwer leidend, sie wohnte in Lichtenberg bei ihrem ältesten Sohn. Als ich mit dem Ehemann meiner Schwester zu ihm in die Wohnung kam, hörte meine Mutter meinen Bruder nebenan krampfhaft weinen bei der Nachricht. Ihr Gesicht war steif, wie es die Krankheit machte, ihre Hände und der Kopf zitterten stärker. Sie sagte gleich: »Sie ist tot.« Und dann: »Warum sie und nicht ich.« Meine Schwester hatte es nicht sehr gut zu Hause gehabt. Sie war unter der Wahnidee des Bürgertums aufgewachsen: ›Du sollst, mußt und wirst heiraten.‹ Obwohl wir nichts hatten, vermied man alles, um sie in ein Geschäft zu stecken. Kein Gedanke war der Familie fremder, als daß die Tochter einfach wie jeder andere Geld verdient und sich auf eigene Füße stellt. So ging die Schwester herum und wurde lange, lange nicht verheiratet. Mein ältester Bruder zog unter Riesenopfern eine große Summe als Mitgift aus seinem Geschäft. Der Mann, den sie dann heiratete, war schon vor der Ehe zweifelhaft. Sie wurde gewarnt, aber sie wollte von Haus weg, sie wollte ihre Wirtschaft. Eine kurze schlimme Ehe. Der Mann hatte sie des Geldes wegen genommen. Nach ein, zwei Jahren war die Ehe geschieden. Die Frau hauste einige Jahre mit ihren Möbeln allein, dann – es konnte ja so nicht bleiben, und noch immer, noch immer war der einzige Weg die Heirat –, dann heiratete sie wieder, einen Handwerker, einen sehr einfachen, ordentlichen Mann. Mit ihm fuhr sie nach Konstantinopel, nach Antwerpen. Wir haben sie da einmal besucht. Sie hatte aus der ersten Ehe dieses Mannes, er war Witwer, zwei Kinder übernommen, und da sie arm waren und nichts hatten, bekam sie noch vier Kinder. Sie hatte früher zu Hause bei uns oft erregte Tänze mit meiner nicht weniger leidenschaftlichen und heftigen Mutter. Später stand die Tochter, die vielgeprüfte und erfahrene Frau, aufs herzlichste auch mit ihr. Ihr Schicksal war schwer wie das meiner Mutter, aber sie bestand es ebenso tapfer wie sie und wurde nicht gebrochen. 1914 wurde Antwerpen beschossen und von den Deutschen eingenommen. Sie hat diese Belagerung und Beschießung mit ihren Kindern mitgemacht, auf einem großen Transport kam sie gleich nach der Einnahme Antwerpens nach Deutschland.
Obwohl sie sich schwer mühte, war sie doch immer guter Laune und gab rechts und links Rat und war sehr beliebt. Es war ein Ende, das gut zu ihrem Bilde paßt, das sie dann traf: der Tod beim Einholen von Milch für ihre kleinen Kinder. Die Kinder sind dann gut herangewachsen, sie gehen in die Schule oder, siehe da, sogar die Töchter, sind schon selbständig, stehen auf eigenen Füßen, obwohl sie jung sind. Es geht ihnen allen gut. Dies sage ich, in einem leisen Denken, daß sie es selber hört.
Lebensabschluß meiner Mutter
Wir zogen von der Blumenstraße nach der Landsberger nahe dem Friedrichshain, dann nach der ganz neuen Marsiliusstraße gegenüber der Fabrik, in den vierten Stock – ich konnte von da auf den Hof meiner Gemeindeschule herüberblicken nach der Blumenstraße. Dann kam der Grüne Weg, wo wir auch einmal die Ehre hatten, den alten Herrn, den Hamburger, als Gast bei uns zu sehn. Die Familie trat langsam aus dem Stadium des Bettelns heraus, hauptsächlich durch die Arbeit des ältesten Bruders. Wir wohnten in der Wallnertheaterstraße, folgten dem ältesten Bruder, als er sich selbständig machte, nach der finsteren Markusstraße und später noch östlicher in die Memeler Straße an der Warschauer Brücke. Allmählich schmolz die Familie zusammen. Als erster verließ Hugo, der Schauspieler, das Nest: er heiratete sehr jung, und meine Mutter hatte von ihm das erste Enkelkind. Dann heiratete der älteste Bruder, und wir waren noch zu dritt bei der Mutter. Dann kam die Eheschließung meiner Schwester, und ich ging auswärts studieren. Blieb noch bis kurz vor ihrem Ende der jüngste Bruder bei meiner Mutter.
Im Leben der Frau vollzog sich da um 1908, wie sie schon über sechzig Jahre war, eine glückliche Wendung. Ein sehr heller Lichtstrahl fiel in ihr Leben: sie erbte einen großen Betrag von einem ihrer Brüder. Sie war von dem Augenblick an wirtschaftlich selbständig und gut gestellt. Es entsprach ihrer Art, daß sie uns von dem, was sie hatte, gab, soviel sie nur konnte. Sie ging jetzt in Sommerfrischen, machte kleine Reisen, auch einmal eine große, nach Antwerpen zu meiner Schwester. Aber schon damals hatte sie rätselhafte Zeichen eines Leidens an sich. Ihr rechter Arm zitterte, ihre rechte Hand zitterte, und es war solch merkwürdiges Reißen in dem Arm, das gar nicht weichen wollte, durch Einreiben nicht, durch Elektrisieren und Massieren nicht. Es war 1910. Ich zeigte sie meinem damaligen Chef am Urbankrankenhaus, Albert Fränkel. Er sagte kopfschüttelnd, es sei eine putzige Sache, man müsse beobachten. Nach einem halben Jahr war alles deutlich: der Arm war steifer geworden, sie konnte sich nicht das Haar mehr machen, das Zittern der Finger hatte einen eigentümlich rhythmischen Charakter, das Pillendrehen zwischen Daumen und Zeigefinger. Es war der Beginn der Schüttellähmung, der Paralysis agitans. Die dann ihren langsamen schweren furchtbaren, langsamen schweren jämmerlichen Verlauf, Ablauf, Hinablauf nahm. Langsam stellte sich die Spannung, Steifigkeit und Härte auch im rechten Bein ein, griff nach links über. Den Kopf befiel ein Zittern, die Gesichtsmuskeln wurden eigentümlich streng. Sie wußte nicht, was sie hatte. Man sagte ihr: es sind die Nerven. Und sie sagte, ja, das sei nicht wunderbar nach dem, was sie alles hinter sich hätte, die Arbeit die langen Jahre, allein mit fünf Kindern, dann noch abvermietet und selbst gewaschen. Ich fuhr mit ihr nach Wiesbaden, sie besserte sich, aber das war alles Trug. 1914, Ende Juli im Trubel der Kriegsgefahr, brachte ich sie nach Oeynhausen. Die Bahnhöfe waren von Soldaten gefüllt, auf der Rückfahrt lagen Posten an manchen Brücken. Ich fuhr mit Russen, die rasch nach Hause wollten. Ich konnte mich in Berlin kaum aus dem Zug pressen, so stürmten neue Menschenhaufen die Coupés. Aber Oeynhausen tat der alten Frau nicht gut, die Bäder schwächten sie. Ich erinnere mich noch, wie sie mich später in der Frankfurter Allee einmal besuchte, Oktober 1914 zum Geburtstag Peters, meines Ältesten. Sie kam mit Geschenken; es ging sehr, sehr langsam die Treppe herauf und herunter.
Ende 1914 wurde ich einberufen, ich sah sie zwei Jahre nicht, meine Urlaube waren mit eigenen Krankheiten erfüllt. Dann kam ich nach Lichtenberg, wo sie wohnte mit dem jüngsten Bruder. Welches Bild. Ich stieg die Treppe hinauf. Ich wußte, sie hatte eine Krankenschwester bei sich. Ich klingle, es öffnet niemand. Ich klingle und klopfe. Da bewegt sich drin eine Tür und ein ganz langsamer schnurrender Schritt naht. Drin wird die Kette abgenommen, und sie steht da. Das ist sie, die ›Oma‹. Ihr Haar ist schlohweiß und dünn. Es ist heut noch nicht gekämmt, es hängt ihr seitlich über die Ohren. Die Frau ist so klein, so klein. Sie steht starr mit rundem Rücken vornübergebeugt, den Kopf hat ihr das Leiden stark auf die Brust gedrückt, die Hände hält sie wie Pfötchen fest gegen den Leib. Sie blickt kläglich, so kläglich, wie bittend von unten herauf. Dicke Säcke sind unter ihren Augen, an den Oberlidern hat sie gelbe Flecke. So steht sie an der Tür. »Du bist es, Fritz. Warum kommst du denn gar nicht?« Eine monotone, leise vibrierende Stimme, der Klang von früher ist da, aber brüchig. Ich habe sie langsam in die Stube geführt, die Schwester war einholen gegangen, ich setzte sie auf einen Stuhl. Ich habe damals bei ihr gewohnt, die Urlaubstage. Obwohl sie äußerlich so sehr verändert war, von der Krankheit in den Boden gedrückt, hatte sie noch ganz ihre alten Gewohnheiten und ihre Art, die Hausfrau, die rechnete, die Mutter, die sich kümmerte, alles greisenhaft. Sie ließ sich gern erzählen, lachte auch gelegentlich. Sie war unbehilflich wie ein Stock, mußte gesetzt, gefüttert und gewaschen werden. Aber noch konnte sie, auf die Füße gestellt, die kleinen Schritte machen; wenn sie aber fiel, konnte sie sich nicht aufrichten. Es kam das Kriegsende, wir waren alle wieder da, es besuchte sie bald der, bald der. Sie zog zu meinem ältesten Bruder, bei der Beschießung Lichtenbergs trug man sie in den Keller.