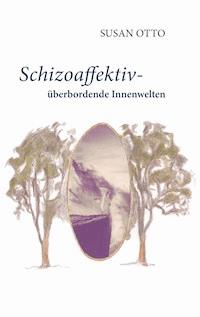
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Schizoaffektive Psychose - was ist das eigentlich konkret? Als Betroffene gibt die Autorin Einblicke in ihre entrückte Seelenlandschaft. Sie schildert psychische Vorgänge, die Fachärzte im Allgemeinen als "Wahn" bezeichnen. Hinter dem Chaos ihres Wahnerlebens, erkennt sie schließlich ein glasklares, logisch nachvollziehbares System, eine übergeordnete Botschaft, die dem schizophrenietypischen Realitätsverlust so gar nicht entspricht. Sie geht davon aus, dass dieser außergewöhnliche Geisteszustand der seelischen Entrückung ein Portal zur Wahrnehmung von Jenseitskontakten öffnet. Zahlen werden plötzlich auf einer energetischen Ebene erfahrbar und abstrakte Ideengebilde aus dem Bereich der Kunst nehmen in und an ihrem Körper Gestalt an. Neben ihren eigenen Erfahrungen schildert sie Fallbeispiele, fachliche Aspekte der Erkrankung sowie Grenzfälle der Psychiatrie und stellt die Frage: “Sind vereinzelte Symptome wirklich nur Ausdruck der Krankheit oder sind sie der Schlüssel zu einem erweiterten Bewußtsein?”
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich danke meiner Familie und meinen Freunden. Ich möchte mich außerdem bei den Menschen bedanken, die mir ihre Zitaterlaubnis eingeräumt haben, und mir somit bei der Entstehung dieses Buches ermöglichten, entsprechende Kapitel aufbauend auszuführen. Ich danke dem Psychoanalytiker Paul Brutsche, dem Physiker Gary-Bruno- Schmid, der Kuratorin Inge Jadi, dem Psychiater Markus Preiter, dem Theologen Uwe Wolff und dem Physiker und Psychologen Walter von Lucadou.
»Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass die Kranken nicht erklären können und die Gesunden nicht verstehen.« (Arzt nach dem eigenen Durchleben einer schizophrenen Psychose)
Inhalt
Begriffserklärungen
Schizophrenie:
Bipolare Störung
Schizoaffektive Psychose
Psychose:
Symptomfreies Intervall:
Residualsymptome:
Schizophrenie – Die Auslöschung des Ich
Fallbeispiel: Der Zerfall der Persönlichkeit
Fallbeispiel: esoterische Weltabgewandtheit
Die schizophrene Dekompensation
Die Andersartigkeit der Wahrnehmung
Der Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit
Wahn – das Ich im luftleeren Raum
Die tragenden Säulen des Ich
Kommunikation
Der Höllentunnel
Was sind die Auslöser einer psychischen Erkrankung?
Der Gedanke – schicksalbildendes Mysterium
Die Wechselwirkung zwischen Gefühl und Gedanke
Der freie Wille im Rahmen der individuellen Entsprechung
Eine Dynamik des Todes
Kurt Cobain: In mir wirst du lebendig
Der Ritualcharakter
Der Nullpunkt
Nirvana – Eine unmissverständliche Antwort
Manie – die Exaltation der Seele
Die manische Aussage
Das perfekte Timing: Ein Phänomen innerhalb der Manie
November 2002 – die Aufwärtsspirale
Die Zusammenkunft der Archetypen
Pia – Und ich fand andere wie mich
Neuroleptika: Ein hoher Preis für Symptomfreiheit
Residualsymptome – was nach dem Psychosevietnam kommt
Der Spiegel, in dem ich mich nicht erkennen will
Berufliche Reha – Vanillekipferl oder Hirschhornknöpfe?
Wenn Strafe Heilung bedeutet – Die doppelte 33
Der Todesengel von Udo Ulfkotte
Etwas in mir hat sich verselbstständigt – Grenzfälle der Psychiatrie am Beispiel von Anneliese Michel und Manuela Ruda
Außersinnliche Wahrnehmung im Rahmen psychischer Erkrankungen
Ambivalente Kommunikation – die alltägliche Schizophrenie
Das Bestreben, den anderen verrückt zu machen
Prinzhorn und die schizophrenen Meister
Belanglose Äußerungen in der heutigen Kunsttherapie
Kunst als übergeordnete Widmung
Louis Wain und die schleichende Veränderung seiner Katzen
Wahn und Traum
Wie Bipolare ihre Krankheit empfinden
Begriffserklärungen
Bei den folgenden Begriffserklärungen handelt es sich nicht um Fachbuchdefinitionen, sondern um Beschreibungen, die ich aus meiner subjektiven Krankheitserfahrung als Betroffene und aus Beobachtungen zusammengetragen habe. Aufgrund dessen ist es möglich, dass einige Aspekte einer vollständigen Definition unerwähnt bleiben.
Schizophrenie:
Bei der Schizophrenie handelt es sich um eine psychische Erkrankung, die akut oder chronisch verlaufen kann und die durch eine andauernde Störung des Empfindens, der Wahrnehmung und der Ich-Identität gekennzeichnet ist. Krankheitstypisch ist die Veränderung der Gedankeninhalte und deren Qualität. Die Krankheit beginnt oft mit einer Veränderung der gewohnten Empfindungsstrukturen bezüglich des eigenen Ich. Infolge dessen, setzt ein rapider Verfall aller kognitiven Fähigkeiten ein. Zusammenhänge können nicht mehr erfasst werden, die Sprache verarmt und die gedanklichen Verbindungen und Äußerungen des Betroffenen werden unlogisch und nicht mehr nachvollziehbar. Die Seele gerät in einen Zustand der Entrückung. Da diese Entrückung vom Betroffenen als befremdlich wahrgenommen wird, geht die Krankheit je nach Ausrichtung der Phase mit Angst und sozialer Isolation einher. Im schlimmsten Fall bewirkt die Schizophrenie die Auflösung des spezifischen Wesenskerns, den Zerfall der Persönlichkeit. Bei der chronischen Verlaufsform wird sie oft von Depressionen begleitet.
Die Phasen der Schizophrenie werden begleitet von einer Positiv- bzw. Negativsymptomatik. Die Positivsymptomatik ist das, was zum normalen Erleben dazukommt, z.B. Wahn, Beeinflussungsgedanken, Halluzinationen. Die Negativsymptomatik ist das, was vom normalen Erleben weggenommen wird, z.B. Depression, Angst, kognitive Störungen.
Ich möchte hier die Definition von drei unabhängigen Fachärzten erwähnen, die die Schizophrenie folgendermaßen charakterisieren:
»Es handelt sich um eine Reihe von Krankheiten, die verschiedene Gründe haben aber in einem gewissen Moment ihrer Entwicklung dasselbe Bild aufweisen.«
(Norman Satorius, Psychiater)
»Die Schizophrenie ist durch ein Auseinanderfallen von Denken, Fühlen und Realität gekennzeichnet. Die Welt der Betroffenen zersplittert.«
(Eugen Bleuler, Schweizer Psychiater)
»Die Schizophrenie ist wie ein Chamäleon. Es gibt keine goldene Regel für ihre Definition. Es handelt sich vielmehr um eine Gruppe von Erkrankungen, die sich irgendwie ähnlich darstellen. Ursächlich bei ihrer Entstehung sind Genetik und psychosoziale Faktoren.«
(Frank Schneider, Professor für Psychiatrie)
Bipolare Störung
Die bipolare Störung ist eine zumeist phasenhaft verlaufende Erkrankung, die durch einen Wechsel von einer pathologisch ausgeprägten Hochstimmung (Manie) hin zu einem krankhaften Stimmungstief (Depression) gekennzeichnet ist. Auch ein umgekehrter Verlauf ist möglich. Der Wesenskern der Erkrankung, liegt in den gegensätzlichen Auslenkungen der Affekte. Anders als bei der Schizophrenie, findet kein Persönlichkeitsverfall und keine wesentliche Beeinträchtigung der kognitiven Funktionen statt. Die bipolare Störung kann von psychotischen Symptomen, wie Wahnvorstellungen begleitet werden, jedoch ist das Wahnerleben mit der zugrundeliegenden Phase (Manie bzw. Depression) kongruent. Ein Maniker wird in seiner Hochstimmung keine Suizidgedanken entwickeln. Anders verhält es sich, wenn ein Patient von einer Manie unmittelbar in eine Depression fällt, aber weiterhin eine manische Getriebenheit zugrunde liegt. In einer solchen Phase ist die Wahrscheinlichkeit einer Selbsttötung am größten. Die Ich-Identität wird nicht in der Form erschüttert, wie die eines Schizophrenen.
Schizoaffektive Psychose
Die schizoaffektive Psychose ist ein Konglomerat, bestehend aus Symptomen der Schizophrenie, sowie der bipolaren Störung. Die schizoaffektive Psychose umfasst die gesamte Bandbreite der emotionalen Ich-Erschütterungen, beginnend bei der Depression, die mit einer Paranoia einhergehen kann, bis hin zum Größenwahn und Beziehungswahn bei manischer Grundstimmung. Alle Formen des Wahns können sich hier entwickeln. Die Anfänge des Persönlichkeitsverfalls, der zerfallenden Ich-Identität, können ebenfalls eingeläutet werden. Sie führen jedoch nicht unbedingt in die Sackgasse eines irreversiblen Verfalls. Die schizophrenietypische Positiv- bzw. Negativsymptomatik wird von den extremen Affektauslenkungen, den Hoch- und Tiefphasen der bipolaren Störung begleitet. Das Wahnerleben bekommt dadurch eine Dynamik, die sich wiederum auf die Wahninhalte auswirken kann. Auch bei dieser Erkrankung kann es zu Ruhephasen kommen.
Psychose:
Eine allgemeine und überaus treffende Definition des Begriffs der Psychose nach dem Psychotherapeuten Gary Bruno Schmid:
»Psychose ist ein außergewöhnlicher Zustand der geistig-seelischen Haltung, der durch eine derart intensiv erlebte Subjektivität im Sinne von veränderten äußeren und inneren Wahrnehmungen – insbesondere des eigenen Ichs – geprägt ist, dass das ihm entsprechende Verhalten von den Mitmenschen kaum oder gar nicht nachvollzogen werden kann und den Betroffenen in Isolation und Einsamkeit bannt. Eine psychotische Störung liegt vor, wenn mindestens eins der folgenden Symptome vorhanden ist: desorganisiertes Verhalten, Halluzinationen, Wahnphänomene, Zerfahrenheit im Denken.«
Symptomfreies Intervall:
Phasen der Symptomfreiheit, die für den Betroffenen eine Möglichkeit zur Regeneration darstellen. Je nach Schwere und Anzahl der Krankheitsphasen, können symptomfreie Intervalle von der sogenannten Residualsymptomatik begleitet werden, die eine Regeneration erschwert oder gar verhindert.
Residualsymptome:
Unter diesem Begriff werden die Überbleibsel einer psychischen Krankheit nach dem Abklingen der Akutphasen zusammengefasst. Diese Symptome entwickeln sich schleichend aber chronisch und machen sich durch körperliche und vor allem sensorische Überempfindlichkeit bemerkbar.
Schizophrenie – Die Auslöschung des Ich
Was uns befremdet, kann uns nicht sympathisch sein. Unter einem Schizophreniepatienten stellt man sich landläufig den personifizierten Schrecken vor. Jemanden, der allem Menschlichen entrückt ist. Ein finsteres Mysterium, dessen Seelenleben gleichzeitig fasziniert und abstößt. Ein Gesicht mit leeren Augen oder verzerrter Mimik. Schizophrene zeigen uns Gesichter, fern der Heimat. Gesichter, aus denen wir nicht lesen können, weil wir nur deuten können, was uns vertraut ist. Wir können nur dann Sympathie empfinden, wenn uns ein Gesicht von einem Gefühl erzählt, das wir selbst schon einmal hatten: Trauer, Freude, Wut, Panik, Erstaunen, Angst. Wenn die Grenzen des Ich jedoch im Begriff der Auflösung sind, dann fusionieren diese Gefühle in einem Schmelztiegel der Gegensätzlichkeiten. Dann wird eine aufgeheiterte Grundstimmung vom Gefühl der latenten Traurigkeit begleitet. Beide Stimmungen können scheinbar grundlos existieren, also ohne äußeren Anlass. Dieser emotionale Kontrast ist in seiner Gleichzeitigkeit ein Symptom der Krankheiten aus dem schizophrenen Formenkreis. In psychiatrischen Fachzeitschriften und Prospekten sind, sobald das Thema Schizophrenie thematisiert wird, oft Grimassen und Gesichter abgebildet, in die der Schrecken gefahren ist. Der Leser soll durch die karikaturesken und plakativen Darstellungen von Gefühlszuständen einen Einblick in das Gemüt eines Schizophreniepatienten erhalten. In einem psychiatrischen Krankenhaus, bieten sich dem Besucher jedoch andere Bilder. Im Angesicht eines Schizophreniepatienten werden wir selbst zu Autisten, zu Analphabeten, die die Geschichte, die ein solches Gesicht erzählt, nicht erfassen können. Welch eine Ödnis und Tristesse muss einer Seele zugrunde liegen, die nur noch den sogenannten »toten Blick« in die Welt wirft? Welcher Umstand hat dem Blick seine Lebendigkeit genommen? Was tritt an die Stelle des Ich, wenn es sich auflöst? Das Gesicht ist die Offenbarung der Seele, doch nicht jedes Gesicht erzählt eine Geschichte. Manche Patienten haben ihr Buch nach Kapitel X einfach geschlossen, für die Außenwelt unzugänglich gemacht, und ihr Gesicht ist gewissermaßen erstarrt. Sie zeigen schließlich gar keine mimische Regung mehr, erscheinen leblos. Diese Weltabgewandtheit, die sich im leeren Blick offenbart, kann ein Anzeichen für die sog. »schizophrene Verpuppung« sein, einem chronischen Rückzugsverhalten, welches infolge einer Kapitulation vor sämtlichen zwischenmenschlichen Interaktionen eintritt. Tatsächlich ist es jedoch so, dass sich in der unausgewogenen Mimik von Schizophreniepatienten eine interfamiliäre Schieflage widerspiegelt, ein Zusammenkommen von gegensätzlichen Gefühlen in Verbindung mit paradoxen Kommunikationsmustern. Emotionale Kontraste, die ihm über Jahre hinweg, vorwiegend unbewusst, aufgebürdet wurden und denen er durch sein kindliches Abhängigkeitsverhältnis nicht entkommen konnte. Die Übertragung dieser emotionalen Verwirrungen auf das Kind trägt zusammen mit anderen Faktoren, zum Ausbruch der Krankheit bei. Ich gehe im Kapitel: »Das Bestreben, den anderen verrückt zu machen« näher auf diese Mechanismen ein.
Wir empfinden Empathie, wenn der Gesichtsausdruck zur Situation passt. Doch was empfinden wir für Menschen, die auf dem Friedhof lachen? Menschen, deren Blick so bohrend und durchdringend ist, dass wir annehmen, von ihnen müsse Gefahr ausgehen? Was sagt uns die Asymmetrie eines Gesichts, dessen rechter Mundwinkel nach oben und dessen linker Mundwinkel nach unten zeigt? Was halten wir von Menschen, die die Bühne einer vollbesetzten Oper stürmen, um durch ein Megaphon »Freude schöner Götterfunken« zu verkünden? Menschen, die politische oder kulturelle Großveranstaltungen aufsuchen, um ein einzelnes Opfer zu verhöhnen oder gar tätlich anzugreifen? Was empfinden wir, wenn wir in der Tageszeitung die Schlagzeile lesen: »Psychisch Kranker überwältigt Hobbypiloten«? Aus dem Kleingedruckten des Artikels würde schließlich hervorgehen, dass der psychisch Kranke den Hobbypiloten gewaltsam überwältigte, mit dessen Hubschrauber entkam, und schließlich zwischenlandete, um ihn mit einem Motor vom Schrottplatz zu einer »Speed-Machine« umzubauen, mit der Begründung, Ufos aus dem Gebiet vertreiben zu müssen.
Wir ahnen die Gefahr, die von diesen Menschen ausgehen kann, und trotzdem sehen wir sie als bemitleidenswerte Randfiguren, als tragische Figuren, die man aus dem Augenwinkel heraus maximal belächelt, bevor sie in der Truhe der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Sie werden belächelt, weil ihre Taten so wenig von Kalkül motiviert sind, dass sie gewissermaßen planlos agieren, ihre Taten unausgegoren erscheinen und ihnen keinerlei vorsätzliche Boshaftigkeit zugrunde liegt. Manchmal ist eine solche Tat sogar ein letzter verzweifelter Versuch, überhaupt irgendwie mit der Außenwelt zu interagieren. Es ist der Wahn oder die emotionale Zwangsjacke, aus der die Betroffenen auszubrechen versuchen, bevor man sie in psychiatrischen Kliniken oder im Falle von Kapitalverbrechen in forensischen Strafanstalten unterbringt.
Die Problematik, die in einer psychischen Krankheit wurzelt, ist jedoch nicht greifbar, da es sich um eine Erkrankung der Seele handelt, welche immateriell ist. Deswegen ist sie für die Psychiatrie in letzter Konsequenz auch nicht vollständig begreifbar. Einen kranken Geist kann man nicht, wie etwa ein Organ, austauschen und durch einen gesunden ersetzen. Seine Existenz ist vielmehr eines der vielen ungelösten Rätsel, die uns die Natur stellt. Ein Rätsel, das der Ursachenforschung bedarf.
Die Affekte eines kranken Geistes können sich von jetzt auf dann ohne ersichtlichen Anlass ins Gegenteil verkehren. Im Patienten wirken psychische Kräfte, denen er ausgesetzt ist und die sein Handlungsmuster formen. Der Anlass dieses Vorganges ist für den Beobachter nicht immer ersichtlich. Der Kranke agiert nicht nachvollziehbar von innen heraus. Sein Handeln wird von seiner angespannten Innenwelt motiviert und schließlich durch einen äußeren Impuls ausgelöst. Mechanismen, die für den außenstehenden Beobachter unzugänglich sind. So kann es zum Beispiel sein, dass ein Patient infolge der Residualsymptomatik unter erhöhter Lärmempfindlichkeit leidet und aggressive Anfälle bekommt, wenn er einem erhöhten Lärmpegel ausgesetzt ist, dem er nicht entkommen kann, z.B. Kindergeschrei in einem Reisebus. Die erhöhte Lärmempfindlichkeit ist das Resultat einer herabgesetzten Reizschwelle, die den Betroffenen übermäßig empfindlich gegenüber sämtlichen Sinnesreizen macht.
Welche Welt betritt ein Patient, bei dem es wieder »soweit ist« oder besser gesagt, in welche Welt wird er von den fremdartigen Energien katapultiert?
Fallbeispiel: Der Zerfall der Persönlichkeit
Einen sehr tragischen Fall von Schizophrenie erlebte ich an einem Betroffenen, namens Jürgen. Es war im Frühjahr 2004, als mein guter Freund Mike mir ein paar seiner Kumpels im betreuten Wohnen vorstellen wollte. Wir fuhren also gemeinsam zu dem Wohnheim, welches sich in einem Neubaugebiet befand. Ein liebloses Wohnsilo, dessen Treppenhaus Requisiten aus finstersten DDR-Zeiten bereithielt: eine schwarze PVC-Überstülpung an dem kalten Geländergriff, schmucklose Gardinen in trostlosem dunkelweiß, die »Adieu Tristesse« zu sagen schienen. Eine ewig gestrige und unpersönliche Stimmung lag in der Luft. Von Zuwendung und menschlicher Geborgenheit fehlte jede Spur. Wir gingen nach oben, klingelten und Jürgen öffnete die Tür zur WG. »Ach, Hallo …«, murmelte er in einem niedergeschlagenen Tonfall, der eine Mischung aus Unterwürfigkeit und Resignation zum Ausdruck brachte. Es war kein »Ach, Hallo«, im Sinne von einer freudigen Begrüßung. Der Tonfall der Stimme erhob sich also nicht, wie es bei einer freudigen Begrüßung normalerweise der Fall ist, sondern der Tonfall sank ab. Auch schien es so, als hätten seine Worte nicht die Kraft, wirklich nach außen zu dringen, sondern eher so, als würde er sie selbst verschlucken. Die Ausläufer der einzelnen Worte, glichen einer Leier. Die Worte waren also nicht kurz und prägnant, sondern nach hinten hinausgezogen. Insgesamt klangen sie eher wie ein Klage-Sprechgesang.
Man musste also schon seine gesamte Aufmerksamkeit auf ihn richten, wenn er begann, etwas von sich zu geben. Jürgen war von kleiner, gedrungener Statur, doch zusätzlich zu seiner kleinen Körpergröße, machte er auch noch einen Buckel, so, als wolle er in der Masse verschwinden. Sein Kopf neigte etwas nach vorn und wenn er etwas erzählte, neigte er ihn seitlich, ähnlich einem Hund, der den Befehlen seines Herrchens lauschte. Er war also das ganze Gegenteil einer stolzen, selbstbewussten Erscheinung. Der Ausdruck in seinen Augen war durchzogen von einer melancholischen Hoffnungslosigkeit, doch er war auch flehend und fragend zugleich. Sein Verhalten und seine Augen sagten Folgendes: »Schön, dass ihr da seid. Ich kann weder etwas mit euch, noch mit mir selbst anfangen und weil ihr jetzt da seid, muss ich weg, um dann wiederzukommen und festzustellen, dass sich an der Ausgangssituation nichts geändert hat. Zu mehr bin ich nicht fähig.«
Die Ausläufer seiner Ober- und Unterlider waren nach unten gebogen, was ihn optisch zu einer traurig wirkenden Erscheinung machte. Nachdem er uns die Tür öffnete und hereinbat, trafen wir auf eine kleine Gruppe relativ unkoordinierter Männer und auf einen Wellensittich, der so sehr im Kontrast zur Gesamtsituation stand und so wenig ins Bild passte, wie ein neonfarbenes Toastbrot im Hintergrund von Davinci’s »Mona-Lisa«. Durch die Anwesenheit des Wellensittichs sollten die Männer scheinbar ihre Fähigkeit des sozialen Aspekts der Fürsorge ausbauen. Wir standen also inmitten eines großen WG-Zimmers, in dem ungefähr fünf mehr oder weniger verwirrt erscheinende Männer mit verschiedenen Amtshandlungen beschäftigt waren, deren Ausgang jedoch unbestimmt war. Ich war mir also nicht sicher, warum diese Männer gerade das taten, was sie denn taten bzw. unterließen. Es war kein vernünftiges Ziel ihres Handelns absehbar. In der Mitte des Zimmers stand ein Tisch mit Stühlen und Jürgen sagte, dass wir uns ruhig setzen könnten. Im selben Moment verließ er jedoch das Zimmer ohne ersichtlichen Grund. Mike setzte sich schließlich in einen Sessel. Auf einem anderen Sessel saß Theo, den wir beide schon aus dem psychiatrischen Krankenhaus Marienthal kannten und der aufgrund einer schweren Gehirnverletzung erkrankte. Er stammelte ein paar belanglose Sätze, die thematisch nichts miteinander zu tun hatten und wenn man darüber lachte, begann auch er zu lachen. Doch dieses Lachen war so wenig von dieser Welt, dass uns allein der Anblick auch wieder zum Lachen animierte. Dieses Lachen war kein freundliches Lachen, es war auch kein Lachen als Resultat eines gelungenen Witzes, es war kein zynisches und kein verhöhnendes Lachen. Es war einfach ein grundloses Lachen, ein Lachen, das aus einer noch unerschlossenen Ecke des Universums zu kommen schien. Ein Lachen, von dem man nicht wusste, ob es der erlebten Tragik und der Abfolge von Ereignissen mit ungünstigem Ausgang trotzt oder ob es aus diesen Aspekten gewachsen ist. Theo hatte stahlblaue Augen, die vor Wahnsinn leuchteten und diesen durchdringenden Blick, den ich oft bei Patienten festgestellt habe. Auf seinem Gesicht befanden sich Narben und auch auf seinem Kopf. Wenn er lachte, sah man seine spitzigen Eckzähne und schwarze Zahnlücken. Die Anordnung der verbliebenen Zähne und das sich zum Dreieck verformende Gesicht mit den beiden gigantisch leuchtenden aber ausdrucksleeren Ausstülpungen, schienen eine absurd paradoxe und doch erheiternde Geschichte zu erzählen.
Während Jürgen ziellos mit einer zerknüllten Plastiktüte in der Hand durch die Wohnung irrte, sah ich mich in dem WG-Zimmer um. Eigentlich sah es so aus, als sollte sich die kleine Gruppe von Männern und wir, die Gäste, zum gemeinsamen Kaffeetrinken und Kuchenessen an den langen, schmalen Tisch in der Mitte des Raumes platzieren. Ich erinnere mich daran, dass zumindest eine Torte auf dem Tisch gestanden hat und sich Jürgen der Herausforderung des Kaffeekochens stellte. Er kündigte es jedenfalls an. Es schien mir in diesem Moment noch unmöglich, dass in dieser Atmosphäre irgendeine Art von Gemeinsamkeit hergestellt werden könnte. Jürgen irrte noch eine Weile unkoordiniert und ziellos in der Wohnung umher und kam schließlich zu uns. Er schien vergessen zu haben, dass es nun Kaffee und Kuchen geben sollte und stammelte ein paar zusammenhanglose Sätze vor sich hin, deren Inhalt jedoch uns gegolten hat. Was mir an seinen inhaltlichen Äußerungen auffiel, war die Tatsache, dass sie keinen logischen Ursprung und keine schlüssige Aussage hatten. Außerdem rissen seine Gedanken mitten im Satz ab, er verlor den roten Faden, der sowieso schon relativ kurz war. Er begann also einen Satz und mitten im Satz verlor er den Gedanken, hielt inne und begann ein völlig anderes Thema: »Und, wie gehts Euch so? Mir geht’s naja …Wir wollen ja dann zusammen Kaffee trinken. Ich weiß auch nicht, mein Vater hat mich nie gut behandelt. Das war damals in Hessen …«
Sein Blick fiel zu Boden und die Hilflosigkeit seiner Gesamterscheinung verunsicherte mich, da ich so etwas zuvor noch nie erlebt hatte. Jürgen stellte sich immer ganz dicht zu uns, wenn er etwas erzählen wollte, so als suche er Schutz und Zuflucht. So, als wären wir Felsen in einer Brandung. Es war ihm völlig unmöglich, auch nur einen zusammenhängenden Satz zu äußern, der zur Situation gepasst hätte oder eine zielgerichtete Aussage mit einem gewissen Sinngehalt. Die reduzierte Mimik und Gestik stand im Kontrast zu einer körperlichen Rastlosigkeit. Jürgen hielt es nie lange an einer Stelle aus, er setzte sich auch nie, sondern blieb stehen, gab einen Satz von sich, den er nicht zu Ende führen konnte und hastete dann in irgendein Nebenzimmer, jedoch ohne Plan und Ziel. Diese gedankliche Zerfahrenheit gepaart mir einem intensiven Bewegungsdrang, stelle ich mir für den Betroffenen als besonders belastend vor. Das, was einen psychisch Kranken von einem geistig Behinderten maßgeblich unterscheidet, ist die gruselige Tatsache, dass der psychisch Kranke seinen geistigen Verfall bei vollem Bewusstsein miterlebt. Er merkt also, dass er verblödet. Der geistig Behinderte kann darüber nicht reflektieren. Er ist eingeschränkt, macht sich darüber aber keine Gedanken, weil er sich aufgrund der Eingeschränktheit gar keine Gedanken machen kann. Beim psychisch Kranken verengen sich die geistigen Spielräume, was zur Folge hat, dass die Persönlichkeit und das gedankliche Spektrum auf ein Mindestmaß schrumpfen. Das ist die ausgeprägteste Form von Persönlichkeitsverfall, die ich jemals bei einem Schizophreniepatienten erlebt habe. Diese Art der Schizophrenie ist degenerativ.
Der Betroffene muss in einem Martyrium des geistigen Verfalls mit ansehen, wie seine Persönlichkeit nach und nach zerfällt. Er muss miterleben, dass seine Gedanken keiner Ordnung mehr folgen und auch nicht mehr aufeinander aufbauen. Er muss sich damit abfinden, dass seine Gedanken nur noch auf ganz flacher Ebene an ihm vorbeihuschen und seine Unfähigkeit, sie zu strukturieren, ihn in völliger Überforderung und Hilflosigkeit zurücklässt. Diese Hilflosigkeit manifestiert sich schließlich auch äußerlich in Körperhaltung, Mimik und Gestik. Der Betroffene kann sein Umfeld irgendwann nicht mehr darüber hinwegtäuschen, dass er zu dem geworden ist, der er nun mal ist. Und diese Tatsache beängstigt ihn selber am meisten. Die Ungewissheit, was die Schizophrenie noch mit ihm vor hat, ist wie der Blick in einen dunklen Abgrund, dessen Tiefe nicht zu erahnen ist.
Ganz anders verhält sich das Erscheinungsbild der schizoaffektiven Psychose. Auch hier erleben sich Patienten als von sich selbst entfremdet. Im Gegensatz zur reinen Schizophrenie, bündelt sich jedoch hier eine geistige Kraft, die in eine ganz bestimmte Richtung ausagiert wird und die den Patienten nahezu obsessiv erscheinen lässt. In der Schizophrenie zerfließt diese geistige Kraft zu einem Emotions-, Gedankenund Handlungskauderwelsch, der den Kranken schließlich in einem Zustand der Verwirrung zurücklässt.
Ich möchte an einem weiteren Fallbeispiel den Kontrast zwischen den oben beschriebenen Symptomen des Schizophreniepatienten Jürgen und den Symptomen der schizoaffektiven Psychose am Fall von Alex, einem Mitpatienten herausstellen:
Fallbeispiel: esoterische Weltabgewandtheit
Alex: »Wovon lebst Du?«
Ich: »Ich bekomme Erwerbsminderungsrente.«
Alex setzte sein breitestes Lachen auf und legte seinen Kopf dabei etwas schräg in meine Richtung und ich konnte nicht widerstehen infolge dieses aufklärenden Geistesblitzes mit zu lachen. Diese Tatsache war im esoterischen Sinn logisch und irgendwie erhebend. Wenn ich dieses Statement zukünftig als Antwort auf die Frage geben würde, warum ich berentet bin, würde ich mich dabei jedenfalls besser fühlen, als langwierig mein seelisches Problem als Ursache zu erklären und mich rechtfertigen zu müssen. Alex war mir aufgrund seiner Affinität zur Esoterik vertraut und er betrachtete mich nicht als ein personifiziertes böhmisches Dorf, oder als jemanden, den man nur aus der Distanz heraus beäugt, so, wie ich es in dieser Zeit oft erfuhr. Vor mir stand jemand, der die weltlichen Banalitäten hinter sich gelassen und eine Sichtweise kultivierte, die Fachärzte als »magisches Denken« bezeichnen. Das erkannte man daran, dass er einer bestimmten Zahlenkombination eine besondere Bedeutung zuschrieb. 734. Diese Zahlen zierten auch sein Nummernschild. Alex hatte etwas närrisches an sich. In liebenswert-abgehobener Art und Weise.
Er war ein Mann, der auf der psychiatrischen Station durch sein Erscheinungsbild herausstach, da er optisch sehr geordnet wirkte. Er war etwa Mitte vierzig und trug sein schulterlanges, blondes Haar zu einem akkuraten Zopf gebunden. Außerdem besaß er diese optische Geschliffenheit, die von seinem gewinnenden Charisma unterstrichen wurde. Er hatte blaue, glasklare Augen und diesen durchdringenden Blick. Auf den ersten Blick entsprach er nicht dem typischen Psychiatriepatienten. Alex wurde wegen Jähzorn zwangseingewiesen. Er bedrohte seine Lebensgefährtin im Streit und schnitt die Telefonkabel durch.
Er fuhr einen Passat und auf der Ablagefläche hinter seiner Frontscheibe lagen dutzende Sonnenbrillen, unabhängig von der Jahreszeit. Im Kofferraum befanden sich seine Samurai Schwerter, die er bei Gelegenheit stolz präsentierte. Er wollte nun den Weg des friedvollen Kriegers einschlagen. Diese Art der Lebensführung ist eine Philosophie des Autoren Dan Millman, beruhend auf den Prinzipien des Zen-Buddhismus. Er trug stets eine Kette mit einer silbernen Plakette, auf der die Symbole aller Weltreligionen eingestanzt waren. Er zeigte mir diese Kette fast jedes Mal, wenn wir uns zufällig trafen, weil wir immer wieder auf dieselben Themen zu sprechen kamen.
Ich hatte vorher kaum einen Menschen getroffen, der ein Gespräch nicht über einen Smalltalk eröffnete, über belanglose Fragen: »Wie geht es dir« oder »Das Wetter macht einem zu schaffen, nicht wahr?« Alex war anders. Er kam auf einen zu, und bezog sich sofort aufs Wesentliche.
Wenn man sich mit Alex unterhielt, bekam alles einen neuen Sinn. Ein Sinn, der eigentlich ein alter war und der sich einem nur erschließen würde, wenn man jedes Wort zu seiner Wurzel zurückverfolgte. Ein zusammengesetztes Hauptwort erscheint in einem ganz anderen Licht, wenn man die einzelnen Wortbedeutungen separiert und ihrem Wesen auf den Grund geht.
»Dies-seits, Jen-seits, Para-dies. Fällt dir was auf? Para- und Jen haben dieselbe Bedeutung. Das Paradies ist also das Hiesige, was drüben ist. Das Hiesige auf der anderen Seite.«
»Mein Opa wird bald 96. Die Bezeichnung »Vorfahre« rührt daher, weil er schon vor mir vor-gefahren ist in diese Welt und mein Sohn als mein Nachfahre, ist erst nach-gefahren, nachdem ich schon hier unten verweilte.«
»Wenn du unter dem Begriff Schicksal, geschicktes Heil verstehst, dann sprechen wir dieselbe Sprache.«
Wir benutzen Worte, ohne darüber nachzudenken und verwenden sie so inflationär und unbedacht, dass sie zur Bedeutungslosigkeit verkommen. Alex ging zur Wurzel der Wortbedeutung zurück. Er ging so aufmerksam an das Wort heran, dass man annehmen könnte, man hätte es mit dem Meister der Worte zu tun. Andererseits war er so sehr in diesem Thema, dass ihn nichts Weltliches von seiner Analyse abzubringen vermochte. Eine Unterhaltung jenseits der sorgfältigsten Wortaufschlüsselung schien unmöglich. Damit meine ich keinen Smalltalk, sondern Fragen, die man aus Interesse am Gegenüber stellt. Man erfuhr nichts über sein emotionales Befinden. Es schien so, als hätte er seine emotionale Welt hinter der Übergeordneten eingeschlossen und isoliert. Oder er hatte sie seiner Ver-rückung geopfert.
Die Frage: »Gefällt dir die Arbeit in der Fabrik?« wurde gezielt ignoriert oder ins Philosophische transportiert:
»Wenn mein Chef in der Fabrik auf mich zukommt und mir erzählen will, wie ich etwas zu machen habe, dann deute ich nur mit dem Zeigefinger nach oben und sage: Der dort oben, das ist mein einzig wahrer Chef und nur der sagt mir, wo es lang geht. Und wenn ein Kollege sich erdreistet und mir Anweisungen geben will, dann sage ich: Wir sehen uns nachher vor der Tür.«
Dabei zeigte er mir seine Faust und riss seine Augen auf.
Er sagte das mit einem Grinsen im Gesicht, so, als hätte diese Methode der Problemlösung schon immer funktioniert. In jedem zwischenmenschlichen Gefüge, sah er sich als oberste Instanz. Aber er wirkte dabei niemals arrogant, weil er freundlich und zugewandt war und seine Ausführungen stets mit einem breiten Grinsen garnierte. Er schaffte es wirklich, Menschen zu entflammen und auf Erkenntnisse aufmerksam zu machen, die es wert waren, überdacht zu werden.
Im Sommer traf ich Alex zufällig auf dem örtlichen Supermarktparkplatz. Ehe ich mich versah, hatte er mich am Haken, was bedeutet, dass er mich in einen »Monolog« verwickelte. Alex war oft so intensiv in seiner Materie, dass die neuesten Erkenntnisse in puncto »Begriffsaufschlüsselung« und »esoterische Weltabgewandtheit« nur so aus ihm herausschossen. Es gab keine Zeit zum Innehalten, weder für ihn als aktiven Redner, noch für mich als teilüberforderten Zuhörer. Wir standen in der prallen Mittagshitze und wichen keinen Millimeter in den Schatten. Die Informationen waren zu relevant und durften um keinen Preis durch eine körperliche Interaktion unterbrochen werden.
Alex gestikulierte raumeinnehmend und setzte nach jeder neu vermittelten Erkenntnis sein närrisches Grinsen auf. Seine blauen, kristallklaren Augen leuchteten und drangen durch mich hindurch, wie das Licht einer ganzen Galaxie, die von Menschen jedoch nicht erschlossen werden konnte. Optisch hatte er frappierende Ähnlichkeit mit Hardy Krüger Junior.
Viele Leute gingen an uns vorbei und drehten sich auffällig zu uns um. Alex lächelte sie alle an und grüßte sie teilweise freundlich. Auf dem Fahrradweg auf der anderen Seite der nahegelegenen Straße, fuhren Männer vorbei, die ihm zuriefen und ihm von Weitem zuwinkten. Es waren Arbeitskollegen und Bekannte, die ihn auch aus der Ferne erkannten. Alex schien sehr beliebt in seiner Fabrik.
Nach etwa einer halben Stunde in der prallen Sonne, gingen wir endlich in den Supermarkt, in dem die Filialleiterin gerade damit beschäftigt war, eine neue Mitarbeiterin anzulernen.
»Ach, siehe da, die Chefin.«, bemerkte er extrovertiert und unüberhörbar für jeden.
»Neulich habe ich mit der Chefin und den Angestellten zusammen hier Kaffee getrunken. Ich bin einfach in den Aufenthaltsraum gegangen und habe mich zwischen den Herrschaften platziert, um ihnen den übergeordneten Sinn ihres Arbeitslebens zu erörtern.«
Es fiel mir auf, dass die Chefin und die Angestellten Alex befremdlich beäugten um dann schnell das Weite zu suchen. Sie grüßten ihn zwar kurz mit skeptischem Gesichtsausdruck zurück, gaben aber durch ihre Körpersprache zu verstehen, dass sie keinen Wert auf Gesellschaft legen.
Bei einem erneuten, zufälligen Treffen, kamen wir auf das Thema »Reue« zu sprechen. Alex sagte:
»Durch eine Entschuldigung kann man die Dinge nicht ungeschehen machen, im Gegenteil. Wenn man sich entschuldigt, bekommt die Sache eine unnötige nachträgliche Bedeutung. Man sollte sich nicht entschuldigen, denn dadurch würde man nur noch mehr Gewicht auf etwas Vergangenes legen, was im gegenwärtigen Moment keine Bedeutung mehr haben sollte. Alles, was passiert, hat seinen Grund, also wozu sollte man sich entschuldigen?«
Einmal kam mir der Gedanke, dass ich mir eigentlich den Mund von Entschuldigungs-Bekundungen fusselig reden müsste, wenn ich mich für jede Unannehmlichkeit, die ich anderen Menschen zugemutet habe, entschuldigen würde.
Deshalb machte Alex’ Sichtweise für mich Sinn. Ich bin auch der Überzeugung, dass nichts ohne Grund geschieht und dass sich in zwischenmenschlichen Beziehungen oft eine Dynamik entwickelt, die nichts mit dem Willen des Menschen zu tun hat, sondern die in einen Automatismus übergeht, in dem der Mensch nicht anders reagieren kann, als er es tut.
Sollte ich deshalb für den Rest meiner Zeit mit einem schlechten Gewissen leben? Oder würde ich es mir durch diese Sichtweise zu einfach machen?
Im Sommer lud ich Alex zu einer meiner Grillpartys ein, die ich mit Freunden und Bekannten jährlich in unserem Garten organisierte. Er kam überraschend, denn er sagte vorher weder zu noch ab. Er stand gegen 21 Uhr einfach da und ich war freudig überrascht. Im Laufe des Abends präsentierte er mir seine neue Errungenschaft: Ein »Cardsharp«. Ein Messer in Form einer Kreditkarte mit entsprechender Hülle. Aus der Hülle zog er ein flaches, silbriges Gebilde, ähnlich einer Kreditkarte, an dessen Ende sich ein Messer befand, welches in der Optik einer Klaue gehalten war.
»Mit dieser Kreditkarte kann man auch ungedeckt bezahlen«, meinte er. Es sei ein Messer aus dem Anglerbereich.
Alex unterhielt sich an diesem Abend vorwiegend mit einem meiner Gäste. Die beiden Männer standen nebeneinander und unterhielten sich, als Alex plötzlich einen Schritt zur Seite ging und bemerkte: »Ich bin verrückt! VER-RÜCKT.« Mit seinen Händen ahmte er nochmals die Bewegung nach, dass er nun einen Schritt zur Seite gegangen war und deshalb ver-rückt.
Auf die Frage meines Gastes, wie er das Wort »Nachrichten« interpretierte, meinte Alex:
»Nachdem sich etwas zugetragen hat, richtet man darüber. Man urteilt im Nachhinein«, oder: »Über das tägliche Leid wird nochmal nach-gerichtet, im Sinne von: Richtet die, die sowieso schon am Boden liegen.«
Der Weg des friedvollen Kriegers als Eigentherapie gegen ein jähzorniges Temperament, die Samurai Schwerter im Kofferraum, die sprechenden Fäuste und das Kreditkartenmesser.
Im Psychosevietnam würde er mit diesen Waffen nicht weit kommen.
Die schizophrene Dekompensation
Die schizophrene »Entgleisung« kann, wie in den Fallbeispielen geschildert, auf völlig unterschiedlichen Wegen erfolgen:
Die pathologische Zerstreutheit, als Resultat der Auflösung des Ich, raubt dem Betroffenen alle geistigen Ressourcen. Einige Patienten müssen sich dem Lauf dieser Zerstreutheit ergeben und dekompensieren in einem Zustand von sog. Bewegungs- bzw. Satzstereotypien, während andere Patienten in ein Wahngebäude gedrängt werden. Je tiefer der Betroffene in den Wahn gerät, desto mehr verfeinert sich diese Idee, die wie eine sichere Festung für das provisorische Ich des Patienten wirkt. Es ist das Ich im abgesicherten Modus.
Der Patient, der zum Opfer seines eigenen Zerfalls wird, findet das letzte statische Element in Satzstereotypien. Das bedeutet, dass er im Verlaufe eines Tages einen einzigen Satz oder auch nur ein Wort tausendfach wiederholt. So beobachtete ich es an einem Patienten, der durch die Flure der psychiatrischen Station lief und unaufhörlich den Satz: »Ich zerfließe, ich zerfließe …« von sich gab. Eine andere, sehr alte Patientin, wurde von motorischer Unruhe geplagt und versuchte, sich selbst durch unaufhörliches Serviettenfalten zu ordnen und zu beruhigen. Dabei gab sie immer wieder denselben Satz von sich. Diese Vorgehensweise bildete für die Frau den letzten Halt des Ich.
Dem Auseinanderfallen und der Auflösung der Persönlichkeit im Falle von Jürgen, steht eine glasklare, unerschütterliche, engmaschige Ich-Struktur innerhalb des Wahns, im Falle von Alex gegenüber. Dem dynamischen Prozess des Zerfließens, steht die statische Idee des strukturierten Wahns gegenüber, der darüber hinaus eine bohrende Logik in sich birgt und sich weit weg von dem Etikett der »vorzeitigen Verblödung« angesiedelt hat, wie Bleuler die Schizophrenie einst charakterisierte.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Schizophrenie bzw. die schizoaffektive Psychose einen Menschen nicht bösartig macht. Sie ist ein Störfaktor der Ich-Identität, dessen Dynamik in Abriss und unvollständigem Wiederaufbau der Ich-Strukturen besteht. Sie macht den Betroffenen unberechenbar, aber auf die Eigenschaften, die im Wesenskern liegen, hat sie keinen Einfluss. Je nach Temperament kann ein Schizophrener defensiv harmlos aber auch offensiv handelnd sein. Er kann introvertiert oder exaltiert sein und dies ist manchmal phasenabhängig. Ich persönlich kenne aus meinem Umfeld keinen einzigen Fall von Schizophrenie, der das Klischeebild der gespaltenen Persönlichkeit des Dr. Jackyll und Mr. Hyde aus Robert Louis Stevensons gleichnamigen Roman verkörpert.
Die Schizophrenie an sich macht einen Menschen also nicht gut oder böse. Sie nistet sich vielmehr in das Bewusstsein des Betroffenen ein, wird als etwas fremdartiges erlebt und durchsetzt zunächst die charakterbildende Persönlichkeitsschicht, um sie schließlich im akuten Stadium zu zersetzen. Sie legt sich also nicht wie ein Schleier über die Persönlichkeit um dann wieder zu entschwinden, wie beispielsweise eine vereinzelte Wahnvorstellung im Rahmen eines Deliriums oder nach einer Narkose.
Die Schizophrenie wirkt aus dem Hintergrund heraus mit dem Ziel der Persönlichkeitsauflösung. Der Betroffene wird mit fremdartigen Gedanken konfrontiert und befindet sich schließlich in einer unbekannten Welt, in der sein Handlungsspielraum so eingeengt ist und das Gewicht der Themen, die ihn belasten so schwer, dass er dazu gezwungen ist, in seiner Welt genau so zu reagieren, wie er es tut. Von seinem Standpunkt aus, ist diese Entscheidung, gerade so zu handeln und nicht anders, genau richtig. Für den objektiven Betrachter hat er längst die Grenzen gesellschaftlicher Konstrukte wie Moral, Distanzwahrung und situationsangepasstem Verhalten überschritten. In der Welt des Patienten existieren diese Konstrukte nicht, denn seine Welt ist so fließend und in ihrem Fluss so bleiern, dass der Betroffene nichts darin findet, was ihm selbst Halt geben könnte. Der Patient kann sich an nichts festhalten, er wird von den Geschehnissen in seiner Welt einfach mitgerissen. Kontrolle existiert nicht mehr, weder über Gedanken, noch über Taten. Dieses Unvermögen der Kontrolle erstreckt sich auf die gesamte Lebensführung des Betroffenen.
Angenommen eine Maus befindet sich in einem Käfig, in dem sich zwei Hebel befinden und wird mit einer Situation konfrontiert, in der es um Leben und Tod geht. Man hat ihren Käfig geöffnet und eine Katze davor positioniert. Vorher hat man die Maus darauf konditioniert, dass der schmale Hebel »Flucht« und der breite Hebel »Gefahr« bedeutet, indem man die Maus mehrfach lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt hat, in denen sie entscheiden konnte, ob sie den schmalen oder den breiten Hebel betätigt. Sie hat nun aus Erfahrungswerten gelernt, dass sie die Betätigung des schmalen Hebels in Sicherheit bringt. Sie entscheidet sich also für den schmalen Hebel.
Ein Schizophreniepatient im akuten Verfolgungswahn befindet sich in genau dieser Situation. Wenn es jedoch keinen Hebel zur Flucht gibt, dann hat er keine andere Möglichkeit, als die Bedrohung selbst anzugreifen oder es zumindest zu versuchen. Das muss er aus Gründen der Selbsterhaltung tun. Im akuten Verfolgungswahn geht es um Leben und Tod. Ich werde die Wahndynamik zur besseren Verständlichkeit später ausführlich beschreiben. Wenn ein Patient sein Leben von außen bedroht sieht, dann wird er flüchten und falls er nicht flüchten kann, wird er angreifen, oder, um aus seiner Perspektive zu sprechen, sich verteidigen. Er wird es aber in fast keinem Fall unversucht lassen, die Flucht anzutreten, denn die Schreckenszenarien, die sich bis dahin in ihm abspielten, sind so unerträglich, dass ihn die Angst vor weiteren Schreckenszenarien, die zusätzlich draußen durch ihn ausgelöst würden, geradezu verschlingt. Dieser Zustand führt ihn oft in die soziale Isolation, die den Wahn wiederum begünstigt. Menschen mit Paranoia, werden keine überlaufenen Veranstaltungen oder Orte aufsuchen, die ihre Angst nur noch um ein vielfaches potenzieren würden. Patienten, die unter paranoider Schizophrenie leiden, werden von ihren Ängsten derart gelähmt, dass sie sich in den meisten Fällen unauffällig und leise in die soziale Isolation begeben und dem Klischeebild des Axt-schwingenden Psychopathen so gut wie nie entsprechen.
Der Geist eines Menschen, der an Schizophrenie erkrankt, ist wie ein Krug aus Porzellan, der durch eine Erschütterung rissig wird. Diese Risse geben den Weg in eine andere Welt frei. In eine übergeordnete Welt, von der die Nicht-Erkrankten abgeschirmt sind. Die Gesunden haben die intakten Wände ihres Porzellankruges »Realität« getauft.
Die Andersartigkeit der Wahrnehmung
Beim psychisch Kranken sind die Wahrnehmungs- und Deutungsgrenzen der Realität über einen bestimmten Zeitraum hinweg verschoben oder sie lösen sich ganz und gar auf. Nach einigen bipolaren Phasen innerhalb der schizoaffektiven Störung, habe ich es selbst so erlebt, dass sich die Bewusstseins-Grenzen erst verengen und erstaunlicherweise später erweitern. Erstaunlich deshalb, weil ich während meiner ersten Krankheitsphase (paranoide Depression) davon ausging, geistig irreversibel zu verfallen.
Infolge der Krankheit, entwickelt der Patient eine Residualsymptomatik, die seine Sensibilität bezüglich sinnlich erfassbarer Außenreize dramatisch erhöhen kann, sodass seine Wahrnehmung Phänomene einordnen muss, mit denen er sich vorher nicht konfrontiert sah. Infolge des "magischen Denkens", der sog. Pseudo-Logik der Patienten, findet in deren Weltbild eine Umstrukturierung des Wesentlichen statt, welches die Grenzen der logisch definierten Welt überschreitet. Der psychisch Kranke projiziert eine andere Wirklichkeit in die Welt, als der gesunde Mensch. Diese andere Auffassung der Realität wird dann als krankhaft klassifiziert, wenn deren Ausläufer im sozialen Miteinander sichtbar werden und der Kranke im sozialen Umfeld auf Widerstände stößt oder etwa für sich selbst und andere eine Gefahr darstellt.
Wenn die Gedankenebene zur Handlungsebene durchbricht, gibt dies oft Anlass, einen psychisch Kranken gegen seinen Willen in psychiatrische Behandlung zu bringen. Dazu muss gesagt werden, dass unser Kulturkreis eine relativ engmaschige Auffassung vom Begriff der Normalität hat. Dass das Spektrum menschlicher Verhaltensweisen in alle Richtungen ausufern kann, sieht man in den Tragödien der griechischen Mythologie, welche das Fundament der europäischen Astrologie bildet. Es ist verblüffend, dass eine charakterliche »Schieflage«, die uns durch die übermäßige Ausprägung einer bestimmten Eigenschaft, wie z.B. Jähzorn innewohnt, einerseits zu einer psychiatrischen Diagnose beitragen, also als Krankheit deklariert werden kann und andererseits durch die Analyse des Geburtshoroskops als Anlage unserer individuellen Entsprechung exakt nachvollzogen werden kann.
Das animalische Ur-Potential und die Instinkte des Menschen, lassen sich nicht vollständig untergraben. Es ist eine Frage des Zusammenspiels bestimmter äußerer, sozialer Faktoren und bestimmter persönlicher Faktoren, die dazu führen können, dass der Mechanismus der Selbstkontrolle aus den Fugen gerät.
Harmlose Spinner, die lediglich in einer bizarren Fantasiewelt leben und ein relativ isoliertes Dasein führen, werden oft nicht als psychisch krank entlarvt. Erst, wenn diese Fantasien oder Vorstellungen auf der Handlungsebene umgesetzt werden und diese Umsetzung einen anderen Menschen störend beeinträchtigt, wird Verdacht geschöpft. Auch wenn die Umsetzung bizarrer Vorstellungen den Betroffenen selbst maßgeblich schädigt, ist es offensichtlich, dass eine Therapie erfolgen muss. Betroffene können beispielsweise zu der Überzeugung gelangen, dass sich in ihrem Blut lebensgefährliche Partikel befinden und um diese loszuwerden, kommen sie auf die Idee, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Dass sie aufgrund von Verbluten ebenfalls sterben würden, ist ihnen in diesem Stadium des Wahns nicht mehr bewusst.
Weitere Beispiele zu konkreten inhaltlichen Überzeugungen, liefert das Buch »Tod durch Vorstellungskraft« von Gary Bruno Schmidt:
»Jemand, der an einer schizophrenen Psychose leidet, fühlt sich vielleicht wie hypnotisiert; er hört Stimmen; er fühlt sich verfolgt; er glaubt, ihm würden Gedanken eingegeben, gelesen, kontrolliert oder weggenommen. Während der Psychose kann ein sonst vernünftiger Mensch meinen, dass ihm die Zehn Gebote in den Weisheitszahn eingepflanzt wurden; er kann seinen Penis abschneiden und aufessen oder seinen Körper mit Messerschnitten oder Zigarettenbrandmarken versehen, um sich selbst besser zu spüren oder um sich von seinen noch gravierenderen seelischen Schmerzen abzulenken; er kann auf die merkwürdige Idee kommen, eine »Zaubermedizin« aus seinem eigenen Kot und Urin im Aschenbecher zusammenzumischen und diese mit einer von der Station gestohlenen Spritze in das Kniegelenk zu spritzen.
Eine Person, die unter einer depressiven Psychose leidet, kann der Überzeugung sein, dass ihr Gehirn eine Pfütze voller Gewürm sei, dass sie schon tot sei und deswegen ihre eigene Verwesung riechen könne, dass ihre Haut in Fetzen von ihrem sonst nackten Skelett herabhänge u.a.m. Sie könnte versuchen, mit einer Bohrmaschine das Ungeziefer aus ihrem Kopf zu entfernen, bzw. in ein Bestattungsunternehmen einbrechen und sich neben eine Leiche in den Sarg legen usw.
Im gegenteiligen Zustand der manischen Psychose kann ein Mensch unbeirrt sicher sein, dass er merkwürdige Wesen aus dem Leib gebäre, dass er Jesus Christus sei, dass er unendlich reich oder mächtig sei und entsprechend handeln: schnell mal eine Villa kaufen, oder Geld verteilen, mal kurz am anderen Ende der Welt vorbeischauen. Man könne alles machen, alles erreichen, wenn man nur die Zeit nutze: 20 Luxus-Autos bestellen oder einen rasenden Zug einhändig stoppen.«
Die Gedanken sind frei und der menschliche Gedankenpool ist so unendlich tief, dass man einen Menschen nicht ausschließlich wegen der Qualität seiner Gedanken für psychisch krank erklären kann. Für ein solch vernichtendes Etikett, müssen Gedanken, Emotionen und Handlungen über einen bestimmten Zeitraum so auffällig, beeinträchtigend und persönlichkeitsfremd sein, dass der Betroffene im Fluss seines Lebens komplett stagniert oder er durch sein Handeln die Lebensqualität von anderen Menschen derartig bedroht, dass diese Hilfe von außen holen müssen und diese Hilfe heißt oft Polizei oder sozialpsychiatrischer Dienst.
Gedanken sind nur dann frei, solange sie sich jenseits des Dunstkreises von Etikettierung, Bewertung und Verurteilung befinden. Sobald Gedanken jedoch in irgendeiner Weise durch das gesprochene Wort Ausdruck finden, scheint ihnen diese Freiheit augenblicklich genommen.
Beispiel: Es ist kein Geheimnis, dass Eheleute in bestimmten Phasen ihrer Ehe schonmal an Mord gedacht haben. Sie haben diese Gedanken zwar im Normalfall nicht auf die Handlungsebene umgesetzt, aber der Gedanke, seinen Partner umzubringen, ist nichts Ungewöhnliches. Derartige Gedanken bilden auch in familiären Krisensituationen eine Art kompensatorisches Ventil. Jedoch redet niemand darüber, um sich einer vernichtenden Etikettierung zu entziehen, die unweigerlich erfolgen würde.
Der Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit
Realität ist ein wissenschaftlich abgeklärtes Fundament und gleichzeitig ein Argument, was uns davon abhalten soll, einer subjektiven Erfahrungsebene, die dem realistischen Erleben widerstrebt und die wissenschaftlich durch das Fehlen messbarer Parameter nicht besiegelt ist, eine Gültigkeit zu geben.
Realität ist eine Frage der Aufmerksamkeit. Das wissen vor allem Menschen, die jemals von einer Wahnvorstellung geplagt wurden. Wenn ich aus dem Fenster schaue und sehe die Felder und Wiesen, die Häuser und Bäume, dann ist das Realität. Es ist Realität, weil man sich übereinstimmend darauf geeinigt hat, dass diese Dinge realistisch sind. Man gewöhnt sich daran und schenkt diesen Elementen keine weitere Aufmerksamkeit. Trotzdem sind sie da. Es gibt jedoch im Umkehrschluss Dinge, die nicht objektiv »da« zu sein scheinen, die man jedoch durch Aufmerksamkeit erzeugen kann.
Eine evozierte Wirklichkeit beinhaltet Phänomene der energetisch feinstofflichen Ebene. Diese Phänomene lassen sich in den Grenzbereichen der außersinnlichen Wahrnehmung, der Telepathie, der Jenseitskontakte, der Synchronizität oder des Wahrträumens ansiedeln.
Ich gehe in dem Kapitel »Außersinnliche Wahrnehmung im Rahmen psychischer Erkrankungen« näher darauf ein.
Materie ist nichts anderes, als zu Form gewordene, verdichtete Energie, die wir als sichtbare und sinnlich erfassbare Welt definieren. Nicht jede Form von Energie ist sichtbar. Dennoch ist sie vorhanden und in einem gewissen geistigen Zustand nimmt man wahr, dass man mit dieser Form der Energie in Wechselwirkung tritt. Genau hier liegt der Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit. Wir wissen, wie die Realität draußen aussieht. Die innere Realität sollte jedoch nicht ungeachtet bleiben. Jeder Mensch hat seine innere Realität: Seine Wahrnehmung und die Interpretation dieser. Kein Mensch, der jemals durch die Täler der bipolaren Störung, der schizoaffektiven Psychose oder der Schizophrenie geschleudert wurde, überlässt einem Unbeteiligten die Deutungshoheit seiner subjektiven Wahrnehmung. Das ist ungefähr so, als wenn sich ein Maulwurf rein gedanklich in die Lage eines Vogels versetzen will, um aus seiner Sicht dann dem Vogel zu erklären, wie sich das Fliegen für diesen anfühlen müsste.
Ein Umstand, der durch das Fehlen von wissenschaftlichen Erkenntnissen noch nicht als Realität deklariert werden konnte, kann trotzdem eine Wirklichkeit sein. Eine Wirklichkeit, die noch nicht durch Messungen nachgewiesen werden konnte. Die innere Realität, die höchst subjektiv ist und die jeder Mensch in sich birgt, unterscheidet sich von der äußeren Realität dadurch, dass sie nicht konform ist. Wenn fünf Leute aus demselben Fenster schauen, sehen sie alle dieselben Bäume und dieselbe Sonne, wenn sie jedoch nach innen schauen, in sich selbst und ihre innere Realität dann untereinander vergleichen, dann sehen sie grundverschiedene Aspekte ihres Denkens, Fühlens und Seins, die sich, trotz ähnlicher Erfahrungen, diametral gegenüber stehen können. Die Interpretation eigener Erlebnisse basiert immer auch auf den Empfindungen, die diese mit sich bringen. Für Empfindungen wie für Gedanken, gibt es kein Messinstrument.
Zu erwähnen wäre hier die subjektive Empfindung über Zeit oder Schmerz, die sich von Mensch zu Mensch unterscheidet. Zwei Menschen können unabhängig voneinander dieselbe Zeitspanne als unterschiedlich lang empfinden. Ähnlich verhält es sich beim Empfindungsspektrum für Schmerzen. Während Person A Geburtsschmerzen als den stärksten Schmerz überhaupt empfindet, empfindet Person B den Schmerz nach einem Beinbruch viel belastender, obwohl auch eine Geburtserfahrung bestand. Dieses Empfinden ist möglicherweise für Person B ein Anlass, um zu Person A zu sagen: »Jetzt stell dich nicht so an.« Diese Aussage resultiert aus der Annahme, dass alle anderen genauso empfinden, wie man selbst. Das ist ein Trugschluss. Demnach gibt es also Menschen mit einem sog. »dicken Fell« und die »Dünnhäutigen«, die vergleichsweise schnell aus dem Gleichgewicht zu bringen sind.
In der Psychiatrie wird diese Dünnhäutigkeit als »Vulnerabilität« bezeichnet.
Wahn – das Ich im luftleeren Raum
Eine Fehlinterpretation der Realität entsteht, wenn ein bestimmtes Thema im Bewusstsein eines psychisch kranken Menschen zu viel Raum einnimmt und andere Aspekte der Realität und des täglichen Lebens aus dem Bild gedrängt werden. Wenn sich der gedankliche Spielraum derartig schmälert und gleichzeitig vertieft, dass man von seinen eigenen Gedanken in die Reserve gezwungen wird. In die existentielle Reserve. War ein Gedankenspiel gestern noch unaufdringlich und neutral, kann es übermorgen schon eine ganz andere





























