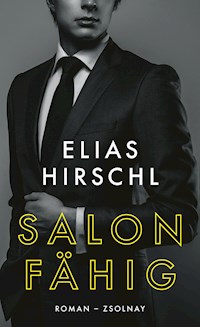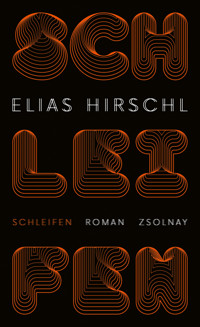
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Franziska Denk wächst im Umfeld des Wiener Kreises auf und leidet als Kind an einer seltsamen Krankheit: Jedes Symptom, von dem sie hört oder liest, bekommt sie sofort. In Otto Mandl, einem genialen Mathematiker, findet die junge Franziska ihren Seelenverwandten. Sie lernt, sich mit Wörtern aus toten Sprachen gegen ihr Leiden zu immunisieren. Die beiden entwickeln eine absolute Sprachbesessenheit und forschen fortan und bis an alle denkbaren Grenzen gemeinsam nach der perfekten Sprache. »Schleifen« ist ein großer, ein kluger Roman über die Macht und den Einfluss von Sprache auf unser Leben, der richtig Spaß macht beim Lesen. Immer wieder stellt sich bei Elias Hirschl das schier Unglaubliche als wahr heraus, und der Rest ist extrem gut erfunden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Über das Buch
Franziska Denk wächst im Umfeld des Wiener Kreises auf und leidet als Kind an einer seltsamen Krankheit: Jedes Symptom, von dem sie hört oder liest, bekommt sie sofort. In Otto Mandl, einem genialen Mathematiker, findet die junge Franziska ihren Seelenverwandten. Sie lernt, sich mit Wörtern aus toten Sprachen gegen ihr Leiden zu immunisieren. Die beiden entwickeln eine absolute Sprachbesessenheit und forschen fortan und bis an alle denkbaren Grenzen gemeinsam nach der perfekten Sprache.»Schleifen« ist ein großer, ein kluger Roman über die Macht und den Einfluss von Sprache auf unser Leben, der richtig Spaß macht beim Lesen. Immer wieder stellt sich bei Elias Hirschl das schier Unglaubliche als wahr heraus, und der Rest ist extrem gut erfunden.
Elias Hirschl
Schleifen
Roman
Paul Zsolnay Verlag
»Niemand kann eine Silbe artikulieren, die nicht voller Zärtlichkeit und Schauer ist, die nicht in irgendeiner dieser Sprachen der gewaltige Name eines Gottes wäre.«
Jorge Luis Borges, Die Bibliothek von Babel
Teil 1
Denk & Mandl
Jedes Wort ist ein Symptom
Franziska Denk hatte die Pest. Schon wieder. Margarethe machte ihr einen Tee. Es war ihre Schuld gewesen. Sie hätte wissen müssen, dass der Begriff bei einer Diskussion zwischen Kurt Gödel und Carl über die Aufklärung fallen könnte. Letzte Woche war es Scharlach gewesen. Davor Cholera. Lepra war spannend, damals hatten sich tatsächlich ein paar Fetzen Haut von Franziskas Armen gelöst, aber das war es dann auch schon. Es war nie tödlich. Es gab ja keine echten Viren oder Bakterien, die Schaden in den Zellen anrichteten. Die Immunantwort war ohnehin schädlich genug. Die Narben von den Pestbeulen würden nicht so schnell verschwinden. Franziskas Kinderarzt war sprachlos gewesen, als Margarethe versucht hatte, ihm das Problem zu erklären. Sie verstand es ja auch. Meine Tochter bekommt jede Krankheit, von der sie hört! Das ist nicht gerade eine normale Symptombeschreibung.
Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe mich erkältet, ich habe Schnupfen und Husten und Fieber, dann erkältet sich Ihre Tochter?, hatte der Arzt gefragt. Und noch ehe er die Frage beendet hatte, musste Franziska niesen. Margarethe stürmte mit ihr aus dem Raum und wechselte den Arzt. Beziehungsweise sie wechselte ihn nicht, sie suchte nie wieder einen auf. Das Beste in so einer Situation war, Franziska von allen sprachlichen Reizen abzuschirmen. Sie bekam nur vorab kontrollierte, medizin- und krankheitsfreie Bücher, die sie mit ihren fünf Jahren schon problemlos lesen konnte. Margarethe legte sogar ein zusammengerolltes Handtuch vor die Tür ihrer Tochter, damit das Gespräch aus dem Wohnzimmer nicht in ihr Zimmer drang. Dieses hatte eigentlich recht harmlos begonnen, über John Wilkins’ Vorhaben im 17. Jahrhundert, eine universelle philosophische Sprache zu erschaffen, die, wie Gödel gemeint hatte, der erste ernsthafte Versuch gewesen sei, die Menschheit in eine höhere Seinsebene zu überführen. Ein Vorhaben, das seiner Meinung nach in der Arbeit Leibniz’ gegipfelt hatte.
Diese Idee einer wissenschaftlichen, vom Menschen künstlich erschaffenen Universalsprache widersprach gänzlich Carls theologischer Auffassung von einer göttlich erschaffenen Ursprache, ja wirkte auf ihn gar wie der Versuch, einen zweiten babylonischen Turm zu bauen, weshalb die beiden es sich nicht nehmen ließen, vor allem wenn sie getrunken hatten, sich gegenseitig so lange mit hypothetischen Faustschlägen zu drohen, bis sie müde wurden.
Carl Stonebrook — geborener Karel Steinbrück — war genau wie seine Frau Margarethe Denk überzeugter Anhänger des mittelalterlichen Theologen und Philosophen Francesco Savogini, zu dessen Lehre unter anderem gehörte, dass es den Turmbau zu Babel vor sechstausend Jahren tatsächlich gegeben und dieser tatsächlich die babylonische Sprachverwirrung zur Folge gehabt habe, wonach die ursprünglich göttliche Sprache durch eine Überschätzung des Menschen in tausende unverständliche Sprachen zersplittert sei, als Strafe eines erzürnten, beleidigten Gottes. Darum hatte es sich Carl Stonebrook zur Aufgabe gemacht, im Rahmen verschiedener christlicher Missionsreisen die Völker dieser Welt, vor allem jene, die noch nie mit Jesus Christus in Berührung gekommen waren, langsam wieder zur göttlichen Ursprache zurückzuführen. Er wollte ihnen zuerst die eigene Sprache ausreden, ihnen anschließend Latein beibringen, dann Hebräisch, dann Aramäisch, Phönizisch und so weiter. Wo es enden sollte, wusste Carl in Wirklichkeit selbst nicht, und sprach man ihn darauf an, bekam er meist einen cholerischen Wutausbruch. Diese Bemühungen, zusammen mit dem Versuch, verschiedene weitere biblische Wunder und Sagen mit empirischen Mitteln auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen, hatten zuweilen so fanatische Züge angenommen, dass sie selbst der katholischen Kirche zu weit gegangen waren und er schließlich, nach einem in den Tageszeitungen viel besprochenen Streit mit dem Wiener Erzbischof rund um ein geplantes, aber nie umgesetztes Experiment zum Nachweis von Parthenogenese in Schweinen, offiziell exkommuniziert worden war. Das brachte den seltsamen Umstand hervor, dass Franziska Denk nun den Nachnamen ihrer Mutter und nicht den ihres Vaters trug, da ihre Eltern technisch gesehen nicht verheiratet waren.
Nach dem Kirchenausschluss hatten sich die Debatten in die private Sphäre verschoben, wo Carl zusammen mit seiner Frau den Savogini-Lesekreis ins Leben gerufen hatte, zu dem des Öfteren auch Persönlichkeiten wie der Logiker Kurt Gödel, der Physiker Moritz Schlick oder der Philosoph Ludwig Wittgenstein erschienen waren, deren Schaffen ebenfalls stark von Savogini beeinflusst war. Deshalb war es für Carl ein umso größeres Ärgernis, dass Gödel nach wie vor den Plansprachen-Ideen von Leibniz, Wilkins oder Zamenhof anhing, die für Carl eine unerträgliche Gotteslästerung darstellten. Anstatt zur ursprünglichen göttlichen Sprache zurückfinden zu wollen, versuchten diese Scharlatane in Frankenstein-Manier eine monströse, künstliche Sprache zu erschaffen und künstlich am Leben zu erhalten. Eine unerhörte Erhöhung der göttlichen Ordnung. Denn jedes Mal — so steht es jedenfalls in der Kritik der Ordnung*1 von Savogini —, wenn der Mensch versuche, künstlich die Ordnung der Dinge zu erhöhen, müsse Gott das Ungleichgewicht ausgleichen und im Gegenzug etwas ins Chaos stürzen. Kein Wunder, dass der große Brand von London exakt in die Zeit fiel, in der John Wilkins die erste Version seiner universalen Sprache vollendet hatte. Das Feuer verbrannte sein Haus, das gesamte Kirchengebäude, in dem er arbeitete, und vor allem all seine Manuskripte, sodass er seine sechshundert Seiten umfassenden Notizen noch einmal komplett aus dem Gedächtnis replizieren musste. Und als wäre das Feuer noch nicht genug, schickte Gott sogar noch die letzten Ausläufer der Pest-Epidemien nach London, um Wilkins’ blasphemischen Versuchen ein für alle Mal den Garaus zu machen. Alles nur, um die Balance wiederherzustellen, die eine derartige wissenschaftliche Errungenschaft zu gefährden drohte.
Was ist Pest?, fragte Franziska, die schon die ganze Zeit aufmerksam dem Gespräch gelauscht hatte, wie sie es oft heimlich tat, wenn der Savogini-Lesekreis im Hause Denk zusammentrat. Und Gödel, aufgepeitscht von mehreren Espressi, erklärte ihr in allen Einzelheiten, wie eine Pesterkrankung aussah. Und noch bevor Carl eingreifen konnte, begann Franziskas Haut schwarze Blasen zu werfen. Margarethe hielt ihrer Tochter sofort die Ohren zu und brachte sie hinauf in ihr Zimmer. Der Salon war verstummt. Gödel und Wittgenstein starrten entsetzt Richtung Treppe. Nur Moritz Schlicks Platz war leer geblieben. Er war heute unangekündigt ferngeblieben. Das war an sich nichts Besonderes. Generell hatte der Lesekreis in den letzten Jahren immer mehr Teilnehmer eingebüßt. Viele hatten das Land verlassen. Auch Wittgenstein schaute nur noch sehr unregelmäßig vorbei. Die meiste Zeit ließ er sich von seinen Studenten in Cambridge anhimmeln. Nach Wien kam er eigentlich nur noch ungern, aus Pflichtgefühl seinen Geschwistern gegenüber, aber wenn er schon mal in der Stadt war, gesellte er sich manchmal zur Runde. Als Margarethe ihre Tochter mit verschlossenen Ohren aus dem Zimmer führte, richtete sich Wittgenstein interessiert in seinem Ohrensessel auf: Ihre Tochter reagiert auf sprachliche Äußerungen, als wären sie real.
Es war mehr eine Feststellung als eine Frage.
Ja, sagte Carl. Bei Krankheiten ist es am schlimmsten. Aber es reicht auch schon, dass jemand eine Geschichte über einen Ski-Unfall erzählt. Sie fühlt wochenlang die Schmerzen in ihrem Bein, als hätte sie es sich selbst gebrochen. Ob das in der Familie laufe, fragte Wittgenstein. Nur auf Margarethes Seite, sagte Carl. Es gäbe Gerüchte. Ein Großonkel, vielversprechender Physikstudent in Erlangen, sei kurz vor seinem Abschluss beim Lesen einer Todesanzeige gestorben. Eine Großtante, Ehefrau eines wohlbetuchten Kaufmanns, sei bei lebendigem Leibe, aber ohne Feuer verbrannt, als sie im Wiener Burgtheater einen schockierenden Brandschutzhinweis gelesen habe. Einige Verwandte wurden angeblich mehrfach hospitalisiert, weil sie immer wieder den Fehler machten, die Risiken und Nebenwirkungen ihrer Medikamente zu lesen. Und Margarethes Vater, der angesehene Chef der Wiener Druckerei Denk, zeitlebens symptomfrei, habe eines Tages, als Margarethe noch ein Kind war, eine Zeitung frisch aus der Druckerpresse zur Hand genommen, darauf die Worte »Smog in London fordert weitere Todesopfer« gelesen und sei daraufhin qualvoll an nichts erstickt. Der Arzt hatte zwar gemeint, es könnte sich auch um eine allergische Reaktion gehandelt haben, doch so genau wisse man das nicht. Margarethes älterer Bruder Adalbert Denk habe daraufhin mit nur neunzehn Jahren den Druckereibetrieb übernommen, hatte laut eigener Aussage noch nie eine von ihm gedruckte Zeitung gelesen und war immer noch bei bester Gesundheit. Auch an Margarethe selbst schien die Krankheit weitestgehend unbemerkt vorübergezogen zu sein. Sie habe lediglich als Kind einige übermäßig empathische Reaktionen auf das Leid ihrer Mitmenschen gezeigt, allerdings nichts Herausragendes, und seit der Pubertät habe sich sogar das gelegt. Generell werfe man in diesem Haushalt jedoch vorsorglich alle Beipackzettel weg, bevor sie jemand lesen konnte. Wittgenstein nickte, und Carl wechselte das Thema, fuhr fort, von seinen neuesten Erkenntnissen über die Sprachen der Welt zu erzählen, die er auf seinen langen Reisen für seinen Atlas der verlorenen Sprachen dokumentierte.
Alle paar Wochen traf eine Postkarte von einem anderen Ende der Welt im Hause Denk ein. Die Karten waren immer an Franziska adressiert, und ihr Vater beschrieb ihr darin in winziger, aber sauber gesetzter Handschrift seine Arbeit, die Völker der Welt Schritt für Schritt zur göttlichen Ursprache zurückzuführen.
Auch Margarethe Denk diskutierte während der Salons mit der Elite der zeitgenössischen Philosophie und Wissenschaft. Obwohl sie nie einen formalen Universitätsabschluss gemacht hatte, galt sie in diversen akademischen Disziplinen zweifellos als Ausnahmetalent. Sie führte lange Brieffreundschaften mit Albert Einstein und Bertrand Russell und schrieb viel diskutierte Essays über Philosophie, Literatur, Kunst und Musik. Allerdings erschienen nur die wenigsten davon unter ihrem echten Namen. Erst lange nach ihrem Tod wurde das eigentliche Ausmaß ihres Werks ersichtlich, als klar wurde, dass sie die meisten ihrer Publikationen unter männlichen Pseudonymen*2 und nicht selten auch unter dem Namen ihres Mannes*3 veröffentlicht hatte. Und auch Franziska selbst mischte sich schon in jungen Jahren in die Diskussionen des Lesekreises ein. So lange, bis sie wieder an irgendeiner nebenbei erwähnten Seuche erkrankte.
Wann haben Sie diesen Zustand das erste Mal bemerkt?, hakte Wittgenstein noch einmal nach. Vor einigen Jahren, sagte Margarethe, als sie wieder zur Gesellschaft stieß. Früher war es noch wesentlich schlimmer als jetzt. Zuerst hatten sie nicht erkannt, was es war. Aber nachdem sie fünfmal hintereinander eine Krankheit bekommen hatte, die jeweils in der Gutenachtgeschichte vorgekommen war, die Margarethe ihr vorgelesen hatte, hatten sie das Muster erkannt. Mit der Zeit wurde es besser, sie reagiere jetzt bei weitem nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Sie werde jetzt zwei, drei Tage in ihrem Zimmer bleiben müssen. Pest sei zwar immer noch eine der schlimmeren Krankheiten, aber man könne sich gar nicht vorstellen, wie langwierig und schmerzhaft das noch vor einem Jahr gewesen war.
Als ob jede Aussage für Ihre Tochter eine Tatsache wäre, murmelte Wittgenstein vor sich hin. Jedes Wort ein Symptom, interessant, sagte er. Sehr interessant.
Die Runde wurde vom schrillen Geräusch des Telefons in der Zimmerecke unterbrochen. Carl hob ab, und nach ein paar Sekunden verhärtete sich sein Gesichtsausdruck. Er wusste jetzt, warum im Salon ein weiterer Platz frei geblieben war. Es war der 22. Juni 1936. Moritz Schlick war tot.
Immer entlang des Randes
Franziska kam mit ihrer Familie bei Verwandten ihres Vaters in Providence, Rhode Island, unter. Nach Moritz Schlicks Ermordung hatte man wie einige andere Wiener Intellektuelle den Entschluss gefasst, das Land zu verlassen. Das Haus Stonebrook, in dem sie nun in Rhode Island zusammen mit Carls Schwester Sylvia und deren Familie lebten, die selbst erst eine Generation früher aus Deutschland in die USA emigriert waren, stand ihrem Haus in Wien in Sachen Größe und Prunk im Grunde in nichts nach. Doch die zunehmende Isolation begann sich schnell auf die Familiendynamik auszuwirken, vor allem da sie Franziska nach wie vor aufgrund ihrer Kondition weitestgehend von Sozialkontakten abschirmten. Franziskas beste Freundin wurde Fuzzy, die schwarze Katze ihrer Tante, die fast den ganzen Tag über in ihrem Zimmer schlief.
Carl nutzte die erste sich bietende Gelegenheit, das Land zu verlassen, und machte sich zusammen mit einem Erkundungsschiff des US-Militärs auf den Weg durch den Pazifik. Man wollte Inseln ausfindig machen, die sich als Zwischenstopp für Flugzeuge und Schiffe eigneten, und nebenbei nahm man es auch auf sich, den Eingeborenen das gute Wort Jesu Christi zu überbringen. Eine Aufgabe, für die sich Carl Stonebrook auserkoren fühlte.
An Franziskas zehntem Geburtstag traf eine Postkarte ihres Vaters von einer kleinen indonesischen Inselgruppe ein. Er hatte dort den letzten noch lebenden Sprecher der kembrischen Sprache interviewt, einen über neunzig Jahre alten Mann, der ihn in einem konstanten, nicht enden wollenden Redefluss durchgehend beschimpfte und dabei starken Kaffee trank. Nach ein paar Tagen »hörte er mit allem auf« — wie Carl schrieb, was meistens der Code war für »er ist gestorben«, jedoch so formuliert, dass Franziska möglichst wenig Symptome beim Lesen entwickelte —, und alles, was von der Sprache der Kembra erhalten blieb, ließ sich in Form von Geschlechtsteilen, Defäkationsmethoden und anderen Beschimpfungen zusammenfassen und übersetzen. Der alte Mann habe sich leider nicht zum christlichen Glauben missionieren lassen, gab Carl ernüchtert zu und wünschte seiner Tochter noch einen schönen Geburtstag.
Carls unregelmäßig eintreffende Postkarten und speziell von Margarethe ausgewählte Buchausschnitte, die keine Krankheitsbeschreibungen enthielten, waren über mehrere Jahre hinweg die einzigen Medien, die Franziska konsumieren konnte. Speziell die Postkarten bildeten für sie eine überlebenswichtige Recherchequelle. Ihren Intellekt konnte ohnehin seit Jahren niemand mehr übersehen. Aber jetzt nahm er richtig Fahrt auf. Selbstständig brachte sie sich mehrere der Sprachen bei, die ihr Vater ihr in unregelmäßigen Abständen aus allen Teilen der Welt in Form von unvollständigen Grammatik-Skizzen und Vokabelsammlungen zuschickte. Wo sie zu wenig Informationen über Wortschatz oder Syntax hatte, erfand sie einfach selbst Wörter und schrieb die toten Sprachen künstlich weiter. Im Alter von elf Jahren sprach sie bereits fünf Sprachen, die zu dem Zeitpunkt, als sie sie flüssig beherrschte, schon allesamt ausgestorben waren. Und im Laufe der Zeit wurden es immer mehr. Arabana, Tocharisch, Ubychisch, Uratäisch, Ogiek, Xiri, Caviteño Chabacano, Latein … keine mit mehr als einer Handvoll lebender Sprecher. Auf einigen der Postkarten vergaß Franziskas Vater offenbar auf die medizinische Kondition seiner Tochter, denn die Vokabelsammlungen enthielten auch immer wieder mal verschiedene Bezeichnungen für landestypische Krankheiten. Doch erstaunlicherweise reagierte Franziska nicht allzu stark auf diese Erwähnungen. Ja, es schien sogar, je mehr Krankheitsbegriffe sie aus diesen toten Sprachen erlernte, desto weniger reagierte ihr Körper darauf. Um ihre Theorie zu testen, schrieb Franziska eines Tages eine Geschichte auf, in der es darum ging, dass ein Mädchen sich mit einer Erkältung ansteckte. Sie schrieb den Text zuerst auf Phönizisch, dann übersetzte sie ihn auf Sumerisch, dann ins Altgriechische und Lateinische und schließlich auf Deutsch. Jede Version las sie mehrmals der Katze Fuzzy vor. Bei jeder Übersetzung, die näher an ihrer Muttersprache war, begann ihre Kehle zwar mehr zu kratzen, ab und zu meldete sich auch ein Niesreiz, und wenn sie es allzu sehr überreizte, traten doch Symptome auf, aber bei weitem nicht so schlimm wie früher, so als hätte sie sich selbst mit diesen ausgestorbenen Begriffen desensibilisiert. Ein Impfstoff aus toten Wörtern. Über die nächsten Monate trainierte sie ihren Körper immer weiter auf die verschiedensten Krankheiten, bis sie sich schließlich selbst für geheilt erklärte. Ihre Mutter wollte es zuerst nicht glauben, doch als Franziska ihr zum Beweis aus einem anatomischen Lehrbuch die haarsträubendsten Krankheitsverläufe vorlas und dabei nicht einmal mit der Wimper zuckte, brach sie in Tränen aus und umarmte ihre Tochter. Einen Tag später besuchte Franziska zum ersten Mal eine Schule.
Während es Franziska immer besser ging, verschlechterte sich dagegen der Zustand ihrer Mutter. Sie fühlte sich zunehmend isoliert ohne ihren Wiener Freundeskreis, den Lesezirkel, ohne ihren Mann und nun tagsüber sogar ohne ihre Tochter.
Sie versuchte Kontakt zu den anderen in die USA emigrierten Intellektuellen aufzunehmen, doch im Endeffekt waren ihre einzigen Freunde zu jener Zeit Kurt und seine Frau Adele Gödel, die nur kurze Zeit nach der Familie Denk Österreich verlassen hatten. Doch auch hier waren zwei von drei Briefen eigentlich nur Beschwerden von Adele darüber, wie sehr sich Kurts Zustand schon wieder verschlechtert habe. Er habe den Tod seines Freundes Moritz Schlick einfach nicht verkraftet, schrieb sie. Zum einen war es natürlich der Mord selbst, der ihn nicht schlafen lasse, einfach so, brutal erschossen am helllichten Tag auf der Philosophenstiege, aber darüber hinaus war es auch die Art und Weise, wie die österreichische Öffentlichkeit nach seinem Tod mit Schlicks Vermächtnis umging. Der Mord wurde dem Opfer selbst angelastet. Schlick trage die Verantwortung für die grässliche moralische Verwirrung, die er bei seinem Schüler durch seine gefährlichen Theorien ausgelöst habe, schrieben die Zeitungen. Durch seine antichristlichen und antideutschen Versuche, die Wissenschaft vom Glauben und von der Metaphysik zu trennen, habe er die Jugend ins Chaos gestürzt. Gödel lese tagein, tagaus diese scheußlichen Schundblätter, schrieb Adele. Und er sei von der Theorie besessen, dass es nicht die Austrofaschisten wären, die dafür verantwortlich waren, sondern die Habsburger, die hinter den Kulissen die Fäden ziehen würden. Er esse auch immer weniger, schrieb sie. Er könne in Restaurants und sogar bei Freunden nichts mehr essen, und sogar wenn Adele selbst koche, beobachte er sie manchmal dabei, aus Angst, jemand versuche ihn zu vergiften.
Als die beiden doch einmal auf Besuch zu Margarethe kamen, hörte Kurt nicht auf, von seiner neuesten Theorie zu reden. Man habe das Hauptwerk von Gottfried Wilhelm Leibniz verschwinden lassen, sagte er, während Adele nur noch die Augen verdrehte. Leibniz habe es gegen Ende seines Lebens zustande gebracht, sagte Gödel. Er habe die perfekte Universalsprache erdacht, die er immer gesucht habe, die Sprache, die die Menschheit auf die nächste Evolutionsstufe führe, doch die da oben wollen nicht, dass uns allen diese Wunderwaffe zur Verfügung steht. Die da oben wollen uns dumm und kleinhalten. Als Franziska, die gerade in den Raum gelaufen war, vorsichtig nachfragte, wer die da oben seien, rief Gödel nur mit echter Panik in der Stimme: Die Habsburger! Die Habsburger haben seine Werke verschwinden lassen! Sie halten sie unter Verschluss, damit wir die Wahrheit nicht erfahren! Wenn man genau hinsah, schrie Gödel, finde man bei Leibniz überall Hinweise auf das geheime Werk! Überall gäbe es Fußnoten und Querverweise, die ins Leere führen, die Bücher rissen immer kurz vor den zitierten Stellen ab, die Kapitel, auf die Leibniz sich beziehe, gäbe es nicht. Hier, sagte er und hielt ein altes, zerfleddertes Lehrbuch über die Monaden in die Höhe, hier hätte jemand das Kapitel 16 herausgeschnitten mit einer feinen Klinge, es sollte niemandem auffallen, doch er habe es bemerkt. Das hat einfach nur ein Student herausgerissen, warf Adele ein. Er macht das am laufenden Band, klagte sie. Tagein, tagaus geht das so. Jedes Mal, wenn er in der Bibliothek ein Buch findet, das ramponiert aussieht, wo Seiten fehlen oder Eselsohren drin sind, wittert er schon die große Verschwörung.
Der Begriff »Eselsohren« ist grob verharmlosend!, schrie Gödel, bevor er fragte, ob Margarethe die Kekse selbst gebacken habe, die vor ihm auf dem Kaffeetischchen lagen.
Wenn sie nicht die Energie hatte, die Gödels einzuladen, schloss sich Margarethe meistens den ganzen Tag in der Bibliothek des Hauses Stonebrook ein, die sie als Arbeitszimmer nutzte, und widmete sich ihrer naturwissenschaftlichen und philosophischen Forschung, während sie eine Zigarette nach der anderen rauchte. Wenn Franziska an der Bibliothek vorbeiging, sah sie oft den Zigarettenqualm durch den Türspalt ziehen. Hätte sie ihre Mutter dabei nicht in ihr Diktiergerät sprechen gehört, hätte sie davon ausgehen müssen, dass die Bibliothek in Flammen stand. Das Diktiergerät von Margarethe Denk ist einer der wenigen Gegenstände, der das Haus überleben sollte. Es handelte sich dabei um ein kleines Bandaufnahmegerät der Marke Stripofon — ein eigentümlicher technologischer Ausrutscher, der schnell wieder aus dem Handel verschwinden sollte. Das eingelegte Schallband des Stripofons war an einem Ende um 180 Grad verdreht, sodass es eine Möbiusschleife bildete, die streng genommen nur eine einzige Seite besaß, wodurch das Band theoretisch bis in alle Ewigkeit automatisch wiederholend abgespielt werden konnte, meistens aber schnell durch Abnutzungserscheinungen kaputtging, weil das verdrehte Band beim Abspielen viel Reibung verursachte.
Die letzte Postkarte, die Franziska von ihrem Vater erhalten sollte, handelte von den Xoxi, einer polynesischen Gruppe auf einer kleinen, Taiwan vorgelagerten Insel, von denen angeblich nur noch eine Handvoll die ursprüngliche Sprache beherrschten, da sie sich als äußerst unpraktisch herausgestellt hatte. Ihr Vater erklärte Franziska, dass das, was man im Westen im Allgemeinen für Sprache hielt (also alle verbalen, mündlichen Äußerungen), in Wirklichkeit nur einen kleinen Teil der Sprache darstellte. Im Japanischen zum Beispiel war es am offensichtlichsten, dass Höflichkeit ein unabdingbarer Teil der Sprache war. Erwies man jemandem nicht die richtige Form der Ehrerbietung durch Körpersprache oder die richtige Anrede, war das genauso, als würde man einen Grammatikfehler begehen. Genauso war es in der Sprache der Xoxi der Fall, dass Kleidung und Frisur einen ungewöhnlich großen Stellenwert in der Sprache einnahmen. Den Ärmel seines Hemdes hochzuschieben, während man einen Satz sagte, bedeutete etwas völlig anderes, als den Ärmel unten zu lassen und denselben Satz zu äußern. Dasselbe mit der Frisur. Die Position jeder einzelnen der geflochtenen Haarsträhnen hatte eine ganz spezifische sprachliche Bedeutung. Wenn das Wetter nicht mitspielte, war es daher äußerst schwierig, eine Unterhaltung zu führen, was je nachdem zu mehr oder weniger schwerwiegenden Missverständnissen führen konnte, wie ihr Vater selbst am eigenen Leib mitbekommen hatte, als er anstatt mit Mittelscheitel zu fragen, ob er noch etwas Reis haben könne, aus Versehen mit Seitenscheitel gefragt hatte, ob denn eigentlich alle Inselbewohner Inzest betreiben würden. Im Übrigen seien fast alle bisherigen Kriege der Xoxi ausschließlich an äußerst windigen Tagen ausgebrochen.
Franziska schrieb den Text der Postkarte wie immer in eines ihrer schwarzen Notizbücher ab und hängte die Karte dann mit dem Strandmotiv nach vorne an die Wand ihres Zimmers.
Danach hörte sie drei Monate nichts mehr von ihrem Vater. Am 10. Januar 1942 erhielt Margarethe schließlich eine Nachricht der U. S. Navy, dass man den leblosen Körper ihres Mannes am Strand der Südseeinsel Wannata gefunden habe.
Aus der Luft sieht Wannata aus wie ein Pantoffeltierchen, das gerade mit der Teilung begonnen hat. Die etwa zwanzig Quadratkilometer große Insel besitzt, abgesehen von der leichten sanduhrförmigen Verengung in ihrer Mitte, eine annährend elliptische Form, die von einem nur wenige Meter breiten, schneeweißen Streifen Korallensand eingerahmt wird, an dessen Rändern sich sanft die Wellen des Pazifiks brechen. Auf alten Fotos des amerikanischen Militärs wirkt das Land beinahe surreal glatt und ordentlich, wie eine Miniaturversion seiner selbst, die da in klar unterscheidbare Farbpartien getrennt inmitten der blauen Wassermassen liegt, die sich in alle Richtungen tausende Kilometer weit erstrecken, ohne auf einen Kontinent zu treffen. Feine weiße Linien ziehen sich wie Blattfasern durch die fruchtbare, phosphatreiche Erde, durch die Feigen- und Kokosbäume, die die Insel bedecken und sich in ihrer Mitte zu einer kleinen Vakuole lichten, die steinig einige Meter über den Meeresspiegel hinausragt.
Von Carl Stonebrooks letzter Reise zeugen nur noch seine eigenen Tagebuch-Aufzeichnungen, die im vorletzten Kapitel seines postum veröffentlichten Atlas der verlorenen Sprachen enthalten sind. Am Abend des 16. Oktober 1941 lief Carl an Bord eines Schiffes der amerikanischen Navy die Strände Wannatas an. In seinem Tagebuch schreibt er:
Das Volk der Insel, das sich selbst Wanna nennt, besteht aus etwa eintausendfünfhundert Personen, die in großen, ineinander übergehenden Familienclans leben. Sie sind unbekleidet bis auf einen Lendenschurz aus geflochtenen Palmfasern über Gemächt und Schoß und leben in Hütten mit spitz zulaufenden Dächern aus demselben Material. Sie sprechen eine Sprache, die phonetisch denen der Bunun ähnelt, mitunter aber durchsetzt ist von moderneren ostasiatisch klingenden Phonemen und auf einer eigenartig vielschichtigen Semantik aufbaut. Die Männer wie die Frauen tragen hölzerne Harpunen bei sich, die sie jedoch ohne Bedenken niederlegten, als wir versuchten, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Insbesondere die Kinder empfingen uns mit naiver, aufrichtig frohmütiger Neugier.*4
Noch am Tag ihrer Ankunft begann Carl mit seinem Religions- und Lateinunterricht. Doch mehr als für die Bibel schienen sich die Inselbewohner für die vielen Apparaturen und Waren zu interessieren, die die Neuankömmlinge dabeihatten. Die Amerikaner bauten Straßen und eine lange Bahn aus Stein, auf der Flugzeuge landeten und abhoben. Fluglotsen winkten mit grünen Stäben die ankommenden Flugzeuge herbei und ließen sie wieder abfliegen. Sie bauten viereckige Hütten, in denen sie auf viereckigen Stühlen saßen und Zeichen auf dünne, weiße, viereckige Blätter schrieben und dabei laut in Funkgeräte sprachen. Und alle paar Wochen kamen mehr Schiffe und Flugzeuge mit weiterer Fracht. Das irritierte die Inselbewohner am meisten: der scheinbar nie endende Strom an Fracht. Die bleichen Männer trugen immer mehr Essen und mechanische und elektronische Geräte von den Schiffen und Flugzeugen auf die Insel. Und nie sahen die Inselbewohner einen von ihnen dafür arbeiten. Nie sahen sie einen der Männer fischen, jagen oder Gemüse und Früchte ernten oder eines der vielen wunderlichen Geräte bauen, die sie mit sich führten. Sie holten lediglich Dinge aus Holzkisten, die mit den regelmäßigen Lieferungen eintrafen. Alles, was sie taten, um die Fracht zu erhalten, war offenbar, an Tischen zu sitzen und Wörter auf Papier zu schreiben, in Funkgeräte zu sprechen und auf Landebahnen mit grünen Stöcken die Flugzeuge herbeizuwinken. Sie schienen Rituale abzuhalten, um mit den Göttern zu kommunizieren, die ihnen die Fracht brachten. Sie erzeugten Nahrung und Werkzeuge aus bloßen Wörtern. Als könnte der flüchtige Lehm der Luft auf ihren Zungen zu fester Materie werden.
Nach einigen Wochen traten die ersten Vorzeichen des nahenden Untergangs auf. Die Wanna begannen damit, die Verhaltensweise der Neuankömmlinge zu imitieren, wobei sie sich dabei nicht nur auf den Religions- und Englischunterricht beschränkten. Sie begannen mit dem Bau eigener Landebahnen und schmückten sie mit Flugzeugattrappen aus Holz. Sie stellten sich darauf und winkten mit bunten Stöcken in die Luft, um Flugzeuge anzulocken. Sie errichteten kleine Hütten, setzten sich darin an Tische und zeichneten Symbole auf Papier. Sie schnitzten Holzstücke zu Rechtecken und steckten einen dünnen Holzstab als Antenne daran, um mit den Göttern zu telefonieren. Fasziniert machte sich Carl Stonebrook Notizen:
Heute beobachtete ich, wie sich die Schamanin des Dorfes (eine ältere Frau, die aufgrund einer Pigmentstörung, die ihre Haare und Haut beinahe weiß bleichte, von den Inselbewohnern als heilig angesehen wird) von Kopf bis Fuß mit Draht umwickelte, sich so lange im Kreis drehte, bis sie aus Schwindel umfiel, und dann meinte, sie könne nun die Worte des Herrn empfangen. Sie sagte, der Herr trage den Namen James Blum, aber seine Freunde würden ihn Jim nennen, und er würde schon bald mit einem goldenen Schiff am Strand eintreffen und alle Bewohner mit zu sich auf seine Insel mit unendlicher Fracht nehmen.*5
Neben seinem Latein- und Bibelunterricht versuchte sich Carl ebenfalls an einer Übersetzung der mündlich weitererzählten Insellegenden und hatte Ende November eine Art Transkript des wannataischen Schöpfungsmythos fertiggestellt, der im Original zumeist als Lied rezitiert wird und laut Stonebrook auf mindestens drei verschiedenen Bedeutungsebenen gleichzeitig stattfindet, in denen je nach Betrachtung der Fokus auf Ortsangaben, Handlungen der Figuren oder Zeitpunkten liegt, sodass das Lied zugleich auch als geografische Karte und moralischer Kodex verwendet werden kann. Wie Carl verzückt festgestellt hatte, kannten die Inselbewohner keinerlei Begriffe für Norden, Osten, Süden oder Westen, sondern orientierten sich ausschließlich an den Höhenunterschieden sowie der länglichen Inselform. »Odo« — ein Begriff, der sich am ehesten mit »unten« übersetzen ließ — bedeutete z.B.: »in Richtung des Strandes«, wohingegen der Begriff »noro« (»oben«) als »in Richtung des Hügels« verwendet wurde. Äquivalente für »rechts« und »links« ließ die wannataische Sprache ebenfalls vermissen und verwendete stattdessen die richtungsweisenden Begriffe »roru« und »aroru«, die so viel bedeuteten wie gegen und mit dem Uhrzeigersinn, mit denen man zusammen mit den Begriffen für »in Richtung Strand« und »in Richtung Hügel« problemlos über die Insel navigieren konnte. Am erstaunlichsten jedoch war, dass es in der Sprache der Wanna keine selbstbezüglichen Begriffe gab, i. e. keine Möglichkeit, auf sich selbst Bezug zu nehmen. Jegliche Varianten von »ich«, »mir«, »meins« waren auf der Insel völlig unbekannt. Man sprach stets in objektiven Ereignissen. Wenn ich einen Fisch esse, dann wird der Fisch gegessen. Wenn ich etwas trinke, dann wird getrunken. Wenn ich Zahnschmerzen habe, dann »sind da Zahnschmerzen«, dann zahnschmerzt es, genauso wie es regnet oder schneit.
Den Wanna zufolge entstand die Welt aus einer einzigen riesigen, kreisrunden Muschel, die zu Beginn der Zeit geschlossen auf der Oberfläche eines spiegelglatten schwarzen und endlosen Ozeans trieb und sich aus Einsamkeit öffnete. Aus ihr traten zweierlei Dinge aus: Wärme und etwas namens »Quans«, das laut Stonebrook zugleich Hunger, Liebe und Sex bedeutet. Die Muschel wird von Stonebrook gedeutet als
Symbol für den Schoß der Weltenmutter, aus dem das Universum geboren wurde. Hier lassen sich interessante Parallelen zum Christentum ziehen, da die Geburt der Welt laut dem wannataischen Schöpfungsmythos genau wie die Geburt Christi einer unbefleckten Empfängnis folgte, die Welt also gleich dem Messias durch den Schoß einer jungfräulichen Mutter ins Leben gerufen wurde. Nur eben mit einer Muschel statt der heiligen Maria.*6
Die Wärme und das Quans quollen aus der Muschel in Form von zwei nackten Schnecken, die hungrig (oder geil) im nunmehr hellen und warmen Ozean nach Nahrung und Partnern Ausschau hielten. Als sie keine Nahrung und keinen Partner fanden, erkannten sie sich gegenseitig am Geruch und liebten sich und fraßen sich auf, woraufhin sie starben. Aus ihren zerfressenen Körpern schlüpften sodann zwei Schmetterlinge, die zum Himmel emporstiegen, wobei sie ihre Flügel abstreiften und rund und leuchtend wurden, bis sie Sonne und Mond waren. Die Flügel hingegen zerbrachen im Aufwind in tausende Teile und bildeten die heutigen Inseln mit ihrer vielfältigen Flora und Fauna und vor allem: den Menschen. Die Schnecken, die sich zu Schmetterlingen und schließlich zu Sonne und Mond wandeln, werden von Carl Stonebrook interpretiert als
Bild zweier jüngerer Schöße, die im Gegensatz zum alten Schoß der Urmutter (die die Welt geboren hatte) die dingliche Realität mit all den unterschiedlichen Objekten dazugebären. Das kannibalistische Liebesspiel der jungen Schnecken symbolisiert somit die spielerische Nachahmung der Weltschöpfung durch den Mutterschoß in Form geiler, aber tödlicher Geschwisterrivalität zweier venerabilis Dei serva. Hier lassen sich also direkte Parallelen zu Kain und Abel ziehen. Nur mit Schnecken statt Menschen. Und Sex statt Tieropfern.*7
Auf dem Mond wiederum lebte ein Mädchen, das, wo immer es sich aufhielt, einen Schatten warf und dadurch über die Mondphasen bestimmte. Der Erzählung nach heißt es, dieses Mädchen trage den Namen Iwaiai und lebte zuvor mit ihren Schwestern, die Iwaiai und Iwaiai hießen, auf einer Insel im Haus ihrer Mutter, die Iwaiai hieß. Nachdem Iwaiai bei einem Spaziergang mit ihrer Ferse in einen giftigen Seeigel getreten war, wurde sie von Iwaiai verstoßen und Iwaiai und Iwaiai versuchten sie wieder zurückzuholen, aber Iwaiai wollte nicht mehr heimkehren und ließ sich erschöpft und hungrig (oder geil, je nach Übersetzung) am Strand nieder, wo sie dem Meer schluchzend ihr Schicksal klagte.*8 Das Meer wurde ihr Leid müde (oder geil) und spülte einen seltsamen Samen an, den Iwaiai tief in den Sand eingrub. Sogleich wuchs aus dem Samen eine riesige Ranke, die sich bis in den Himmel erstreckte und bunte, leuchtende Früchte trug. Iwaiai probierte eine dieser Früchte. Sie schmeckte so gut, dass sie gleich noch eine probieren wollte. Doch die Ranke wuchs immer weiter und es kamen keine neuen Früchte mehr nach, sodass Iwaiai an ihr hochklettern musste, um an die köstlichen Früchte zu gelangen. Und je höher sie kletterte, desto größer und saftiger und köstlicher (oder geiler) wurden die Früchte, bis sie sich mit einem Mal auf dem Mond wiederfand, wo sie einer alten gehörlosen Frau heimlich ihren köstlichen Sirup wegtrank, den diese aus den seltsamen Früchten herstellte. Als sie Iwaiai beim Trinken des Sirups erwischte, ließ diese ihn aus Versehen fallen, und eine ganze Menge Insekten krabbelten aus allen Richtungen heran, um den Sirup zu trinken. Einige kletterten der alten Frau ins Ohr, und als sie wieder herauskrochen, konnte die alte Frau wieder hören. Zur Strafe zwang sie Iwaiai dazu, ihren Sohn zu heiraten, der der Mond war. Carl deutet die endlose, früchtetragende Ranke als
das ewig nährende Funiculus umbilicalis der Weltmutter, das aus dem Nabel der Erde erwächst und Iwaiai zurück in den Schoß des matriarchalen Urbildes trägt. Das Hinaufklettern läßt sich als Bild für eine umgekehrte Geburt deuten und für den Wunsch, wieder im schützenden und nährenden Schoß der Mutter zu versinken. Hier lassen sich deutliche Parallelen zum Paradies des Christentums ziehen, in das man durch seinen Tod (also gleich dem Klettern an der Ranke ein Exitus aus der alten Welt) an einen ewig schützenden und nährenden Ort gelangt, der den ursprünglichen Schoß darstellt, aus dem man durch die Geburt vertrieben wurde.*9
Während Carl mit der Aufzeichnung des Schöpfungsmythos beschäftigt war, verkündete das mit Draht umwickelte Orakel der Wanna, dass die magische Insel, auf die sie Jim Blum mitnehmen würde, den Namen Wodot tragen würde. Die Insel sei mit einem endlosen Garten überzogen, dessen Bäume sich von dem Gewicht köstlicher Nahrung und seltsamer Gerätschaften und Apparaturen nur so bögen. Jim Blum verlange jedoch einen Beweis ihrer Würdigkeit.
Am nächsten Tag begannen die Inselbewohner unter den stolzen Blicken der Amerikaner mit dem Bau einer Kirche aus Holz und Palmwedeln auf dem zentralen Hügel, dem höchsten Punkt der Insel, etwa fünf Meter über dem Meeresspiegel. Vor der Kirche errichteten sie ein großes Kreuz aus zwei Balken, die sie aus Kokospalmen hergestellt hatten. Der Stolz der Amerikaner wurde jedoch gleich wieder zunichtegemacht, als die Wanna die Kirche pünktlich am Weihnachtsabend anzündeten und um sie herumtanzten, während sie immer wieder fröhlich in befremdlichen Rhythmen das Wort »woiwoi« sangen, das sich laut Carl Stonebrooks Vokabel-Tabelle sowohl mit dem Ausruf »Oh, wie schrecklich!« als auch mit »Fisch, der von allein von den Wellen an den Strand gespült wurde« übersetzen ließ. Carl versuchte die Inselbewohner vor den Amerikanern zu verteidigen und sagte, dass sie es sicher nur gut gemeint hätten, und man habe ihnen ja schließlich auch einige Bilder von mit Lichtern geschmückten Christbäumen gezeigt, da sei es nur verständlich, dass sie die Symbole vielleicht etwas durcheinandergebracht hätten. In seinen privaten Notizen merkte er jedoch an, er hätte
[…] das Gefühl, daß das Medium die Inselbewohner aufzustacheln versucht. Während die Einheimischen uns in froher Erwartung anstarrten, als sie die Kirche in Brand setzten, stand das Medium lediglich daneben und warf mir einen schrecklichen, feindseligen und wissenden Blick zu. Auch habe ich langsam den Eindruck, daß die Schamanin die lateinische und sogar die englische Sprache beunruhigend schnell erlernt hat und auch schon den einen oder anderen Brocken Deutsch beherrscht, was ich mir beim besten Willen nicht erklären kann, da ich diese Sprache hier außerhalb meiner eigenen privaten Notizen noch gar nicht benutzt habe.*10
Als Jim Blum einige Wochen später immer noch nicht aufkreuzte, erklärte das Medium, es habe erneut eine Botschaft erhalten. Jim Blum sage diesmal, dass er lediglich zwei Menschen auf seine Insel mitnehmen könne. Diese zwei Menschen jedoch — geschlechtslos und asexuell — würden die Seelen aller Inselbewohner enthalten, sowohl die der lebenden als auch die der toten, aber nicht die der bleichen Männer. Jim Blum würde die Seelen der Wanna sorgsam aus ihren Körpern ziehen und in den Leib des letzten Menschen gießen. Um Jim Blum zu beweisen, dass sie würdig waren, müssten sie sich von allen lebenswichtigen Dingen lösen, um ihm so zu zeigen, dass seine Ankunft unabdingbar wäre. Erst, so sprach das Medium, wenn nichts mehr zum Leben da ist, wird Jim Blum die Notwendigkeit erkennen, uns in sein Paradies zu holen.*11
In der darauffolgenden Nacht brannten die Inselbewohner alle Äcker und Obstbäume nieder, töteten das Vieh und zerstörten sämtliche Häuser. Die Amerikaner mussten überstürzt von der Insel fliehen. Einige schafften es nicht mehr zurück aufs Schiff. Erst einige Stunden später stellten sie fest, dass auch Carl Stonebrook nicht an Bord war. Als sie am nächsten Tag wachsam die Insel umkreisten und sich in ihren Fernrohren nichts regte, kehrten sie an den Strand zurück, um nach den Hinterbliebenen zu sehen. Doch als das Schiff am Silvestertag am Strand anlegte, stellte man fest, dass die übrigen Mitglieder der Mission verstorben waren. Die Körper der Amerikaner lagen in seltsamen Positionen am Strand, die Augen weit aufgerissen, als starrten sie in ihren letzten Augenblicken mit Ehrfurcht auf etwas in der Ferne. Einige waren offenbar ertrunken, als wären sie direkt ins Meer gegangen. Wieder andere Körper wiesen Bissspuren auf. Manche hatten sonderbare Zeichen in Stirn und Arme geritzt. Am Strand lagen Holzstücke mit seltsamen Einkerbungen, und auch in den weißen Sand waren eine Vielzahl riesiger, fremdartiger Symbole gezogen, die mit jeder Welle ihre Form veränderten. Man fand Carl leblos im Sand, umgeben von einem Kreis ritualistisch anmutender Symbole. Die Inselbewohner hatten sich ins Inselinnere zurückgezogen. Man entschied sich dazu, keinen weiteren Kontaktversuch zu unternehmen.
In der Fachwelt wird immer noch debattiert, wie die Schriftzeichen am Strand, die in einigen wenigen Fotografien festgehalten wurden, zu interpretieren seien. Die landläufige Meinung ist inzwischen, dass es sich dabei um nichts weiter handelt als den amateurhaften, sinnentleerten Versuch, die Wörter der englischen Sprache nachzuahmen.*12 Dem widerspricht Franziska Denk, die Jahre später versuchte, die Symbole auf einer vergilbten Fotografie zu entziffern und zu übersetzen. Ihre Übertragung lautet in etwa:
»Nach unten [In Richtung des Strandes/Endes]
Du musst nach unten [man/ihr muss/müsst in Richtung des Strandes/Endes]
Du musst ganz, ganz nach unten [man/ihr muss/müsst in Richtung aller Strände/Enden]
Immer entlang des Randes.«