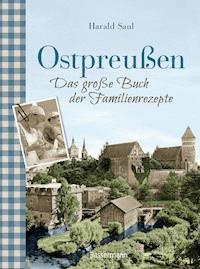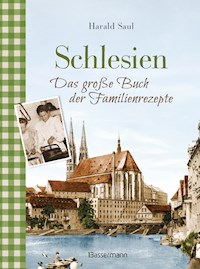
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bassermann Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Schlesische Familienschätze: Geschichten, Fotos, Postkarten und Rezepte
Harald Saul, Küchenmeister und Sammler von regionalen Rezepten, hat sich auf die Suche nach der alten schlesischen Küche gemacht. Er bat die Menschen um ihre alten Familienschätze: So erhielt er handgeschriebene, über Generationen weitergegebene Kochbücher, die alten Fotoalben wurden für ihn geöffnet und die Menschen erzählten ihm ihre Geschichten.
Dieser Doppelband besteht aus den Einzelbänden "Unvergessliche Küche Schlesien" und "Alte Familienrezepte aus Schlesien" aus dem Bassermann Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ISBN 978-3-641-25578-7V001
Dieses Buch ist ein Bind-up aus den beiden Einzelbänden von Harald Saul mit Familienrezepten aus Schlesien, erschienen beim Buchverlag für die Frau 2004 und 2008, bei Bassermann 2013 und 2014.
© 2019 by Bassermann Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
© der Originalausgaben by Buchverlag für die Frau, Leipzig, 2004 und 2008,
Orginaltitel: Familienrezepte aus Schlesien: Geschichten und Rezepte einer unvergessenen Zeit, 2004
Noch mehr Familienrezepte aus Schlesien: Erinnerungen an die unvergessene alte Heimat, 2008
Die Verwertung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Umschlaggestaltung: Atelier Versen, Bad Aibling
Herstellung: Elke Cramer
Projektleitung: Anja Halveland
Die Ratschläge in diesem Buch sind vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autors bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Satz: Nadine Thiel, kreativsatz, Baldham
E-Book Produktion: Vera Hofer
Ober-Krummhübel um 1920
Hirschberg um 1930
Peterbaude1927: Arbeitsstelle von Paul Jacob
Die letzte Arbeitstätte von Paul Jacob: die neue schlesische Baude
In der großen Nacht
Wir haben die Gewißheit, daß die Bäume, Wege und Felder es sind, die uns helfen, weil wir jede ihrer Furchen kennen und wissen, daß in dem alten Wald unserer Kindheit und auf den Feldern, die wir bearbeiteten, uns kein Schaden treffen kann. Wie wäre es sonst geschehen, daß vor der Aussiedlung so viele Deutsche unbeschadet in die Tschechei flüchten konnten, trotz strenger Grenzbewachung? Das sind Nächte, in denen keiner schläft, und viele gehen als Führer einige Male in einer Nacht über die Grenze: die Trupps der unbekannten Menschen aus anderen Gebieten Schlesiens oder Polens, die angstvoll ihren sicheren Schritten folgen, gleiten durch die dichte Postenkette lautlos wie ein Schatten.
In der Osternacht läßt uns ein tschechischer Bauer an die Grenze kommen. Wir wissen nicht, was er von uns will. Aus der Dunkelheit des Dickichts tritt er riesengroß und schweigsam zu uns. Einen Sack mit Brot und Fleisch, Mohn und Mehl trug er für uns von seinem fernen Dorf her. »Heut die große Nacht, wir wollen Gutes tun.« Er sagt es auf tschechisch und wir verstehen ihn. Die große Nacht, die Osternacht. Erst als er von seinem Grenzstein erkennt, daß wir heil und ungehindert den Heimweg gehen können mit unserer guten Last, sehen wir ihn wieder in die Tiefe seines böhmischen Waldes zurückkehren. Einer, der weiß, worum es geht in der Welt.
Bericht April 1946, aus:Einladung in ein altes Haus.Geschichten von Vorgestern.Von Dagmar von Mutius
HERMANN GEBHARDT
Rübezahl
Den Geist der Berge hab’ ich gut gekannt.Ich traf ihn oft auf seinen Wanderwegenund sah ihn gern mit spielerischer Handauf Hang und Hütten Wolkenschatten legen.
Ich lauschte seinem Donnerzorn am Kammund hörte ihn vergnügt im Knieholz pfeifen.Ich sah ihn polternd eilen durch die Klammund mit der Sturmfaust nach den Bäumen greifen.
Oft hat er seinen Blitz nach mir gezückt,zum Spaße nur, dem Übermut zu drohen;doch hat er je und je mich tief beglückt,wenn Lebensmut und Freude mir entflohen.
Traf mich ein Schmerz, hing er mir geisterstummim Dämmer einer kühlen Abendstundeden weichen grauen Wolkenmantel um,und wie ein Kind vergaß ich Weh und Wunde.
Von seinem Garten bin ich lange fort,doch denk’ ich gerne seiner tollen Schwänke.Schlug mich zuweilen auch sein grobes Wort,
»Man kann durch viele Länder reisen, das Land des Anfangs gibt es nur einmal.«
Inhalt
In der großen Nacht, Dagmar von Mutius
Rübezahl, Hermann Gebhardt
Aphorismus, Gerhard Gruschka
Landkarte von Schlesien in den Grenzen von 1940
Vorwort des Autors
Geschichten und Rezepte
Erinnerungen von Gerda Schneider aus Hoyerswerda
Holundersuppe mit Kartoffelstampf
Haferflocken-Beeren-Auflauf
Eduard Bacher, der Ebereschenkoch aus Bad Warmbrunn
Ebereschensaft
Ebereschengelee
Ebereschenmarmelade
Ebereschen-Bonbons
Ebereschensuppe mit Griesstürmchen
Ebereschentorte mit Birnen
Wanderkoch Paul Jacob: Spezialitäten aus dem Riesengebirge
Hirschberger Bierfleisch
Hirschrückensteaks mit Zwiebelmus überbacken
Rehkeule nach Schlesierhaus-Art
Schlesische Honigcreme
Geschmorte Rehkeule mit Backpflaumen
Wildgerichte von Martha Weichler aus Grüssau
Hasenbraten nach Grossmutters Art
Schlesische Mehlklösse
Rebhühner mit Linsengemüse um 1930
Hirschkeule nach Weichlers Art
Hähnchenbrust auf roten Nudeln
Wildschweinwurst im Glas – Breslau um 1930
Schankwirtrezepte der Familie Kohler aus Kynau
Kohlers Fliederblütenwein Rezept um 1910
Kohlers Waldhimbeerrolle auf Fliederschaum, um 1930
Kohlers »Lila« Fliederdicksaft
Hausrezepte der Selma Groß aus Frankenstein
Schlesischer Apfelkuchen nach Selma Gross
Birnensoufflé
Schlesische Linsenrösti
Familie Dinter – ein Schicksal in der Grafschaft Glatz
Oma Minkas schlesischer Kartoffelsalat
Sirupplätzchen
Neissgrunder Pflaumenkuchen
Neissgrunder Obsttorte
Bäckermeister August Frieben aus Gellenau
Die Rindfleischbrühe des Feiertagsessens
Hausmachernudeln von Elisabeth Frieben
Sauerkraut von Elisabeth Frieben
Schmorrotkohl von Elisabeth Frieben
Rinderschmorbraten nach Frieben-Art
Schweinebraten mit Dörrpflaumen nach Mutter Frieben
Die Meerrettichsosse nach Mutter Frieben
Quarknocken auf Holunder-Honigsosse
Die Geschichte von Martha Krebs aus Ludwigsdorf
Ludwigsdorfer Sandkuchen
Schlesischer Kartoffelsalat nach Martha Krebs
Ludwigsdorfer Mehlsuppe
Schlesische Mehlsuppe
Otto Exner, der Koch aus Habelschwerdt
Otto Exners Pfefferkuchensosse
Otto Exners Schlesische Mohnklösse
Otto Exners Schlesischer Mohnstriezel
Hausrezepte der Elsa Topf aus Glatz
Elsas Häckerle
Schwärtelbraten
Schlesische Mehlklösse
Glatzer Apfelklösse
Lungensuppe nach Glatzer Art
Der Koch und Konditor Otto Schreiner aus Neisse
Schreiners Mohntorte
Schreiners Früchtebrot
Wilder Schweinebraten in Buttermilch
Roggenplätzchen
Gemüse-Fisch-Auflauf nach Otto Schreiner
Schreiners Reisfleisch
Neisser Honigkuchen
Manfred Krug: Damals in Jägerndorf
Schlesischer Mohnkuchen
Der schlesische Streuselkuchen
Die Oderschleie in Weissweinsosse
Jägerndorfer Schmorhase mit Preiselbeeren
Imelda Machowska: Erinnerungen an Ratibor
Grünkernsuppe
Ratiborer Gemüseschnitzel, 1935
Der schlesische Möhrenkuchen
Die Hauswirtschaftslehrerin Emma Franke aus Gleiwitz
Neues und Sparsames für jede Tageszeit
Kartoffelmehl aus Kartoffelschalen
Zum Frühstück: schlesische Molkesuppe
Schlesischer Kartoffelauflauf
Leberknödel
Kochkäse nach Emma Franke
Oberschlesische Rezepte von Marie Meyer aus Gleiwitz
Schlesisches Huhn in Gelee
Gekochte Eier mit Tomaten in Aspik
Gleiwitzer Gemüsetopf
Rhabarber-Streusel-Kuchen
Rezepte der Familie Kirchner aus Oppeln
Hausschlachtenes bei Kirchners
Hühnchen im Wirsingmantel, 1901
Mohn-»Klösse«
Erna Kirchners Schlesisches Himmelreich
Das Familienkochbuch der Schädlichs aus Oppeln
Schädlichs Weihnachtskarpfen
Schädlichs Hefeknödel – Lemberg um 1910
Rindfleisch mit Rosinensosse, Bad Landeck 1925
Weisskrauteintopf mit Gehacktem
Küchenchef Heinrich Triebig aus Breslau
Der Sauerkrauteintopf
Schlesischer Sauerkrautauflauf
Schlesische vegetarische Sülze
Das Dienstkochbuch von Emma Felgentraeger aus Breslau
Die magere Graupensuppe
Süsse Möhrensuppe nach Breslauer Art
Die rohe Kartoffelsuppe – »Schnelle Zudelsuppe«, Breslau um 1936
Emmas rote Grütze aus roten Rüben
Roggenmehlpudding
Die Kochbücher der Familie Jauer aus Breslau
Hasenbraten
Stampfkartoffeln (Kartoffelbrei)
Ernas Allerlei-Topf
Schweinefleisch mit Birnen
Die Linsensuppe der Edelgard Jauer
Das Degenkolb-Familienkochbuch, Trebnitz
Trebnitzer Täubchenbrühe
Kümmelkotelett mit Ofenkartoffeln
Schlesische Mohnbuchteln
Möhrenlebkuchen nach Breslauer Art
Schlesische Sesambrötchen
Schlesische Zimtsterne
Die Küchenrezepte der Anna Dokter aus Zedlitz
Breslauer Mandelforelle
Mohnkuchen nach Grossmutterles Art
Schlesische Quarkkeulchen
Schlesischer Käsekuchen
Breslauer Mandelmakronen
Die Kreischauer Familienküche
Schlesische Häckerle – Brotaufstrich
Pflaumenmus nach Kreischauer Art
Kreischauer Kürbissuppe
Saure Eier in Brauner Sosse
Kreischauer Hefeklösse
Kreischauer Mohnklösse
Rosi und Gotthard Schmidt aus Kaiserswaldau und Altenreichenau
Gelinge mit Kartoffelbrei
Schlesische Klösse mit Backobst
Bouillonkartoffeln
Das Berühmte Schlesische Himmelreich
Marinierter Hering
Das selbstgemachte Sauerkraut der Familie Schmidt
Das Familienkochbuch der Jelinecks aus Bunzlau
Jelinecks Weihnachtsbaumbehang
Bunzlauer Mandelgebäck, um 1930
Bunzlauer Reisauflauf mit Erdbeersosse
Hausrezepte von Frieda Karsch aus Bunzlau
Apfelkrapfen nach Frau Müller
Schlesische Birnentorte nach Frau Grothe
Patschkauer Knoblauchsuppe
Heinrich Gersdorff, der Kloß-Heinrich aus Sagan
Kartoffelsuppe nach art des Savoy-Hotels, Breslau um 1900
Breslauer Kartoffelklösse, um 1900
Saganer Semmelklösse – vor 1897
Breslauer Mehlklösse – 1910
Breslauer Karpfen
Steckrübensuppe
Der Koch Johannes Schramm, Zoblitz
Leber nach Zoblitzer Art
Zoblitzer Quarkauflauf
Fischfilet auf Sauerkraut
Schlesische Krauttaschen
Rezeptverzeichnis
Quellenangaben
Impressum
Kulinarische Zeitreisedurch Schlesien
»Eins, zwei, drei,vier, fünf, sechs, sieben,eine alte Frau kocht Rüben,eine alte Frau kocht Speck,du bist weg.«
Alter Breslauer Kinderversum 1920
Ideen, die man lange mit sich trägt, brauchen manchmal einen Anstoß von außen, damit sie verwirklicht werden. Schon seit Anfang der 70er Jahre (als Kochlehrling in Meuselwitz/Thüringen) beschäftigte ich mich mit der schlesischen Küche. Doch erst 2001, auf der Leipziger Buchmesse, erhielt ich die entscheidende Anregung. Ehemalige Schlesier wünschten sich auch ihre alte Heimat und Küche in meiner Buchreihe »Familienrezepte« dargestellt. Ich ermunterte sie, in ihrem Familien- und Verwandtenkreis nach Schrift- und Bildmaterial aus jener Zeit zu forschen und es mir zukommen zu lassen. Die Resonanz war groß. Nun befanden sich zahllose Ansichtskarten, Fotos und handgeschriebene Familienkochbücher in meinem Archiv und bildeten den Grundstock zu meinem ersten Kochbuch, das einen repräsentativen Querschnitt durch die schlesische Küche gibt und ausschließlich authentische Rezepte und Geschichten vorstellt.
Nach dem Erscheinen meines ersten Buches »Familienrezepte aus Schlesien«, 2003, erreichten mich unzählige Briefe und Telefonate, in denen mir ältere Menschen ihr Lebensschicksal schilderten, ihre Familiengeschichten erzählten und mir weitere Rezepte der traditionellen schlesischen Küche zur Verfügung stellten. Dieses umfangreiche Material bot mir die Möglichkeit, erneut einen besonderen Teil des schlesischen Lebensalltags zwischen 1900 und 1945 zu dokumentieren. Das zweite Buch wurde 2008 unter dem Titel »Noch mehr Familienrezepte aus Schlesien« veröffentlicht.
Dieser Doppelband ist eine Zusammenstellung der Rezepte, Fotos und Erzählungen der beiden Einzelbände.
Von den frühen Kolonisten des Jahrhunderts, die aus Franken, Bayern, Schwaben und Thüringen kamen, bis hin zur Zugehörigkeit Schlesiens zu Böhmen und dem Kaiserreich Österreich-Ungarn finden sich Spuren in der schlesischen Küche.
Die typisch schlesischen »Kließla« können ihre Verwandtschaft mit bayerischen Knödeln, Thüringer Klößen, schwäbischen Klöß und Knöpfle sowie Wiener Mehlspeisen und Backwerk nicht verleugnen. Süßspeisen sind traditioneller Bestandteil schlesischer Mahlzeiten. Das »schlesische Himmelreich«, gewissermaßen Nationalgericht der Region, serviert Backobst zu Fleisch und Klößen. Festtage bieten Anlass, die ganze Pracht der Küche auf den Tisch zu bringen. Ob zum »Kindelschmaus« (Taufe), auf der »Huxt« (Hochzeit), beim Schlachtfest – Essen und Trinken dürfen nie fehlen. Besondere Reichhaltigkeit entfalten die Erntemonate bei der »Kerms« (Kirmes). Die Gaben der Natur werden in vielfältige Speisen verwandelt, während sich die ländliche Bevölkerung unter der Erntekrone – gewunden aus Ähren, Blumen und Eichenlaub – singend und tanzend vergnügt.
Landschaft, Boden und Klima formen den Menschen und bestimmen seine Ernährung, die hier urwüchsig-rustikal ist. Neben Erzeugnissen der Garten- und Feldwirtschaft erscheint nicht nur das Fleisch der Weidetiere auf dem Speiseplan, sondern zu besonderen Gelegenheiten auch Wild und Fisch. So probiere man zu Weihnachten den würzigen Karpfen auf polnische Art (Seite 136), der durch seine Zutaten Feiertagsdüfte verströmt, oder genieße im Herbst die schmackhaften Wildvariationen! Ich habe viele Gerichte nachgekocht und aktualisiert für die Zubereitung in der heutigen Küche, einige Rezepte sind originalgetreu wiedergegeben.
Vielleicht kann meine Arbeit ein Beitrag sein, daß die persönlichen Erinnerungen an die einstige Heimat Schlesien nicht verloren gehen und die Traditionen einer Region auch an die kommenden Generationen weitergegeben werden. Allen, die meiner Neugier und meinen Fragen nach Schlesien und der alten Zeit geduldig Zeit opferten und mich großzügig mit Material bedachten, sei herzlich gedankt!
Gerda Schneider, 1939
Ein Sommer in Schlesien – Erinnerungen von Gerda Schneider aus Hoyerswerda
Meine dritten Sommerferien stehen kurz bevor – endlich ist es soweit, nur noch heute gehe ich in die Schule. Seit Ostern 1927 bin ich Schülerin der Mädchenschule in Hoyerswerda. Sie besteht aus acht Klassen. Der Schulalltag ist ganz schön anstrengend für mich, Anna Ernestine Gerda Schützel. Über eine halbe Stunde führt mich von Montag bis Sonnabend der Fußweg vom ländlichen Klein Neida, einem Vorort von Hoyerswerda, in meine Schule. Dabei muß ich sogar die Bahnschienen überqueren. Meine Schule befindet sich in der Nähe des großen Postamtes.
»Ich komme ja schon, Muttel!« Muttel nenne ich liebevoll meine Mutti, die mir gerade mein Frühstück zubereitet hat. Oh, ein Eierplins mit … – nein – ohne Blaubeeren! Es wird Zeit, daß ich mit Vatel wieder in den Wald gehe zum Blaubeerenpflücken. Aber der Eierplins schmeckt köstlich, Muttel bäckt ihn fast jeden Morgen für mich. Nun bin ich bereit fürs Lernen. Schnell noch die in Butterbrotpapier gewickelten Schnitten eingepackt und los geht es. Im Anbau unseres Wohnhauses Waldstraße Nummer 11 befindet sich eine Glasschleiferei, in der schon tüchtig gearbeitet wird. Ansonsten ist es ein ruhiger Morgen, die Vögel zwitschern und der Dorfbach plätschert munter drauflos.
Es ist 9.45 Uhr und die große Pause lädt zum Essen ein. Muttel gibt mir immer ein paar Groschen mit, davon kaufe ich mir jetzt für zehn Pfennige eine Flasche Kakaomilch. Eine Molkerei aus der Stadt liefert sie täglich frisch an unsere Schule. Kakaomilch schmeckt mir viel besser als Vollmilch, die es für zwei Pfennige weniger gibt.
Die nächsten Schulstunden vergehen schnell. Mein Heimweg führt mich bei meiner Oma Anna vorbei. Sie wohnt in der Bahnhofsstraße. Oma kocht jeden Tag für mich Mittagessen. Ich erzähle ihr dann noch schnell, was es Neues in der Schule gab und verabschiede mich mit vielen Grüßen für Opa Gustav, der fleißig in der Tischlerei arbeitet. Heute muß ich mich nämlich etwas beeilen, weil ich für Muttel einkaufen gehen soll. Übrigens haben wir, als ich noch klein war, auch mal hier in der Bahnhofsstraße gewohnt. Vor den Toren von Hoyerswerda gefällt es mir aber viel besser. Vatel hat uns die Wohnung besorgt. Hausbesitzer Weiß vertreibt Automaten, die Vatel ab und zu repariert und so kamen wir im vorigen Jahr nach Klein Neida.
Mal gucken, wenn ich richtig rechne, was ich schon ganz gut kann, bleiben zwanzig Pfennige für mich übrig und dafür kaufe ich mir bei »Gemüse-Peter« zwei Bananen. In unserer Waldstraße liegt ein Bauerngehöft. Dort gibt es eigentlich alles, was Muttel so braucht, wenn sie für uns kochen will. Das große Tor ist wie immer gut verschlossen, aber das stört mich nicht. Ich kenne eine geheime Tür, die mich hintenherum auf den Hof führt. Bienenhonig, Butter und Eier kaufe ich heute ein – und das Geld reicht, bloß gut.
Kurz vor sieben am neuen Morgen weckt mich Vatel aus dem Schlaf. Weiß er denn nicht, daß ich Ferien habe? »Komm Kleene, wir gehen in den Wald!« Endlich! Ich liebe den Wald, der gleich hinter unserem Haus beginnt. Er ist hügelig, ein wenig geheimnisvoll und es gibt so viel zu entdecken und zu sammeln.
Vatel kam gerade von der Nachtschicht. Er arbeitet auf Grube Erika der Ilse-Bergbau-AG in Laubusch als Schlosser. Dort repariert er Lokomotiven und riesige Förderbrücken, während er sehr weit oben angeseilt ist. Wir waren Vatel mal auf Arbeit besuchen und mir wurde ganz schwindelig, als ich ihn dort oben sah.
Frauendorf, Haus der Großeltern, um 1907
Frauendorf, historische Ansichtskarte
»Schau mal, es gibt schon Pilze!« Die ersten Pfifferlinge und Birkenpilze, da wird Muttel staunen. Vielleicht kocht sie uns am Wochenende etwas Schönes damit. Am liebsten esse ich die Pilze mit Rührei, brauner Butter und viel Petersilie.
Im Spätsommer sammeln wir wie jedes Jahr Blaubeeren und Preiselbeeren, die weckt Muttel ein. Ich habe dann auch wieder etwas für meine morgendlichen Eierplinsen. Auf dem Heimweg zähle ich die Tage, die noch vergehen müssen, bis Muttel und ich auf große Reise gehen – auf große Reise nach Neualtmannsdorf zu Urgroßvater August. Einmal jährlich, im Sommer, besuchen wir ihn für eine Woche. Das werden wunderbare Ferien.
Hoyerswerda am Bahnhof: Von weitem höre ich bereits das Schnaufen der Lokomotive – und schon sitzen wir im Zugabteil. Über 300 Kilometer liegen vor uns, der Zug rast durch Täler und vorbei an großen Städten wie Bunzlau, Liegnitz, Schweidnitz und Frankenstein. Urgroßvater August erwartet uns, seine Enkelin und seine Urenkelin, sehnsüchtig. Er hat vom Gutsbesitzer ein paar freie Tage bekommen, damit er die Zeit mit uns verbringen kann. Urgroßvater August lebt allein in seinem Haus und arbeitet auf dem Gut als Knecht. Sein Lohn wird ihm teilweise in Lebensmitteln ausgezahlt. Urgroßvater geht mit uns viel spazieren. Wir besuchen die katholische Kirche, wo er 1876 heiratete. Manchmal machen wir Ausflüge in die Umgebung von Münsterberg/i. S. Es gibt dort große Felder mit rot blühenden Mohnblumen.
An einem Abend erzählt er Muttel und mir die gruselige Geschichte vom Massenmörder »Papa Denke« (Karl Denke aus Oberkunzendorf bei Münsterberg brachte über 30 Menschen um und aß sie z. T. auf), der die ganze Umgebung von Neualtmannsdorf in Angst und Schrecken versetzte. Er erzählt von seiner Frau Theresia, meiner Urgroßmutter, die schon lange nicht mehr lebt. Sie starb mit 37 Jahren. Dann berichtet er von seinem Sohn Gustav, der als Tischler auf Wanderschaft ging und zur Tischlerei Nicolai nach Hoyerswerda kam. Dort lernte er schließlich meine Oma Anna kennen.
Gerda (vorn links) als Blumenmädchen auf einer Hochzeit, 1931
Zu schnell vergeht die Zeit in diesem Sommer, zu schnell sind wir wieder in Neida. Noch eine kleine Reise versüßt mir meine Sommerferien. Sogar Vatel kommt mit. Viel Urlaub hat er nicht, aber die sechs Tage im Jahr werden ihm bezahlt. In seiner freien Zeit geht er außerdem gern kegeln im Verein »Rollendes Glück«.
Aber nun ist er mit uns unterwegs und zwar zu Großmutter Ernestine nach Frauendorf bei Ruhland im westlichen Zipfel von Niederschlesien. Das ist nicht weit von uns aus, deshalb kann ich meine Großmutter auch öfter besuchen. Meinen Großvater Karl habe ich nur als kleines Mädel kennengelernt. Vor fünf Jahren, 1925, kam er auf dem Weg zu seiner Arbeit bei einem Unfall ums Leben. Er war in Lauchhammer als Eisendreher tätig. An einem Bahnübergang wurde er vom Zug überfahren. Seither ist Großmutter Ernestine allein. Sie freut sich immer sehr, wenn ich sie besuchen komme und ihr von meinen Erlebnissen erzähle. »Großmutter, stell dir vor, in Neualtmannsdorf waren Zigeuner, die haben viele Hühner mitgenommen und ich hatte ganz schön Angst, als in der Nacht das Kätzchen von Urgroßvater August ans Fenster klopfte.«
Vatel (hinten), Großmutter Ernestine (2. v. l.), Großvater Karl (2. v. r.), 1910
Jetzt bin ich 87 Jahre alt, lebe nicht mehr in Schlesien, sondern in Brandenburg, in Senftenberg/Niederlausitz. In meinem Zimmer hängt ein Gemälde mit rot leuchtenden Mohnblumen – eine Erinnerung an die damalige Zeit.
Meine Gedanken wandern oft in die Vergangenheit zurück, zu meinem Ehemann, der aus Ratibor in Oberschlesien stammte. Ich lernte ihn in Görlitz während meiner Ausbildung zur Bücherrevisorin bei der Firma Liva – Terrazzo- und Zementwarenfabrik kennen. Er war damals mit seinem 30. Infanterieregiment in der Stadt stationiert.
Ich sehe auch die dunklen Tage. Der Bombenhagel, der über Görlitz niederging, zwang mich zurück nach Hoyerswerda, wo ich dann beim Amt für Volksgesundheit arbeitete. 1940 heiratete ich in Klein Neida meinen Max. Er verbrachte hier seinen Fronturlaub. Ich sah ihn erst 1949 wieder, als er aus Kiew kam – aus der Gefangenschaft. Vatel starb in der Nachkriegszeit 1947 im sowjetischen Internierungslager in Buchenwald. Muttel starb 1964, ohne je erfahren zu haben, was mit ihrem Mann Reinhold passierte. Sein Schicksal konnte ich erst nach der Wende aufklären lassen. Viel Trauer, aber auch viele glückliche Momente begleiten mein Leben.
HOLUNDERSUPPEMIT KARTOFFELSTAMPF
Suppe: 375 g Holunderbeeren • 11 Wasser • Schale und Saft von ½ Zitrone
10 Nelken • 1 Zimtstange • 100 g Rosinen • 30 g Stärkemehl • 75 g Zucker
1 EL Butter • Hultsch-Zwieback (heute Neukircher Zwieback)
Stampf: 1½ kg Kartoffeln • ¼ l Milch • 2 EL Butter
Die gewaschenen schwarzen Holunderbeeren mit einer Gabel von den Stielen abstreifen und zerdrücken. Zusammen mit knapp 1 l Wasser und der Zitronenschale, den Nelken, der Zimtstange und den Rosinen 20 Minuten kochen. Den Saft abgießen, wieder zum Kochen bringen und mit dem im restlichen Wasser kalt angerührten Stärkemehl binden. Nun mit Zitronensaft und Zucker abschmecken.
Nebenbei den Zwieback in kleine Stücke brechen und in der Butter braten. Für den Kartoffelbrei Salzkartoffeln bereiten, abgießen, stampfen. Einen Eßlöffel Butter zugeben. Die heiße Milch zugießen und nochmals stampfen.
Von der restlichen Butter braune Butter bereiten und über den zusammen mit der Holundersuppe angerichteten Stampf geben und geröstete Zwiebackwürfel darüberstreuen.
TIP: Aus den getrockneten Blüten des Holunderstrauches bereite ich immer köstlichen Tee, der hervorragend bei Erkältung hilft.
Gerda als Blumenkind, 1928
Gerda, 1937
HAFERFLOCKEN-BEEREN-AUFLAUF
150 g Haferflocken • ½ l Milch • etwas Salz • 30 g Zucker
abgeriebene Schale einer halben Zitrone • 3 Eigelb
Guss: 3 Eiweiß • 150 g Zucker
375 g Blaubeeren (Preisel- oder auch Stachelbeeren)
Die Haferflocken mit der kochenden Milch übergießen und zugedeckt 2 Stunden stehen lassen. Dann mit Salz, Zucker und der geriebenen Zitronenschale würzen, die Eigelb daruntermengen und in eine gefettete feuerfeste Form füllen. Im Ofen 10 Minuten vorbacken.
Inzwischen die Eiweiß zu steifem Schnee schlagen, den Zucker und die gewaschenen, entstielten Beeren daruntermischen und über den vorgebackenen Auflauf verteilen, der noch ½ Stunde bei mäßiger Hitze backen muß.
Ricarda und Eduard Bacher, 1901
Der Ebereschen-Koch aus Bad Warmbrunn: Eduard Bacher
Familie Bacher bekam von Bekannten das Buch »Familienrezepte aus Schlesien« geschenkt. Im Internet recherchierten sie meine Adresse sowie die Telefonnummer und luden mich zu sich ein.
Bei meinem Besuch im März 2008 sitzen August und Erna Bacher bereits auf gepackten Koffern. Sie wollen in ein altersbetreutes Wohnheim nach Bad Honnef umziehen und sind sehr beschäftigt. In dem Häuschen, das von August Bachers Großvater 1935 erbaut wurde, sind viele Erinnerungen noch gegenwärtig.
Das Ehepaar Bacher empfängt mich mit dem unverkennbaren schlesischen Dialekt. Auf meine Nachfrage, warum denn beide diesen schlesischen Dialekt sprächen, obwohl sie nur ihre Kindheit in Schlesien verbracht haben, meinen sie verschmitzt, der Umgang forme den Menschen und seine Aussprache. Beide unterhalten lebhaften Kontakt zu schlesisch sprechenden Menschen. Das sei für sie sehr wichtig. Man lebe zwar heute und stelle sich auch den Anforderungen der heutigen Zeit, aber man gedenke ebenso liebevoll der Vergangenheit.
Bad Warmbrunn, um 1920
Für das neue Wohnzimmer im altersbetreuten Wohnheim steht schon eine große Kiste mit Heimatliteratur bereit – natürlich in Mundart verfaßt. Sofort verfallen beide erneut in den schlesischen Dialekt. Da ich davon nur die Hälfte verstehe, beeilen sie sich rücksichtsvoll, wieder Hochdeutsch zu sprechen.
Die Bachers stammen beide aus dem schlesischen Bad Warmbrunn und sind hier auch 1930 geboren. Beide arbeiteten als Lehrer und wollen nun hoch in den Siebzigern eine geschmackvolle, schon möblierte Seniorenresidenz beziehen. Sie entschieden sich, fast nichts mitzunehmen und da sie keine Kinder und Enkel haben, stellten sie den gesamten Hausrat für einen Trödelhändler bereit. Freundlicherweise verpackte das Ehepaar aber alles, was an die berufliche Laufbahn des Großvaters erinnert, in eine extra Kiste, die auf mich wartete. Trotz der begehrlichen Blicke des Trödelhändlers haben sie diese Kiste nicht hergegeben, erzählt mir die immer noch sehr lebhafte Erna Bacher lachend.
Aus der Familiengeschichte
Erna Bacher, geb. Nolde, ist die einzige Tochter des Brunnenbaumeisters Richard Nolde und seiner Frau Hertha, geb. Grünling.
Bad Warmbrunn, Quellenhof und Schloß, um 1920
August Bacher ist der einzige Sohn des Oberkellners Reinhardt Bacher und seiner Frau Leonore, geb. Feigenspan.
Reinhardt Bacher war wiederum der einzige Sohn des bekannten Bad Warmbrunner Kochs Eduard Bacher und seiner Frau Ricarda, geb. Geißler. Erst nach einem ausführlichen Gespräch kann ich langsam die komplizierten Familienverhältnisse erahnen, die eng mit der Geschichte des alten schlesischen Kurortes Bad Warmbrunn (heute polnisch Cieplice Zdrój) verwoben sind.
Zum Beispiel erbaute im Kurpark von Bad Warmbrunn ein männlicher Sproß der Familie Geißler, der bekannte Breslauer Baumeister Carl Gottfried Geißler, 1797 die Galerie nach italienischem Vorbild.
Bad Warmbrunn fand das erste Mal 1281 Erwähnung und wurde nach den hier im 12. Jahrhundert entdeckten heißen Thermalquellen benannt.
Der schöne Kurpark, in dem sich die beiden Mütter Hertha und Leonore zufällig kennen lernten, als sie mit ihren Kinder spazieren gingen, existiert heute noch! Die Bekanntschaft hing mit der Arbeit des in Bad Warmbrunn überall bekannten »Ebereschen-Kochs« zusammen.
Leonore Bacher (1899–1951), die Mutter von August Bacher, sammelte Wildobst für den Schwiegervater, der aus den Früchten der Eberesche köstliche Marmeladen, Cremés für Torten, Kuchenfüllungen und auch Desserts zauberte.
Nach und nach lernten sich die beiden Familien kennen. Gern gingen beide Ehepaare zu den Volksfesten in Bad Warmbrunn und hier besonders zum »Tallsackmarkt«, einem alljährlich stattfindenden Volksfest. Später als die Bachers schon in Köln wohnten, verlor man sich ein wenig aus den Augen.
Die Lebensgeschichte des Eduard Bacher (1858–1947)
Eduard Bacher wurde 1858 in Bad Warmbrunn als einziges Kind der Hausköchin Erna Bacher (1834–1900) geboren. Seinen Vater lernte Eduard nie kennen. In der Familie wird überliefert, daß seine Mutter ihm erst kurz vor ihrem Tod verriet, wer sein Vater war: ein kaiserlicher Offizier der österreichisch-ungarischen Monarchie. Nach einem Manöverball hatte er mit ihr eine wundervolle Nacht verbracht. Am anderen Tag zog er mit seinem Regiment weiter. Bald bemerkte die schöne Dorfgasthofköchin, daß diese Liebesnacht nicht ohne Folgen blieb. Sie fuhr nach Bad Warmbrunn zu Verwandten ihrer verstorbenen Mutter und kam hier vorerst unter. Die beiden kinderlosen Schwestern ihrer Mutter nahmen Erna Bacher liebevoll auf, kümmerten sich um den Jungen Eduard und vermittelten ihm, die Gaben der Natur zu schätzen. Viel Zeit verbrachte der gelehrige Junge in der Küche bei den Tanten und beobachtete, wie sie die gesammelten Wildfrüchte zu Tee, Kuchenfüllungen und allerlei Naschwerk verarbeiteten.
Eduard war ein sehr ruhiger, aber fleißiger Schüler und hing sehr an den beiden Tanten, die ihn liebevoll umsorgten. Eduard besuchte die Volksschule in Bad Warmbrunn bis 1874. Von 1874 bis 1878 lernte er Koch im Kaiserhof Breslau.
In seinem Tagebuch, welches er mit 12 Jahren angefangen hatte, beschreibt er den Küchenalltag um 1874, er schildert die schweren Arbeiten in der Spülküche, das Scheuern der Riesentöpfe und der schwarzen Gußpfannen. Der Arbeitsalltag umfaßte täglich 16 bis 18 Stunden. Eduard Bacher erzählt auch von seinen ersten Hilfsarbeiten für die Köche in ihren blütenweisen Schürzen und den hohen gestärkten Mützen und schließlich von den ersten eigenen Kochversuchen, die vom strengen Schweizer Küchenchef Fred Ehrsam, der lange Jahre in Zürich in besten Hotels gearbeitet hatte, wohlwollend bewertet wurden.
Eduard Bacher entdeckte seine Leidenschaft für die Herstellung von Desserts. Er verarbeitete Naturprodukte, die ihm die Bauern aus der Umgebung etwas mitleidig lächelnd als kostenfreie Zugaben zu ihren Kartoffeln und dem frischen Gemüse dazupackten. Erst als Eduard Bacher den Küchenchef Ehrsam von seinen wundervollen Naturdesserts überzeugt hatte, fand die Geschäftsidee Beachtung. Die Bauernkinder mußten nun fortan körbeweise Vogelbeeren sammeln und fehlten den Bauern jetzt bei der täglichen Feldarbeit. Der geschäftstüchtige Küchenchef Ehrsam vermarktete die Ebereschenprodukte inzwischen gewinnbringend.