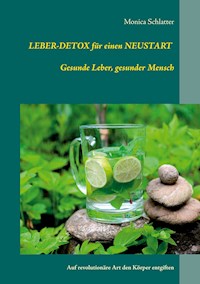Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die 3 Säulen der Migräneprävention: Raus aus dem Schmerz-Hamsterrad Migräne ist eine weit verbreitete und belastende neurologische Erkrankung, die weltweit Millionen von Menschen betrifft und ihre Lebensqualität stark einschränkt. Die Autorin selbst litt rund 30 Jahre unter Migräne. Erst eine radikale Ernährungsumstellung brachte Linderung. Zusätzlich entdeckte sie zwei weitere zentrale Auslöser, beide beginnen ebenfalls mit dem Buchstaben E, an unerwarteten Stellen. Diese drei Faktoren bilden das Fundament ihres Erfolgskonzepts. Heute ist sie seit sieben Jahren migränefrei. Mit diesem praktischen Selbsthilfebuch zeigt sie, wie Betroffene aktiv aus der Migränespirale aussteigen können, denn Migräne ist weder ein genetisches Schicksal noch eine unheilbare Krankheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die hier vorgestellten Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie spiegeln lediglich die Erfahrungen und Meinungen der Verfasserin wider und sind daher nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten oder Befindlichkeitsstörungen geeignet. Die dargestellten Massnahmen sind nicht als Therapieempfehlungen zu verstehen. Wiederkehrende Migräneanfälle sollten stets ärztlich abgeklärt werden, da diesen möglicherweise schwerwiegende Ursachen zugrunde liegen können.
Die Autorin hat die von ihr als zuverlässig erachteten Quellen nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Da jedoch menschliche Fehler möglich sind und sowohl die Migräneforschung als auch die Forschung in den anderen hier aufgeführten Bereichen einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen, übernimmt die Autorin keine Garantie dafür, dass die enthaltenen Informationen in jeglicher Hinsicht fehlerfrei, genau oder vollständig sind und dem aktuellen Wissensstand entsprechen.
Die Autorin übernimmt ausdrücklich keinerlei Verantwortung für nachteilige Auswirkungen, die sich möglicherweise direkt oder indirekt aus der Anwendung oder Umsetzung der im Buch enthaltenen Informationen ergeben.
Monica Schlatter
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Meine Geschichte
Stress hat viele Gesichter
Wie entsteht Migräne?
Alles beginnt mit dem Essen
Wenn Essen weh tut: Die 3 Ernährungsfallen
1. Blutzuckerschwankungen
2. Nährstoffmangel
3. Unverträglichkeiten
Migränebewältigung Teil 1 Ernährung: Essen ist Medizin
Übeltäter
Zucker: Alles andere als Zuckerschlecken
Süssstoffe: Dick- und Krankmacher aus der Light-Palette
Fruktose: Das Problemmolekül
Stärke: Ein nettes Wort für „Zucker“
Sonderfall Gluten
Ist es Histamin oder Gluten?
Schlechte Nahrungsfette: Dicke Post
Hülsenfrüchte: Ein kontroverses Thema
Was ist mit der Milch?
Kaffee: Trigger oder Therapie?
Neue Wege zur Gesundheit: Was Migränebetroffene wirklich brauchen
Lösungsansatz 1: Alle Getränke durch Wasser ersetzen
Lösungsansatz 2: Richtig hydrieren
Lösungsansatz 3: Koffeinkonsum einschränken
Lösungsansatz 4: Das Frühstück neu erfinden
Lösungsansatz 5: Bei Bedarf Zwischenmahlzeiten einnehmen
Lösungsansatz 6: Industriezucker reduzieren & Süssstoffe meiden
Lösungsansatz 7: Die richtige Reihenfolge
Lösungsansatz 8: Jede Hauptmahlzeit beginnt mit Rohkost
Lösungsansatz 9: Jede Hauptmahlzeit enthält Eiweiss
Lösungsansatz 10: Jede Hauptmahlzeit enthält Fett
Lösungsansatz 11: Stärkereiche Lebensmittel in gekochtes Gemüse tauschen
Lösungsansatz 12: Nährstoffergänzungen bei Migräne – wir brauchen sie doch
Lösungsansatz 13: Keine isolierten Kohlenhydrate
Lösungsansatz 14: Maximal 1 Portion Glutenhaltiges pro Tag
Die praktische Anwendung
Der Zwölf-Wochen-Aktionsplan
Phase 1: Der Einstieg
Phase 2: Der Aufbau
Phase 3: Die Konsolidierung
Phase 4: Die Wiedereinführung
Migränebewältigung Teil 2 Elektrosmog: Gesundheitsrisiko und Therapiebremse
Migränebewältigung Teil 3 Emotionen: Die Mind-Body-Verbindung erkennen
Hier endet meine Geschichte – und Ihre beginnt
Gemeinsam bewirken wir mehr
Produktquellen
Literaturverzeichnis: Bücher & Zeitschriften
Literaturverzeichnis: Studien & Fachartikel
MEINE GESCHICHTE
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Diesem Buch liegt die Absicht zugrunde, meine Geschichte zu teilen und die Methoden zu erläutern, die ich angewandt habe, um vor einigen Jahren migränefrei zu werden. Die Informationen, die mir dabei halfen, habe ich durch meine eigenen jahrelangen Recherchen, Erfahrungen und den Austausch mit anderen Migränebetroffenen zusammengetragen.
Auf meinem Weg zur Beschwerdefreiheit musste ich allerdings bereit sein, alles infrage zu stellen, was ich bis dahin über Migräne als allgemeingültig gehalten hatte. Es folgte eine Phase des Lernens und Staunens, in der ich erkannte, dass die Lösung oft nicht dort lag, wo ich sie ursprünglich gesucht oder mir gewünscht hatte. Überraschenderweise waren es meist ganz einfache Dinge, die entscheidende Veränderungen brachten.
Daher ist es kaum verwunderlich, wenn auch Ihnen einige der Strategien, die ich Ihnen vorstellen werde, zunächst simpel, ungewohnt, übertrieben oder sogar absurd erscheinen mögen. Ich möchte Sie dennoch ermutigen, offen zu bleiben und sich für ein paar Wochen darauf einzulassen. Denn wie Albert Einstein einst so treffend sagte: „Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“
Aller guten Dinge sind drei
Auch wenn jeder Mensch eine unterschiedliche „Ausstattung“ besitzt und es deshalb keine allgemein gültige Regel gibt, welche Ernährung und welcher Lebensstil optimalerweise einzuhalten sind, so kann man speziell bei Migräne auf Basis der vorliegenden Untersuchungen gewisse Empfehlungen aussprechen.
Es gibt verschiedene Arten von Kopfschmerzen, und jeder Mensch empfindet sie anders. Daher lässt sich die Symptomatik nicht immer zweifelsfrei einer bestimmten Art zuordnen. Ich verwende in diesem Ratgeber die Ausdrücke „Migräne“ und „Kopfschmerzen“. Mit „Migräne“ meine ich einen halbseitigen, wiederkehrenden Schmerz, der häufig von vegetativen Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen sowie einer Überempfindlichkeit gegenüber Lärm, Licht und Gerüchen begleitet wird. „Kopfschmerzen“ verwende ich als Überbegriff.
Ich stelle Ihnen in diesem Buch die drei Hauptverdächtigen vor, die meiner Meinung nach mit der Entwicklung und Chronifizierung der Kopfschmerzen zu tun haben. Es handelt sich um die Formel: Ernährung, Elektrosmog und Emotionen. Mittlerweile werden diese auslösenden Reize auch durch aktuelle Studien bestätigt. Anschliessend erkläre ich Ihnen Schritt für Schritt, was Sie tun können, um eine Remission zu begünstigen. Jedem dieser Punkte ist im Buch ein eigenes Kapitel gewidmet.
Die Reihenfolge entspricht dem Vorgehen, mit dem ich meine Heilungsgeschichte angegangen bin. Nach heutigem Wissensstand würde ich von Anfang an alle drei Hauptfaktoren berücksichtigen, um den Prozess zu beschleunigen.
Aber machen Sie es so, wie es für Sie passt. Wichtig ist, dass Sie überhaupt Änderungen in Ihrer Lebensführung vornehmen und diese konsequent umsetzen. Denn nur so kann sich eine Verbesserung einstellen. Die Erfolge müssen im Verhältnis zum Aufwand betrachtet werden. Für eine deutliche und nachhaltige Besserung Ihrer Situation sind alle drei Interventionen erforderlich, um die Schwelle zu überschreiten, ab der es dann zur Umkehr der Beschwerden kommen kann. Und je konsequenter Sie die Richtlinien befolgen, desto schneller stellen sich positive Resultate ein.
Die Massnahmen und Empfehlungen dazu habe ich möglichst konkret und alltagstauglich gestaltet, damit die Umsetzung problemlos gelingt. Ich hoffe, dass auch Sie damit Ihre Gesundheit zurückerlangen. Denn alles, was ich gemacht habe, können auch Sie tun. Und es hat funktioniert!
Ein schmerzhafter Weg
Schon in meiner Kindheit hatte ich mit Beeinträchtigungen zu kämpfen. Ich war schlapp, energielos und manchmal in einem Zustand permanenter Erschöpfung, die auch bei noch so viel Nachtschlaf nicht nachlassen wollte. Meine Mutter meinte, ich sei bereits „müde“ auf die Welt gekommen.
Nach dem Essen hatte ich sehr oft einen Blähbauch. Als ich in die Pubertät kam, bekam ich Akne und die grässlichen Kopfschmerzen begannen. Letztere sollten mich rund 30 Jahre lang begleiten.
Gelegentlich bauten sie sich schleichend auf, manchmal entstanden sie jedoch anfallsartig. Oft kamen sie erst, wenn ich nach einem stressigen Tag entspannte – häufig am Wochenende. Nicht selten wachte ich bereits am Morgen mit Migräne auf. Manchmal musste ich mitten in der Nacht aufstehen und nach der Einnahme einer Schmerztablette ein bis zwei Stunden sitzend auf einem Stuhl oder Sofa verbringen, bis die Schmerzen vorbei waren, sodass ich mich wieder hinlegen konnte.
Die stechenden und pulsierenden Schmerzen waren immer linksseitig und stets begleitet von weiteren Symptomen wie Licht-, Geruchs- und Geräuschempfindlichkeit, starken Verspannungen im Kiefer-, Schulter- und Nackenbereich sowie plötzlich auftretendem Frieren oder Schwitzen. Tagsüber musste ich mich vielfach übergeben. In der Erholungsphase fühlte ich mich ein bis zwei Tage kraftlos und reduziert.
Es wurde schlimmer
Die Migräneanfälle häuften sich und erreichten eine hohe Regelmässigkeit – sie wurden chronisch. Es verging praktisch keine Woche mehr ohne Schmerzen. Da ich Triptane ablehnte, wich ich auf nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) aus, was jedoch nicht immer half. Auch musste ich eine Tablette bei jedem potenziellen Schub frühzeitig einnehmen, sonst riskierte ich, dass sie nicht mehr wirkte. Schmerzmittel hatte ich immer und überall dabei.
Ich hatte zwei klare Auslösereize identifiziert: Rotwein und olfaktorische Reize wie Parfüm, Duftkerzen oder Duftbäume im Auto, Räucherstäbchen und Zigarettenrauch – und vermied diese so gut es ging. Trotzdem konnte ich die Häufigkeit meiner Migräneepisoden nicht reduzieren. Nur während Schwangerschaft und Stillzeit gingen die Beschwerden deutlich zurück.
Gesundheit ist nicht alles – aber ohne Gesundheit ist alles nichts
Mit den Jahren kamen Gelenkschmerzen (Knieschmerzen und Tennisarm), Gehirnnebel („brain fog“), Haarausfall, verfärbte Zähne und hin und wieder attackenförmig auftretender Schwindel - der sich übrigens ebenfalls einer Migräne zuordnen lässt - dazu. Auch häufige Erkältungen suchten mich mittlerweile heim.
Ich konsultierte verschiedene Spezialisten für meine vielen „Zipperlein“. Alle versuchten ihr Bestes – doch nichts wirkte nachhaltig. Schliesslich musste ich sogar mein Krafttraining aufgeben, weil ich jedes Mal danach Migräne bekam.
Auch mein Sozialleben richtete ich nach meinen Migräneanfällen aus: Ich sagte jede Veranstaltung ab, die nicht unbedingt nötig war – und verlor dadurch viel Lebensqualität.
Der grosse Aha-Moment
Im Jahr 2015 fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Wir alle wissen, dass ungesunde Ernährung zu Übergewicht oder Diabetes führen kann. Doch dass sie auch das Gehirn beeinflussen und neurologische Beschwerden wie Migräne begünstigen kann – daran hatte ich nie gedacht. Warum auch? Ich war mein Leben lang schlank und hatte mir deshalb keine Gedanken darüber gemacht, was ich ass. Ausserdem hatte mir bis dahin niemand gesagt, dass bestimmte Nahrungsmittel oder Essgewohnheiten Migräneattacken auslösen oder verstärken können.
Doch der Reihe nach: Mein Mann bekam irgendwann nach seinem 45. Geburtstag Gewichtsprobleme und fühlte sich zunehmend unwohl. Ich selbst hatte mich nie mit Ernährung beschäftigt – einfach, weil ich nicht abnehmen musste. Deshalb war ich ziemlich ratlos, als wir gemeinsam einen Plan aufstellen wollten, um Gewicht zu verlieren.
Einen Spruch hörte ich jedoch immer wieder, wenn es ums Abnehmen ging: „Weniger essen und mehr bewegen.“ Mein Mann wollte nicht hungern, und für mehr körperliche Aktivität fehlte ihm die Zeit. Ich nahm darauf keine Rücksicht und kochte ihm kleinere Portionen – was dazu führte, dass er sich ständig am Kühlschrank und an den Süssigkeiten der Kinder bediente. Nach ein paar Wochen hatte sich beim Gewicht nichts verändert, also warfen wir frustriert das Handtuch.
Meine fatale Einschätzung
Ich wandte mich an meine Kollegin, die Personal Training und Ernährungscoaching professionell betreibt. Als Erstes mussten wir zwei Wochen lang ein Ernährungsprotokoll ausfüllen.
Ich war ganz stolz darauf, zu jeder Mahlzeit ein anderes Gericht zu kochen – und das über Wochen! Daher war ich mir sicher, dass wir uns ausgewogen ernährten und es nur noch kleinerer Anpassungen bedurfte.
Morgens starteten wir mit einem Marmeladen- oder Käsebrötchen, mit Croissants oder mit Müsli in den Tag. Zum Trinken gab es Milch oder Orangensaft vom Supermarkt. Unter der Woche assen die Kinder und ich mittags am liebsten ein Gnocchi- oder Nudelgericht. Mein Mann besorgte sich ein belegtes Brötchen, ein kleines Dessert und trank eine Apfelschorle.
Abends und am Wochenende kochte ich fast immer ein neues Risotto- oder Nudelgericht. Manchmal gab es Pizza, Flammkuchen oder Fleisch bzw. Fisch mit einer Beilage aus Kartoffeln, Polenta oder Reis. Hin und wieder kam ein Salat oder etwas gedämpftes Gemüse dazu. Zwischendurch naschten wir Kekse, Schokolade oder Gebäck. Getrunken wurde nur stilles Wasser.
Ich erinnere mich noch genau an den Abend, als meine Kollegin vorbeikam und das Ergebnis ihrer Analyse vorstellte. Viele Gerichte waren im Protokoll rot markiert. „Was bedeutet das?“, fragte ich sie. „Ganz einfach“, antwortete sie. „Die roten Markierungen sind Kohlenhydrate1, und sie machen etwa 80 % eurer Gesamternährung aus. Wenn man bedenkt, dass Stärke und Zucker im Körper zu Glukose (auch Traubenzucker genannt) abgebaut werden, habt ihr erstens eine ganze Menge Zucker auf dem Teller und zweitens ist das eine ziemlich einseitige Ernährung. Damit könnt ihr euren Nährstoffbedarf kaum decken. Wir müssen dringend mehr gesundes Eiweiss, hochwertige Fette und Ballaststoffe, wie sie in Salat, Gemüse und Obst vorkommen, einbauen.“
Somit war eine komplette Umstellung unserer Essgewohnheiten nötig – ein ziemlicher Schock für mich.
Zurück zu den Wurzeln
Meine Kollegin empfahl uns, auf die Paleo-Ernährung - auch Steinzeiternährung - umzusteigen. Sie ernährte sich selbst so und hatte auch bei ihren Kunden nur beste Erfahrungen damit gemacht.
Erlaubt ist - wie der Name bereits andeutet - all das, was unsere Vorfahren früher pflücken, sammeln, jagen oder fischen konnten. Diese Kost ist der mediterranen Ernährung ähnlich, da viel Salat und Gemüse, Pilze, Obst, gutes Fett wie Olivenöl, Avocado, Nüsse und Samen, aber auch regelmässig Eiweiss wie Eier, Fisch und Fleisch auf den Tisch kommen. In der Summe entspricht die Speisekarte unserer Vorfahren einem ausgewogenen Menü.
Verzichtet wird auf Gluten, Zucker sowie auf das Trinken tierischer Milch – also genau die drei Dinge, von denen wir uns bisher hauptsächlich ernährten.
Wir bekamen einen genauen Ernährungsfahrplan, den mein Mann - mit meiner Unterstützung - penibel umsetzte. Die ersten zwei Monate ernährte er sich ausschliesslich nach der Paleo-Ernährung – mit einer Ausnahme pro Woche. Meistens gönnte er sich am Samstagabend eine Pizza oder einen Teller Nudeln und ein Dessert. Nach dieser Zeit erlaubte er sich vier Mahlzeiten nach Wahl.
Sehr bald bemerkte er einen riesengrossen Unterschied: Sobald er zucker- und stärkehaltige Lebensmittel ass, fühlte er sich danach gebläht, schlapp und schlief schlecht. Dies führte dazu, dass er immer weniger Lust darauf verspürte.
Der Umstieg wurde ein voller Erfolg. Er konnte ohne Hungern und ohne Sport jede Woche mühelos ein Kilo verlieren, bis er nach zehn Wochen sein Wunschgewicht erreichte. Aber viel entscheidender waren die gewonnene Energie und die vermehrte Lust auf Bewegung, sodass er am Wochenende wieder mühelos seine geliebten Wanderungen machen konnte.
Am Wendepunkt: Endlich wieder gut fühlen
Anfangs nahm ich nur am Rande teil, und das auch lediglich aus Solidarität. Abnehmen musste und wollte ich nicht. Doch nach etwa zwei Monaten fiel mir auf, dass ich deutlich seltener unter Migräne und Blähbauch litt. Zum ersten Mal fragte ich mich, ob meine Ernährung womöglich etwas damit zu tun haben könnte.
Obwohl ich den Zusammenhang noch nicht verstand, faszinierte mich die Idee, und ich beschloss, ein Experiment zu wagen: Für die nächsten acht Wochen hielt ich mich ebenfalls strikt an die Ernährungsvorgaben. Schliesslich hatte ich nichts zu verlieren, ausser vielleicht ein bisschen Gewicht.
Das Ergebnis war erstaunlich! Meine Migräneepisoden wurden immer seltener, und zwar verblüffend schnell – parallel dazu verschwanden Blähbauch, Gehirnnebel, Knieschmerzen und mein Tennisarm. Ausserdem bemerkte ich eine allgemeine Verbesserung meines Wohlbefindens: mehr Energie, eine bessere Darmtätigkeit und geistige Klarheit. Ich schlief auch besser und wachte morgens vital und energiegeladen auf. Das war ein grossartiges Gefühl und es motivierte mich, weiterzumachen. Dabei stellte ich fest, dass es weitere erfreuliche Auswirkungen gab: Ich wurde nur noch selten krank und machte optisch eine positive Veränderung durch – meine Haut wurde klarer, mein Haar voller und meine Zähne wieder weiss.
Das Beste daran war jedoch, dass ich im Umgang mit Essen deutlich entspannter wurde. Mir wurde plötzlich klar, dass ich all die Jahre - ohne es zu merken - ständig gestresst war, getrieben von Heisshunger, manchmal sogar begleitet von Händezittern. Wer Heisshunger kennt, weiss, wie machtlos man sich fühlt: Die Gedanken kreisen nur noch ums Essen – besonders um Kohlenhydrate. Deshalb hatte ich immer und überall Snacks dabei. Am schlimmsten war es im Urlaub. Bevor ich die freien Tage geniessen konnte, musste ich mich mit Zwischenmahlzeiten eindecken und die Öffnungszeiten von Restaurants abklären.
Plötzlich war ich gelassen. Essen rückte in den Hintergrund. Ich konnte problemlos längere Phasen ohne Nahrung auskommen – sogar eine Hauptmahlzeit auslassen, ohne gleich in eine Krise zu geraten. Selbst an der Bäckerei vorbeizugehen, ohne den Drang nach etwas Süssem, war möglich. Es war so befreiend.
Essen ist Information
Dieses Experiment führte mir eindrucksvoll vor Augen, wie gross der Unterschied ist zwischen einem Teller Nudeln mit anschliessender Torte oder einer Mahlzeit aus Lachsfilet mit Gemüse und etwas Obst. Obwohl beide Gerichte die gleiche Kalorienzahl haben können, wirken sie sich völlig unterschiedlich auf den Stoffwechsel aus – denn es kommt nicht nur auf die Kalorienmenge an, sondern auf deren Herkunft. Die Quelle der Kalorien beeinflusst unsere Hormone und damit auch, wie unser Körper darauf reagiert.
Diese chemischen Botenstoffe wirken als Nachrichtenüberträger, die im Körper die Steuerung und Regulation verschiedener Organfunktionen übernehmen. Kurz gesagt: Hormone sagen dem Körper, was zu tun ist. Man kann sich den Organismus wie einen Computer vorstellen – je nachdem, wie wir ihn „füttern“, liefert er unterschiedliche Ergebnisse. Ein Konzept aus der Informatik bringt es auf den Punkt: „garbage in, garbage out“ (wörtlich: „Müll rein, Müll raus“). Entscheidend ist also nicht die Kalorienzahl, sondern die Wirkung auf unseren Stoffwechsel.
Diese Erkenntnis stellte die Weichen, die den Gang meines Lebens komplett veränderten. Ich recherchierte jeden Tag, verschlang unzählige Ernährungsratgeber und wandelte konventionelle Rezepte in Paleo-Gerichte um – daraus entstanden später zwei Paleo-Kochbücher.
Anschliessend absolvierte ich die Ausbildung zur Fachberaterin für holistische (ganzheitliche) Gesundheit. Währenddessen entdeckte ich Literatur über weitere Themen, die unsere Gesundheit beeinflussen können. Es waren für mich neue und spannende Erkenntnisse, die ich gerne ausprobierte.
Raus aus der Migräne-Falle und zurück ins Leben
Ich experimentierte mit verschiedenen Methoden, Ideen und Ansätzen, denn es ist bekannt, dass Migräne mit einem Bündel an Einflussfaktoren zusammenhängt. Es reicht daher nicht, nur an einem Punkt anzusetzen. Um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, braucht es einen ganzheitlichen Ansatz.
Für mich waren es letztendlich drei Modifikationen, die den entscheidenden Unterschied machten und mir das qualvolle Leiden endlich ersparten. Seither bin ich seit vielen Jahren migränefrei und kann auch wieder alles essen.
Dennoch spüre ich einen deutlichen Unterschied, wenn ich Dinge zu mir nehme, die mir nicht guttun. Übertreibe ich es über längere Zeit und kommen weitere belastende Situationen hinzu, kann es vorkommen, dass ich wieder Kopfschmerzen bekomme. Der Kopf ist eben meine Schwachstelle.
Es handelt sich jedoch nicht mehr um eine Migräne von früher, die mich komplett aus dem Verkehr zog, sondern um erträgliche Kopfschmerzen, die ich mit einer entzündungshemmenden Tablette wie Algifor forte 400 mg rasch lindern kann.
Weil ich heute die Mechanismen eines Migräneanfalls besser verstehe, gelingt es mir oft, erste Anzeichen so zu beeinflussen, dass die Kopfschmerzen gar nicht erst entstehen.
1 Kohlenhydrate sind ein Oberbegriff und umfassen drei Arten von Stoffen: Zucker, Stärke und Ballaststoffe. Im Allgemeinen meint man mit „Kohlenhydrate“ aber oft nur Zucker und Stärke (z. B. Getreide, Hafer, Kartoffeln, Mais, Reis). Ballaststoffe werden häufig aussen vor gelassen, da sie nicht in Zucker umgewandelt werden. Ich werde mich an dieser verbreiteten Sprechweise orientieren und mit „Kohlenhydrate“ nur Stärke und Zucker meinen. Wenn ich von Ballaststoffen spreche, werde ich das explizit so nennen.
STRESS HAT VIELE GESICHTER
Schon lange ist bekannt, dass Kopfschmerzen und Stress unweigerlich zusammengehören. Viele PatientInnen erleiden während einer Belastungsphase eine Attacke, andere bekommen sie in der Erholungsphase. Es ist erwiesen, dass stressreduzierende Therapien einen Schutzeffekt gegen Kopfschmerzen haben. Doch was ist Stress eigentlich?
In der Regel verstehen wir darunter die nervöse Unruhe angesichts übermässiger Anforderungen in den Bereichen Arbeit, Familie, Beziehungen, Finanzen oder Gesundheit. Das ist zwar korrekt, aber Stress ist weit mehr. Nicht nur das wahrgenommene subjektive Empfinden definiert Stress, sondern auch eine Reihe messbarer physiologischer Vorgänge im Körper, an denen das Gehirn sowie das Nerven-, Hormon- und Immunsystem beteiligt sind.
Das Reiz-Reaktions-Modell
Der bedeutende, in Ungarn geborene Endokrinologe Hans Selye (1907-1982) war der erste, der den Zustand der Sub-Gesundheit beschrieb, das heisst weder krank noch richtig gesund und fehlende Vitalität.
Für ihn war Stress eine Folge von schädigenden physikalischen, psychischen und sozialen Einflüssen („Stressoren“ genannt), die bei Betroffenen innere Veränderungen zur Folge haben. Diese können sichtbar beziehungsweise spürbar sein oder auch nicht, wenn der Organismus eine Bedrohung seiner Existenz oder seines Wohlergehens wahrnimmt.
Die Stressoren selbst können vielfältig sein und führen dazu, dass der Körper aus seiner Homöostase gerät. Diese bezeichnet das Gleichgewicht der physiologischen Körperfunktionen und dessen Erhaltung. Sind beispielsweise Körpertemperatur, Blutzucker oder pH-Wert im Blut ausgeglichen, spricht man von homöostatischen Systemen. Das Wort stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Gleichstand“. Der Körper arbeitet kontinuierlich daran, diesen Zustand aufrechtzuerhalten.
Beispiele für Stressoren sind:
Mangel an Nahrung, Nährstoffen, sauberem Wasser und sauberer Luft
Mangel an Schlaf, Bewegung, Sonnenlicht und natürlichem Licht
Mangel an sinnvoller Arbeit, Ruhe, Erholung und sozialer Bindung
Überforderung, Unterforderung, geringes Selbstvertrauen, Gefahrensituationen
Toxine (z. B. Genussmittel, Arzneimittel, Zusatzstoffe, Pestizide, Schwermetalle)
Krankheitserreger, schädliche Strahlung
Verletzungen, Prellungen, Verbrennungen, Fremdkörper (z. B. Dornen, Splitter)
Extreme Temperaturen (Hitze, Kälte)
Lärm und Platzmangel („Dichtestress“)
Tiere und Pflanzen können ebenfalls Stressreaktionen zeigen, obwohl Letztere keine Nervenzellen haben. Selbst bei bewusstlosen PatientInnen unter Vollnarkose oder in ausserhalb des Körpers gezüchteten Zellkulturen lässt sich Stress auslösen – er kann also auch unbewusst entstehen.
Im Gegensatz zu Tieren ist der Mensch in der Lage, eine Stressreaktion allein durch Gedankenkraft hervorzurufen – diese kann also vollständig auf Einbildung beruhen. Auch Menschen, die überzeugt sind, „positiv“ gestresst zu sein, erzeugen eine physiologische Stressantwort.
In verschiedenen Anforderungssituationen wird eine Reihe hormonell gesteuerter Prozesse in Gang gesetzt, um den Gesamtorganismus an die störenden Einflüsse anzupassen. Der Begriff „Stress“ kommt aus dem Englischen und lässt sich mit „Druck“ oder „Anspannung“ übersetzen.
Die Kampf-oder-Flucht-Reaktion
Eine wichtige Anpassungsleistung ist die „Kampf-oder-Flucht-Reaktion“. Der geläufige Begriff des amerikanischen Physiologen und Psychologen Walter Cannon (1871-1945), der neben Hans Selye zu den Pionieren der Stressforschung gehört, beschreibt einen hohen Erregungszustand, der als Schutz und Überlebensstrategie für Menschen und Tiere dient.
Die im Englischen als „fight-or-flight response“ bekannte Reaktion beschreibt die rasche physiologische und psychologische Verhaltensänderung von Lebewesen in stressigen, unsicheren und gefährlichen Situationen. Sie ist eine evolutionäre Errungenschaft, die unseren Vorfahren half, Gefahrensituationen zu bewältigen – etwa vor Raubtieren wegzurennen oder sie zu konfrontieren.
Während der „Kampf-oder-Flucht-Reaktion“ veranlasst das Gehirn durch Impulse entlang der Nervenbahnen die rasche Ausschüttung von Stresshormonen, um der Situation Herr zu werden. Bei akutem Stress spielt vor allem Adrenalin eine entscheidende Rolle. Hält die Stressphase länger an, wird „Verstärkung“ in Form von Cortisol geliefert.
Wenn diese Stresshormone in höheren Konzentrationen durch den Körper zirkulieren, wird die Freisetzung von Zuckerreserven angestossen. Durch die erhöhte Durchblutung wird diese Energie gezielt in die für die Notsituation wichtigen Organe wie bestimmte Hirnareale, Muskeln und das Herz geleitet, damit sie leistungsfähiger und kraftvoller arbeiten können.
Auch die Lungenfunktion wird gesteigert, damit mehr Sauerstoff in den Körper gelangt. Die Muskulatur von Rücken, Schultern und Nacken spannt sich an, um die motorischen Reflexe schneller aktivieren zu können. Der physische und emotionale Stress verkürzt die Reaktionszeit, das Gehirn ist hellwach, und auch die Seh- und Hörfunktionen werden geschärft. So steigt die Wahrscheinlichkeit, der Gefahr zu entkommen und zu überleben.
Die Stresshormone drosseln ausserdem energieverbrauchende Organtätigkeiten wie jene des Magens und Darms, des Immunsystems sowie der Haut und der Extremitäten, um kurzfristig möglichst viel Energie für schnelles Reagieren zur Verfügung zu haben. Denn wer benötigt in einer Situation, in der es um Leben oder Tod geht, schon warme Hände, ein schlagkräftiges Immunsystem und einen optimal funktionierenden Verdauungstrakt?
Im Gegenteil: Je schneller wir uns „erleichtern“, desto geschwinder können wir davonlaufen. Nicht umsonst ist es in Angstsituationen Teil unserer Alltagssprache geworden, zu sagen: „Ich habe Schiss“ oder „Ich habe die Hosen voll“.
Stress ist super – aber nur bei Gefahr
All diese uralten Körperreaktionen haben einen einzigen Zweck: unsere Haut zu retten. Ist die Gefahr vorüber, beruhigt sich das Stresssystem wieder. Es kommt zurück in seine Ruhelage, auch „rest and digest“ genannt, auf Deutsch: „Ruhen und Verdauen“. In dieser Phase widmet sich der Körper seinen normalen Organfunktionen wie Verdauung sowie dem Aufbau und der Reparatur.
Produzieren wir ständig Stresshormone, wird dieser Ruhezustand nicht mehr erreicht und bestimmte Organe werden in Mitleidenschaft gezogen. Ihre Durchblutung - und damit die Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff sowie der Abtransport von Abfallstoffen - funktioniert nicht mehr reibungslos. Infolgedessen nimmt ihre Funktionsfähigkeit ab, und es kommt zu Entzündungsprozessen.
Eine Entzündung ist zunächst nichts Schlechtes, sondern ein wichtiger Teil unserer menschlichen Physiologie und für das Überleben sogar hilfreich. Das Immunsystem erkennt Ungereimtheiten wie Fehlfunktionen, Verletzungen oder Keime und „entzündet“ einen Heilungsprozess, indem es einen schädlichen Reiz eingrenzt, abwehrt und anschliessend den Schaden wieder repariert. Ist die Bedrohung beseitigt und die Reparatur erfolgreich abgeschlossen, gehen die Entzündungsreaktionen zurück, und der Körper arbeitet wieder normal.
Ist das Missverhältnis zwischen den persönlichen Anforderungen und den Bewältigungsmöglichkeiten nur vorübergehend, entstehen in der Regel keine Schäden. Unser Körper ist ein genialer, selbstregulierender Organismus, der einzelne oder gelegentliche Herausforderungen oder Ausnahmesituationen gut verkraftet.
Wenn das Gleichgewicht kippt
Hält der Konflikt zwischen Abwehrsystem und schädlichem Reiz über längere Zeit an oder tritt er wiederholt auf, fehlen dem Körper wichtige Erholungsphasen – entzündliche Prozesse stellen sich dauerhaft ein. Sie können sich über das Blut im ganzen Körper ausbreiten. Das Immunsystem muss dann an mehreren Stellen gleichzeitig gegen Angreifer und Entzündungsstoffe kämpfen.
Im Dauerstress-Modus wird vermehrt Cortisol ausgeschüttet – ein lebenswichtiges Hormon, das stressbedingte Reaktionen im Gehirn dämpft und, ähnlich wie das Medikament Cortison, das Immunsystem unterdrückt. Langfristig kann ein gedrosseltes Abwehrsystem jedoch die Immunfunktion schwächen und die Anfälligkeit für Infektionen erhöhen.
Kaskadierende Entzündungsreaktionen
Ständige Entzündungsherde im Körper führen langfristig zu oxidativem Stress, einer Stoffwechsellage, bei der reaktive Sauerstoffverbindungen (freie Radikale) produziert und akkumuliert werden. Sie sind Teil der normalen Physiologie und wichtig für Signalketten, die das gesunde Zellverhalten steuern. Übersteigt jedoch die Konzentration oxidierender Stoffe die Menge reduzierender Substanzen, werden Moleküle innerhalb und ausserhalb der Zelle geschädigt, was zu bleibenden Schäden an Zellstrukturen und deren Funktionen führt.
Die Schädigung biologischer Strukturen induziert weitere Entzündungen, die wiederum oxidativen Stress verursachen. Da diese beiden pathogenen Prozesse untrennbar miteinander verknüpft sind, entsteht eine Kettenreaktion, die sich perpetuiert. Die Entzündungsprozesse können trotz oder gerade wegen des dauerhaft hohen Cortisolspiegels nicht mehr ausreichend gestoppt werden und somit ausser Kontrolle geraten (Stichwort: Autoimmunerkrankungen).
Irregeleitete Reaktionen im Körper sind Ursache vieler Zivilisationskrankheiten, die uns heute heimsuchen. Laut der WHO stellen chronisch entzündliche Erkrankungen derzeit die grösste Bedrohung für die menschliche Gesundheit dar.
Es brodelt im Inneren
Unglücklicherweise breiten sich Entzündungen, die nicht mit den klassischen Symptomen wie Hitze, Rötung oder Schwellung einhergehen, schleichend und unbemerkt aus – wie ein unterirdischer Schwelbrand. Dieser ist vergleichbar mit einem Vulkan, der noch nicht ausgebrochen ist. Im Inneren brodelt und kocht es, was aber für das blosse Auge nicht erkennbar ist. Man nennt sie deshalb „stille Entzündungen“. Diese verborgenen, unterschwelligen Herde werden oft über Jahre hinweg nicht bemerkt, weil sie lange Zeit keine offensichtlichen Symptome auslösen und auch die Lebensqualität nicht stark einschränken.
Dieser Zustand benötigt jedoch viel Energie, weil das Immunsystem ständig aktiviert ist. Diese fehlt dann an anderen Stellen. Mit der Zeit fühlen sich Betroffene müde und erschöpft, bekommen Verdauungsprobleme und haben eine höhere Infektanfälligkeit. Wird dies nicht erkannt und entsprechend gehandelt, führt ein fehlgeleiteter Stoffwechsel früher oder später zu sicht- und messbaren Erkrankungen. Diese können sowohl die Psyche als auch den Körper betreffen – letztlich beides, da diese zwei „Einheiten“ perfekt aufeinander abgestimmt sind und sich gegenseitig beeinflussen.
Migräne reagiert auf Veränderungen in der Hormonlage
Während Wissenschaftler noch nach den genauen Ursachen forschen, gibt es starke Hinweise darauf, dass Hormone einen grossen Einfluss auf das Migränegeschehen haben. Hormone sind Substanzen, die durch den Blutkreislauf zu verschiedenen Geweben und Organen gelangen und den Zellen mitteilen, was sie wann und mit welcher Geschwindigkeit tun sollen. Sie steuern praktisch alle Prozesse, unter anderem Appetit, Schlaf, Stresspegel und Fortpflanzungszyklen.
Alles, was man tut, beeinflusst die Hormone, und alles, was die Hormone tun, wirkt sich auf den gesamten Organismus aus. Sind die verschiedenen Hormontypen harmonisch aufeinander abgestimmt, funktioniert der Körper wie ein eingespieltes Symphonieorchester. Gerät dieses Gleichgewicht jedoch aus der Balance, kommt auch der gesamte Organismus aus dem Takt.
Hormonelle Veränderungen sind dafür bekannt, Migräneanfälle auszulösen oder zu verstärken. Dies zeigt sich besonders in den folgenden Situationen:
Pubertät
: Ab der Pubertät steigt die Migräne-Prävalenz bei Mädchen verglichen mit Jungen um das Zwei- bis Dreifache, während sie vorher etwa gleich hoch ist. Mit der Pubertät kommt für Frauen ein weiterer Hormonzyklus hinzu, den Männer in dieser Form nicht erleben.
Menstruationszyklus
: Viele Frauen berichten von erhöhter Migräneneigung vor der Menstruation. Studien legen nahe, dass schwankende weibliche Sexualhormone, insbesondere Veränderungen des Östrogenspiegels, relevante Auslösefaktoren sein könnten.
Schwangerschaft
: Für die meisten Frauen ist die Schwangerschaft eine schmerzfreie Zeit. Untersuchungen zeigen, dass bei fast 70 Prozent der betroffenen Patientinnen eine deutliche Verbesserung oder sogar völlige Migränefreiheit, insbesondere in den letzten zwei Dritteln der Schwangerschaft, zu beobachten ist. Vermutlich sorgt das Ausbleiben der Menstruation und die stabileren Hormonverhältnisse dafür. Dieser Zustand kann manchmal auch in der Stillphase anhalten.
Wechseljahre
: Mit Beginn der Wechseljahre stellt sich der Hormonhaushalt im Körper um. Diese hormonellen Schwankungen können dazu führen, dass Frauen dann vermehrt unter Migräneanfällen leiden.
Nach der Menopause
: Bei vielen Migränepatientinnen kommt es nach der Menopause zu einem Rückgang der Kopfschmerzen. Das Ausbleiben der Menstruation und die Stabilisierung der Hormone führen dazu, dass die Prävalenz wieder ähnlich hoch ist wie bei Männern.
Stress und Entspannung
: Bei vielen Migränebetroffenen treten die Kopfschmerzen nicht während einer Belastungsphase auf, sondern erst in der Entspannung. Forschungen haben gezeigt, dass in Phasen von nachlassendem Stress das Risiko für Migräneattacken erhöht ist. Ein möglicher Erklärungsansatz ist ein sinkender Cortisolspiegel. Studien belegen, dass Migräniker-Innen oft eine ungewöhnlich hohe Konzentration des Stresshormons Cortisol aufweisen. Dieses Hormon besitzt eine stress- und schmerzlindernde Wirkung und sorgt dafür, dass im Blut mehr Glukose - also Traubenzucker - als Energielieferant für die Zellen bereitgestellt wird. Wenn der Stress nachlässt und der Cortisolspiegel sinkt, fällt auch der Blutzuckerspiegel, was möglicherweise Kopfschmerzen auslöst.
WIE ENTSTEHT MIGRÄNE?
Die Prozesse, die bei einer Migräneattacke im Gehirn ablaufen, sind komplex und noch nicht vollständig erforscht. Langjährige Forschung hat jedoch viele Erkenntnisse über die zugrunde liegenden Mechanismen geliefert.
Das Gehirn von MigränikerInnen „tickt“ anders
Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren zeigen, dass Migränebetroffene eine erhöhte Aktivität in den auditorischen, visuellen und sensorisch-motorischen sowie den emotionalen Schaltkreisen des Gehirns haben. Ihr Gehirn nimmt Reize schneller wahr, und die Schwelle, ab der diese als unangenehm empfunden werden, liegt niedriger als bei Menschen ohne Migräneneigung. MigränepatientInnen gewöhnen sich auch nicht an wiederkehrende Reize, was eine Abschirmung gegenüber Stressoren erschwert.
Diese gesteigerte Reizempfindlichkeit wird als Hypervigilanz bezeichnet. Sie lässt sich mit einer Suchmaschine vergleichen, die permanent zu viele Ergebnisse liefert und dadurch überfordert ist. Strömen zahlreiche Sinneseindrücke gleichzeitig ins Gehirn, werden viele Nervenzellen auf einmal aktiviert, was den Energiebedarf stark erhöht. Kann dieser nicht gedeckt werden, führt das zu einer nervlichen Erschöpfung bis hin zum vollständigen „Shutdown“.
Dabei werden Botenstoffe freigesetzt, insbesondere das Eiweiss Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP). Es zählt zu den stärksten gefässerweiternden Substanzen und wurde während Migräneschüben in erhöhter Konzentration im Blut von PatientInnen nachgewiesen. Erhöhte CGRP-Spiegel gelten als Schlüsselfaktor bei der Migräneentstehung – was sich bestätigte, als man durch CGRP-Injektionen Migräneattacken auslösen konnte.
Migräne als neurogene Entzündung
Die Erweiterung der Hirngefässe durch den Botenstoff CGRP erhöht deren Durchlässigkeit. Dadurch werden Substanzen freigesetzt, die eine leichte Entzündung und Schwellung der schmerzempfindlichen Hirnhäute verursachen (neurogene Entzündung). Schmerzaktive Moleküle steigern die Empfindlichkeit derart, dass selbst das Pulsieren des Blutes als Schmerz wahrgenommen wird – ähnlich wie bei einem Sonnenbrand, bei dem schon leichte Berührungen schmerzhaft sind. Betroffene empfinden dies als pulsierenden Kopfschmerz, der sich bei Anstrengung verstärkt.
Da äussere Erschütterungen die Gefässinnenhaut zusätzlich reizen, meiden MigränepatientInnen häufig jede Bewegung. Wird auch das Sehzentrum einbezogen, kann es zu optischen Trugbildern und Verzerrungen kommen, wie sie typischerweise während einer Migräne-Aura auftreten.
Dieses Wissen über die entzündlichen Prozesse hat zur Entwicklung von Medikamenten geführt, die entweder den CGRP-Rezeptor blockieren oder den Botenstoff CGRP selbst abfangen.
Migräne ist ein Selbstschutzreflex
Laut einer verbreiteten Hypothese ist der Migräneanfall eine besondere Form der Gefahrenreaktion. Er zwingt die Betroffenen, sich aus dem Einflussbereich einer schädlichen Übererregung zurückzuziehen, damit das Gehirn sich erholen und seinen Energiehaushalt wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Eine Attacke stellt somit einen Hilferuf eines Gehirns dar, das unter Energiemangel leidet.
Die Erholungsaspekte der Migräne zeigen deutliche Parallelen zum Schlaf und wurden vom polnischen Neurophysiologen Jerzy Konorski (1903-1973) als klare Überlebensreflexe beschrieben.
Die genetische Komponente
Mehr als 70 Prozent der Betroffenen haben Familienangehörige ersten Grades (Eltern, Geschwister), die ebenfalls unter Migräne leiden. Studien zeigen, dass Kinder von MigränepatientInnen im Vergleich zu Gleichaltrigen ein bis zu vierfach erhöhtes Risiko haben, selbst an Migräne zu erkranken. Dies deutet auf Vererbungsfaktoren hin.
Tatsächlich konnten Wissenschaftler genetische Risikofaktoren identifizieren, die sowohl mit Migräne mit Aura als auch mit Migräne ohne Aura in Verbindung stehen.
Gene sind kein Schicksal
Anders als lange Zeit angenommen, bestimmen nicht nur Gene unsere Eigenschaften. Wir werden auch stark von unserer Umgebung beeinflusst – von der Nahrung, die wir aufnehmen, der Luft, die wir atmen, der körperlichen Aktivität, die wir ausüben, den Erfahrungen, die wir machen, und den Gefühlen, die wir empfinden. Diese Einflüsse hinterlassen biologische Signaturen, die das Ablesen der Erbinformationen und somit die Produktion von Proteinen beeinflussen. Dieser Prozess wird unter dem Begriff „Epigenetik“ (wörtlich: „Übergenetik“) zusammengefasst.
Epigenetische Programme steuern den Funktionsmodus einer Zelle, ohne die DNA selbst zu verändern. Man kann es mit einem Computer vergleichen: Die DNA ist die Hardware, die Epigenetik die Software, die ihre Nutzung steuert.
Ein eindrucksvolles Beispiel für die Auswirkungen von Umweltfaktoren auf die Epigenetik liefert eine bekannte Studie des Karolinska-Instituts in Stockholm. 23 untrainierte ProbandInnen trainierten drei Monate lang einbeinig auf speziellen Ergometern mit nur einer Kurbel. Sie radelten viermal pro Woche jeweils 45 Minuten. Die entnommenen Muskelproben zeigten, dass sich am trainierten Bein die Aktivität von 4.076 Genen veränderte – also fast ein Fünftel aller Gene. Das Training beeinflusste also nicht nur Gene, die direkt am Muskelaufbau beteiligt waren, sondern auch viele andere.
Damit wird deutlich, wie körperliche Aktivität die Genexpression steuern und epigenetische Veränderungen im Körper auslösen kann.
Eine weitere Studie desselben Instituts legt nahe, dass kurzfristige Reize wie Sport oder Stress die Zellen nicht dauerhaft umprogrammieren. Bleiben Sie jedoch regelmässig bestehen, können sich epigenetische Muster verfestigen – und sogar an die nächste Generation weitergegeben werden.
Die Risikogene laden das Gewehr, doch unser Lebensstil drückt den Abzug
Einfach ausgedrückt: Es kommt nicht nur darauf an, welches Genom wir besitzen, sondern auch darauf, welche Gene in verschiedenen Situationen an- oder abgeschaltet werden. Bildlich gesprochen ist das mit einem Lichtschalter vergleichbar.
Bei der Auslösung von Migräneattacken müssen also sogenannte Triggerfaktoren - im Sinne eines „Anschaltens“ - von den grundlegenden Ursachen unterschieden werden. Wie erwähnt, belegen neue Untersuchungen, dass das Gehirn von MigränepatientInnen durch eine besonders empfindliche Reizverarbeitung gekennzeichnet ist. Ihr Nervensystem steht ständig unter „Hochspannung“.
Diese Disposition erhöht zwar das Risiko für eine Erkrankung wie Migräne, doch massgeblich für Latenz und Ausbruch sind unmittelbare Stresseinflüsse. Das bedeutet, dass wir durch bewusste Entscheidungen hinsichtlich unserer Lebensgewohnheiten die Aktivität unserer Gene - und damit auch unsere Migränegeschichte - positiv beeinflussen können.
Das Fass-Modell
Die individuelle Belastbarkeitsgrenze lässt sich vereinfacht mit dem „Fass-Modell“ veranschaulichen. Dabei wird der menschliche Körper mit einem Fass verglichen, dessen Fassungsvermögen von Person zu Person unterschiedlich ist. Stress entspricht dem Wasser, das in das Fass strömt. Füllt sich das Fass bis zum oberen Rand, zeigt der Körper keine Reaktion. Fiesst jedoch ein Tropfen zu viel hinein, läuft es über – und der Körper reagiert.
Da MigränikerInnen aufgrund ihrer erhöhten Abwehrbereitschaft bereits über einen vorgefüllten „Behälter“ verfügen, kann der Organismus bei zusätzlichen Belastungen schnell den Kipp-Punkt erreichen.
Durch die genetische Vorbelastung erhalten MigränikerInnen dann die Rückmeldung in Form eines Migräneanfalls. Andere entwickeln je nach individueller Schwachstelle Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma, Übergewicht oder Diabetes. Ein anschauliches Bild dafür ist das sprichwörtliche „schwächste Glied in der Kette“: Solange die Kette nicht überbeansprucht wird, bleibt die Schwachstelle unbemerkt. Doch wenn sie immer wieder unter Spannung gerät, reisst sie schliesslich an genau dieser Stelle.
Leeren wir den Behälter bis unter den Rand, können wir wieder beschwerdefreie Tage und Wochen erleben. Um langfristig stabil zu bleiben und nicht bei jedem kleinen belastenden Ereignis - sei es nur ein Wetterumschwung - einen Rückfall zu erleiden, müssen wir den Behälter deutlich entleeren. Das gelingt nur, wenn wir die grossen Einflussfaktoren identifizieren und aktiv reduzieren.
ALLES BEGINNT MIT DEM ESSEN
Die Frage nach der richtigen Ernährung und ihrer Bedeutung für die Gesundheit beschäftigt die menschliche Zivilisation seit jeher. Schon im antiken Griechenland stand die „díaita“ (Ernährungs- und Lebensweise) im Zentrum jeder Therapie. Heute weiss man: Rund 70 Prozent der chronischen Erkrankungen, unter denen wir im Alter leiden, lassen sich auf eine ungesunde Ernährung zurückführen.
Aber warum ist das, was täglich auf unserem Teller landet, so wichtig? Dazu müssen wir uns zuerst eine andere Frage stellen: Wozu müssen wir überhaupt essen?
„Wir leben nicht, um zu essen; wir essen, um zu leben.“ Sokrates, Philosoph (470 - 399 v. Chr.)
Unser Organismus besteht aus Zellen – der kleinsten Einheit des Lebens. Der menschliche Körper setzt sich aus rund 70 Billionen (70.000.000.000.000) Zellen zusammen. Sie sind die grundlegenden Bausteine: Jedes Gewebe, jeder Knochen und jedes Organ besteht aus ihnen.
Jede einzelne Körperzelle ist eine kleine biochemische Fabrik, in der Sekunde für Sekunde Milliarden von Vorgängen ablaufen. Diese Prozesse werden in ihrer Gesamtheit als Metabolismus oder Stoffwechsel bezeichnet – also die Umwandlung von Stoffen.
Jeden Tag sterben etwa 600 Milliarden Zellen (600.000.000.000) und werden neu gebildet. Jede Gewebeart hat dabei ihren eigenen Erneuerungszyklus. Alle fünf Tage entsteht eine neue Darmschleimhaut, alle drei Wochen regenerieren sich die Leberzellen, und jeden Monat erneuert sich die oberste Hautschicht. Das Knochenmark stellt jede Sekunde Millionen neue Blutkörperchen her.
„Eine lebende Zelle benötigt Energie, nicht nur für alle ihre Funktionen, sondern für die Aufrechterhaltung ihrer Struktur. Ohne Energie würde die zelluläre Fabrik kollabieren und das Leben augenblicklich ausgelöscht.“ Albert Szent-Györgyi, Arzt, Biochemiker und Nobelpreisträger (1893 - 1986)
Damit all diese Prozesse funktionieren können, müssen die Mitochondrien - die winzigen Kraftwerke der Zellen - Energie produzieren. Fast jede Zelle enthält Tausende davon. Sie stellen die zelluläre Energie in Form von Adenosintriphosphat (ATP) bereit, das jede Zelle für ihre Funktionen benötigt.
Ohne diesen Energiespeicher ist der Körper zu nichts mehr fähig: Weder Muskelbewegung noch Atmung sind möglich – jede einzelne Körperfunktion kommt zum Stillstand. Der Stoffwechsel bricht zusammen, und der Organismus stirbt.