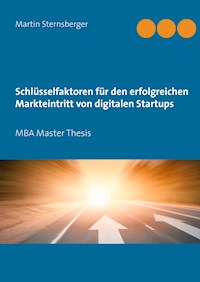
Schlüsselfaktoren für den erfolgreichen Markteintritt von digitalen Startups E-Book
Martin Sternsberger
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Was macht den Erfolg von Startups aus? Diese MBA Master Thesis beschäftigt sich mit der Frage, weshalb ein Teil dieser jungen Unternehmen sehr erfolgreich ist, aber der Rest scheitert. Welche Schlüsselfaktoren sind dafür ausschlaggebend? Nach ausführlicher Literaturrecherche wurden zwölf namhafte Vertreter von Startup-Unternehmen, Business-Angels, Venture-Capital-Unternehmen, Förderstellen und des Ökosystems mit entsprechendem Expertenwissen befragt. Die relevanten Schlüsselfaktoren wurden identifiziert und danach gewichtet, welche Merkmale entscheidende Erfolgsfaktoren sind und welche keine Relevanz haben. Das Ergebnis sind zwölf Schlüsselfaktoren, von denen drei als kritische Erfolgsfaktoren und die anderen als wichtig und vorteilhaft eingestuft werden konnten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Universität Salzburg & University of Salzburg Business School
Universitätslehrgang International Executive MBA
Schwerpunkt: International Management
Lehrgangsleitung: Univ.-Prof. Dr. Walter Scherrer
Betreuer: Dr. Philipp Müller
Schlüsselfaktoren für den erfolgreichen Markteintritt von digitalen Startups
Master Thesis vorgelegt von:
Martin Sternsberger
Wien, im Dezember 2014
DANKSAGUNG
Herzlich bedanken möchte ich mich bei den zwölf Expertinnen und Experten, die sich für diese Arbeit als Interviewpartner für die Studie zur Verfügung gestellt haben und ihr Wissen und ihre Erfahrung geteilt haben: Irene Fialka, Stefan Fleig, Herwig Gangl, Thomas Glössner, Jürgen Höbarth, Christoph Jeschke, Daniel Keiper-Knorr, Bernhard Lehner, Ali Mahlodji, Thomas Peruzzi, Martin Sirlinger und Bernhard Thalhammer.
Mein Dank gilt außerdem folgenden Personen für ihre Unterstützung und das Herstellen des Kontakts zu den Gesprächspartner. Sie haben damit die Interviews und die Auswertung erst möglich gemacht: Paul Amann, Alois Gruber, Jürgen Höbarth, Romy Sigl und Thomas Vitzthum.
Des Weiteren möchte ich meinem Master-Thesis-Betreuer für sein immer promptes, wertschätzendes und wertvolles Feedback danken: Dr. Philipp Müller.
Ganz spezieller und besonderer Dank gilt einer Person, die mich nicht nur bei dieser Arbeit, sondern weit darüber hinaus unterstützt hat: Kerstin Dohnal.
ÜBER DEN AUTOR
Martin Sternsberger, Jahrgang 1969, Unternehmer seit 1996, begleitet Startups und Technologie-Unternehmen in der strategischen Unternehmens-, Führungskräfte- und Persönlichkeitsentwicklung. Er setzt außerdem Online-Marketing- und Internet-Projekte um und ist ausgebildeter Trainer und Coach.
Als einer der Ersten in Österreich gründete Sternsberger bereits 1996 eine Internet Agentur und betreute Kunden wie Mercedes-Benz, Prefa, Gaulhofer, Suzuki, Eckes-Granini, smart und Gabor Schuhe. Er baute das Unternehmen mit bis 20 Mitarbeiter zu einer Top-20-Agentur in Österreich auf und verkaufte es 2010 erfolgreich.
Davor war Sternsberger als Leiter der Software-Entwicklung (Car Access) bei der SkiData AG tätig.
INHALT
1 EINLEITUNG
2 PROBLEMSTELLUNG UND METHODIK
2.1 M
OTIVATION UND
R
ELEVANZ
1.1 P
OSITIONIERUNG DIESER
A
RBEIT
1.2 F
ORSCHUNGSDESIGN
1.2.1 Die fünf Postulate qualitativen Vorgehens
1.2.2 Erhebungsverfahren
1.2.3 Leitfragen für die Befragung
1.2.4 Transkription und Auswertung
1.2.5 Stichprobe
2 THEORETISCHER RAHMEN
2.1 W
AS IST EIN
"S
TARTUP
"?
2.2"D
IGITALE
" S
TARTUPS AUS
Ö
STERREICH
2.3 D
ER
M
ARKTEINTRITT
2.3.1 Markteintrittsbarrieren
2.4 W
ACHSTUMSPHASEN EINES
S
TARTUPS
2.4.1 Seed-Phase (0) - Vorbereitung, Ideen- und Vorproduktentwicklung
2.4.2 Start-up (1) - Unternehmensgründung
2.4.3 First Stage (2): Frühentwicklung
2.4.4 Second Stage (3): Markteinführung und erste Expansion
2.4.5 Third Stage (4): Up-Scaling oder zweite Expansion
2.4.6 Fourth Stage (5): Pre-Exit oder Pre-IPO
2.4.7 Unternehmensverkauf oder Börsengang (6)
2.5 D
EFINITION
E
RFOLG
2.6 S
CHLÜSSELFAKTOREN
2.6.1 Grundlegende Ansätze
3 ANALYSE: DIE 12 ERFOLGSFAKTOREN
3.1 K
RITISCHE
E
RFOLGSFAKTOREN
3.1.1 Das Produkt
3.1.2 Zusammensetzung von Gründerteams
3.1.3 Leistungsbereitschaft
3.2 W
ICHTIGE
E
RFOLGSFAKTOREN
3.2.1 Markt und Marktrisiko
3.2.2 Persönlichkeit und Charaktereigenschaften
3.2.3 Start-up-Prozess
3.2.4 Beteiligungskapital
3.3 V
ORTEILHAFTE
E
RFOLGSFAKTOREN
3.3.1 Gründungserfahrung
3.3.2 Team- gegenüber Einzelgründung
3.3.3 Netzwerk ("Ökosystem")
3.3.4 Selbstfinanzierung
3.3.5 Öffentliche Fördermittel
3.4 N
ICHT RELEVANTE
F
AKTOREN
3.4.1 Alter
3.4.2 Gründungsmotive
3.4.3 Berufs- und Branchenerfahrung
3.5 S
ONSTIGE
F
AKTOREN
3.5.1 Kompetenzen
3.5.2 Organisationsform
3.5.3 Inkubatoren und Acceleratoren
3.5.4 Banken (Kredite)
3.5.5 Crowdfunding
4 CONCLUSIO
5 LIMITATIONEN UND AUSBLICK
6 REFERENZEN
1 EINLEITUNG
Was macht den Erfolg eines Startups aus? Warum ist eine kleine Minderheit dieser jungen Unternehmen sehr erfolgreich, aber der Großteil scheitert?
Täglich liest man von Meldungen über die Finanzierung neuer Technologieunternehmen durch Investoren in Millionenhöhe oder der Übernahme solcher Unternehmen mit Kaufpreisen im Bereich von hunderten Millionen Euro. Sogar österreichische und deutsche TV-Sender haben diesen Trend aufgegriffen und liefern dazu Fernsehsendungen in denen Gründerinnen und Gründer live vor Investoren um Kapital für ihr Startup"pitchen". Allen Ortens in Österreich aber speziell in Wien, entstehen eigene Ökosysteme für innovative Neugründungen.
Zwar sind bislang Erfolgsgeschichten á la Silicon Valley hierzulande selten, aber dennoch kann Österreich auch bereits auf eine Reihe erfolgreicher Startups zurückblicken, wie nachfolgende Beispiele zeigen. bwin wurde 1997 mit zwölf Mitarbeitern gegründet und beschäftigt jetzt weltweit 3.100 Mitarbeiter bei einem Umsatz von US$ 760 Millionen. Jajah, ein Anbieter für webbasierte Telefonie, wurde 2005 gestartet und 2009 um EUR 145 Millionen an die spanische Telefónica verkauft. Paysafecard existiert seit dem Jahr 2000 und wurde zum ersten bankenrechtlich genehmigten Online-Zahlungsmittel in Europa. Runtastic hatte bereits vier Jahre nach der Gründung im Jahr 2009 mehr als 85 Mitarbeiter und über 50 Millionen Downloads seiner Fitness-App (vgl. AustrianStartups, 2013, 11).
Doch Erich Ries (2011) warnt zur Vorsicht. Wenn man den Prozess nicht kennt und nicht beherrscht, wie man ein großartiges Produkt in ein funktionierendes Unternehmen verwandelt, nutzen die beste Idee und die tollste Innovation nichts. In den Medien wird überwiegend von den erfolgreichen Startups berichtet und dabei übersehen, dass in Wirklichkeit der Großteil der Startups scheitert. Dennoch faszinieren uns die Geschichten von kreativen Genies, von Beharrlichkeit und harter Arbeit. Sie lassen es so aussehen, als käme es gar nicht auf die langweiligen, alltäglichen Details und die einzelnen, kleinen Entscheidungen an. Diese Geschichten liefern Ausreden, wenn wir scheitern: Wir waren einfach nicht visionär genug, oder waren nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Jedoch zeigt die Erfahrung, dass es gerade auf dieses"langweilige Zeug" ankommt und der Startup-Erfolg keine Folge guter Gene ist, sondern das Einhalten des richtigen Prozesses, und somit geplant und damit auch erlernt werden kann (vgl. Ries, 2011, 2f).
Denn ein neues Unternehmen zu gründen, ist laut Gartner (1985) ein komplexes Unterfangen. Das Bewusstsein nimmt zu, dass der Prozess, wie dieses zu starten ist, nicht einfach ein Standardvorgang ist, der von gleichartigen Unternehmertypen immer und immer wieder durchexerziert wird. Erfolgreiche Neugründung ist ein mehrdimensionales Phänomen. Die Gründerinnen, sowie Gründer und ihre neuen Firmen unterscheiden sich in weiten Bereichen. Es kann somit nicht nach dem"typischen" Gründer, der"typischen" Gründerin oder dem"durchschnittlichen" Startup gesucht werden (vgl. Gartner, 1985, 697).
Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet daher:
Was sind die Schlüsselfaktoren für den erfolgreichen Markteintritt von digitalen Startups aus Österreich, die eine Unternehmung trotz gleicher oder ähnlicher Markt- und Umweltbedingungen deutlich erfolgreicher sein lässt als den Mitbewerb?
2 PROBLEMSTELLUNG UND METHODIK
2.1 MOTIVATION UND RELEVANZ
Startups haben eine niedrige Überlebensrate. In der US-amerikanischen Studie von Michael Song, Ksenia Podoynitsyna, Hans van der Bij, and Johannes I. M. Halman (2008) von über 11.000 neuen Technologieunternehmen mit über fünf Mitarbeitern zwischen 1991 und 2002 wurde herausgefunden, dass nach vier Jahren nur 36% der Unternehmen überlebt hatten. Nach fünf Jahren waren es gerade mal knapp 22%. Deshalb ist es von Bedeutung zu verstehen, wie solche Unternehmen bessere Überlebenschancen haben können (vgl. Song et al, 2008, 7).
Welche Faktoren entscheiden nun über Erfolg und Misserfolg für neue, junge Unternehmen? Diese Frage ist für verschiedene Gruppen interessant. Zunächst natürlich für Personen, die vorhaben, ein Unternehmen zu gründen und sich dafür interessieren, welche Kriterien in der Startup-Phase maßgeblich für das Gelingen sind. Unterstützt durch dieses Wissen können sie ihre Aussichten überprüfen und mögliche Fallgruben umgehen. Weiters sind diese Erkenntnisse auch für all jene wichtig, die mit der Förderung von Jungunternehmen auf einem makroökonomischen Niveau befasst sind, oder entsprechende politische Maßnahmen veranlassen. Denn hohe unternehmerische Aktivität wirkt sich nachhaltig positiv auf Innovation, Wettbewerb, Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen aus (vgl. van Gelderen et al, 2006, 319f).
Sowohl der österreichische Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Dr. Reinhold Mitterlehner, wie auch die Geschäftsführer des AWS Austria Wirtschaftsservice Mag. Edeltraud Stiftinger und DI Bernhard Sagmeister sind sich deshalb auch dar über einig, dass Startups als Erfolgsfaktor für den Wirtschaftsstandort Österreich von enormer Bedeutung sind, weil sie Impulsgeber, Innovationstreiber sind, neue Märkte und Wachstumschancen eröffnen und neue Arbeitsplätze und Geschäftsmodelle für die Zukunft schaffen (vgl. Austria Wirtschaftsservice, 2014a, S 3f). Dies wird auch von Studien unterstützt, die nachweisen, dass eine Förderung des Unternehmertums wichtig für die Stimulation von Innovationen in wirtschaftlich entwickelten Ländern wie Österreich ist und dass die unternehmerische Initiative eine zentrale Rolle beim technologischen Fortschritt spielt (vgl. Sergey and Wincent, 2012, 55f)
Es gibt somit eine Reihe von Stakeholdern - angefangen mit den Gründerinnen und Gründern selbst, über Kapitalgeber, Förderstellen, bis hin zur öffentliche Hand - die an einer Beantwortung der Frage nach den kritischen Erfolgsfaktoren von digitalen Startups interessiert sind.
1.1 POSITIONIERUNG DIESER ARBEIT
Seit den 1970er Jahren ist ein aktives Forschungsinteresse an jungen Technologieunternehmen, in die sich nun auch die digitalen Startups eingliedern, wahrnehmbar. Strohe (2005) hat bei ersten umfassenden Ländervergleichen festgestellt, dass die Gründungszahlen im deutschsprachigen Raum seit den Neunzehnfünzigern nur auf niedrigem Niveau gestiegen sind. Im Vergleich zu den Vereinigten Staaten konnten Nachteile bei den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise bei der Bereitschaft zur Finanzierung, der steuerlichen Behandlung und den öffentlichen Förderungen, aber speziell auch bei der Gründerkultur festgestellt werden (vgl. Strohe, 2005, 22).
Es gibt in der internationalen akademischen Literatur einige Studien, die sich mit den Erfolgsfaktoren von Startups, oder neuen Technolo gieunternehmen beschäftigen. Laut Michael Song, Ksenia Podoynitsyna, Hans van der Bij, and Johannes I. M. Halman (2008) bieten diese Studien aber nicht viele Erkenntnisse. Die empirischen Ergebnisse dieser Studien sind oft widersprüchlich, was sich vermutlich auf methodische Probleme, wie unterschiedliche Forschungsdesigns und nicht vergleichbare Sample-Mengen zurückführen lässt (vgl. Song et al, 2008, 8).
Fokus dieser Arbeit sind nicht Startups jeglicher Branche oder grundsätzlich jegliche junge Technologieunternehmen, sondern die genau definierte Gruppe der digitalen Startups in Österreich (siehe Kapitel "Theoretischer Rahmen"). Des Weiteren kann und will diese Arbeit kein allumfassendes Werk über Startups oder gar ein Gründerhandbuch oder Leitfaden sein, sondern sich auf die Ermittlung der wesentlichen Erfolgsfaktoren konzentrieren.
1.2 FORSCHUNGSDESIGN
Mit dieser Arbeit soll ein theoretisch abgeleiteter und empirisch geprüfter Ansatz eines Strategierahmens für den erfolgreichen Markteintritt von digitalen Startups in Österreich geschaffen werden. Für eine strukturierte Herangehensweise wurde nachfolgendes, forschungsmethodisches Vorgehensmodell gewählt.
Im Rahmen der Literaturanalyse wurde die Basis für den theoretisch konzeptionellen Hintergrund erhoben. Es wurde eine ausführliche Recherche der relevanten Fachliteratur, Studien, Aufsätze und wissenschaftlichen Artikel durchgeführt. Im Kapitel "Theoretischer Rahmen" werden mit den Ergebnissen daraus die zentralen Begriffe definiert und abgegrenzt.
Die empirische Erhebung wurde in Form einer qualitativen Studie mit fokussierten Interviews durchgeführt. Als gewünschte Stichprobe wurden Repräsentanten von Startup-Unternehmen, Investoren, Förderstellen und des Öko-Systems festgelegt. Auf Basis der erhobenen Erfolgsfaktoren aus der Literaturrecherche wurde ein Leitfaden entwickelt, mit dem dann die zwölf Experteninterviews ausgeführt wurden.
Alle Interviews wurden transkribiert und ausgewertet. Passende Aussagen wurden den erhobenen Schlüsselfaktoren zugeordnet. Konnten aus der Analyse weitere, relevante Schlüsselfaktoren festgestellt werden, wurden diese aufgenommen und alle anderen Interviews überprüft, ob es dazu weitere Aussagen gab.
Die ermittelten Faktoren wurden nach Relevanz in vier Gewichtungskategorien eingeteilt: kritische Erfolgsfaktoren, wichtige Erfolgsfaktoren, vorteilhafte Erfolgsfaktoren und nicht relevante Faktoren.
1.2.1 Die fünf Postulate qualitativen Vorgehens
Als theoretische Grundlagen für qualitatives Vorgehen hat Philipp Mayring (2002) mit seinen fünf Postulaten Grundsätze herausgearbeitet, indem er die Gemeinsamkeiten aus den anderen vorhandenen, qualitativen Ansätzen analysiert hat. Nachfolgend sind die fünf Postulate von Mayring (2002) zusammengefasst (vgl. Mayring, 2002, 19ff):
Zunächst wird eine starke Subjektbezogenheit gefordert. Gegenstand der Forschung müssen immer Menschen (Subjekte) sein, die auch Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung darstellen. Die vorliegende Arbeit kommt dieser Forderung durch Befragung von we sentlichen, handelnden Personen in Startups, Öko-System und Förderungsinstituten, sowie von Kapitalgebern nach.
Dann betont Mayring (2002), dass am Anfang einer Analyse immer eine genaue Beschreibung des Gegenstandes stehen muss, die in den ersten Kapiteln zu finden ist, die die Problemstellung, die Grundlagen und die Herangehensweise beschreiben.
Als Drittes wird darauf hingewiesen, dass der Untersuchungsgegenstand nie völlig offen liegt, sondern durch Interpretation erschlossen werden muss. Dies gilt in besonderem Maße, wenn - wie in dieser Arbeit - verbales Material, konkret Interviews, analysiert wird.
Weiters sollen humanwissenschaftliche Gegenstände in Ihrer alltäglichen Umgebung untersucht werden, da Menschen in einer experimentellen Situation oder in einem Labor anders reagieren, als im Alltag. Fast jede Forschung bringt ohnehin eine Verzerrung der Realität mit sich. Nachdem bei dieser Untersuchung für die Befragung keinerlei experimentelle Situation geschaffen wird, sondern die Interview-Partner nach ihren Erfahrungen und Meinungen zum Thema befragt wurden, wird diesem Postulat implizit entsprochen.
Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse muss im spezifischen Fall schrittweise begründet werden. Argumente müssen darlegen, inwieweit in dieser Arbeit gefundene Resultate auch für andere Situationen, konkret andere Startups, gelten. Dies wird hier im Kapitel "Analyse" dargestellt.
1.2.2 Erhebungsverfahren
Im Rahmen dieser Arbeit waren Erfahrungen, Meinungen und Stellungnahmen von Schlüsselpersonen der Zielgruppen zu erheben. Es stellte sich dabei die Frage, welches das geeignetste Erhebungsver fahren dafür ist. Nach Mayring stehen für eine qualitative Erhebung unter anderem nachfolgende vier Verfahren zur Verfügung (vgl. Mayring, 2002, 66ff):
Das fokussierte Interview als Unterart des problemzentrierten Interviews ist eine offene, halbstrukturierte Art der Befragung, die den Interviewpartner möglichst frei zu Wort kommen lässt. Sie zentriert sich aber um die gegebene Fragestellung und kommt immer wieder darauf zurück. Die Problemstellung wurde dabei im Vorfeld bereits analysiert und ein Leitfaden für die Befragung erarbeitet. Begonnen wird das Interview mit Sondierungsfragen, die dazu beitragen herauszufinden, welche subjektive Bedeutung das Thema für den Befragten hat. Danach folgen die zuvor festgelegten Fragen aus dem Leitfaden. In weiterer Folge können noch spontan Fragen formuliert werden, wenn sich aus dem Gespräch weitere Aspekte ergeben. Wichtig bei der Durchführung ist das Kriterium der Offenheit. Der Befragte soll ohne vorgegebene Möglichkeiten frei antworten können. Der Vorteil dieser Erhebungsart liegt in der theoriebegleiteten Forschung, weil die vorangegangene Analyse und die theoretischen Grundlagen in die Befragung einfließen können. Weiters findet durch den Leitfaden eine teilweise Standardisierung statt, was eine Vergleichbarkeit der einzelnen Interviews erleichtert.
Beim narrativen Interview, als zweite Form der Befragung, wird der Interviewpartner zum ganz freien Erzählen ermutigt. Der Grundgedanke hinter dieser Methode ist, dass durch das freie Erzählen Erkenntnisse zum Vorschein kommen, die bei systematischer Befragung nicht zutage kommen würden. Der Befragte wird dabei angehalten, zum vorgegebenen Thema eine typische Geschichte zu erzählen. In die Erzählung wird dabei nicht führend eingegriffen, außer es wird zu stark vom Thema abgewichen. Erst nach Abschluss der Erzählung können unklare Punkte geklärt und Warum-Fragen gestellt werden. Narrative Interviews sind sinnvoll nur dann einzusetzen, wenn es um subjektive Sinnstrukturen geht, die nicht einfach direkt erfragt werden können.
Gruppendiskussionen werden dann eingesetzt, wenn viele Meinungen oder subjektive Bedeutungsstrukturen stark an soziale Wechselbeziehungen gebunden sind, und es deshalb vorteilhaft ist, diese auch in einem sozialen Setting zu erheben. Man kann so allgemeine Anschauungen, gemeinschaftliche Auffassungen, kollektive Grundüberzeugungen und ähnliches herausfinden. Der Gesprächsleiter führt dazu Reizargumente in das Gespräch ein, greift aber in die entstehende Diskussion möglichst wenig ein.
Unter teilnehmender Beobachtung versteht man, wenn der Befrager nicht von außen den Forschungsgegenstand oder das Forschungssystem beobachtet, sondern selbst an der Situation teilnimmt. Der Forscher will damit größtmögliche Nähe zum zu untersuchenden Gegenstand oder System erreichen und eine Innenperspektive erhalten. Hier ist weder eine völlig strukturierte, noch eine vollkommen freie Vorgangsweise sinnvoll. Vorab müssen die wichtigsten Beobachtungskriterien aus der Theorie abgleitet und daraus ein Leitfaden für die Beobachtung festgelegt werden. Problematisch ist, dass der Beobachter ins Untersuchungssystem integriert und dort akzeptiert werden muss, ohne als Störfaktor zu wirken. Beobachtungen werden in möglichst detaillierten Protokollen festgehalten, welche die Grundlage für die Schlussauswertung bilden. Dieses Erhebungsverfahren ist dann gut geeignet, wenn der Gegenstand in eine soziale Situation eingebettet oder von außen schwer einsehbar ist.
Gewähltes Erhebungsverfahren: Experteninterviews
Da im Rahmen dieser Arbeit einerseits möglichst objektivierbare und nicht ausschließlich subjektive Aussagen erwünscht sind und andererseits ein konkreter Vergleich mit den aus der Literaturanalyse erhobenen Erfolgsfaktoren gemacht werden soll, erscheint das narrative Interview für diese Arbeit als nicht geeignet. Auch handelt es sich bei dieser Arbeit nicht um die Untersuchung von allgemeinen Anschauungen in sozialer Interaktion, weshalb eine Gruppendiskussion ausgeschieden ist. Weiters wäre es quasi unmöglich gewesen, einen gemeinsam Termin aller Befragten zu organisieren. Die teilnehmende Beobachtung ist neben der Tatsache, dass deren Durchführung viel zu aufwändig gewesen wäre, für den vorliegenden Fall auch deshalb ungeeignet, weil die abgefragten Erkenntnisse sich nicht durch reine Beobachtung erschließen würden.
Als Erhebungsverfahren, das für die vorliegende Arbeit am besten geeignet ist, wurde somit das fokussierte Interview ausgewählt, da es einerseits eine Vergleichbarkeit der Befragungen untereinander, aber speziell auch der Befragungsergebnisse mit der erarbeiteten Theorie, aus der sich der Leitfaden ableitet, ermöglicht.
Die fokussierten Interviews wurden als Experteninterviews nach Mayer (2009) ausgeführt, bei der die oder der Befragte weniger als Person, sondern vielmehr in ihrer oder seiner Rolle als Expertin oder Experte für die gewählte Problemstellung interessant ist. Die Expertin oder der Experte nimmt dabei auch die Funktion eines Repräsentanten einer Gruppe ein (vgl. Mayer, 2009, 38).





























