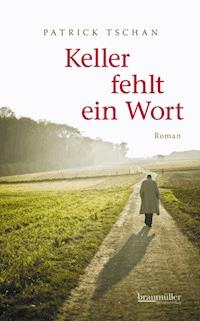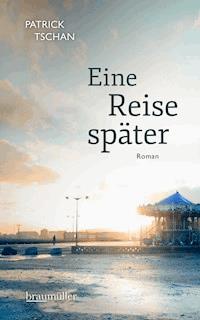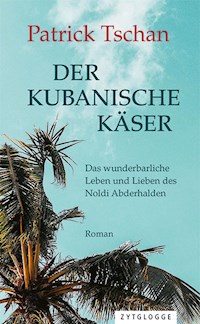21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Frühjahr 1947 hüpft die Buchhändlerin Emilie Reber von einem Linienschiff auf den Landungssteg einer Kleinstadt am Bodensee. Zurückgekehrt aus der Résistance, eröffnet sie mit französischer Hilfe eine Leihbibliothek und macht sich daran, die gesellschaftlichen Verkrustungen der Nachkriegszeit mit Literatur aufzubrechen. Kein leichtes Unterfangen, wollen doch die Kleinstädter Ruhe, vergessen und schon gar nicht, dass jemand in ihren Wunden stochert. Vorerst legt sich die Buchhändlerin alleine mit dem Städtchen und den Altnazis an, bis sie zwei Freundinnen und Mitstreiterinnen findet. Gemeinsam mit einem Kunden der Buchhandlung stemmen sich die drei Frauen dem eisigen Schweigen mit Literatur, Mode und Musik entgegen. Mit Mut, Beharrlichkeit und Lebenshunger behaupten sie gegen alle Widerstände ihr eigenes Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Patrick Tschan
SCHMELZWASSER
Roman
Für Mami
Inhalt
Schmelzwasser
Dank
Mit einem disziplinierten Hüpfer setzte die Buchhändlerin an Land.
„Hallo, Sie! Ja, Sie! Das geht nicht, das geht gar nicht!“, rief ihr der Schiffsschaffner nach.
Festen Boden unter den Füßen drehte sie sich zu ihm um, lächelte ihn an, machte auf dem Absatz kehrt, fasste die Häuserzeile vor ihr ins Auge und ging schnurstracks zum Gasthof „Seesicht“, in dem ihr der Kœnig ein Zimmer reserviert hatte.
Sie wollte unbedingt vor dem Anlegen der Fähre ankommen. Der Sprung vom Schiff auf das Festland war ihr wichtig gewesen: für den Rhythmus der kommenden Jahre, für die Festigkeit ihrer Zuversicht, ihre neue Lebensaufgabe umzusetzen. Es war die einzige Ankunft, die ihr möglich erschienen war. Außer, der See wäre gefroren gewesen. Sie wäre zu Fuß von einem Ufer zum anderen marschiert. Der Rock hätte im bitterkalten Wind geflattert, das Eis geknirscht und manchmal dumpf gekracht. Sie hätte in der Mitte des riesigen Eisfelds angehalten, sich umgeschaut, eingehüllt von flimmerndem Eisdampf kein Ufer mehr erkennen können, sich für einen Augenblick der Illusion hingegeben, übers Meer zu wandeln, bis sie, eingedenk der Kälte, die Arme vor der Brust verschränkt, sich gegen den Frost gestemmt hätte und entschlossenen Schrittes in Richtung des kleinen Städtchens geeilt wäre.
Aber es war gut so, wie es war. Die vom See gekühlte Frühlingswärme des Jahres 1947, die sie bei diesem kleinen Hüpfer verspürt hatte, war genau richtig gewesen, um im Süden anzukommen.
Sie betrat die dunkle Gaststube der „Seesicht“, stellte ihre Tasche vor der Theke ab, rief „Hallo?!“, aber der Raum blieb stumm.
Als sich ihre Augen an das wenige Licht gewöhnt hatten, erblickte sie einen Schlüssel mit einem Zettel auf dem Tresen. „Reber, Zimmer 7, 2. Stock.“
Sie steckte Schlüssel und Zettel ein, stieg die Treppe hoch, fand Zimmer 7 auf Anhieb, betrat den sauberen, hellen Raum, stellte die Tasche ab, öffnete sofort die Fenster, sah auf den See und die gegenüberliegende Halbinsel, atmete tief ein, schüttelte vor Freude für einen Augenblick den Kopf und sagte leise zu sich: „Süden, Meer – in meiner Sprache.“
Sie blickte kurz in den Spiegel, glättete den Rock, atmete tief ein, verließ Zimmer und Gasthaus und machte sich auf den Weg zu Fritz Zängler, einem Beamten der Stadtverwaltung. „Ein Einheimischer“, mehr konnte ihr Kœnig, der oberste Verwalter des gesamten französischen Besatzungsgebiets, nicht über Zängler sagen.
Der ungewöhnlich braun gebrannte, sportliche Beamte begrüßte sie bereits am Ende der Treppe, geleitete sie hinkend in sein Büro und wies ihr einen Stuhl zu.
„Sie hinken ja, haben Sie sich verletzt?“
„Ist schon eine Weile her … schwerer Bootsunfall.“
„Das tut mir leid.“
„Man kann damit leben. Aber jetzt zu Ihnen: Sie sind also die Frau, die hier Bücher verleihen und möglicherweise sogar verkaufen will.“
„Ja, die bin ich. Sie sind ja bestens informiert. Und Sie sind schon ganz schön braun für diese Jahreszeit.“
„Segeln, auf meinem Meer. Der Frühling ist mild, die Sonne bereits kräftig, der Wind ab Mittag meist gut.“
„Es muss wunderbar sein, da draußen auf dem Wasser, fast wie auf dem Meer.“
„Das schwäbische Meer. Wir nennen meinen See das schwäbische Meer.“
„Ich weiß. Es gab auch mal eine Seeschlacht auf dem schwäbischen Meer, nicht?“
„Ja, aber das ist lange her, Dreißigjähriger Krieg. Der Schwertletanz erinnert noch daran. Haben Sie den mal gesehen?“
„Nein. Ich werde ihn ja sicher bald sehen. Es ist gut, hier zu sein.“
„Es sind viele gerne hier. Ist auch einzigartig, unser kleines Städtchen. Aber jetzt zeigen Sie mir Ihre Papiere, damit ich sehe, welches Haus der Kœnig für Ihre Leihbibliothek mit Lesestube vorgesehen hat.“
Emilie Reber zog eine graugrüne Kartonmappe aus ihrer Handtasche und legte ihren Pass und die Berechtigung zum Bezug des Hauses an der Leuchtturmgasse 14 auf den Tisch.
Fritz Zängler nahm das Papier, las, schaute Emilie Reber erstaunt an, legte es zurück auf den Tisch und sagte mit nicht zu verbergender Verwunderung in der Stimme: „Aber das ist ja das alte Parteihaus.“
„Sie sagen es.“
„Aber das gehört doch …“
„Beschlagnahmt. Zu Recht.“
„Aber Sie können doch nicht einfach …“
„Ich nicht, aber die Franzosen. Bitte, Herr Zängler, beachten Sie die Unterschrift.“ Sie zeigte mit dem Finger an die Stelle, an der das Dokument unterschrieben war. „Er kann das.“
„Kœnig … der Kœnig?“
„Ja, der Kœnig! Entnazifizierung auf Französisch sozusagen“, sagte sie keck und gab sich nicht viel Mühe, das Schmunzeln zu unterdrücken.
Der Beamte lehnte sich zurück und sah auf den See. Ein leichter Dunst lag über ihm, es waren weder Schiffe noch Boote zu erkennen. Nur der dunkelgrüne Hügelzug der Konstanzer Halbinsel. Nach einer Weile drehte er sich wieder zu ihr um und fragte: „Springen Sie immer von anlegenden Schiffen?“
„Nein, nur wenn ich ankommen will. Aber warum wissen Sie das überhaupt?“
„Ich habe Sie kommen sehen“, wies der Mann auf das offene Fenster. „Man muss schon wissen, wer kommt.“
„Sie sind bereits entnazifiziert, oder?“
„Wegen dem alten Parteilokal?“
„Ja, man muss schon wissen, zu wem man kommt.“
„Aber bitte, selbstverständlich bin ich entnazifiziert“, antwortete der Beamte, „und zwar noch nach dem amerikanischen Verfahren!“
„Einfacher Mitläufer?“
„Nein, natürlich nicht. Sonst hätte ich diese Stelle ja nicht bekommen.“
„Na wunderbar. Dann steht ja einer Übergabe der Liegenschaft Leuchtturmgasse 14 nichts im Wege. Haben Sie den Schlüssel gleich hier?“
„Welche Bücher werden Sie denn anbieten? Unterhaltungsromane? Lebenshilfen? Erbauende Literatur?“
„Bücher, die während der Nazizeit nicht gelesen werden durften, Bücher über die Nazizeit, die noch geschrieben werden, Bücher, die klug unterhalten und gerade der Jugend Menschlichkeit vermitteln, Bücher, die helfen, zukünftig mit Rückgrat zu leben, Bücher, die zum Denken anregen, um wieder eine geistig gesunde Gesellschaft aufzubauen. Das wird es in etwa so sein, das Programm der Leihbibliothek, des Antiquariats und der Buchhandlung Emilie Reber. Gut so für das kleine Städtchen, nicht, Herr Zängler?“
Fritz Zängler blickte wieder auf den See. Der Dunst schien sich zu verdichten, das Schweizer Ufer war nicht zu sehen. Er stand auf und schloss das Fenster, lehnte sich an den Fenstersims, schaute Emilie Reber in die Augen und sagte eindringlich: „Frau Reber, die Menschen hier, Sie und ich auch, wir haben alle eine schwere Zeit hinter uns. Was wir brauchen, ist ein wenig Ruhe, damit wieder ein geordnetes Leben entstehen kann, damit wir wieder ein geordnetes Deutschland aufbauen, damit wir wieder ein Leben fern von Hunger und Entbehrungen führen können und auf diese Weise wieder unsere Menschenwürde zurückgewinnen. Dafür müssen gewisse Dinge auch ein wenig ruhen, bis man genügend Übersicht hat, was eigentlich wirklich geschehen ist. Dafür büßen alle genug, verstehen Sie?“
„Ich verkaufe Bücher. Bücher für den Hunger, die Entbehrung und fürs Büßen. Alles andere überlasse ich Ihnen.“
„Mmmh … wo waren Sie eigentlich während des Krieges?“
„Auf der Flucht.“
„Oh, das tut mir leid.“ Zängler nahm wieder hinter seinem Schreibtisch Platz.
„Das muss Ihnen nicht leidtun. Geben Sie mir jetzt den Schlüssel?“
„Ich habe ihn nicht hier. Ich muss ihn holen.“
„Gut, bringen Sie ihn mir bis heute Abend. Sie wissen ja, wo ich einquartiert bin.“
„Ich werde sehen, was sich machen lässt.“
„Ich möchte Marie-Pierre Kœnig, Militärgouverneur der französischen Besatzungszone, nicht mit einer Rechnung für Ersatzschlösser belästigen.“
„Also bitte, Frau Reber!“, entrüstete sich Zängler.
„Gut, Sie bringen mir den Schlüssel in den Gasthof Seesicht. Bis heute um 18 Uhr. Besten Dank, Herr Zängler. Und segeln würde ich wirklich gerne mal“, verabschiedete sie sich noch im Sitzen, griff nach ihren Papieren, steckte sie in den Umschlag, verstaute diesen in ihrer Handtasche, stand auf und verließ das Büro. Sie hörte kaum noch, wie Zängler ihr hinterherrief: „Eine Leihbibliothek mit Lesestube! Kein Antiquariat! Keine Buchhandlung!“
Der Schlüssel lag am anderen Morgen auf der Theke der Gaststube. Emilie Reber machte sich auf, um ihre zukünftige Leihbibliothek, aus der so rasch wie möglich eine Buchhandlung mit Antiquariat werden sollte, auf Vordermann zu bringen.
Im Erdgeschoss befanden sich zwei große Säle, die ein Mittelgang trennte. Die Wände des linken Saals waren bis auf Kopfhöhe mit dunklem Holz verkleidet, die Decke mit ihren massiven Balken war getäfelt, in der Mitte stand ein langer Tisch, um den gepolsterte Kaffeehausstühle gruppiert waren, und über dem Türsturz verriet ein weißes Viereck, von wo aus Adolf Hitler zwölf Jahre grimmig in den Saal geschaut hatte. Der Raum stank nach abgestandenem Rauch, widerlicher Männerbündelei und Durchhalteparolen.
Drei ungleichmäßige Treppenstufen führten in den gegenüberliegenden Saal hinunter. Im Gegensatz zum anderen Raum war dieser vollständig leer, viel heller, hatte feinen, weißen Verputz an den Wänden und roch nur wenig nach Feuchtigkeit. Die gewölbte, gotische Decke wurde von zwei Säulen aus dem örtlichen Molassesandstein getragen, die im Abstand von etwa drei Metern mitten im Raum standen. Dieser ältere Teil des Gebäudes wurde wie der andere Saal zur Straße hin durch einen Halbbogen mit großen Fenstern abgeschlossen.
Am Ende des Mittelgangs führte eine abgetretene Steintreppe in die oberen Stockwerke, wo sich die eigentliche Gaststube befand. In diesen ufernahen Stadtteilen wurden die erdgeschossigen Räume als Remisen, Abstellkammern oder Lager schnell zu verschiebender Ware benutzt. Gelebt wurde in den oberen Stockwerken. Das Wasser des Sees war eine allgegenwärtige Bedrohung.
Die Gaststube wirkte, als wäre die letzte Runde gestern Nacht ausgegeben worden. Verschmutzte Biergläser standen noch auf den Tischen, die Aschenbecher gefüllt, schmutzige Teller mit Schimmelwolken in der Durchreiche zur Küche und auf dem Herd stand eine schwarze, stählerne Bratpfanne mit verbrannten Fettresten.
Ein Küchenbuffet aus schwerer Eiche, in dem die Zunftweinbecher verstaut waren, hatte als Abschluss einen pseudobarocken Zwerchgiebel, in dem ein geschnitzter Reichsadler eingelassen war. Unter dem Ausschank stapelten sich Biergläser, Kaffeetassen, Krüge und Schüsseln.
Emilie Reber ging auf den Dachboden. Schlitten, Wäschekörbe, Koffer und sonstiges Gerümpel lagen herum. An einer Wäscheleine hingen noch Tischdecken und Handtücher. Hinter den Tüchern waren zwei große Schränke versteckt. In einem fand sie drei Porträts Adolf Hitlers und im Wäscheschrank zwei Bronzebüsten des Mannes mit dem Fliegenbärtchen. Scheinbar wäre er den Flüchtigen zu einer zu schweren Last geworden.
Auf den unteren Regalblättern befanden sich sorgfältig gebügelte und gefaltete Tischdecken, zwischen diesen versteckte sich eine verdreckte SS-Uniform. Ganz unten war der Schrank vollgestopft mit nationalsozialistischen Schriften, Broschüren und Kampfblättern, die von einer Schicht Taubendung überzogen waren. Dies war ihr dann doch zu viel.
Augenblicklich lief sie zum braun gebrannten Beamten, hieß ihn, im Türrahmen verharrend, das abscheuliche Zeug bis heute Abend wegzuräumen, ansonsten würde sie bei Kœnig vorstellig werden, da es die städtische Verwaltung versäumt hätte, wie von den Besatzungsmächten angeordnet, das ganze Nazikrempel zu entsorgen, was sicherlich kein gutes Licht auf die Entnazifizierungsanstrengungen der neuen städtischen Verwaltung werfen würde.
Dies zeigte sofortige Wirkung, standen doch bereits eine Stunde später vier kräftige Burschen vor ihrer zukünftigen Antiquariatsbuchhandlung, die sich gleich anschickten, den ganzen Dreck auf einen alten Heuwagen aufzuladen und spätabends damit irgendwo hinzufahren.
Ein sich im ruhigen Seewasser spiegelnder Feuerschein beim ehemaligen KZ-Stollen war bis in die frühen Morgenstunden zu sehen.
Vier Tage später hielt ein zerbeulter, grauer Citroën TUB Traction Avant mit französischem Militärkennzeichen vor der Eingangstüre an der Leuchtturmgasse 14, und zwei junge Soldaten halfen Emilie Reber die fast zehn Jahre eilends versteckten Bücher der Deutschen Freiheitsbibliothek in den Saal mit der Mittelsäule hineinzutragen.
Im Spätherbst 1939 hatten Emilie Reber, Heinrich Mann sowie zwei Mitstreiter die literarischen Bestände der Freiheitsbibliothek in ein sicheres Versteck gebracht. Die Bibliothek war nach der Bücherverbrennung gegen das Vergessen und zum Erhalt der von den Nazis verfemten Deutschen Literatur 1934 von Exilanten unter dem Präsidenten Heinrich Mann in Paris gegründet worden.
Und jetzt waren die Bücher wieder hier, bei ihr. Mit Argusaugen achtete sie darauf, dass die Soldaten die Bücher sorgfältig behandelten, wies sie an, alle vorerst auf einem Tisch zu stapeln, zog weiße Handschuhe an, prüfte den Zustand eines jeden einzelnen Buches, freute sich über dieses und jenes, strich versonnen über die halblederne Erstausgabe von Thomas Manns „Zauberberg“, wog Goethes in einem Schuber gefasste Gesamtausgabe wie ein Neugeborenes in ihren Armen, konnte noch immer kein abschließendes Urteil über „den heiligen Trinker“ Joseph Roths fällen und legte Kafkas „Prozess“ liebevoll zur Seite, um ihn abends mit nach Hause zu nehmen und endlich wieder den Satz Das Gericht will nichts von dir. Es nimmt dich auf, wenn du kommst, und es entläßt dich, wenn du gehst lesen zu können. Das Gericht hatte sie für lange Zeit aufgenommen, nun war sie wieder ein freier Mensch.
*
In den nächsten Tagen trafen vier weitere Kleinlastwagen mit deutschen Büchern sowie Brettern für Regale und einem großen Tisch ein. Aus den Brettern ließ sie sich beim örtlichen Tischler Regale auf Maß anfertigen. Nebst dem Einrichten der künftigen Antiquariatsbuchhandlung besichtigte sie verschiedene Häuser, die ihr die französischen Behörden zuwiesen. Sie entschied sich für ein kleines Haus im „Dorf“, wie die Kleinstädter dieses Quartier nannten.
Das „Dorf“ lag oberhalb der eigentlichen Stadt am See, außerhalb der ältesten Stadtmauer. Es wurde beim Bau einer weiteren Mauer in den Bann der Stadt integriert – zum Schutz der Weingärten. Wein und Korn waren die wichtigsten Handelsgüter der seit dem Ende des 14. Jahrhunderts reichsfreien Stadt. Der Handel über den See – nach Konstanz, an die Ufer der Besitzungen der Fürstabtei St. Gallen, im Süden mit der Salzmacht Lindau – bescherte der Stadt großen Reichtum. Er machte den Ort so reich, dass die Einwohner aus Übermut den Mörtel für den Bau eines Kirchturms mit Wein anstelle von Wasser anrührten. Nach gut neunzig Jahren war das Mauerwerk derart alkoholisiert, dass der Turm in sich zusammenfiel. Seither bauten sie wieder mit Wasser.
Die „Greth“, ein riesiges Speicher- und Umschlaghaus, direkt am See gebaut, mit Einfahrluken zum Beladen und Löschen der Fracht der Lastkähne sowie einem riesigen Dachstock ist das markanteste Gebäude zur Seeseite hin. Es war ein weit sichtbares Symbol für die einstige Macht des Städtchens als Handelsplatz. In seinen gewaltigen Speichern im Dachstock konnten die Bürger weitaus größere Mengen an Waren länger lagern als die anderen Seeanrainer. Ein Umstand, der ihnen Dominanz über die Korn- und Weinpreise rund um den Bodensee verlieh.
Es kam den Kleinstädtern zugute, dass die Natur es auf der Schweizer Seite des Bodensees weniger gut mit Topografie und Bodenbeschaffenheit meinte, sodass den Untertanen der Grafen von Thurgau und des Klosters St. Gallen rasch einmal das Getreide ausging. Sie sperrten den Dachstock der Greth so lange zu, bis die Eidgenossen am anderen Ufer des Sees gezwungen waren, die überhöhten Preise zu bezahlen. Danach öffneten sie die Speicher, und die Menschen auf der anderen Seite des Sees konnten wieder Brot backen und die Stadtoberen einen weiteren Maler beauftragen, der ihnen einen der noch blanken Flecken der Ratshauswände verschönerte. Oder man hieß ihn zu übermalen, was oder wen man künftig nicht mehr sehen wollte.
An die innere wie äußere Stadtmauer hatten sich während der Jahrhunderte mehr und mehr Häuser angeschmiegt. Für eines von ihnen entschied sich Emilie Reber.
Es war ein kleines Haus mit fünf Zimmern, davon waren zwei so winzig, dass gerade ein Bett, ein Stuhl und eine Kommode darin Platz fanden, dafür verfügte es über eine großzügige Küche, die sich gegen eine überdachte Veranda öffnete, und einen großen Garten. Man sah über die Dächer, deren Biberschwanzziegel von den stadttypischen Staffelgiebeln zusammengehalten wurden, den See und das gegenüberliegende Ufer. Und an klaren Tagen das Alpsteinmassiv in seiner ganzen bedrückenden Pracht und den ewigen Schnee des Säntis.
Im Garten wollte sie hauptsächlich Lilien pflanzen. Lilien hatten etwas Aristokratisches. Und etwas Aristokratisches gebührte einer Buchhändlerin, einer Handelsfrau des Geistes, der Muse der Geschichten der menschlichen Seele, egal, ob durchdrungen von Hass oder getränkt in Liebe. Vielleicht würde sie auch ein bisschen Salat, den sie von Jahr zu Jahr kampfloser den Schnecken überlassen würde, sowie ganz sicher Basilikum, Rosmarin, Thymian und Lavendel anpflanzen. Der Geschmack der Kräuter würde sie ans Mittelmeer erinnern, als in den dunklen Stunden deren Duft, vermischt mit der Brise vom Meer, die ausgezehrte Hoffnung genährt hatte, irgendwann endgültig vom Gericht entlassen zu werden.
Das Haus wurde nach und nach mit Bauhausmöbeln ausstaffiert, und als endlich wieder Corbusiers Chaiselongue mit Fohlenfell ihr Wohnzimmer zierte und der Biedermeiertisch ihrer Oma, umgeben von den unverkennbaren Marcel-Breuer-Freischwingerstühlen aus dem Hause Thonet, in der Küche stand, war das Gericht weit weg, und sie fühlte sich endgültig von ihm entlassen und bereit, den Kampf gegen dessen noch vorhandenen Chimären anzutreten.
Das aktuelle Angebot ihrer Antiquariatsbuchhandlung verbreiterte sich nur zögerlich: Junge Autoren waren rar und die Amerikaner wie Ernest Hemingway oder Thomas Wolfe mit ihren „Storys“ ihr suspekt. Sie fragte sich, wie Hans Werner Richter in der ihr zu politischen und zu wenig literarischen Zeitschrift „Der Ruf“: Warum schweigt die Jugend?
Wo sind sie, all diese jungen Männer, die von der Hölle berichten könnten? Die dem Grauen tagtäglich in die Augen geschaut hatten? Die auf Befehl unvorstellbare Verbrechen begangen hatten? An der Front, hinter Stacheldraht, in Kellern oder an Schreibtischen? Wo waren die, die trotz Gewehrkugeln, Granatsplittern und Henkersstricken einen Rest streng gehüteter Menschlichkeit gegenüber den Opfern bewahrt hatten? Wo waren sie? Und wer von ihnen wollte überhaupt schreiben? Konnte schreiben – noch schreiben?
Doch da, plötzlich, war ein lauter, verzweifelter Schrei zu hören. Ein Hörspiel, das am 13. Februar 1947 vom Nordwestdeutschen Rundfunk ausgestrahlt, danach von Radiostation zu Radiostation bis in den tiefsten Süden Deutschlands getragen wurde und letztlich am 16. November auch Emilie Reber, zuerst sitzend, dann stehend und schließlich aufgewühlt vor dem Radioempfänger auf und ab gehend, erreichte.
Sie wusste sofort: Dieser junge Wolfgang Borchert, der war sie. Die Stimme dieser verlorenen, für immer gebrandmarkten Generation junger Männer, deren Heimat sich in geistigem Irrsinn und apokalyptischem Bombenhagel unwiederbringlich aufgelöst hatte.
Dieses Stück, „Draußen vor der Tür“, war das erste Werk seit langer Zeit, das für Emilie Reber wieder unter die Kategorie „Deutsche Literatur“ fiel. Gut, mit der Prosa ihrer Lieblinge Thomas Mann, Franz Kafka oder auch Theodor Fontane konnte sich die Sprache dieses jungen Mannes natürlich nicht messen. Diese ständigen Wiederholungen Seit gestern. Seit gestern heiße ich nur noch Beckmann. Einfach Beckmann. So wie der Tisch Tisch heißt oder Beckmann – sagte meine Frau zu mir. Einfach nur Beckmann. Und dabei war man drei Jahre weg. Beckmann sagte sie, wie man zu einem Tisch Tisch sagt. Möbelstück Beckmann. Stell es weg, das Möbelstück Beckmann missfielen ihr, waren nicht ihre Welt, diese verkrüppelten Sätze wie die verkrüppelten Körper mit den schamlos exponierten Geschlechtsteilen von Egon Schiele. Andererseits spürte sie die Kraft, die von diesen Wiederholungen ausging. Das war eine neue Stimme, das war 1947, der Krieg war aus, die todbringende Nazi-Ideologie besiegt, das waren die Worte gebrochener Kinder, wiederholt verwundet, eiternd, todgeweiht, ohne Zuhause – Sterben zwischen Schutthalden.
Das waren die Eindringlichkeit und die Kraft gesprochener Texte. Diese Eindringlichkeit rief Bilder in ihr hervor, die sie unkontrolliert vor dem Radio umhergehen ließen. Diesen Text musste sie sofort haben. Dieser Text war es, der auf eine neue, kommende Deutsche Literatur hinwies. Diesen Text brauchten die Bewohner des Städtchens. Dieser Text war wie Medizin. Bittere, wirksame Medizin!
Nur woher sollte sie ihn bekommen? War er überhaupt schon gedruckt? Wenn nicht, würde das sicher bald geschehen. Um diesen Text müssten sich die lizenzierten Verleger doch reißen? Aber würden sie für diesen Text überhaupt ein Papierkontingent bekommen?
Am anderen Tag telefonierte sie sich durch die französische Besatzungsverwaltung, bis ihr der Konstanzer Militärgouverneur Marcel Degliame versicherte: Der Rowohlt Verlag habe die Rechte am Text. Man habe sich erfolgreich darum bemüht, dass ein so wichtiger Text in der französischen Besatzungszone gedruckt werde. Und ja, Papier sei zugeteilt.
So bestellte sie gleich vierzig Stück bei Rowohlt in Stuttgart, obwohl das definitive Erscheinungsdatum noch unbekannt war, wie sie vom Verlag erfuhr. Das war ihr egal, wusste sie doch genau, wer diesen Text zu lesen hatte.
Als das schmale Bändchen mit dem Untertitel „Ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will“ endlich geliefert wurde, wollten es die Kleinstädter nicht kaufen. Sie dekorierte ihr Schaufenster damit, legte es im Laden an mehreren Orten auf, versuchte jede und jeden, die oder der ihre Antiquariatsbuchhandlung betrat, von dieser einmaligen neuen Stimme zu überzeugen, und davon, wie wichtig dieser Text gerade für die Heimkehrer sei. Er erzähle eingehend von deren seelischen Verwundungen und davon, wie zurückgestoßen sie sich fühlten, keinen Platz mehr in ihrem Zuhause fänden, weil man es ihnen weggenommen habe und man ihnen kein neues geben wolle. Man müsse sich dem stellen, was der Autor eindringlich tue, nur so könne man Schritt für Schritt diese schreckliche Vergangenheit bewältigen, was schleunigst zu tun sei, da sonst die notwendige Reinigung von der Nazi-Ideologie zu langsam vor sich gehe, sprach sie sich bei manchen Kunden den Mund fusselig. Einzig die Besitzerin eines Kleiderladens, von der ihr nur die grellrot geschminkten Lippen in Erinnerung blieben, und ein junger, schmächtiger Gymnasiallehrer kauften das dünne Bändchen. Die übrigen Kleinstädter winkten ab und fragten nach Unterhaltungsromanen.
Borcherts entsetzlicher Schrei schien die Herzen der Kleinstädter nicht zu erreichen. Niemand hörte ihn, niemand hörte Emilie Reber, versuchte sie Borcherts Ruf noch zu verstärken. Sie blieb auf dem eingekauften Posten sitzen. Nach zwei Jahren nahm sie das letzte Exemplar aus dem Schaufenster. Sie hatte auch ihren Stolz. Ignorantenpack.
*
„Sagen Sie mal, Frau Reber, die Bücher, na ja, und die Wohnung und, na ja, die Lokalität im alten Parteilokal, na ja, unter der Wirtschaft, Sie wissen schon, was ich meine, nicht?“
„Nein.“
„Na ja, dass Sie so einfach zu allem kommen, während unsereiner, na ja, Sie wissen schon.“
„Nein.“
„Na gut, dann lassen wir es.“
„Nein.“
„Also gut, Frau Reber, unser Bürgermeister, also der damalige Bürgermeister Spreng, der hat schon geschaut, dass es den Juden hier gut ging … also soweit das möglich war. Zwei haben den Krieg unversehrt überstanden. Und im KZ-Stollen, da waren längst keine Juden mehr dabei. Das waren alles Italiener, also die meisten, die anderen Russen, Slawen, zwei, drei Franzosen, aber keine Juden. Die Franzosen haben die verwesten Leichen aus dem Massengrab im Wald geholt und sie auf dem Adolf-Hi… also auf dem Landungsplatz ausgestellt. Die haben uns gezwungen, das anzusehen, gestunken hat das. Zwei Tage später mussten wir auch noch an der Trauerfeier teilnehmen, obwohl wir mit der ganzen Geschichte nichts zu tun hatten.“
„Ich nehme die zwei Eier da, dann geben Sie mir bitte noch von den frischen Zwiebeln und von diesem Kohl.“
„Der ist nicht mehr so frisch, den schenke ich Ihnen.“ Die Bäuerin rupfte die verwelkten Blätter ab und gab ihr den Kohlkopf.
„Aber, na ja, Sie können doch so gut mit den Franzosen.“
„Die Franzosen sind immer Menschen geblieben“, antwortete Emilie Reber streng.
„Ja, na ja“, zupfte sich die Bäuerin ihre verwaschene blaugraue Schürze zurecht, „das waren wir doch auch.“
Emilie Reber bezahlte, verweigerte das Wechselgeld mit einem barschen „Ist recht so“ und machte sich auf den Weg in ihre Antiquariatsbuchhandlung.
Der Vorfall hatte sich in der Kleinstadt herumgesprochen, bevor Emilie Reber die Türe zu ihrer Antiquariatsbuchhandlung aufsperren konnte.
Am Nachmittag kam der sportliche Beamte Zängler bei ihr vorbei, tat so, als würde er sich für Stefan George interessieren, fragte, ob sie auch Heimatdichter führe, und meinte dann trocken: „Sie sollten nicht überall gleich mit der Türe ins Haus fallen.“
„Seit wann gibt es auf dem Markt Türen? Falls Sie das meinen?“
„Seien Sie doch einfach ein bisschen netter. Das stünde Ihnen gut, glauben Sie mir.“
„Wie bitte?“
„Ja, stoßen Sie die Menschen hier nicht gleich vor den Kopf. Was meinen Sie, warum Sie bislang noch keinen Borchert verkauft haben?“
„Es war ein kalter Winter. Mit klammen Fingern zu lesen, ist keine gute Voraussetzung. Wollen Sie ein Exemplar?“
Zängler winkte ab.
„Der Text täte Ihnen aber gut!“
„Sehen Sie.“
„Ich bin nett genug. Waren Sie nett genug zu den Stollenhäftlingen?“
„Wir wurden nicht gefragt.“
„Sie kennen sich in diesen Räumlichkeiten aus, nicht?“
„Hören Sie mal!“
„Wie Sie die drei Treppenstufen hinuntergestiegen sind – nahezu … hinkend schlafwandlerisch.“
„Jetzt reicht’s … Sehen Sie, genau das meine ich.“
„Was meinen Sie denn?“
„Dass Sie immer jeden darauf hinweisen müssen.“
„Worauf denn? Auf das Hinken.“
„Ach was, auf das, was war. Wir müssen zur Ruhe kommen, das habe ich Ihnen Deutsch und deutlich gesagt. Haben Sie verstanden?“
„Leben Sie eigentlich schon immer hier am Bodensee?“
„Was soll das jetzt?“
„Leben Sie eigentlich schon immer hier am Bodensee?“
„Ja.“
„Und wenn er frieren würde?“
„Die letzte Seegfrörne war 1880.“
„Und wenn er frieren würde?“
„Über den Rhein würden die Wasser immer noch hineingetragen werden, sie würden tief unter dem See durchfließen und über den Seerhein wieder abfließen. So, wie sie es seit Tausenden von Jahren tun. Und daran können auch Sie mit Ihrer Fragerei nichts ändern.“
Emilie Reber drehte ihm den Rücken zu und ordnete eine soeben angelieferte Neuauflage von „Jugend ohne Gott“ unter H im Regal ein.
„Wie eine Leihbibliothek mit Lesestube sieht es hier aber nicht gerade aus.“
„Soll ich Ihnen einen Tee bringen, während Sie in der Lesestube, im Sessel, dort in der Ecke, den Borchert lesen?“
„Man kann nichts daran ändern, auch Sie nicht mit Ihren Franzosen. Also bleiben Sie bei Ihrer Leihbibliothek. Verleihen Sie romantische Unterhaltungsromane, die brauchen die Menschen jetzt, und richten Sie eine Kinderecke ein, dann wird alles gut“, sagte Zängler, stieg die drei Treppenstufen hoch und ließ die Türe ins Schloss knallen.
Am Abend schrieb Emilie Reber einen Brief an den Militärgouverneur der französischen Besatzungszone Marie-Pierre Kœnig, man solle sich doch mal mit einem Fritz Zängler genauer beschäftigen. Und – fügte sie an – sie wolle eine richtige Buchhandlung aufmachen und werde ein Doppel des entsprechenden Antrags dem Leiter der Abteilung für öffentliche Bildung, Raymond Schmittlein, zukommen lassen.
In den nächsten Wochen wurde sie öfter auf der Straße gegrüßt, in den Läden und an den Marktständen überhöflich bedient und die Kleinstadtverwaltung erfüllte jeden ihrer Wünsche. Sobald sie aber außer Hörweite war, den Laden verlassen oder die Türe der Beamtenstube hinter sich geschlossen hatte, zerrissen sich die Kleinstädter das Maul über sie: „Kommt daher und führt sich auf wie der Großherzog von Baden.“ – „Das war eine Fahnenflüchtige, die war sicher in Frankreich versteckt.“ – „Nein, sie war sogar in der Résistance, das hat mir ein Franzose gesagt.“ – „Sicher Jüdin, die denkt, jetzt könne man es uns zeigen, aber nicht mit uns.“
Natürlich kam ihr all das dumme Geschwätz zu Ohren, und sie machte sich einen Spaß daraus, die Gerüchte zu befeuern: Da bestätigte sie, dass sie Jüdin sei, dort, dass sie Zeugin Jehovas gewesen sei und daher hätte flüchten müssen, der Marktfrau erzählte sie, dass sie in Frankreich einen Wehrmachtsversorgungstrupp samt Besatzung und drei Mannschaftswagen in die Luft gesprengt hätte, oder der Bäckersfrau, dass sie am Grundlsee die Führerbibliothek betreut hätte und daher den Alliierten wichtige Tipps zur Ergreifung von Göring hätte geben können.
Anfänglich bereitete ihr das Spiel noch Vergnügen, dann gingen ihr die Ideen aus, und letztlich war sie sich auch nicht mehr sicher, ob sie damit nicht zu viel Verwirrung stiftete und sich selbst nur Schaden zufügte. Schließlich waren die Menschen hier ja ihre zukünftigen Kunden, und nochmals den Ort zu wechseln, kam für sie nicht infrage. Sie war angekommen, tief im Süden, wo man aber noch ihre Sprache sprach. Zwar nur am schwäbischen Meer, aber am Meer.
So setzte sie eine Woche später ihr Sonntagsgesicht auf, ging von Laden zu Laden, von Marktstand zu Marktstand und in die Bäckerei, entschuldigte sich, dass sie den Kleinstädtern keinen reinen Wein eingeschenkt habe, und nahm sich vor, damit rasch die ganze Stadt davon vernahm, der Bäckersfrau und der Friseurin Bruchstücke ihrer Geschichte zu erzählen: „Ich bin 1933 nach Paris emigriert und habe dort Arbeit in der Deutschen Freiheitsbibliothek gefunden, deren Präsident Heinrich Mann war. Als die Wehrmacht Paris besetzte, mussten sich alle deutschen Emigranten melden und wurden nach Geschlechtern getrennt in Radrennstadien gepfercht. Drei Wochen verbrachten wir da, dann wurden wir in den Süden, in das Konzentrationslager Gurs, gebracht. Von dort gelang mir die Flucht, und so lebte ich mehr oder weniger versteckt an der Küste von Südfrankreich. Eine traumhafte Gegend, sage ich Ihnen. Und das Meer, das Meer … aber der Bodensee ist auch schön, wirklich. Wie dem auch sei, als die Wehrmacht ganz Frankreich besetzte, ging ich in den Untergrund und schloss mich der Résistance an. Und jetzt bin ich hier, weil ich eine Buchhandlung eröffnen wollte, im Süden, am Meer, in meiner Sprache.“
„Aber es ist doch eine Leihbibliothek?“, fragte die Bäckersfrau.
„Jetzt noch. Es wird aber eine richtige Buchhandlung werden. Mit Antiquariat, solange wie nötig. Der Antrag ist bereits unterwegs.“
„In dem Haus, in dem Sie jetzt sind?“
„Ja, das eignet sich perfekt. Meine Bücher werden den geistigen Schmutz, der sich über die Jahre angesammelt hat, nach und nach vertreiben.“
„Wissen Sie, wir hatten ja sehr viel Glück, dass wir nicht zerbombt worden sind. Ein wenig bei der Eisenbahn vorne, der Gustav hat da sein Leben gelassen, aber sonst sind wir wohl davongekommen. Jetzt hoffen wir einfach, dass nicht noch mehr Flüchtlinge in unser Städtchen kommen. Die Schlesier, Sudeten, Siebenbürger sind nicht wie wir. Die haben auch viel zu viel getan für den Krieg. Die will niemand mehr.“
„Aber Sie haben Glück gehabt? Und immer noch. Ihnen geht es ja gut?“
„Ja, wir haben auch alle nicht so recht mitgemacht. Auch mit den Juden haben wir nichts gemacht. Ja, wir haben schon ein Glück gehabt. Wir machen wieder mal ein Milchbrot. Soll ich Ihnen ein Stück reservieren?“
„Ja gerne.“
„Verleihen Sie auch Unterhaltungsromane oder Liebesgeschichten? Wir könnten ja ein Tauschgeschäft machen. Buch gegen Milchbrot! Was meinen Sie, Frau Reber?“
„Kommen Sie doch einfach bei mir vorbei, es wird sich sicher was finden.“
„Das ist gut, man braucht jetzt auch wieder mal was fürs Gemüt und die Seele.“
„Genau, darum bin ich da. Können Sie eine Zucker- anstelle einer Brotmarke gebrauchen? Ich selbst brauche praktisch keinen Zucker.“
„Oh“, strahlte die Bäckerin, „da wird das Milchbrot gleich viel besser.“
*
„Ist das Wasser warm genug?“, fragte die Friseurin.
„Ja, wunderbar!“, antwortete Emilie Reber.
„Da haben Sie aber ein gefährliches Leben gehabt.“
„Ja, manchmal wurde es richtig ungemütlich.“
Die Friseurin war noch in der Lehre, ein junges, hübsches Mädchen mit Händen, die beim Einmassieren der Seife durch die Kopfhaut fast bis in die Seele greifen konnten. Emilie Reber gab sich ganz dieser wohltuenden Kopfmassage hin.
„Schlafen Sie mir aber nicht ein“, hörte sie die Friseurin wie in einem Traum sagen. „Daher hatten Sie auch gleich eine Menge Bücher, als Sie hierherkamen. Von dieser Freibücherei …“
„Freiheitsbibliothek.“
„Dieser Freiheitsbibliothek.“ „
Nicht ganz, die Nazis haben zerstört, was wir nicht in Sicherheit bringen konnten.“
„Aber wie kamen die Bücher denn alle nach Paris? Nach einem Jahr schon 11.000 Stück, 11.000, das haben Sie doch gesagt, oder nicht?“
„Ja, die haben halt viele, die Deutschland verlassen mussten, mitgebracht, geschmuggelt.“
„Aber 11.000 Stück, die alle verboten waren, in einem Jahr?“
„Es gibt Menschen, viele Menschen, die hegen ihre Bücher wie einen Schatz. Sie lieben sie, als wären es die eigenen Kinder. Sie sind wie Kinder: ein Fenster, durch das man die Welt anders sehen kann. Vorausgesetzt natürlich, man ist offen dafür.“
„Also ich habe nie viel gelesen. Die Landserhefte, die meine Freundinnen gelesen hatten, waren doch immer das Gleiche, genau wie die Fliegergeschichten. Ich habe auch den Führer nie richtig gemocht, obwohl ich ihn doch hätte lieben müssen. Aber wie kann man einen lieben, der ein ganzes Radio zum Bellen bringt, wenn er spricht.“
„Man muss nie, nie jemanden lieben müssen. Das geht gar nicht.“
„So, jetzt können Sie aufstehen und auf dem Frisierstuhl Platz nehmen.“
„Kommen Sie mal vorbei, ich habe sicher etwas für Sie, das Ihnen gefallen tät.“
„Was für eine Frisur wünschen Sie eigentlich? Einfach ein wenig nachschneiden? Oder so, dass Sie die Haare gut wachsen lassen können?“
„Einfach nachschneiden. Die bleiben kurz, für immer.“
„Aber kurz tragen wenige.“
„Ist bequem. Musste ich in der Résistance so tragen. Man wusste ja nie, wann man plötzlich ein Mann sein sollte.“
„Wollten Sie schon mal ein Mann sein?“
„Nein. Oder vielleicht ein, zwei Mal, als es mir an körperlicher Kraft fehlte.“
„Ich bin froh, dass ich kein Mann bin. Sonst hätte ich mit einem krummen Karabiner in der Hand noch das zerbombte Friedrichshafen verteidigen müssen.“
„Wir bleiben Frauen. Auch mit kurzen Haaren. N’est-ce pas?“
„Oui! Das Einzige, was ich auf Französisch kann“, lachte die Friseurin. „Aber sagen Sie, Frau Reber, ich weiß nicht so recht, ob ich für die Bücher, die Sie ausleihen, gescheit genug bin.“
„Jede und jeder ist gescheit genug, um ein gutes Buch zu lesen. Man muss es nur wollen.“
*
Es war der langersehnte Brief, den ihr der Postbote an diesem regnerischen Tag überbrachte. Er war von der „Direction de l’Éducation Publique“, von General Raymond Schmittlein persönlich.
Die Direktion versicherte ihr, dass ihr Antrag zur Führung einer Buchhandlung von der französischen Militärverwaltung grundsätzlich gutgeheißen würde, aber es gebe noch einige ansässige Stimmen in der Stadt, die ihrem Vorhaben kritisch gegenüberstünden, wie sie aus beiliegender Briefkopie entnehmen könne.
Fünfzehn Minuten später knallte sie die beigelegte Kopie Zängler auf den Tisch.
„Sie kennen dieses Schreiben. Haben Sie das geschrieben? Haben Sie geschrieben: ‚Frau Reber hat mit Täuschungen und Umgehung der Bestimmungen ihren Laden zu einem Buchverkaufsladen gemacht und vorzeitig geführt.‘ Oder: ‚In den vergangenen Jahren wurden Anträge von Personen, die politisch und fachlich einwandfrei sind, abgelehnt mit der berechtigten Begründung, dass kein Bedarf vorhanden sei. Und jetzt soll plötzlich Bedarf da sein?‘“
Fritz Zängler starrte sie schweigend an.
„‚In der Zeit vor Weihnachten war der Laden Reber keine Leihbibliothek mehr, sondern eine Buchhandlung. Die Leihbibliothek war immer nur Tarnung und Täuschung!‘“
Fritz Zängler schwieg. Emilie Reber ging ans Fenster, schaute durch den Regen auf den See, dessen Oberfläche zu tanzen schien.
„Wahrlich kein Segelwetter“, hörte sie Zängler sagen.
Emilie Reber drehte sich um, ging zu Zänglers Schreibtisch, stützte sich darauf und sprach ihn leise an: „Sie werden das jetzt aus der Welt räumen, und ich werde meine Leihbibliothek mit Lesestube in eine Buchhandlung mit Antiquariat umwandeln. Und sollte ich das dafür notwendige Papier nicht in den nächsten Tagen erhalten, werde ich die französische Militärregierung bitten, jede noch so kleine Aktennotiz, auf der Ihr Name steht, zu suchen und diese so lange hin und her zu drehen, bis sie etwas gegen Sie gefunden hat.“
Sie nahm den Brief von Zänglers Pult, steckte ihn ein und verließ Zänglers Büro, ohne die Tür hinter sich zu schließen. Was sie noch hörte, war, wie er wütend in den Gang hinaus nach einer Schreibkraft rief.
Seit sie zwei Tage nach ihrem Auftritt bei Zängler die Bewilligung zur Führung einer Buchhandlung erhalten, die Durchschrift davon an ihr Schaufenster geklebt sowie die Kleinstädter mit einer glaubhaften Geschichte ihrer Vergangenheit gefüttert und damit einen schlüssigen Nachweis ihrer Privilegien geliefert hatte, wuchs das Zutrauen zwischen den Bewohnern der Kleinstadt und Emilie Reber nicht gerade zügig, aber doch stetig.
So bewegte sich Emilie Reber in der beinahe unzerstörten mittelalterlichen Kleinstadt, die in der Renaissance eine italienische Note in Form einer neuen Marktplatzgestaltung und einem großen Palais bekommen hatte, immer lieber und selbstverständlicher. Auch die Kleinstädter legten mehr und mehr ihre Scheu ab, betraten in kontinuierlich steigender Zahl ihr Geschäft und ließen entweder die Gier nach der von den Nazis verbotenen Literatur stillen oder sich die Angst davor nehmen.
Anfänglichen Enttäuschungen über bei ihr nicht erhältliche Unterhaltungsromane überwand sie mit geschickten Einführungen über, wie sie es nannte, leichte Literatur. Zum Beispiel über den einige Jahre am See wohnhaften Hermann Hesse, den sie – bis auf den „Steppenwolf“ – als ewig pubertierenden Kitschautor betrachtete, oder über die Kinderbücher und Gedichte von Erich Kästner, der in Berlin zugesehen hatte, wie die Nationalsozialisten seine Werke ins Feuer geworfen hatten, aber auch über die wunderbaren Reisereportagen von Egon Erwin Kisch, welche die Kleinstädter zum Träumen brachten.
Wer was kaufte oder auch nicht, vermerkte sie auf sorgsam angelegten Karteikarten. Pro Person legte sie drei Karten mit folgenden Überschriften an: „Persönlichkeit“, „Verknüpfungen“ und „Leseweg“.
Unter „Persönlichkeit“ beschrieb sie den Charakter des Kunden, so wie sie ihn empfand. Dabei schreckte sie weder vor Einträgen von Mutmaßungen über Gefühlslage und Vergangenheit noch vor psychologischen Interpretationen zurück. Diese Einträge wurden bei jedem Besuch der Kundin oder des Kunden ergänzt, falsche Eindrücke korrigiert oder sich in ihrer Wahrnehmung als richtig erweisende vertieft. Bei manchen konnte sie nicht widerstehen, körperliche Merkmale wie „fehlt ein Bein“, „hat sehr eng stehende Augen“, „trägt das Haar zu lang“ bis geradezu frivole Bemerkungen wie „trägt links“ oder „hat einen hübschen Hintern“ zu notieren. Letztere allerdings in einer stenografischen Geheimschrift, die außer ihr und ein paar Résistanceveteranen wohl niemand lesen konnte.
Auf der Karte „Verknüpfungen“ notierte sie verwandtschaftliche, berufliche sowie freund- und feindschaftliche Beziehungen innerhalb der Kleinstadt.
„Leseweg“ unterteilte sie in drei Rubriken: „Bereits gelesen“, „Gekauft“ und „Zu lesen“. Sie erkundigte sich bei allen Kunden zuerst immer nach bereits Gelesenem, was gefallen hatte, was begeistert hatte, und warum sowie was bereits nach wenigen Seiten weggelegt worden war. Unter „Gekauft“ fielen die Bücher, die sie verkauft hatte, und unter „Zu lesen“ wurden Titel aufgelistet, welche die jeweilige Person als Nächstes lesen sollte.
Waren mehrere Kunden gleichzeitig im Geschäft, ließ sie sich dadurch nicht abhalten, nach jedem Verkauf oder jeder Beratung fein säuberlich in ihren weißen Handschuhen ihre Notizen zu machen. So viel Geduld musste aufbringen, wer von ihr auf der individuell vorgezeichneten Via Dolorosa zu Thomas Manns Sanatorium Berghof auf dem Zauberberg geführt werden wollte.
Schon nach kurzer Zeit wusste sie über die Leserinnen und Leser der Stadt mehr oder weniger Bescheid. Dazu kamen noch die Urlaubsgäste, die von Jahr zu Jahr zahlreicher wurden, und Menschen, denen es aufgrund ihres persönlichen Schicksals oder ihrer Rolle in Nazideutschland ratsam erschien, fernab von alten und neu entstehenden Zentren ein möglichst ruhiges und unauffälliges Leben zu führen.
Die Stadt wie auch die gesamte Bodenseeregion hatte eine große literarische Tradition. Viele Schriftsteller, Dichter und Dramatiker hatten an den Gestaden des schwäbischen Meers Inspiration, Melancholie oder anders gestaltete Lebensentwürfe gesucht. Genauso wie Maler, Tänzer, Bildhauer, Musiker, aber auch Sekten, Naturheilkundler, Veganer und Esoteriker, kurz das ganze wahrheitssuchende Treibgut, welches aus den tiefgeistigen Strömungen rund um die Jahrhundertwende aufgetaucht und letztlich an die Ufer des Bodensees gespült worden war.