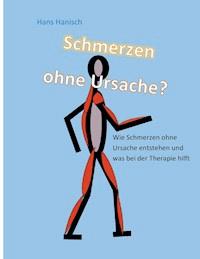
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Beschwerden am Bewegungsapparat hat wohl jeder einmal im Leben. Für den Betroffenen wird es dann problematisch, wenn keine Ursache festgestellt werden kann. Das ist (je nach Studie) bei bis zu 85% der Rückenschmerzen der Fall. Die Folgen sind unbefriedigende Therapieergebnisse, Ungewissheit über den eigenen Gesundheitszustand und natürlich Einschränkung der Lebensqualität. In diesem Buch werden die Beschwerden mit einem neuen Denkansatz erklärt. Der Umgang mit dem Problem wird durch das Wissen um die Ursache erleichtert, die Beurteilung einer Therapie ermöglicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Schmerzen ohne Ursache
Bewusst oder unbewusst, das ist die Frage
Das unbewusste Muskelspiel
Der äußere Einfluss
Das Problem
Die Praxis
F
unktioneller Beinlängenunterschied
D
ie Gewichtsverlagerung nach vorne
Das Hohlkreuz
Becken und Beine
Becken, Lendenwirbelsäule
Rücken
Hals und Kopf
Differenzdiagnosen
Der Fuß
Das Knie
Die Hüfte
Der Bandscheibenvorfall
Spinalkanalstenose
Schulter
Ellbogen, Unterarm
Hand
Die Therapie
Selbsthilfe
Kinder
Mögliche Ursprungsorte für Symptome
Literatur
Vorwort
Den Schmerz mit unbekannter Ursache im Bewegungsapparat gibt es tatsächlich. Und er ist noch dazu sehr häufig. Die Ursache von Rückenschmerzen kann nur bei etwa 15% der Fälle bestimmt werden. Bei allen anderen Fällen ist eine zielgerichtete Therapie nicht möglich, da die Ursache unbekannt ist. Wenn sich also der Körper nicht selbst helfen kann, werden sich chronische Schmerzen einstellen. Das ist umso unangenehmer, als der Betroffene ja nicht weiß, warum es ihn so quält. Hier soll eine mögliche Ursache für viele Probleme des Bewegungsapparates dargestellt werden. Es soll dazu dienen, dem Betroffenen eine nachvollziehbare Erklärung für seine Probleme zu geben.
Mit diesem Verständnis sollte der Betroffene auch besser in der Lage sein, mit seinen Problemen umzugehen. Auch das Hinterfragen und Beurteilen von Therapie-Ansätzen wird durch ein besseres Verständnis der Probleme möglich. Insbesondere bei chirurgischen Eingriffen, die oft zu pauschalisiert eingesetzt werden, ist ein solches Hinterfragen sicher von Vorteil. Auf jeden Fall soll bei den chronischen Beschwerden die Hoffnungslosigkeit („das sind halt Abnutzungen, damit müssen Sie leben!“) beseitigt werden. Durch die Gliederung des Inhaltes nach Körperteilen kann das Buch auch zum Nachschlagen bei einem Problem genutzt werden.
Andererseits habe ich die Hoffnung, dass vielleicht auch Fachleute hier Informationen finden, die die eine oder andere Idee hervorbringen. Die Probleme mit „Schmerzen ohne erkennbare Ursache am muskuloskelettalen System“ sind vielfältig und bedürfen einer Verbesserung der Diagnosestellung und Behandlung. Ich habe mich bemüht, wissenschaftliche Tatsachen mit Literaturhinweisen zu belegen und meine Schlussfolgerungen und Meinungen textlich erkennbar zu machen. Die Hochziffern im Text beziehen sich auf die unter „Literatur“ genannten Quellen.
Das hier geschriebene kann allerdings die Diagnose und Behandlung durch den Arzt oder Heilpraktiker nicht ersetzen. Ebenso wenig lässt sich eine Therapie (in Selbsthilfe) ableiten. Dosierungen und Anwendungen sind durch fachlich entsprechend Ausgebildete den individuellen Voraussetzungen anzupassen. Eine Haftung für Folgen aus Hinweisen, die in diesem Buch gemacht werden, kann weder der Autor noch der Verlag übernehmen.
Im Februar 2017
Hans Hanisch
Schmerzen ohne Ursache
Beschwerden am Bewegungsapparat sind häufig. Jeder hat schon einmal Rückenschmerzen, Ischias oder auch nur einen Muskelkater gehabt. Kennt man die Ursache (z.B. beim Muskelkater), kann man damit umgehen. Ein bisschen Wärme, vielleicht noch eine Salbe und spätestens nach ein paar Tagen ist alles vergessen. Anders sieht es aus, wenn die Schmerzen ohne ersichtlichen Grund einsetzen und nach Wochen immer noch quälen. Der Gang zu den Ärzten ist erfolglos. Röntgen, MRT, Blutbild usw. sind ohne Befund. Es bleibt die Verunsicherung und der immer wiederkehrende Schmerz.
Diese Situation ist nicht selten. Für Rückenschmerzen liegen einige Statistiken vor. Nach dem Themenheft „Chronische Schmerzen“ (Gesundheitsberichterstattung des Bundes)3 hatten 50 bis 60 % der Befragten im letzten Jahr Rückenschmerzen. Nach anderen Quellen treten lebenslang bei 60 bis 85 % der Menschen Rückenschmerzen auf. Bei 85 % der Rückenschmerzpatienten kann keine Ursache für die Schmerzen benannt werden.3 Dies gilt auch für andere Bereiche des Bewegungsapparates, wenn da auch weniger statistische Daten vorliegen. Der „Ischias“ ist eine Nervenreizung des Nervus ischiadicus, die (unter anderem) Schmerzen im Bein bis zum Fuß verursachen kann. Mit der Diagnose „Ischialgie“ ist dann zwar die Nervenreizung, aber nicht die Ursache des Reizes bestimmt. Und diese Ursache ist auch bei der Ischialgie oft nicht erkennbar.
Eine Therapie der Schmerzursache ist also nicht möglich, da diese Ursache ja nicht bekannt ist. Es bleibt nur übrig, den Schmerz selbst zu therapieren. Die Therapie besteht in der Hauptsache darin, dass die Nerven mit Schmerzmitteln abgeschaltet werden. Die einhergehenden Muskelverspannungen werden mit Krankengymnastik und Muskelrelaxantien behandelt. Zunehmend wird auch die Psyche als Verursacherin, zumindest als Unterstützerin des Problems gesehen. Damit kommen in der Behandlung auch Antidepressiva ins Spiel. Der Behandlungserfolg insgesamt ist bekanntermaßen äußerst begrenzt.1
Diese Situation führt dazu, dass eine Vielzahl von Behandlungsmethoden, Trainingsgeräten, Medizinprodukten, Medikamenten usw. existieren, unter denen der Betroffene wählen kann. Diese Qual der Wahl wird durch mehr oder weniger glaubhafte Argumentationen mit mehr oder weniger wissenschaftlichen Beweisen unterstützt. Ob die Anwendung einen Vorteil bringt, kann nur der Patient, leider erst nach der Anwendung, beurteilen. Der Vorteil kann in der Linderung der Symptome bestehen. Unter einer Heilung verstehe ich das Ausbleiben der Symptome auch nach Absetzen der Behandlung! Eine zur Heilung führende Behandlung kann also nach einer begrenzten Anzahl von Anwendungen abgesetzt werden, ohne dass die Symptome zurückkehren. Mehr darüber im Kapitel „Therapie“.
Die Schwierigkeit, eine Diagnose zu stellen, liegt wohl in der Systematik. Da der Arzt eine wissenschaftlich bekannte Krankheit diagnostizieren muss (nur die kann er dann auch abrechnen), ordnet er die Symptome einer dieser Krankheiten zu. Diese Krankheiten sind in der Liste „ICD 10“ von der WHO (Welt-Gesundheits-Organisation) erfasst. Hat er eine Krankheit mit den entsprechenden Symptomen gefunden (Verdachtsdiagnose), bestätigt er die Diagnose durch eine entsprechende, in Leitlinien festgelegte Untersuchung (Röntgen, Blutbild usw.). Damit wird die Untersuchung der Funktion, die zu den Symptomen führt, in den Hintergrund gedrängt. Es genügt ja, wenn das Röntgenbild so aussieht, wie es für die entsprechende Krankheit nach der Leitlinie aussehen muss. Weitere Untersuchungen würden das Ergebnis weder für die Diagnose noch für die Therapie verändern. Die Untersuchung der Fehlfunktion, die zu einem Krankheitsbild führt und die Beschreibung des Krankheitsbildes ist demzufolge eher Aufgabe der Forschung.
Für die zur Erforschung des Problems „Schmerzen ohne Ursache“ ist es zunächst erforderlich, die Funktion des Bewegungsapparates zu beschreiben. Das sieht dann etwa so aus: Das ausführende Organ ist das Muskel-Skelett-System mit Muskeln, Knochen, Gelenken, Bändern usw., das Fachgebiet des Orthopäden. Die Funktion (Bewegung und Haltung) wird in der Sportmedizin und Biomechanik untersucht. Die Steuerung des Ganzen geht von Gehirn und Rückenmark aus und wird über die Nerven durchgeführt, was den Neurologen beschäftigt. Vier Fachrichtungen sind also nötig, um die Funktion des Bewegungsapparates zu verstehen. Umso schwieriger wird es, wenn in diesem System eine Fehlfunktion auftritt. Eine durch ein fehlerhaftes Nervensignal ausgelöste Muskelverspannung wird zu Muskelschmerzen führen (wie das zustande kommen kann, ist im nächsten Kapitel beschrieben). Mit dem Symptom „Muskelschmerz“ beschäftigt sich der Orthopäde. Er wird die Ursache „verspannter Muskel“ feststellen und mit entsprechender Therapie den Muskel lockern. Der Erfolg tritt sofort ein, der gelockerte Muskel schmerzt nicht mehr. Da aber das Nervensignal weiter besteht, stellt sich die Verspannung und damit der Schmerz schnell wieder ein. Also ist der Muskel zu schwach und verspannt sich deshalb über die Norm. Der Patient soll den Muskel trainieren. Auch hier stellt sich der Erfolg ein, da durch die Bewegung der Muskel gelockert wird. Allerdings führt das Absetzen des Trainings auch schnell wieder zu Muskelschmerzen.
Der momentane Stand (2016) ist wohl der, dass eine Krankheit „chronischer Schmerz“ eingeführt und dafür eine interdisziplinäre Therapie entwickelt wurde. „Interdisziplinär“ heißt hier, dass aus den beteiligten Disziplinen die Therapien zusammengefasst wurden und so ein „ganzheitlicher“ Ansatz entstanden ist. Die Neurologen haben ein Schmerzgedächtnis entdeckt, das durch massiven Schmerzmitteleinsatz gelöscht wird. Der Orthopäde setzt manuelle Behandlungen und Gymnastik ein, der Psychologe rundet die Therapie mit Antidepressiva, Gruppentherapie und Stressbewältigung ab. Die Erfolgsquote der Schmerzbehandlung ist mir nicht bekannt. Allerdings habe ich einige Patienten, die nach dieser Behandlung zu mir gekommen sind.
Bewusst oder unbewusst, das ist die Frage
Wie funktioniert das Gehen? Wie verlagern wir das Gewicht, um ein Bein nach vorne zu bewegen? Diese Fragen kann kein Mensch aus seiner eigenen Erfahrung und Empfindung beantworten. Erst recht können wir die Muskulatur nicht bewusst so steuern, dass „Gehen“ dabei herauskommt. Wir wollen unseren Standort verändern und gehen einfach los. Es existiert offensichtlich etwas in uns, das diese standardisierten Abläufe automatisch steuert, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen.
Diese Programmierung besteht nicht von Geburt an. Das Kind muss erst stehen und laufen lernen. Zwar existieren bei der Geburt bereits Muskelreaktionen, die Reflexe, aber sie sind noch weit von sinnvollen Bewegungsabläufen entfernt. Stellt man einen Säugling auf die Füße, setzt er ein Bein nach vorne, er macht einen „Schritt“. Das nennt sich Schreitreflex. Gesteuert wird dieser Reflex wahrscheinlich durch einen „central pattern generator“, der wissenschaftlich an Tieren nachgewiesen wurde. Das ist eine Verschaltung von Nerven im Rückenmark, die rhythmische Bewegungsmuster (z.B. Atmen) erzeugt. Aber zu einer selbstständigen Fortbewegung gehört natürlich weit mehr als dieser Reflex. Erst wenn das Kind gelernt hat, auf eigenen Füßen zu stehen, also das Gleichgewicht zu halten, wird es in der Lage sein, den komplexen Vorgang „Gehen“ zu lernen.
Die Haltungen (Sitzen, Stehen) und Bewegungsabläufe müssen also erst eingeübt werden. Das funktioniert über Wiederholung des Vorgangs. Die Fähigkeit zur Einübung eines Bewegungsablaufes bleibt ein Leben lang erhalten. Wir haben also Erfahrung mit dem „Einprogrammieren“ von Bewegungsabläufen und können diese Erfahrungen auch beschreiben. Einige Phänomene sind deutlich wahrnehmbar.
Am Anfang ist es kompliziert und erfordert volle Aufmerksamkeit. Das bewusste Denken ist zur Steuerung erforderlich. Mit der Anzahl der Ausübungen lässt die erforderliche Konzentration immer mehr nach, bis der Vorgang automatisiert ist. Man kann beim Gehen über Dinge nachdenken, die mit Fortbewegung nicht das Geringste zu tun haben.
Die ersten Übungen brauchen Zeit. Je öfter die Übung ausgeführt wurde, umso flüssiger und schneller wird der Ablauf. Die bewusste Steuerung geht deutlich langsamer vor sich, als die unbewusste, automatisierte.
Aller Anfang ist schwer - die ersten Übungen sind anstrengend. Mit der Zeit wird die Übung immer leichter, weil die Muskulatur immer effektiver eingesetzt wird, Haltung und Abläufe automatisch optimiert werden.
Das „Programmieren“ ist also zunächst ein bewusstes Experimentieren. Das Ergebnis jedes Experiments führt in der nächsten Übung zur Verbesserung des Ablaufs. Mit jeder Übung wird der unbewusst gesteuerte Anteil größer, bis der Muskeleinsatz optimal ist und die Steuerung völlig unbewusst abläuft. Ein so einprogrammierter Bewegungsablauf, respektive Haltung, wird mit geringstmöglicher Muskelspannung ausgeführt. Muskelverspannungen sind hier nicht vorhanden. Es ist der physiologische Normalzustand, bei dem keine Beschwerden auftreten. Ein Kind, das stehen lernt, wird irgendwann auf den Fersen stehen, weil dann die tragenden Knochen senkrecht übereinander stehen und das Körpergewicht tragen. Die Muskulatur muss nur noch Schwankungen ausgleichen. Dieser Vorgang ist nur am Anfang Folge einer bewussten Überlegung, geht aber schnell in eine völlig unbewusst ablaufende Optimierung über.
Das unbewusste Muskelspiel
Jede Haltung des Körpers erfordert Muskelkraft. Die Muskelspannungen fixieren die Lage der Gelenke und damit die Haltung. Normalerweise nimmt man weder die Spannung wahr noch wird sie bewusst gesteuert. Offensichtlich existiert auch hier ein unbewusster neurologischer Mechanismus, der die Steuerung der Muskulatur übernimmt. Da auch die Haltung eingeübt werden muss (Kind lernt stehen) scheint der neurologische Mechanismus für Haltung und Bewegung zumindest funktionell gleich zu sein. In der Wahrnehmung wird aber die Bewegungssteuerung im Vordergrund stehen, weil im Leben ungleich mehr Bewegungsabläufe einprogrammiert werden als Haltungen.
Der äußere Einfluss
Der beschriebene Automatismus eignet sich bis jetzt nur für bestimmte Verhältnisse. Das Programm „Gehen“ eignet sich nur für einen ebenen, glatten Boden. Eine 2 cm hohe Türschwelle kann schon zum Stolpern führen, wenn man sie im Dunkeln nicht wahrnimmt. Sieht man die Schwelle, hebt man das Bein innerhalb des Programms etwas höher an und überschreitet die Schwelle. Dieser Vorgang ist weitgehend unbewusst. Das Gespräch, das man dabei führt, wird nicht beeinträchtigt. Offensichtlich beeinflussen Signale von den Sinnesorganen die Steuerung von Haltung und Bewegungsablauf. Das Gleichgewicht im Stehen ist eine wissenschaftlich oft untersuchte Situation. Menschen mit defektem Gleichgewichtsorgan (im Ohr) können das Gleichgewicht fast ebenso gut halten, wie Gesunde.4 Es werden also noch andere Informationen zur Steuerung des Gleichgewichts genutzt. Drucksensoren in den Fußsohlen zeigen Gewichtsverlagerungen des Körpers und damit Änderungen im Gleichgewicht. Mit den Augen nehmen wir nicht nur unsere Umgebung wahr, sondern auch unsere Lage im Raum. Geringfügige Änderungen dieser Lage führen schon zu einer Korrektur der Körperhaltung und damit zur Erhaltung des Gleichgewichts. All diese Informationen und wahrscheinlich noch einige mehr werden zum größten Teil unbewusst verarbeitet und zur Steuerung des Gleichgewichts verwendet.4, 8 In einem 3D-Kino habe ich einen Film von einer Achterbahnfahrt gesehen. Es entstand der Eindruck, als säße man in dem Wagen. Alle Zuschauer (einschließlich ich selbst) haben sich unwillkürlich in die Kurve gelegt, weil sie unbewusst die (natürlich nicht vorhandene) Fliehkraft erwarteten.
Das Gleiche gilt für die Steuerung von Bewegungsabläufen. Zumindest hier haben auch Lagesensoren in den Gelenken, Spannungssensoren in Muskeln und Sehnen Einfluß.2 Ohne diese Informationen könnte beim Lernen kein Optimierungsprozess stattfinden.
Fazit





























