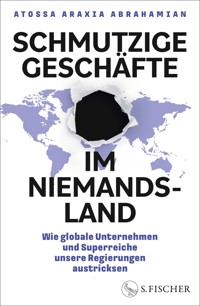
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie Geld nationales Recht aushebelt »Auf ihren Reisen in verschiedene Teile der Welt beschreibt Abrahamian die heimtückisch miteinander verbundenen globalen Regime der Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Dabei [...] beleuchtet sie auf brillante Weise unsere politische Sackgasse.«Pankaj Mishra Freihandelszonen, die von Steuergesetzen ausgenommen sind. Offshore-Haftanstalten, in denen Menschen auf unbestimmte Zeit inhaftiert werden. Charter-Städte, die von multinationalen ausländischen Unternehmen kontrolliert werden. Schiffe, die unter falscher Flagge fahren. All diese Orte bilden das Niemandsland. Hier gelten die Rechte und Gesetze nicht, die in den uns bekannten Nationalstaaten bestehen. Und das nutzen die Wohlhabenden und Mächtigen zu ihrem Vorteil. In einer fesselnden Investigativreportage, in der sie uns rund um den Globus führt, verfolgt die Journalistin Atossa Abrahamian die Entstehung und Entwicklung dieses verborgenen Universums. Sie enthüllt die schmutzigen Geschäfte preisgekrönter Ökonomen, exzentrischer Theoretiker und visionärer Berater und zeigt, wie diese letztendlich die globale Ordnung bestimmen. »Spannend, scharfsinnig und nachdenklich.«Daniel Immerwahr »Faszinierend – liest sich wie ein Roman.«Anne-Marie Slaughter
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Atossa Araxia Abrahamian
Schmutzige Geschäfte im Niemandsland
Wie globale Unternehmen und Superreiche unsere Regierungen austricksen
Über dieses Buch
Freihandelszonen, die von Steuergesetzen ausgenommen sind. Offshore-Haftanstalten, in denen Menschen auf unbestimmte Zeit inhaftiert werden. Charter-Städte, die von multinationalen ausländischen Unternehmen kontrolliert werden. Schiffe, die unter falscher Flagge fahren. All diese Orte bilden das Niemandsland. Hier gelten die Rechte und Gesetze nicht, die in den uns bekannten Nationalstaaten bestehen. Und das nutzen die Wohlhabenden und Mächtigen zu ihrem Vorteil.
In einer fesselnden Investigativreportage, in der sie uns rund um den Globus führt, verfolgt die Journalistin Atossa Abrahamian die Entstehung und Entwicklung dieses verborgenen Universums. Sie enthüllt die schmutzigen Geschäfte preisgekrönter Ökonomen, exzentrischer Theoretiker und visionärer Berater und zeigt, wie diese letztendlich die globale Ordnung bestimmen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Atossa Araxia Abrahamian, geboren 1986, ist eine in New York lebende schweizerisch-iranisch-kanadische Journalistin. Aufgewachsen ist sie in Genf, wo ihre vorliegende Reportage ihren Anfang nimmt. Sie ist leitende Redakteurin bei »The Nation«, ehemalige Redakteurin bei »Al Jazeera America« und ehemalige Wirtschafts- und Nachrichtenreporterin bei Reuters. Ihre Reportagen erscheinen unter anderem in der »New York Times«, im »New York Magazine« und im »Guardian«.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »The Hidden Globe. How Wealth Hacks the World« im Verlag Riverhead Books, einem Imprint von Pengiun Random House LLC
© 2024 Atossa Abrahamian
Für die deutsche Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung: Shutterstock
ISBN 978-3-10-491384-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Motto
Einführung
Kapitel 1: Stadt mit Löchern
Kapitel 2: Gute Hehler
Kapitel 3: White Cube, Black Box
Kapitel 4: In den Zonen
Kapitel 5: Die Welt hacken
Kapitel 6: Die Stadt und die Stadt
Kapitel 7: Titanic
Kapitel 8: Herausgestanzt
Kapitel 9: Ad Astra
Kapitel 10: Laos Vegas
Kapitel 11: Terra Nullius
Dank
Quellenangaben
Law makes long spokes of the short stakes of men.
William Empson, Legal Fiction, 1928
Einführung
Ich habe dieses Buch über die Welt geschrieben, weil ich schon mein Leben lang das Gefühl hatte, dass an der Stadt meiner Kindheit irgendetwas seltsam war.
Ich spreche von der Stadt Genf in der Schweiz, wobei ihr Standort längst nicht alles sagt. Genf beherbergt die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation und Hunderte weitere internationale Organisationen und NGOs sowie Tausende Diplomaten, Konsuln, ausländische Arbeitskräfte und ihre Familien. Es gibt dort mehr multinationale Konzerne, als ich auflisten kann. Fast die Hälfte der Genfer Bevölkerung stammt ursprünglich nicht aus der Schweiz. Ohne Auswärtige wäre die Stadt nichts.
Ich bin und bleibe ein Teil dieser Welt für sich – einer Welt, die von einer gewissen Ortlosigkeit geprägt ist. Ich habe internationale Schulen besucht; dort hatte die Geschichte, die man uns lehrte, kaum etwas mit den Kämpfen zu tun, die nur wenige Schritte vom Kinderspielplatz entfernt ausgefochten worden waren. Die Jobs meiner Eltern – mein Vater war Ökonom in der UNCTAD, der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, und meine Mutter Konferenzdolmetscherin des Sekretariats – vermittelten mir das Gefühl, irgendwo anders zu sein. Meine Mitschüler schienen alle paar Jahre umzuziehen, wodurch für mich der Eindruck entstand, als würde auch ich ständig umziehen, obwohl ich die Stadt damals so gut wie nie verließ. Dieses Gefühl von Heimatlosigkeit inspirierte mich zu meinem ersten Buch, Cosmopolites, einer Recherche zum globalen Handel mit Reisepässen – dem völlig legalen Erwerb von Staatsangehörigkeitsdokumenten. Was konnte einem ein Reisepass bedeuten, den es zu kaufen gab wie ein Paar Turnschuhe?
Doch es gab noch einen anderen, weniger offensichtlichen Grund für mein Unbehagen in Bezug auf Genf. Er betraf die Regeln: wer sie machte, wer sie befolgte, und wo und für wen sie nicht galten. Als Jugendliche beobachtete ich, wie die Diplomatenkinder von der Immunität profitierten, die mit dem Status ihrer Eltern einherging: Sie kamen stets ungeschoren davon, wenn sie von der Polizei beim Rasen erwischt wurden oder beim Grasrauchen nach Einbruch der Dunkelheit im Park. Ein weiteres Privileg war der steuerfreie Einkauf: Wer als Ausländer in eine bestimmte Beschäftigungskategorie fällt, für den ist die ganze Welt ein Duty-free-Shop. Unweit der UNO, in einem unauffälligen Gewerbebau, befindet sich am unteren Ende einer steilen Treppe ein spezieller Laden, der seinen Kunden die Mehrwertsteuer auf alle Waren erlässt, seien es Boxershorts oder Kosmetika von La Mer. (»Eine der wohl skurrilsten Einkaufserfahrungen«, lautet ein Online-Kommentar. »Wo könnte man wohl sonst Tausende Euro für eine Uhr ausgeben und zugleich noch ein Fertiggericht für die Mikrowelle erstehen?«)
Die Diplomaten, stellte ich fest, waren nur der sichtbare Teil der Genfer Sonderregelungen. In der Hauptgeschäftsstraße der Stadt lagerten Privatbanken Informationen, zu denen nicht einmal die Schweizer Regierung Zugang hatte: über die Geheimkonten abgesetzter Monarchen und die unrechtmäßig erworbenen Gewinne multinationaler Steuerhinterzieher und -vermeider. Und unweit des Freibads, in dem ich schwimmen gelernt hatte, befand sich das Genfer Zollfreilager, ein abgeschottetes Lagerhaus, das außerhalb der Schweizer Zollbehörden agierte. Vor langer Zeit geschaffen, damit Kaufleute dort ihr Korn lagern konnten, ist das Zollfreilager heute ein Ort, in dem Oligarchen Kunst, Wein, Schmuck und andere Luxuswaren bunkern.
Einerseits steht die Zusammensetzung der Stadt für eine vertraute, greifbare, unvollkommene, oftmals liebenswürdige Internationalität, die Menschen aus aller Herren Länder zur selben Zeit am selben Ort in friedlicher Harmonie zusammenführt. Doch gleichzeitig ist hier noch etwas anderes im Gange – etwas, das man nicht sehen kann, dessen Einfluss auf seine Umgebung aber genauso mächtig ist wie der Globalismus aus Fleisch und Blut. Ich nenne es die Geisterwirtschaft: die abgehobenen, abgefahrenen und doch erstaunlich lukrativen Transaktionen, die nicht in Genf, sondern von Genf aus vonstattengehen. Die Stadt ist voller Kanäle oder dient als Zwischenlager für einen Kapitalismus, der aus der Ferne gelenkt wird. Sie fungiert weniger als Ort, an dem Dinge geschehen, denn als Pforte zu anderen Welten. Und es gibt noch viele andere Orte, die ganz ähnlich funktionieren. Von solchen Orten handelt dieses Buch.
Als ich Schmutzige Geschäfte im Niemandsland zu schreiben begann, wollte ich verstehen, wie meine Stadt zu dem wurde, was sie heute ist: wie sich ihre sprichwörtliche Behäbigkeit mit ihrem unendlichen Repertoire an Geheimnissen vereinbaren ließ. Ich wollte auch verstehen, warum gerade ich, eine Genferin, sich so sehr zu diesen anderen Nicht-Orten hingezogen fühlte: Stadtstaaten wie Singapur und Dubai, Steueroasen in der Karibik, Offshore-Finanzplätze, Flughafenbars, Hotellobbys, Zollfreilager. Solche Orte sind nicht nach jedermanns Geschmack, doch mir erschienen sie schon immer vertraut, so als teilten sie eine gemeinsame Logik mit meiner Heimatstadt.
Erst nachdem ich von Genf nach New York gezogen war, ging ich daran, all die Puzzleteile zu einem größeren Ganzen zusammenzusetzen. Ich begriff allmählich, dass Räume, die von einer überraschenden oder unkonventionellen Gerichtsbarkeit geprägt waren – Botschaften, Freihäfen, Steueroasen, Containerschiffe, arktische Archipele und tropische Stadtstaaten –, das Herzblut der globalen Wirtschaft und ein bestimmender Teil unseres Alltags waren.
Betrachten wir den Welthandel: Trotz ihrer rohen Körperlichkeit ist die Schifffahrt abhängig von den abstrakten Konstrukten, die spezielle Wirtschaftszonen schaffen, ausländischen Unternehmen die Kontrolle der Häfen gewähren, Binnenstaaten erlauben, Gefälligkeitsflaggen zu verkaufen, und Reedern Schlupflöcher öffnen, die es ihnen ermöglichen, billige Arbeitskräfte anzuheuern. Die Transaktionen, die die Bewegungen dieser Güter finanzieren – die stille Verschiebung schamlos hoher Summen auf Bildschirmen –, folgen ebenfalls nicht zwangsläufig einer geradlinigen Geographie. Die Routen, auf denen Menschen, Gelder und Dinge den Globus durchqueren, sind nicht die kürzeste Verbindung zwischen zwei Orten. Sie sind gewunden, stockend und umständlich – und das hat Methode.
Allein in den Vereinigten Staaten gibt es 193 aktive »Freihandelszonen«, die von den Zollvorschriften befreit sind. Sie beschäftigen um die 460000 Menschen (die Einwohnerschaft von Palm Springs!) und sehen im Laufe eines Jahres Waren im Wert von mehreren hundert Milliarden Dollar kommen und gehen – von Autoteilen bis hin zu Pharmazeutika –, die dort gelagert, umfunktioniert oder zusammengebaut werden. In einer Welt, die laut aktueller Zählung aus 192 Ländern besteht, gibt es schätzungsweise dreitausend solcher speziellen Zonen. In China tragen Sonderwirtschaftszonen nach Schätzung der Weltbank 22 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei, 45 Prozent zum Gesamtvolumen ausländischer Direktinvestitionen und 60 Prozent zu den Exporten.
Oder nehmen wir die Kultur. In speziellen zollfreien Depots werden nebst Kisten voller Wein, stapelweise Gold und Truhen voller Schmuck Kunstwerke im Wert von vielen Milliarden Dollar vermutet. Der Schaden ist hier zweifach: Nicht nur, dass niemand vor Ort ist, um die weggesperrten Monets und Picassos zu bewundern, zu studieren und zu verstehen, ihre Besitzer halten sie möglicherweise aus ruchloseren Gründen versteckt, zum Beispiel um Steuern zu vermeiden oder einen Rechtsstreit zu umgehen.
Diese Freihäfen inspirierten Christopher Nolan zu seinem Film Tenet. Tenet ist ein Actionfilm voller Schießereien und Autoverfolgungsjagden, dessen Plot von der Idee ausgeht, dass die Zeit nicht immer linear verläuft (was bei einer Schießerei oder einer Verfolgungsjagd – Achtung, Spoiler! – durchaus wichtig ist). Die Handlung spielt fast ausschließlich im Offshore-Bereich: auf Yachten, Windparks und in diesen Lagerhäusern, die sich geographisch zwar »in« einem Land befinden, aber einen fiktiven extraterritorialen Status genießen.
Bei seiner Wahl der Kulissen rührte der Regisseur an etwas, das mehr Tiefe hatte, als dieses Genre vermuten ließe. Im Konstrukt Niemandsland sind Raum und Zeit aufgehoben, wird unsere Wahrnehmung vom Hier und Jetzt gänzlich auf den Kopf gestellt.
Mein wachsendes Interesse an diesen merkwürdigen Rechtsräumen fiel mit etwas zusammen, was eine geopolitische Zeitenwende zu sein schien. Donald Trump war gerade zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden und schwadronierte davon, dem »Globalismus« ein Ende setzen zu wollen. Narendra Modi, Victor Orbán, Jair Bolsonaro und Rodrigo Duterte hatten mit unverhohlen nationalistischen Parolen die Wahlen in Indien, Ungarn, Brasilien und auf den Philippinen gewonnen. Die Briten bereiteten sich darauf vor, den Brexit einzuleiten, während europäische Staaten sich mühten, ihr propagiertes Engagement für Menschenrechte mit einer großen Zahl Asylsuchender in Einklang zu bringen, die an ihren Grenzen aufschlugen. Experten proklamierten das nahende Ende der Ära unbekümmerter Globalisierung, und nationalistische Politiker warfen ihnen Brocken zu in Form von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und dem einen oder anderen Schutzzoll.
In einschlägigen Zeitungen wie der Financial Times, dem Economist, auf den CNBC-Nachrichtenkanälen sowie auf Dutzenden Webseiten und in weiteren Publikationen sagten Kolumnisten den »Männern von Davos« Lebewohl. Der Nationalstaat war zurück, Schätzchen!
Der Tenor dieser öffentlichen Diskussionen – und vor allem das Doppelgestirn Nationalismus/Globalismus, das allmählich Gestalt annahm – verärgerte mich. Da ich in der Stadt Genf mit ihren vielen Enklaven aufgewachsen war, wusste ich, dass man an zwei Orten gleichzeitig sein konnte: auf Schweizer Boden, aber unter ausländischer Rechtsprechung; an einige Schweizer Gesetze gebunden, gegen andere gefeit. In einem größeren Maßstab bedeutete dies, dass die Zugehörigkeit zu einer Nation, ob territorial oder sonst wie, eine Teilnahme an der globalen Wirtschaft nicht ausschloss. Das war ja auch der Grund, warum es in Genf so viele internationale Organisationen gab. Irgendwo musste man ja sein.
Außerdem fiel mir auf, dass die sogenannten Globalisierungsgegner, die in den Nachrichten auftauchten, im Grunde ausgesprochen global agierten. Donald Trump führte weltweit Hotels und Golfplätze und zeigte überdies eine gewisse Schwäche für ausländische Frauen. Auch seine profilierte Entourage schien ständig mit einem Fuß im Ausland zu sein. Peter Thiel, vom libertären Investor zum konservativen Großspender mutiert, hatte sich just zum Zeitpunkt, da er Trumps America-First-Ideologie propagierte, die neuseeländische Staatsbürgerschaft erkauft. Steve Bannon, in der Presse oft als Trumps Superhirn ausgemacht, tat sich mit Nationalisten aus anderen Ländern zusammen, um seine Vision von geschlossenen Grenzen zu globalisieren – und das alles in einem italienischen Schloss. Kurz vor dem Weltwirtschaftsforum 2017 – das erste von Trumps Kabinett – kontaktierte ich die Organisation per E-Mail, weil ich wissen wollte, wie oft die einzelnen Mitglieder seiner Delegation schon an einem Forum teilgenommen hätten. Die Antwort verblüffte mich – während Energieminister Rick Perry erst ein einziges Mal teilgenommen hatte, war Außenminister Rex Tillerson schon dreimal in Davos gewesen. Elaine Chao, die dem Verkehrsministerium vorstand, bereitete sich auf ihren fünften Besuch vor. Und Robert Lighthizer, Handelsbeauftragter der USA, hatte bereits fünfzehn Kerben an seinen Skistöcken.
Politiker sind nicht dafür bekannt, besonders beständig zu sein in ihren Überzeugungen. Aber die Kluft zwischen dem, was diese Männer und Frauen nach außen darstellten, und dem, was sie tatsächlich taten – nicht nur in ihrem Privatleben, auch mit ihrem Geld und beruflich –, schien mehr zu verraten als opportunistische Heuchelei. Die Diskrepanz suggerierte, dass das System, in dem wir alle leben, nur dazu dient, geschlossene Grenzen mit der kapitalistischen Maxime eines freien Handels zu versöhnen.
Als ich diese Widersprüche allmählich durchschaute, stieß ich auf Orte, an denen diese Versöhnung stattfinden konnte. Sie lagen versteckt, damit unser Alltagsleben davon unberührt weitergehen konnte: über, unter und manchmal auch innerhalb von Nationen, in speziellen Rechtsräumen, die größtenteils im Verborgenen liegen, und in Gesetzen, die sich so weit über die Grenzen eines Landes hinaus dehnen, dass sie physisch außer Reichweite sind. Weil es diese Orte gibt, können Politiker über Grenzen, Zölle und Mauern sprechen, ohne die Wirtschaft zu verprellen. Dieses Himmel-und-Hölle-Spiel, so der Ökonom Ronen Palan 2003 in seinem hellsichtigen Buch The Offshore World, biete Staaten »einen politisch annehmbaren, wenn auch ungeschickten Weg, die wachsenden Widersprüche zwischen ihrer territorialen, nationalistischen Ideologie … und ihrer Befürwortung einer kapitalistischen Akkumulation im globalen Maßstab in Einklang zu bringen«.
Diese Orte sind nicht unbedingt geheim, liegen aber so weit verstreut, dass sie auf den ersten Blick nicht als ein Netzwerk oder System, sondern als kuriose Einzelphänomene wahrgenommen werden. Das ist einer der Gründe, warum sie vor unser aller Augen so unsichtbar bleiben.
Wir neigen dazu, uns als Bürger oder zumindest als Bewohner eines Staates zu begreifen. Schließlich beinhalteten die Lektionen, die den meisten von uns in der Schule begegnet sind, eine Weltkarte. Darauf waren, mittels Linien fest umrissen, verschiedene Staaten eingezeichnet. Jeder Staat, erfuhren wir, habe eine Regierung; und jede Regierung lenke ihr Land, seine Angelegenheiten und seine Bevölkerung. Das Modell »ein Land, ein Gesetz, ein Volk, eine Regierung« ist vorherrschend, mächtig und oft auch zutreffend. Es bildet die Grundlage für einen Großteil des nationalen und internationalen Rechts.
Das Konstrukt Niemandsland ist gleichsam die Umgestaltung dieser Karte mit zunehmend mehr Spalten und Zugeständnissen, vorübergehenden Aufhebungen und Abstraktionen, Ausnahmen, Freizonen und anderen Orten ohne Nationalität im herkömmlichen Sinn, die sich vom Meeresboden bis ins Weltall erstrecken. Das Niemandsland ist eine gewinnsüchtige Weltordnung, in der die Befugnis, Gesetze zu machen und zu gestalten, gekauft, verkauft, gehackt, neu gestaltet, ent-territorialisiert, re-territorialisiert, transplantiert und neu gedacht wird. Es ist die über die Grenzen eines Staates hinauskatapultierte Staatsmacht. Es ist auch der selektive Verzicht eines Staates auf bestimmte Befugnisse innerhalb seiner Zuständigkeit: Enklaven, die nicht ohne Gesetze sind, sondern anderen, seltsameren Gesetzen unterstehen.
Der englische Begriff loophole, Schießscharte, entstand im 17. Jahrhundert, um die kleinen senkrechten Schlitze in einer Burgmauer zu beschreiben, durch die Bogenschützen ihre Pfeile abschießen konnten, ohne sich dabei selbst dem Feind auszusetzen. Seine moderne Bedeutung hat sich nicht allzu weit davon entfernt, nur dass die Bogenschützen jetzt Anwälte, Berater und Buchhalter sind – und die Burg der Staat selbst. Im Deutschen spricht man in diesem Zusammenhang eher von Schlupflöchern.
Der Wunsch nach Ausnahmen von der Regel ist nicht neu: Gemeinschaften haben schon immer gesonderte Orte geschaffen – Orte der Kontemplation, des Rituals und des Gebets. Die Kelten nannten sie »dünne Orte«, weil dort der Abstand zwischen Himmel und Erde angeblich kürzer war.
Heutzutage sind unsere Anderswos oder Nirgendwos nicht dem Opfer, sondern der Flucht vorbehalten. Sie erinnern uns an die Neuheit unserer Welt der umgrenzten unabhängigen Staaten – eine Gussform, deren Inhalt erst nach der Entkolonialisierung allmählich aushärtete – und an ihre Verwundbarkeit gegenüber mächtigeren Kräften.
Kapitalisten, unentwegt auf der Jagd nach Profit, betrachten Offshore-Rechtsräume als ihr Niemandsland. Dieses Buch handelt ebenso von diesen modernen »Hasardeuren« wie auch von ihren Jagdgründen. Doch ist das kein unbekümmertes System offener Grenzen. Während es den Anschein hat, als untergrabe die Existenz eines Niemandslandes den Mythos von der sinnhaften, geeinten Nation, ist das Konzept der Nation viel zu beharrlich und politisch zu gut verwertbar, um es gänzlich abzuschaffen. Das Konstrukt Niemandsland kann sogar dem allerfremdenfeindlichsten, allerausgrenzendsten Nationalismus Vorschub leisten. Und solche Strategien sind nicht nur der politischen Rechten vorbehalten: Ganz gleich ob Republikaner oder Demokraten, ob Konservative oder Liberale, die Regimes hinter ihnen zielen darauf ab, die richtigen Leute hineinzubringen und die falschen draußen zu halten.
Indem es nationalistische Einwanderungskonzepte stärkt, hemmt das Niemandsland die Leben derjenigen, die auf dieser Welt am wenigsten Rechte haben: die Insassen der Offshore-Asyllager in der Karibik und im Pazifik, die verarmten Arbeiter in Indien, die in zollfreien Produktionszonen Güter für den Export fertigen, die Seeleute und Asylsuchenden, die wegen fehlender Papiere auf Schiffen festsitzen. Wann immer ein Mensch nicht in der Heimat bleiben kann und im Ausland unerwünscht ist, endet er möglicherweise an einem dritten Ort: weder hier noch dort.
Diese Orte als das zu erkennen, was sie sind, hat meine Sicht auf die Welt grundlegend verändert, und das dürfte Ihnen nicht anders ergehen.
In den nun folgenden Kapiteln erfahren Sie, wie meine Heimatstadt Genf und ihre Nation, die Schweiz, durch die Menschen, Kriege und Gesetze, die sie prägten, das Fundament für unsere heutige Welt gelegt haben. Sie werden entdecken, wie das Schweizer Modell andere Staaten dazu inspirierte, ihre Grenzen immer weiter nach draußen zu verschieben – hinaus auf See, hinunter zum Meeresboden und sogar in die Weiten des Alls. Sie werden geheime Lagerhäuser besuchen, virtuelle Gerichtssäle und schwarze Löcher im Gesetz, kontrolliert von westlichen Demokratien und ihren Verbündeten. Sie werden sich in einer Freizone für Waren umsehen und überlegen, ob man nicht auch Freizonen für Menschen errichten sollte.
Die Personen, die ich porträtiere – weil sie sich freundlicherweise die Zeit nahmen, uns ihre Sicht auf die Welt, ihre Methoden und Ideale mitzuteilen –, stehen exemplarisch für eine weitaus größere Gruppe, die im Kontext weltgeschichtlicher Kräfte agiert. Ich bin dankbar für ihre Gesprächsbereitschaft und möchte ihre Entscheidungen nicht verurteilen. Trotzdem hoffe ich, dass meine Einstellung zu den Konsequenzen des Konstrukts Niemandsland deutlich wird. Wann immer die reichsten Bürger ihr Geld verstecken, anstatt Steuern zu zahlen, müssen Städte und Gemeinden mit weniger auskommen, was mit schlechteren Schulen und Straßen und mit Defiziten bei Infrastruktur und Gesundheitsversorgung einhergeht. Wenn dieses Geld in Offshore-Finanzplätzen gebunkert oder durch sie hindurch westwärts geschleust wird, wächst die Ungleichheit. In einer Zeit, in der Geld überproportional von ärmeren Ländern in reiche transferiert wird und nicht umgekehrt, müssen wir über die Mechanismen nachdenken, die dergleichen ermöglichen. Wenn Waren zu neunzig Prozent auf Schiffen transportiert werden, die ihre Verantwortung für Kohlendioxidemissionen oder Arbeitsbedingungen ganz einfach umgehen können, werden unsere Meeresfrüchte am Ende von Sklaven verarbeitet, erreichen uns unsere Waschmaschinen mit einem Packen Umweltverschmutzung als Zugabe. Eine permanente Flüchtlingspopulation, ganz gleich wo, wirft einen dunklen Schatten auf unser Engagement für Menschenrechte und Anstand – einen dunklen Schatten auf uns alle, die wir in demokratischen Staaten leben.
Ich will auch klarstellen, dass eine Rückkehr zum Nationalismus nicht die Lösung ist. Um zu wissen, wo wir stehen – politisch, wirtschaftlich und auch physisch –, müssen wir die Risse zwischen den Grenzen ausleuchten. Nur dort erkennen wir unser wahres Spiegelbild in dieser Welt – und können damit beginnen eine bessere zu bauen.
Kapitel 1: Stadt mit Löchern
Städte wie Träume sind aus Wünschen und Ängsten gebaut, auch wenn der Faden ihrer Rede geheim ist, ihre Regeln absurd, ihre Perspektiven trügerisch sind und ein jedes Ding ein anderes verbirgt.
Italo Calvino, Die unsichtbaren Städte
Willkommen in Genf, der Hauptstadt des Niemandslandes. Genf ist eine Stadt der Ausnahmen, eine Stadt wie Schweizer Käse. Seit Jahrhunderten schützen ihre Gewölbe und Schlupflöcher Menschen vor Verfolgung und Revolution, vor Besteuerung und Rechtsstreitigkeiten. Seit der Renaissance war Genf ein sicherer Hafen für Geflüchtete und ihr Geld, ihre Lebensweise und ihre politischen Überzeugungen.
Kommunisten und Kapitalisten, Protestanten und Katholiken, Waffenhändler und Friedensstifter, exilierte Monarchen und mittellose Flüchtlinge, sie alle strömten nach Genf, wo sie dieselben Cafés und Confiserien frequentierten, Spaziergänge am selben malerischen Seeufer unternahmen und in allen Sprachen dieser Welt miteinander kommunizierten. Genf war schon immer neutrales Territorium: wenn nicht unpolitisch, so doch unparteiisch. Doch was uns hierherführt, ist auch eine Angelegenheit der Metaphysik.
Über, unter und in dieser Stadt gibt es Dutzende kleinerer Städte, eine jede in speziellen Ordnungssystemen eingeschlossen, und alle gehorchen sie ihren eigenen Regeln. Die einen haben die Größe eines Koffers, andere den Umfang einer kleinen Stadt. Ein Meer aus Stahlkammern, Lagerhäusern, Konsulaten, Botschaften, Missionen, internationalen Organisationen, atomaren Forschungseinrichtungen und Handelsplattformen – vor aller Augen unsichtbar – verleiht Genf die fraktale Anmutung eines 3-D-Illusionsbuches. Ein flüchtiger Blick, und du siehst nur eine Tapete. Schau genauer hin, und aus den abstrakten Mustern entstehen konkrete Gestalten.
Ich habe lange gebraucht, um Genf in all seinen Dimensionen zu erkennen. Das Gesicht, das es der Welt zeigt, ist so solide, so verwurzelt, so schwer, dass es ewig anmutet. Seine Altstadt, lavieille ville, erscheint mir als ein ebenso fester Bestandteil der natürlichen Landschaft ringsum, der regionalen Topographie wie die Rhône und der Lac Léman (besser bekannt als Genfersee). Liest man Mary Shelleys Roman Frankenstein, der vor über einem Jahrhundert in Genf spielt, bemerkt man, dass die Straßen, Stadtteile und Uferböschungen noch immer die alten Namen tragen.
Die engen Gassen der Altstadt könnten sich sogar genauso anhören wie damals. Mehrmals am Tag und auf die Minute pünktlich erklingen in schönster Harmonie die Glocken der Kathedrale St. Peter. Die dunkel tönende Clémence wurde 1407 installiert. Sie ist gut dreieinhalb Meter hoch, wiegt über sechs Tonnen und hält uns mit ihrem vorwurfsvollen Geläut im Zaum. Die Vibrationen der Glocke dringen bis tief in den Grund, wo unter der Kathedrale die exhumierten Gebeine eines Häuptlings der Allobroger aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert aufbewahrt werden.
Die Kathedrale selbst wurde im 12. Jahrhundert auf einem Hügel errichtet, wuchs mit den Jahren, bis sie schließlich mit ihrem spitzen Kirchturm und den leuchtenden Glasfenstern hoch über den Pflastersteinen thronte. Im Zuge der Reformationsbewegung im 16. Jahrhundert, in der viele Europäer sich gemeinsam gegen die Exzesse der katholischen Kirche erhoben, wurde die gotische Fassade der Kathedrale ihrer Schmuckelemente beraubt und in Anlehnung an die griechische Klassik umgestaltet. Die Reformatoren, allen voran Johannes Calvin, propagierten einen äußerst nüchternen Stil. Die Calvinisten stellten nicht nur strenge moralische Regeln auf, sie verbannten auch die Kunst – ungeachtet ihres religiösen Charakters – aus den Kirchen, da sie ihrer Ansicht nach zum Götzendienst ermunterte.
Die farbenfrohen Glasfenster der Kathedrale St. Peter überstanden den reformatorischen Bildersturm. Nicht so ein Altarstück, Der wundersame Fischzug. Doch eine seiner Tafeln konnte vor der Zerstörung gerettet werden und ist nun in einem nahegelegenen Museum zu besichtigen.
Das Gemälde des Baseler Künstlers Konrad Witz ist ein bemerkenswertes Artefakt: Angeblich ist es das erste in der europäischen Geschichte, das keine imaginierte biblische Szene darstellt, sondern eine wiedererkennbare reale Landschaft. Witz malte zu Beginn der 1440er Jahre, als Genf noch sehr ländlich war, dürfte aber beim Anblick des Genfersees von etwas Größerem inspiriert worden sein. Das Gemälde definiert den See explizit als einen Ort, an dem das Heilige dem Weltlichen begegnet. Es nimmt die Rolle der Stadt als Mittlerin zwischen dem Greifbaren und dem Nichtgreifbaren vorweg. Es ist auch ein Bild über den Glauben: an Gott natürlich, aber auch an das Geld und an die Wichtigkeit, nicht zu viele Fragen zu stellen.
Das Kunstwerk zeigt eine Gruppe von fünf Aposteln in einem Boot in Ufernähe; zwei von ihnen halten Ruder in den Händen, die übrigen drei ziehen an einem Netz, berstend voll mit zappelnden Fischen. Man erkennt auf den ersten Blick, dass die Szene nicht auf dem See Genezareth spielt, wo sie sich laut biblischer Geschichte zugetragen hat, sondern unweit der Heimat des Künstlers: Er malt Berge, Hecken, Lagerhäuser, einen Anlegesteg. Die Landschaft ist üppig grün, also arbeitete Witz wohl im Frühling oder Sommer, und über dem Wasser hängen schwer große weiße Wolken. Ein niedriger Bergrücken, der Mont Salève, und der prägnante Gipfel im Hintergrund – die weiße Spitze des Mont Blanc – verraten den präzisen Standpunkt des Künstlers. Witz malte den See vom heutigen Genfer Stadtviertel Eaux-Vives aus.
Die Männer tragen knielange Tuniken in Rot, Weiß und Schwarz. Sie blicken in den Himmel, scheinen ihr Glück kaum zu fassen: Nach einem enttäuschenden Tag auf dem Wasser, so die Geschichte, warfen sie, Jesu Weisung folgend, ein letztes Mal ihre Netze aus und wurden reich belohnt. Auch der heilige Petrus ist zu sehen, wie er mit ausgestreckten Armen auf Jesus zu watet. Der auferstandene Christus empfängt ihn in einem flammend roten Gewand, glückselig strahlend im seichten Wasser.
Witz tat etwas bis dahin Undenkbares, indem er die physische Welt malte, wie sie war. Dennoch ist seine Malerei irgendwie jenseitig, und das liegt nicht an den Fischern oder den Bergen, nicht einmal an dem Wunder. Obschon er große Sorgfalt auf die Darstellung von Licht und Schatten verwendet, spiegelt sich einzig die Gestalt Christi nicht im Wasser.
Durch dieses Weglassen bietet Konrad Witz einen frühen flüchtigen Blick auf das andere, metaphysische Genf, in dem die Gesetze des Menschen und der Natur nicht immer gelten.
In den vergangenen fünfzig Jahren ist just am Standort von Witz’ Wunder an die Stelle Gottes der Reichtum getreten. Nachts erhellen Luxuslogos – Rolex, Breitling, Zenith – den Himmel. Auf der Wasseroberfläche des Sees spiegelt sich eine Stadt, die der realen gleicht und doch ihr Gegenteil ist: so wenig greifbar, so fließend und ortlos wie das echte Genf greifbar und verortet.
Im Genfersee schwimmen noch immer viele Fische: Barsche, um genau zu sein, die in den Restaurants mit Sauce Tartar und Zitrone serviert werden. Doch das eigentliche Geld kommt von dieser Geisterwirtschaft, die Genf beherbergt, in einem sicheren Kokon aus Neutralität, Verschwiegenheit und Steuerfreiheit.
Genf hat gerade einmal zweihunderttausend Einwohner, doch über ein Drittel des Weltgetreides wird von hier aus gehandelt. Auf dieselbe Weise wandern mehr als die Hälfte aller Kaffeesäcke der Welt »durch« die Schweiz, die meisten über Firmen in und um Genf. Die erste Filiale von Starbucks im Land eröffnete gerade einmal 2001; wenige Monate später bezog das Unternehmen seinen Kaffee bereits über eine eigene Schweizer Tochtergesellschaft. Es gibt andere Rechtsräume, darunter Singapur, die vergleichbar niedrige oder noch niedrigere Steuern anbieten. Doch mit einer Bank an jeder Ecke und einer Versicherung an jeder Biegung ist der Standort Genf zu vorteilhaft für das Unternehmen, um ihn aufzugeben.
Genf ist seit langem ein Drehkreuz für Öl – wenn man es als »Drehkreuz« bezeichnen kann, zumal die Barrel nie wirklich dort aufschlagen. Bis vor wenigen Jahren wurden zwischen 50 und 60 Prozent des russischen Rohöls von der Schweiz aus gehandelt, laut Recherche der nicht staatlichen Organisation Public Eye zumeist über Genf. Als das Schweizer Parlament sich nach Wladimir Putins Invasion in die Ukraine widerstrebend dafür aussprach, sich den Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland anzuschließen, verlagerte sich ein Teil dieses Handels nach Dubai – ein Rechtsraum, der Genfs Patchworkmodell aus Steueranreizen, Verschwiegenheit und professionellem Knowhow nachempfunden ist und diesem so sehr gleicht, dass Ölhändler die Stadt mittlerweile schon als das »neue Genf« bezeichnen. (Die Vereinigten Arabischen Emirate sind zwar reich an Öl, doch wurden auch hier 90 Prozent der Geschäfte getätigt, ohne dass der Rohstoff tatsächlich vor Ort war.)
Die Schweiz ist ein Binnenstaat. Was sie nicht daran hindert, einige der größten Schifffahrtsunternehmen der Welt zu beherbergen: Diese chartern und managen Schiffe von Genf aus und packen diejenigen, die die Gewinne einfahren, hinter dichte Schleier der Verschwiegenheit. Auf die Frage, warum die Schifffahrtsbranche sich so fern der Küste zusammengerottet habe, antwortet der Schweizer Rechtswissenschaftler Mark Pieth, dass seine Regierung schlichtweg nicht reguliere, was die Schiffe tun, es sei denn, es handle sich um eines der nur siebenundzwanzig Schiffe unter Schweizer Flagge. Wer braucht schon Wasser zum Schwimmen.
Wie sich die Stadt Genf in der Welt positioniert, ist ihr größter Beitrag zu der Art und Weise, wie wir heute alle leben: in einer Zeit der Ausnahmen, in der das Wo und das Wann weniger zählen als das Wer, Wie viel und Warum. Es ist eine Welt, in der Reichtum in abstrakter Form unterwegs ist: als Zahlen auf einem Bildschirm, Handelsabschlüsse auf einem Trading Terminal. Es ist eine Welt, in der Grenzen nicht nur um Orte, sondern auch um Menschen und Dinge gezogen werden.
Theoretisch können Enklaven mit speziellen Regeln nicht nur zum Geldverdienen genutzt werden. Während des Ersten Weltkriegs war der französische Militärarzt Georges Saint-Paul angesichts des zivilen Blutzolls dermaßen entsetzt, dass er vorschlug, Sicherheitsinseln einzurichten, die er als Genfer Zonen bezeichnete: eine kleine Schweiz in jeder Nation. Diese Zonen sollten sich insofern von gewöhnlichen Aufnahmelagern für Vertriebene unterscheiden, als sie bereits in Friedenszeiten errichtet würden, um im Falle eines Kriegsausbruchs die verwundbarsten Zivilpersonen aufzunehmen. Wichtig dabei war: Sie würden keiner überstaatlichen Organisation unterstehen, sondern der Regierung des Gastlandes. Die Hoffnung war, dass die kriegführenden Parteien sogar während des Konflikts davon absehen würden, sie anzugreifen. (Dies erscheint uns heutzutage umso naiver, zumal während der Konflikte beispielsweise in Bosnien, Ruanda und Irak humanitäre Zonen, die Nichtkombattanten Zuflucht gewähren sollten, am Ende zu Angriffszielen wurden.)
Georges Saint-Paul gründete 1931 in Paris die Association des Lieux de Genève, die Vereinigung der Genfer Zonen, ehe er sie 1937 nach Genf verlagerte. Er starb, bevor er Gelegenheit hatte, seine Pläne in Taten umzusetzen. Auf der anderen Seite der Erde fand seine Idee zum Schutz der Zivilbevölkerung dennoch Anklang: Sie inspirierte den Jesuitenpater Robert Jacquinot de Besange dazu, ähnliche Sicherheitszonen in Schanghai zu errichten, die dann im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg tatsächlich einer halben Million chinesischer Bürger das Leben retteten. (Kurioserweise grenzten die Zonen, genau wie Genf selbst, an das französisch kontrollierte Gebiet der Stadt.) Nachahmerprojekte entstanden in weiteren chinesischen Städten, unter anderem in Shenzhen, das als Sonderwirtschaftszone bekannt werden sollte, und auch in Spanien während des Bürgerkriegs. In dieser Zeit großer Umwälzungen, mit geringer Perspektive auf Frieden und ohne internationale Abkommen zu Flüchtlingsrechten, war die Idee der Enklave eine ansprechende Art und Weise, sich auf halbem Weg entgegenzukommen und Leben zu retten.
Saint-Pauls Idee wird heute von der Internationalen Zivilschutzorganisation ICDO fortgeführt. Diese eingetragene Organisation hat sich dem Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegszeiten verschrieben und war bereits in politisch heiklen Gebieten wie Kuba, Nordkorea und dem Kaukasus aktiv, allerdings erst, nachdem das russische Ministerium für Katastrophenschutz die Einsätze gebilligt hatte. Die Organisation wird heute fast ausschließlich von Russland finanziert, mit 140 Millionen Dollar im Jahr. Bis 2012 hatte ihr ein russischer Diplomat vorgestanden, der 1985, als mutmaßliche Gefahr für die nationale Sicherheit, von Margaret Thatcher des Landes verwiesen worden war. Einem schweizerischen Fernsehbericht zufolge bereichern Hilfsvereinbarungen heutzutage den russischen Verteidigungsminister, der persönlich mitentscheidet, welche Vertragspartner Gelder aus dem Hilfsfonds erhalten sollen. Der Vorsitzende der ICDO zahlte sich selbst ein höheres Gehalt als die UNO ihrem Generalsekretär. Die Organisation hat ihren Sitz in einem stattlichen Gebäude im vornehmen Genfer Stadtteil Petit Lancy, mit Blick in einen Park mit hohen Eichen und ausladenden Weiden; vor der Terrasse des Hauses stehen drei Palmen, die nicht so recht ins Bild passen: noch ein Hinweis, dass hier Seltsames Wurzeln schlagen kann.
Der Gegensatz zwischen dem Leib der Stadt und ihrer Seele ist oft genauso verblüffend. Eine der vielen hundert Vermögensverwaltungen in Genf bietet Superreichen »bei der Eröffnung von Konten in aller Welt« ihre Dienste an, unter Zuhilfenahme ihrer »ultramodernen Finanzplattform«. Ihr Geld gebiert Geld, das wiederum Geld gebiert, das egal wo mit dem Fiskus Verstecken spielt. Und das alles von einem großen Gebäude in einer altehrwürdigen Stadt aus, erbaut vor Jahrhunderten, als die Begriffe »Plattform« und »netto« nichts weiter benannten als eine Fläche und ein Gewicht.
Auf der anderen Straßenseite bietet ein Vermögensberater auf Englisch, Französisch und Russisch ganz ähnliche Dienste an. Sollten Sie je davon geträumt haben, ins Steuerparadies Mauritius umzusiedeln – ganz gleich, ob als Unternehmen, als Selbständiger oder Privatperson –, gibt es im selben Viertel ein Familienunternehmen, das sich seit den späten 1990er Jahren auf dergleichen spezialisiert hat.
Dass Genf und Mauritius in der physischen Welt wenig Berührungspunkte haben, braucht Sie nicht zu kümmern. Beide sind Teil eines unsichtbaren Kosmos, der eine höchst unwahrscheinliche Konstellation von Orten miteinander verbindet.
Schweizer Banken sind historisch gesehen der Referenzpunkt für diesen brüchigen Atlas. Jahrelang agierten sie wie schwarze Löcher, nahmen Geld, egal von wem, egal von wo, und ließen es verschwinden. Und zwar ganz legal: Illegal nach schweizerischem Gesetz war es, den Klarnamen eines Kontoinhabers preiszugeben. Noch 2015 wurden Whistleblower aus diesem Grund vor Gericht gestellt und verurteilt. Bis heute haben Schweizer Banken 8,6 Billionen Dollar in ihren Portfolios, über zwei Billionen davon in den Händen von Privatpersonen. Zum Vergleich: Das nominelle Bruttoinlandsprodukt des Landes beläuft sich auf 700 Milliarden Dollar, was etwa einem Zehntel dieser Summe entspricht. Die Asymmetrie erwächst aus der Tatsache, dass ein Großteil der Vermögen in diesen Banken – von Wald-und-Wiesen-Geldmarkteinlagen bis hin zu exotischen Derivaten – Nicht-Schweizern gehört.
Gabriel Zucman, Ökonom an der University of California, Berkeley, eruierte 2008, dass nur ein Drittel der ausländischen Wertpapiere in Schweizer Privatbanken tatsächlich Schweizern gehörte, die übrigen zwei Drittel waren im Besitz von Ausländern. Besonders treue Kunden sind Personen aus Frankreich, Deutschland, Saudi-Arabien und den Emiraten, aber die Bankiers verwalten auch Fonds unbekannter oder unklarer Herkunft, deren Inhalt mehrere Metamorphosen vollzogen haben dürfte: vom anfänglichen afrikanischen Bergwerk zum Koffer mit Bargeld, der wiederum zum Karibikfonds und dann zum Nummernkonto wurde.
Außerdem macht ein Großteil des Geldes nur einen Zwischenstopp auf einer unendlich langen Reise. »Dieses Muster zeigt anschaulich, wie Offshore-Finanzzentren agieren«, schreibt Zucman. »Im Wesentlichen helfen Schweizer Banken ausländischen Kunden dabei, ihr Geld außerhalb der Schweiz zu investieren.« Die Banken fungieren demnach eher als Kanäle denn als sichere Depots.
Während des Zweiten Weltkriegs verkaufte die Deutsche Reichsbank bekanntermaßen Gold im Wert von heute zwanzig Milliarden Dollar an die Banken und Bankiers der Stadt, während die Schweizer auf ihrer Neutralität beharrten. Die Nachwehen waren gewaltig: eine Untersuchung durch das US-Außenministerium, endlose Zeitungsberichte, eine hochkarätige Reparationskommission und Entschuldigungen aus den obersten Etagen der Industrie. Die Neutralität der Schweiz (und ihr Bankenwesen) war zur Lachnummer geworden. Doch die Demütigung war offenbar nicht genug.
Nach dem Arabischen Frühling zu Beginn der 2010er Jahre war durchgesickert, dass Finanzinstitute der Schweiz, viele mit Niederlassungen in Genf, auf Millionenvermögen saßen, die den Staatsoberhäuptern Ägyptens, Syriens, Tunesiens und Libyens gehörten. Dazu kamen noch Vermögen, die mit Diktatoren aus Nigeria, den Philippinen und der ehemaligen Sowjetunion in Verbindung gebracht werden konnten. Ein Großteil dieses Geldes, insgesamt fünf Milliarden Dollar, liegt seit 2015 eingefroren auf entanonymisierten Konten.
Die Banken haben rückwirkend versucht, den Zugriff zu blockieren oder Rückzahlungen vorzunehmen, aber diese Arbeit kann Jahre dauern. Die Probleme blieben nicht ohne Konsequenzen: Dank einer partiellen Aufhebung des Bankgeheimnisses infolge des Drucks durch andere Staaten ist es nun etwas schwieriger, große ausländische Vermögen in der Versenkung verschwinden zu lassen.
Doch die Skandale reißen nicht ab: Wie sich herausgestellt hat, verfügen die mächtigsten Personen in Malaysia, Kasachstan, Russland und der Ukraine allesamt über Zweitwohnungen in Seelage, wenn nicht für sich, so für eine Treuhand, einen Fonds oder ein Investmentkonstrukt in direktem Zusammenhang mit einer Firma, die in irgendeiner Weise mit ihrer Person verknüpft ist. Erst kürzlich wurde ein texanischer Tech-Milliardär namens Robert Brockman in den USA angeklagt, weil er (unter anderem) eine Genfer Bank dazu benutzt hatte, eine Rekordsumme von zwei Milliarden US-Dollar an Steuern zu umgehen. Public Eye zählte in der Stadt Genf 13600 Strohfirmen, einige davon nur Briefkästen, andere nach außen mit Personal ausgestattet; viele fungierten als Portale, über die Kunden ihr Geld immer weiter offshore abfließen lassen konnten.
Der Genfer Justizpalast befindet sich direkt gegenüber der Kathedrale St. Peter. Seit 1860 steht das umgebaute Kloster Anwälten und Klägern offen – nicht aber der Öffentlichkeit. Neben lokalen Verbrechen und Verfehlungen werden dort routinemäßig Fälle verhandelt, die mit Gesetzesbrüchen im fernen Ausland in Verbindung stehen: Abbaukonzessionen in Guinea, Korruption in Venezuela, Erpressung an der Elfenbeinküste und im Kongo. Solche Fälle zeigen, wie erfolgreich sich die Stadt Genf in das Gewebe der Welt und ihrem Geld eingeflochten hat, indem sie Unternehmen überzeugte, dort Niederlassungen zu gründen.
So viele Waren und Güter passieren Genf. Die meisten berühren jedoch nie den Boden.
Nicht weit von hier, an den Ufern des Genfersees, ersann Mary Shelley ihr berühmtes Monster.
1816 verbrachte die Schriftstellerin (damals noch Mary Godwin) den Sommer mit ihrem Liebhaber Percy Bysshe Shelley und ihrer schwangeren Stiefschwester Claire Clairmont in einer Villa einige Kilometer nördlich der Stadt. Lord Byron, der mit Claire ins Bett stieg, hatte das Nachbarhaus bezogen. Die Gruppe war eigentlich in den Ferien, aber das Wetter spielte nicht mit: ein heftiger Vulkanausbruch in Indonesien im Vorjahr hatte dort zehntausend Menschenleben gefordert, und die Flugasche bedeckte einen Großteil der Erde. Sie blockierte die Sonne über Europa, wodurch es zu Missernten, Hungersnöten, einem tödlichen Typhusausbruch und politischen Unruhen kam. Im fernen Genf »hielt Dauerregen uns tagelang im Haus fest«, schrieb Mary Shelley von diesem »Jahr ohne Sommer«. Um sich die Zeit zu vertreiben, erzählte sich die Gruppe Schauergeschichten oder versuchte es zumindest. Mary wurde von einer Schreibblockade geplagt, »jener lähmenden Unfähigkeit, etwas zu erfinden«, bis ihr eines Nachts eine Idee kam.
»Ich sah das abscheuliche Trugbild eines Mannes, der langgestreckt auf dem Rücken lag«, schrieb sie später, »und dann durch das Einwirken einer mächtigen Apparatur Anzeichen von Leben zeigte.«
»Die Idee schlug mich so sehr in ihren Bann, dass mich ein Angstschauder durchlief, und ich wünschte, die grässlichen Bilder meiner Phantasie durch die Realitäten ringsum auszulöschen«, schrieb sie. »Ich sehe sie noch immer vor mir; denselben Raum, das dunkle Parkett, die geschlossenen Läden, durch die das Mondlicht sich kämpfte, und die Gewissheit, dass sich dahinter der glasklare See und die weißen Hochalpen erstreckten.«
Die Chimäre wurde zu einer der unvergesslichsten Figuren der Literatur: ein Riese von zweieinhalb Metern, aus Leichenteilen zusammengeflickt, die an verschiedenen Orten geraubt worden waren; er würde rastlos durch die Welt irren, dürstend nach Rache und getrieben von Sehnsucht nach Freundschaft und Liebe. Das Monster war von dem Genfer Bürger Victor Frankenstein zum Leben erweckt worden.
Normalerweise inspiriert der See nicht zu derlei Monstrositäten. Es ist schön an seinen Ufern, die Temperatur sinkt selten unter den Gefrierpunkt. Die Wintermonate jedoch sind dunkel, bedrückend und klamm, und gelegentlich verschärft die Bise, ein frostiger Nordostwind, die Kälte. Kommt dann der Frühling, verursacht der heißtrockene Föhnwind – eine Alpenversion der südkalifornischen Santa-Ana-Winde – angeblich psychotische Anfälle, Migräneattacken und Autounfälle. Eigentlich glauben die Genfer nicht an Windgeister; sie sind nicht abergläubisch. Sie geben nur deshalb der Natur die Schuld, weil sie selbst immer alles unter Kontrolle zu haben glauben. Irrational agiert nur das Wetter.
Von der Uferböschung aus führt eine von vier Fußgängerbrücken über den See. An seinem Ostufer fanden bedeutende Ereignisse der Diplomatiegeschichte statt: Abkommen über Krieg und Frieden, internationale Gesetze, Verbrechen und Strafen. Ein langer, malerischer Kai, benannt nach Woodrow Wilson, führt zu einem großartigen alten Sandsteinpalast, der ebenfalls seinen Namen trägt. Neben dem Palast befindet sich das President Wilson Hotel und in ihm die kostspieligste Suite der Welt. Sie verfügt über zwölf Schlafzimmer und einen Steinway-Flügel und ist für 81000 Dollar pro Nacht zu haben.
Die Genfer fühlen sich in Wilsons Schuld. Er war maßgeblich an der Gründung des Völkerbundes beteiligt, der Genf auf die Weltkarte setzte – auch wenn er bei seinem Auftrag, den Frieden zu wahren, erbärmlich gescheitert war und sein eigenes Land sich weigerte, dem Bündnis beizutreten. Die Universität Princeton hat den Namen des ehemaligen Präsidenten aufgrund seines unverhohlenen Rassismus von ihrer School of Public and International Affairs getilgt. Die Genfer scheinen sich nicht daran zu stören, zumindest noch nicht.
1946 traten die Vereinten Nationen an die Stelle des Völkerbundes, bezogen das für sie vorgesehene Gebäude und brachten eine Vielzahl von Schwesterorganisationen in die Welt – die Welthandelsorganisation, die Weltgesundheitsorganisation, die Weltorganisation für geistiges Eigentum WIPO und ein Dutzend weitere zwischenstaatliche Bürokratien, die von Telekommunikation bis hin zu Umsiedlungsprogrammen für Geflüchtete alles regeln.
Über ihre Mitgliedschaft in diesen Organisationen kamen die einzelnen Nationalstaaten – die Bauklötzchen der Welt, in der wir leben – zu ihrem Recht. Imperien wurden in Länder aufgeteilt, ehemalige Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen und jede nationale Einheit mit souveräner Gleichberechtigung ausgestattet: ein Land, ein Staat, eine Regierung, eine Stimme in der UNO.
Wie ironisch ist es da, dass die Schweiz erst 2002 der UNO beigetreten ist. Und wie passend, dass die Polizei von Rechts wegen keinen Zugriff hat auf ihre Gebäude. Tausende Mitglieder der Genfer Arbeitnehmerschaft genießen diplomatische Immunität, so dass sie von bestimmten Steuern befreit und in einigen Fällen auch sicher sind vor strafrechtlicher Verfolgung. Diplomaten tragen in ihren Köfferchen wichtige Dokumente herum, unter dem Schutzstatus internationaler Vereinbarungen. Selbst ihre Fahrzeuge sind von Strafzetteln wegen Falschparkens und Geschwindigkeitsdelikten befreit. Einige sind kugelsicher und haben abgedunkelte Scheiben. Sie alle tragen das vielsagende Zusatzkennzeichen CD für corps diplomatique, diplomatisches Korps.
Auch die internationalen Organisationen in Genf agieren in diesen Parallelwelten. Die UNO hat ihre eigenen Briefmarken, ihr eigenes Besteuerungssystem und einzigartig dysfunktionale Arbeitsregeln, die Arbeitnehmer weitgehend daran hindern zu streiken, zu klagen oder Gewerkschaften zu gründen. Es gibt sogar ein Geschäft, in dem Angestellte Alkohol, Zigaretten und Unterwäsche kaufen können, ohne Schweizer Steuern zu zahlen. Ich weiß noch, dass ich freitags nach der Schule oft dort war und zwischen den Parfümregalen und den Süßigkeiten zwangsläufig auf einen Kollegen meines Vaters oder die Mutter einer Schulfreundin traf. Die kleinen Welten in Genf wirken wie enthoben, als wären sie Gegenstand eines Kernphysikexperiments am CERN, das nordwestlich von Genf ein weitläufiges Gelände belegt, halb in Frankreich, halb in der Schweiz, zum großen Teil unter der Erde vergraben.
Mary Shelley schrieb ein Buch über einen Mann, ein Monster und die Orte, an denen beide Zuflucht suchten. Doch Frankenstein ist auch die Geschichte einer Stadt, die ja selbst wie eine aus Einzelteilen zusammengeflickte Chimäre anmutet, befeuert von Hybris, Gier und einer Spur des Übernatürlichen.
In seinem Essay über den Begriff des Unheimlichen stellt Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, fest, dass das deutsche Wort heimlich – ehedem heimelig, vertraut – häufig im gegensätzlichen Sinn gebraucht wird. »Wir werden überhaupt daran gemahnt«, erklärt Freud, »daß dies Wort heimlich nicht eindeutig ist, sondern zwei Vorstellungskreisen zugehört, die, ohne gegensätzlich zu sein, einander doch recht fremd sind, dem des Vertrauten, Behaglichen, und dem des Versteckten, verborgen Gehaltenen.«
(Un)heimlich ist Genf. (Un)heimlich ist das Niemandsland. Man könnte zehnmal am Tag an diesen Orten vorübergehen, ohne sich Gedanken zu machen, was – oder wo – sie eigentlich sind. Ich muss es wissen – ich habe es achtzehn Jahre lang getan. Und wäre ich nicht fortgezogen, würde ich es wahrscheinlich weiter tun.
Also schreibe ich dies alles zunächst aus meiner Erinnerung – vielmehr den Versatzstücken meiner Erinnerung – und aus der Ferne. Dann gehe ich zurück, um meine Schritte nachzuzeichnen und meinen Sinneswahrnehmungen von damals nachzuspüren. Nur aus der Distanz finde ich die passenden Worte, um die Stadt Genf und den Schweizer Staat zu beschreiben: Dabei geht es mir weniger um die konkrete Realität der Schweiz als um die Macht über die 41000 Quadratkilometer und darüber hinaus, die sie im Herzen Europas darstellt.
Alles begann mit Körpern.
Damals gab es noch keine Großbanken, keine internationalen Organisationen, nicht einmal Papiergeld. Es war eine Zeit vor dem Kapitalismus, dem Nationalismus und dem Imperialismus, wie wir sie kennen.
Als die Alte Eidgenossenschaft als Zusammenschluss von Kantonen ins Leben trat, sah die Schweiz aus wie »ein Flickenteppich aus einander überlappenden Gerichtsbarkeiten, uralten Bräuchen, wurmstichigen Privilegien und Zeremonien, unterschiedlichen Zöllen, Gesetzen, Maßen und Gewichten«, schreibt der Historiker Jonathan Steinberg in Why Switzerland?. Eine »fantastische Ansammlung von Kleinstrepubliken, Fürstbistümern, Fürststiften und Grafschaften, freien Städten, souveränen Klöstern und Konventen, freien Tälern, Zünften, Oligarchien und Städtearistokratien« prägte das Territorium.
In anderen Worten: Einen homogenen Staatskörper für die Schweiz hätte nicht einmal Dr. Frankenstein zusammenflicken können – doch das war nichts Ungewöhnliches. Das Heilige Römische Reich, dem die Alte Eidgenossenschaft angehörte, war genauso chaotisch: Nominell das Territorium eines Kaisers, beinhaltete es zahllose Regierungseinheiten, darunter Herzogtümer, Marquisate, Königreiche, Abteien, Stadtstaaten und andere Herrschaftsgebiete.
Dies sollten wir uns ins Gedächtnis rufen, wenn wir uns heute das »merkwürdige« Phänomen Niemandsland ansehen. Wer von uns Geographie und Geschichte anhand einer Weltkarte lernte, findet es vermutlich seltsam, dass innerhalb desselben Staatsgebiets parallele oder einander überlappende Steuer-, Polizei- und Einwanderungssysteme existieren. Doch dieses Gefühl ist eher einem nationalistischen Mythos als historischen Fakten geschuldet. Der Nationalstaat, so die Historikerin Claire Vergerio, wurde nach dem Westfälischen Frieden 1648 nicht plötzlich zur »einzigen legitimen Einheit im internationalen System«. Ganz im Gegenteil. Das sogenannte Westfälische Ideal – ein Land, ein Volk, eine Regierung – war bis zur Entkolonialisierung nicht wirklich umgesetzt. Der Nationalismus hat »unsere kollektive Wahrnehmung zu der Überzeugung umprogrammiert, seit 1648 sei dies der Status quo«, schreibt Vergerio.
Nicht geändert hat sich die Tatsache, dass Herrscher Macht über ihr Volk ausüben können. Und die Schweizer erkannten, lange bevor sie zur Nation wurden, wie sie ihre Fähigkeit, Regeln aufzustellen, Gesetze zu erlassen und Armeen zu bilden, zu Geld machen konnten.
Der Kern der Eidgenossenschaft bildete sich 1291, als die Kantone Uri, Schwyz und Unterwalden die Angriffe ihrer Nachbarn abwehren mussten und sich zu einem Bündnis zusammenschlossen, um künftig ihren Schutz zu gewährleisten. Ihr gemeinsamer Feind war das Reich Habsburg, und aufgrund von Spannungen zwischen den Habsburgern und den Kantonen sah sich Herzog Leopold I. 1315 schließlich veranlasst, die Schweizer mit einer achttausend Mann starken Armee anzugreifen – und erfuhr prompt eine überraschende Niederlage.
Die Geheimwaffe seiner Gegner? Ein in sogenannten Gevierthaufen kämpfendes Fußvolk, bewehrt mit fünfeinhalb bis sechs Meter langen Piken. Dank dieser Taktik errangen die Schweizer in den nachfolgenden eineinhalb Jahrhunderten gewaltige Siege, bezwangen österreichische und burgundische Armeen, die vier- bis sechsunddreißigmal so stark waren wie sie. Bis ins ausgehende 15. Jahrhundert war das Bündnis zu acht eigenständigen Regionen angewachsen, zusammengehalten durch Abkommen und Verträge. Ihr ruchloser Ruf verbreitete sich bald in ganz Europa, und so dauerte es nicht lange, bis ihre einzigartigen taktischen Formationen nicht nur gefürchtet und geachtet, sondern auch exportiert wurden, nämlich in Gestalt gut ausgebildeter Krieger.
Im Rückblick lässt sich der aufkeimende Söldnerhandel der Kantone am besten durch Angebot und Nachfrage erklären. Die Schweiz war zur damaligen Zeit sehr arm; ihre Bevölkerung war gewachsen und belastete mittlerweile das urbare Land und die Ressourcen der Alpenregionen über Gebühr. Angrenzende Monarchien (vor allem die französischen) hatten innere Probleme zu bewältigen, die ihnen die Bildung eigener Milizen erschwerten. Die Feudalherren fürchteten aufrührerische Bauern, die Könige wiederum misstrauten den Feudalherren, weil diese ihre Macht in Frage stellen konnten. Hier kommen nun die Schweizer ins Spiel. »Um die Probleme zu lösen, die sich aus der Überbevölkerung dieser kargen Erde ergaben, deren Ertrag durch keine öffentlichen Investitionen gesteigert wurde, schritten die Oberhäupter der herrschenden Familien zu einer originellen Lösung: Sie verkauften ihre Landsleute als Söldner an ausländische Regierungen!«, schreibt der Schweizer Politiker, Intellektuelle und Aktivist Jean Ziegler in seinem Buch Eine Schweiz: Über jeden Verdacht erhaben.
Zunächst verdingten sich die Söldner der Kantone auf eigene Faust: Als freie Reisläufer wurden sie oft spät bezahlt und erhielten kaum Arbeitsschutz. Weil sie in der Heimat keine Perspektive hatten, machten sie das Beste aus ihrem Soldatenleben und beteiligten sich an den obligatorischen Plünderungen, Trinkgelagen und Hurereien. Im 17. Jahrhundert verfügte das Söldnerwesen bereits über feste Strukturen: Es gab Anwerber, Mittelsmänner, Militärunternehmer und Verhaltenskodizes. Die Männer genossen sämtliche Vorteile ihres Schweizer Rückhalts – Ausbildung, Ausrüstung, Sold –, ohne tatsächlich für ihr Land zu kämpfen.
Die Männer eines Kantons dienten im Regiment; sie gingen gemeinsam in die Fremde, kämpften und kehrten je nach Jahreszeit in die Heimat zurück. Ihre Ungebundenheit konnte als Garant für Neutralität gesehen werden. Söldner hegten keinerlei Groll, weder gegen die Monarchen, die sich mit ihrer Hilfe gegen die Feudalherren behaupteten, noch gegen die Feudalherren.
Die Männer agierten außerhalb der Gerichtsbarkeit ihrer Vertragspartner, trugen dagegen ihr Heimatgesetz mit sich herum wie streitlustige Schnecken ihre Häuser. Ihren Arbeitgebern gefiel das Arrangement. »Diese bewaffneten Verbände agierten völlig unabhängig, mit eigenen Regeln, eigenen Richtern und eigenen Fahnen«, liest man in einer Chronik des Vatikans, der bis zum heutigen Tag Schweizer Soldaten als päpstliche Palastwache beschäftigt. »Die Befehle wurden von Schweizer Offizieren in ihrer Landessprache, dem Deutschen, erteilt, und die Söldner blieben dem Gesetz ihrer Kantone unterstellt: Kurzum, das Regiment war ihr Vaterland, und all diese Gepflogenheiten wurden in späteren Jahren in ähnlichen Übereinkünften bestätigt.«
Eine Schlüsselrolle in diesem Handel kam den sogenannten Militärunternehmern zu. Sie rekrutierten die armen Söhne der Eidgenossen, bildeten sie aus und verpfändeten sie an ausländische Armeen. Zum Ende des 18. Jahrhunderts dienten bereits siebzigtausend Männer aus den Kantonen permanent im Ausland; sie kämpften für alle und jeden, von der französischen Krone bis zur niederländischen Ostindienkompanie, wehrten Feinde ab, kamen viel herum und spielten letztlich eine kleine, aber bedeutende Rolle in der Kolonisierung des indischen Subkontinents.
Was die Menschen anbelangte, gegen die sie fochten: »Im Aufbegehren der Bürger gegen den Absolutismus und in den freiheitlichen Klassenkämpfen«, schreibt der Historiker Victor G. Kiernan, »kämpfte Bürgersoldat und Bürgermiliz gegen den Söldner, in dem man das Alte, das Reaktionäre und den repressiven Arm des Königs sah.« Die Animosität beruhte nicht auf Gegenseitigkeit; für die Söldner war der Krieg nichts weiter als ein Geschäft. Als gedungene Soldaten hatten sie keinen Anteil am Auskommen der Lokalbevölkerung, an ihren Familien, ihren Leben. Sie sprachen nicht einmal deren Sprache. Und da sie mehr Sold erhielten als die einheimischen Rekruten, bestand keinerlei Gefahr, dass sie sich aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur selben Klasse, selben Religion oder zum gleichen Handwerk in Solidarität verbünden würden. Sie erledigten ihren Auftrag und gingen danach ihrer Wege; sie hinterließen weder Witwen noch Waisen und forderten keine Pensionen, keine Gesundheitsversorgung und keine Unterbringung.
Resultat dieses Menschenmarkts war, dass mittellose Männer aus den Kantonen zu Waren degradiert wurden. »Soldaten waren zu einem standardisierten vermarktbaren Produkt geworden, zu einer ›Gebrauchsware‹«, schreibt der Historiker John Casparis. Die Kommerzialisierung der Männer – oder war es eine Entmenschlichung? – ging so weit, dass man mit ihnen Handel trieb, als wären sie Vieh. Käse wurde zur wichtigen schweizerischen Exportware, doch die Städte, die die berühmten Gruyère-, Raclette- und Emmentaler Käse produzierten, brauchten für deren Herstellung einen beständigen Vorrat an Salz, und im landumschlossenen Hinterland war keines zu finden. Also einigten die Kantone sich mit der französischen Krone. Wie schon die römischen Legionäre, auf die der Ausdruck zurückgeht, waren die Söldner ihr Salär wert, im wörtlichen Sinn. Sie waren ein wesentlicher Bestandteil der Schweizer Außenpolitik.
Und sie dienten tatsächlich ihrem Land, auf ihre ganz eigene Weise. Das Söldnerwesen brachte einen Zustrom von Geld und hob die Beschäftigungsquote. Einer Schätzung zufolge emigrierten im 15., 16. und 17. Jahrhundert vier Prozent der Bevölkerung als Söldner, wobei der Anteil bis zum Ende des 18. Jahrhunderts auf ein bis zwei Prozent sank. Die Söhne der oberen Schichten wurden als Offiziere angeworben. Ein Leutnant brachte fünfmal mehr ein als ein Soldat; ein Hauptmann fünfzehnmal so viel. Doch die Männer in den untersten Rängen waren abhängige Dienstboten, lebten wie heutzutage die Wanderarbeiter in Dubai oder die Hausangestellten in Singapur. Der Sold war nicht eben üppig, sie genossen keinerlei soziales Ansehen, und viele von ihnen starben im Ausland, auf dem Schlachtfeld oder an einer Krankheit.
Doch junge Männer für ein anderes Land in den Tod zu schicken, war eine bequeme Art und Weise, in der Heimat die Stabilität zu erhalten. Die Streitlust mittelloser junger Männer im Ausland zu entfesseln, war allemal besser, als sich in der Heimat ihren Forderungen stellen zu müssen. »Ein aufrührerischer junger Obwaldner war verständlicherweise im Regiment des Bourbonenkönigs in Neapel besser aufgehoben als vor den Toren Basels, und zweifellos ist die Kompromissbereitschaft zum großen Teil dem Export der Kompromisslosen geschuldet«, schreibt Jonathan Steinberg.
Das damalige Söldnerwesen leistete der entstehenden Eidgenossenschaft gute Dienste. Es erhielt die gesellschaftliche Stabilität, schuf Arbeitsstellen, bewahrte junge Männer vor Scherereien und gewährleistete, dass größere, streitbarere Armeen gut daran taten, die Schweiz in Ruhe zu lassen.
Der Kanton Genf, damals ein unabhängiger Stadtstaat, trat der Eidgenossenschaft erst später bei, aber er hatte seine Lektion gelernt: Als ein effizienter, unkritischer Nachbar kann man ein Vermögen machen.
Es gibt zwei weitere Charaktere, die uns dabei helfen können, Genf besser zu verstehen, den Prediger und den Bankier.
Zu Beginn des 15. Jahrhunderts war Genf eine unabhängige Diözese zwischen dem Süden und dem Norden Europas. Die Stadt war nicht sonderlich groß, aber die Medici aus Florenz – die vermögendste und bedeutendste Kaufmannsfamilie der Welt – errichteten an der heutigen Hauptgeschäftsstraße eine Bank. (Aktuell befindet sich dort eine Hermès-Boutique.) Die Medici wählten Genf aufgrund seiner Lage und seines blühenden Tuch- und Luxusgüterhandels. »Die Stadt war ein Zwischenlager, ein Umschlagplatz, und sie war eine Stadt, die für die umliegenden Regionen und Länder im Europa der Frühen Neuzeit sehr nützlich war«, sagte mir die Historikerin Helena Rosenblatt. Die Medici konnten nicht ahnen, dass das Bankenwesen einmal den Handel mit Textilien und anderen materiellen Gütern um ein Mehrfaches übertreffen würde.
1541 trat eine ganz andere Figur auf den Plan: Johannes Calvin, ein französischer Jurist und protestantischer Theologe, würde in Genf von seiner Kirchenkanzel aus das Regiment führen. Auch er sollte auf dem Genfer Marktplatz seine Spuren hinterlassen.
Calvin war maßgeblich an der protestantischen Reformation beteiligt, deren führende Köpfe – darunter Martin Luther – einen größeren Fokus auf die Heilige Schrift forderten, das Wort Gottes. Damals waren die katholischen Päpste korrupt geworden und hatten daher ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt. Die Einwohner der Stadt Genf sind heutzutage nicht mehr sonderlich religiös, Erinnerungen an die Reformation sind trotzdem allgegenwärtig. 1909, zum vierhundertsten Geburtstag Johannes Calvins, schufen Bildhauer eine fünf Meter hohe Skulptur des Reformators. Sie thront noch heute auf einem Sockel an der Mauer der Reformatoren über einem schmalen Wasserbecken, in dem in jedem Frühjahr meiner Kindheit kleine Entenküken um Brotstückchen bettelten. Auch der Wahlspruch der Stadt ist in die Mauer geritzt: Post tenebras lux. ›Nach der Dunkelheit das Licht.‹
Andere protestantische Größen sind ebenfalls in der Mauer verewigt: der schottische Reformator John Knox, Théodore de Bèze, Guillaume Farel und Wilhelm I., Fürst von Oranien, Wilhelm der Schweiger genannt. Verdrießlich waren sie allesamt, doch Calvin tat sich in dieser Hinsicht besonders hervor. In seinem Genf gab es weder Kunst noch Theater noch andere Lustbarkeiten, und wer gegen die Regeln verstieß und Lärm machte, musste mit harten Strafen rechnen. Dennoch sagte der armen, arbeitenden Bevölkerung seine Botschaft zu, lobte diese doch das Gebet und die harte Arbeit und implizierte, dass sich im persönlichen Verhalten der Menschen spiegelte, wie gut (oder schlecht) sie vor Gott abschneiden würden.
Um eines deutlich zu machen: Calvin stellte keinerlei Kausalzusammenhang her zwischen harter Arbeit, Profit und Seelenheil; das Seelenheil war vorherbestimmt (von Gott) und (für den Menschen) unergründlich. Dennoch war es von Bedeutung, ob jemand durch sein irdisches Tun oder seine Berufung seine Hingabe zu Gott unter Beweis stellte.
1904 veröffentlichte der Soziologe Max Weber das Buch Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in dem er argumentierte, Calvins Ideen hätten sich in einen Lobpreis der Arbeit und der Anhäufung von Reichtum als Werte per se ausgewachsen. Diese Besessenheit von Fleiß, schrieb Weber, sei ein Mittel, die tiefe Verunsicherung zu kanalisieren, die der Calvinismus hinsichtlich unserer Sterblichkeit befeuert habe. Es gab zwei Welten: die diesseitige und die jenseitige. Einen todsicheren Weg in den Himmel gab es nicht. In ihrer Ratlosigkeit hätten die Calvinisten die Möglichkeit erwogen, dass materieller Erfolg vielleicht ein Zeichen sei für Gottes Gunst, so Weber. Dies sei zu einem Grundprinzip des Kapitalismus geworden, so sein Argument, habe es doch dazu beigetragen, den materiellen Erfolg protestantischer Gruppen über Genf hinaus und in der ganzen Welt zu erklären.
(Auch das Schweizer Bankgeheimnis könnte ein Abkömmling calvinistischen Denkens sein, allerdings aus ebenso politischen wie eigennützigen Gründen: Es konnte Protestanten, Einheimische wie Zugezogene, vor der mächtigen katholischen Kirche schützen. »Vor langer Zeit, als der Protestantismus in großen Teilen Europas verboten war, gaben wir Protestanten eine Zuflucht. Später waren die Juden unerwünscht. Aus unserer Sicht sind die Finanzgeschäfte eines Menschen ebenso heilig und ebenso bedeutsam wie seine Seele oder sein Körper. Warum sollten wir nur verfolgten Seelen eine Zuflucht bieten, und nicht auch verfolgtem Geld?«, erklärte 1965 ein Berner Bankier der Zeitschrift The Atlantic.)
Der Calvinismus änderte auch die Demographien in Genf. Die religiösen Konflikte, die in der Frühen Neuzeit durch Europa fegten, prägten maßgeblich Genfs Selbstverständnis als Zuflucht für Menschen, Ideen, Dinge und Geld. Als König Ludwig XIV. von Frankreich 1685 das Edikt von Nantes widerrief, das den Protestanten im Land Gleichbehandlung garantiert hatte, flüchteten viele von ihnen nach Genf – wo einige schließlich als Finanzberater für denselben König arbeiteten, der sie außer Landes getrieben hatte. (Pictet, die größte Privatbank in Genf, wird von einem Nachkommen eines jener königlichen Bankiers geleitet.) Über ihre Transaktionen bewahrten sie Stillschweigen: Dass der König mit Ketzern Geschäfte tätigte, durfte nicht nach außen dringen.
Wie angrenzende Kantone Krieger exportierten, exportierte Genf seine Bankiers. Der bekannteste war Jacques Necker, Sohn eines Theologen und Vater der Schriftstellerin Madame de Staël. Er hatte zunächst mit Getreide spekuliert und die Erträge dann in der französischen Ostindienkompanie investiert, die den Subkontinent plünderte. Die Schweiz war keine Imperialmacht im herkömmlichen Sinne, verbrüderte sich aber mit dem Imperialismus: Ihre Bankiers spielten eine maßgebliche Rolle bei der Finanzierung der von der Krone mit Rechten ausgestatteten Handelsunternehmen. Gleichzeitig halfen Söldner aus den Kantonen diesen staatenähnlichen Systemen dabei, im Ausland bedeutende Schlachten zu schlagen.
Necker wurde unabhängig davon durch seine Finanzgeschäfte reich, und er errang in Paris, unter Ludwig XVI., einen hohen Posten im Finanzwesen. Als Prototyp eines königlichen Finanzchefs wurde Necker damit beauftragt, Kapital zu beschaffen – und zwar schleunigst. Schließlich galt es, Kriege zu finanzieren und Marie Antoinette bei Laune zu halten. Seine Herkunft kam Necker zugute. Seine Landsleute in Genf hatten gewinnbringende Pläne – Pläne, an denen Necker sich beteiligen würde.
Um öffentliche Arbeiten zu finanzieren, hatte der französische Staat schon seit längerem Jahresrenten verkauft, deren Renditen bis zum Tod des Käufers ausbezahlt wurden. Eine solche Rente ist ein Finanzprodukt, das seinem Käufer in regelmäßigen Raten einen festen Geldbetrag verspricht. Sinn des Ganzen ist, dass der Verkäufer sofort eine große Summe Geldes erhalten kann, wogegen der Käufer über eine festgesetzte Dauer einen unentwegten Geldstrom plus Zinsen garantiert bekommt.
Als die Franzosen in das Geschäft mit den Jahresrenten einstiegen, lange bevor Necker auf den Plan trat, hing die Höhe dieser Rückzahlungen zunächst vom Alter des Käufers ab: Einem Siebzigjährigen, der hundert Pfund investierte, wurden vielleicht zehn Pfund jährlich versprochen, weil er aller Wahrscheinlichkeit nach früher starb als ein Kunde, der nur halb so alt war; Letzterer erhielt aufgrund seiner höheren Lebenserwartung nur fünf Pfund jährlich. Die Investition war für beide Parteien ein Wagnis, aber sie war so austariert, dass beide den Eindruck haben konnten, der Einsatz werde sich lohnen.
Um 1760 veränderten die Franzosen ihre Konditionen. Der Staat verkaufte nun Produkte, die jedem Käufer altersunabhängig eine feste Summe garantierten; die Mittelwerte, so die Begründung, würden auf lange Sicht zu ihren Gunsten arbeiten. Die Genfer Finanzexperten fanden schnell heraus, dass nichts sie daran hinderte, im Namen eines Kunden Jahresrenten zu kaufen und einen Teil der Erträge für sich zu verbuchen.
1774 ließ ein Impfstoff gegen die Pocken die Überlebensraten von Kindern maßgeblich steigen, und so versuchte ein Schweizer Bankier, gemeinsam mit seinem Hausarzt, sich die Persönlichkeitsrechte von denjenigen anzueignen, die am wahrscheinlichsten sehr lange leben würden: die geimpften, wohlbehüteten jungen Töchter des Schweizer Bürgertums. Die »Dreißig Genfer Mädchen«, wie man sie nannte, bildeten das Fundament für lukrative Jahresrentenverträge. Die Bankiers kauften die Anleihen in ihrem Namen und zahlten die Erträge regelmäßig an Investoren jeden Alters und deren Erben aus.
Das war längst nicht alles. Ein gesundes Leben war schön und gut, aber Genf war immer noch die Stadt Calvins: Es war nicht vorauszusehen, wem Gott gewogen wäre. Also reduzierten die Bankiers das Risiko, indem sie, anstatt nur auf ein einziges Mädchen zu setzen, Tranchen aus zehn, zwanzig, dreißig und mehr »Köpfen« packten und sich auf eine Ertragsrate einigten, die auf Durchschnittswerten beruhte. Dann verkauften sie Anteile dieser Pakete an Spekulanten (und, kommt Ihnen das bekannt vor?).
Da die Monarchie ihn drängte, die Erträge zu steigern, bediente sich Jacques Necker dieser »Finanzakrobatik« seiner Landsleute, um den klammen französischen Staat über Wasser zu halten. Dieser Zustrom von Geld blies neues Leben in das Programm. Necker habe die Jahresrenten zwar nicht erfunden, schrieb der Schweizer Historiker Marc Cramer, der den Trick aufgedeckt hatte, aber »den maßlosesten Nutzen daraus gezogen, nachdem er sie aus den Tiefen der Aktenschränke des Rechnungshofes gezogen hatte«.





























