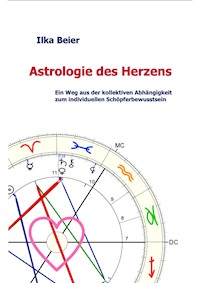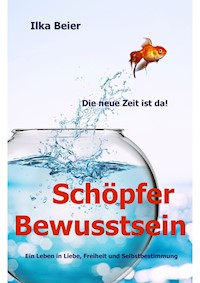
9,99 €
Mehr erfahren.
Hallo und Willkommen auf der Erde! Das Leben auf diesem wunderbaren Planeten ist für mich eine absolute Besonderheit. Wir haben unendliche Möglichkeiten, uns auf der physischen Ebene auszudrücken, Dinge zu kreieren, Emotionen und Gefühle zu empfinden und uns in Beziehungen mit anderen auszutauschen. Unser Bewusstsein erweitert sich momentan exponentiell. Wir bekommen dadurch die Möglichkeit, immer mehr Facetten unseres multidimensionalen Weens zu entdecken und zu unserer wahren Größe zurückzufinden. Mit diesem Buch möchte ich dich ermutigen, die eigenen Grenzen zu sprengen und deinen ganz individuellen Weg zu gehen. Dazu ist es manchmal nötig, die Matrix zu verlassen und alte Strukturen und Muster endgültig aufzulösen. Unsere einzigartigen Fähigkeiten, die in jedem von uns bereits von Geburt an angelegt sind, warten nur darauf, dass du sie benutzt und mit ihnen spielst. Liebe, Freude, Kraft, Harmonie und Kreativität sind unser Geburtsrecht (um nur einige zu nennen). Die momentane Zeitqualität lässt uns immer leichter auf diese inneren Ressourcen zugreifen. Je mehr Menschen sich an diesem Prozess beteiligen, desto schöner, leichter und freudiger wird es für uns alle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ilka Beier
Schöpfer Bewusstsein
Ein Leben in Liebe, Freiheit und Selbstbestimmung
© 2021 Ilka Beier, D - 65719 Hofheim am Taunus
www.ilkabeier.de
Korrektorat: Miriam Landwich
Verlag: tredition GmbH
2. Auflage, Vorgängerausgabe 2021
Printed in Germany
ISBN: 978-3-347-83350-0 (Paperback)
ISBN: 978-3-347-83351-7 (Hardcover)
ISBN: 978-3-347-83357-9 (e-Book)
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 D-Ahrensburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung «Impressumservice», An der Strusbek 10, 22926 D-Ahrensburg
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Wer ist die Person hinter der Maske?
Was ist eigentlich ein Wert ?
Gefühle und Emotionen
Aufwachen - Verhaltensmuster erkennen
Zugehörigkeit - den anderen gefallen wollen
Perfektion - sich zum Objekt machen
Vernunft - sich der Außenwelt anpassen
Geistige Minderwertigkeit - sich für unfähig halten
Beziehungs-Harmonie - die eigene Kraft abgeben
Vergangenheit - sich als Opfer fühlen
Mangel - die Materie ablehnen
Feindbilder - Angstmacher erkennen
Verändern - das Leben neu ausrichten
Kindliches Ego versus erwachsenes Ego - das Ego loswerden wollen
Den Verstand verstehen - Gedankenmuster entlarven
Verstehen versus Erleben - den Bücherschrank ausmisten
Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche, Befürchtungen - die Komfortzone verlassen
Versagensangst auflösen - sich trauen
Begründungen sein lassen - geistig entspannen
Frieden finden - Sündenböcke adé
Freiheit spüren - Angebote der Außenwelt filtern
Genießen können - annehmen was ist
Wertschätzung - Liebe fließen lassen
Sich benehmen - Achtung und Respekt zollen
Ehrlichkeit - authentisch sein
Nein sagen - Entscheidungen treffen
Die Meta Ebene - über den Tellerrand schauen
Bei sich selbst ankommen - warum ist die Erde rund?
Die Matrix erkennen - die Türen des Käfigs sind offen
Selbstermächtigung - die Klarheit in der Ohnmacht
Bewusst Mensch sein - die eigene Besonderheit leben
In der eigenen Zeit bleiben - Gelassenheit als innere Stärke und Kraft
Verjüngung - den Hauch der Unendlichkeit wahrnehmen
Schöpfermodus - Reichtum auf allen Ebenen
Ausblick - eine neue Welt erschaffen
Danksagung
Autorenbeschreibung
Einleitung
Momentan, während ich an diesem Buch schreibe, tobt in der äußeren Welt ein fiktiver Krieg. Es ist ein Krieg der Informationen und wie schon so oft in der Geschichte geht es lediglich darum, wer die Guten und wer die Bösen sind. «Divide et impera» (lat. «teile und herrsche») wurde seit jeher dazu benutzt, um Menschen, Gruppen oder sogar ganze Völker zu spalten, damit sie sich gegenseitig be– kämpfen. Vereinigung bedeutet Stärke. In hierarchischen Systemen, in denen wir immer noch leben, ist dafür kein Platz. Diese Systeme können überhaupt nur existieren, weil wir uns gegeneinander richten.
Wollen nicht alle Menschen in Liebe, Frieden und Freiheit leben? Wenn ja, warum ist es dann nicht so? Warum lassen wir uns als liebende, intelligente Wesen so verführen, dass wir uns anfeinden, anstatt miteinander eine wundervolle Zeit hier auf der Erde zu verbringen?
Bereits in meiner Jugend spürte ich, dass irgendetwas nicht stimmen konnte. Ich las Erich Fromms «Die Kunst des Liebens» und musste traurig feststellen, dass die Menschen um mich herum genau das nicht lebten. Fast dreißig Jahre verbrachte ich damit, mich dem System anzupassen und gut zu funktionieren. Meine Vision von einer liebevolleren und frei– eren Zukunft gab ich jedoch niemals auf.
Irgendwann fängt jeder von uns an Fragen zu stellen. Wir alle verfügen über ein höheres Bewusstsein, welches wir ab einem gewissen Punkt nicht mehr unterdrücken können. Wir sind jedoch durch unsere Ansichten, Überzeugungen, Urteile, Glaubensstrukturen und Identifikationen so geprägt, dass wir keinen neutralen Blick mehr auf das zulassen, was im Leben wirklich passiert.
Sehen wir also, was wirklich ist oder sehen wir nur, was wir sehen wollen? Schopenhauer bringt es auf den Punkt: «Bei gleicher Umgebung schaut doch ein jeder Mensch in eine andere Welt.» Ein Kind sieht die Welt völlig anders als ein alter Mensch, ein Physiker anders als ein Musiker und ein Buddhist anders als ein Atheist. Wir betrachten die Welt durch eine Brille von Glaubensmustern, Ideologien und Meinungen.
Diese Brille abzusetzen erfordert Mut.
«Erkenne dich selbst - werde, der du bist» steht über dem Eingang des Tempels von Delphi. Warum sind wir uns nicht gewahr, wer wir wirklich sind? Sind es unsere Erwartungen, wie wir zu sein hätten? Oder unsere Hoffnungen und Befürchtungen, was aus uns mal werden würde? Wir zwingen uns eine Maske zu tragen, aus der Angst heraus, ein anderer könnte uns durchschauen und unser wahres Wesen erkennen.
Wir fühlen uns klein und machtlos, einem übergeordneten «Etwas» ausgeliefert, welches wir noch nicht einmal benennen können. Unsere wunderbaren Eigenschaften, Fähigkeiten, Talente und Besonderheiten opfern wir einem System aus Angst vor Bestrafung und dem Verlust der Zugehörigkeit. Dabei ist unsere Einzigartigkeit das höchste Gut, welches wir besitzen; das System jedoch bringt uns dazu, uns mit anderen zu vergleichen und uns damit selbst zu richten.
Ist das System nun der Übeltäter, die Übermacht, die uns unmissverständlich zu verstehen gibt, dass es sinnlos ist dagegen anzukämpfen? Ich lasse diese Frage hier bewusst offen und werde am Ende des Buches noch einmal darauf zurückkommen.
Dieses Buch ist mein Angebot an dich, dein Leben ab jetzt selbstbestimmt und selbstbewusst in die Hand zu nehmen. Lange genug haben wir fremdbestimmt gedacht, gehandelt und gelebt. Das Chaos im Außen ist nichts weiter als ein Spiegel, der uns zeigt, dass auch in uns vieles ganz bewusst angeschaut und «in Ordnung» gebracht werden will. Wir befinden uns sozusagen an einem Umkehrpunkt. Die äußere Welt hat keine Struktur mehr, um uns zu diktieren, wie wir zu sein hätten. Wir sind diejenigen, die sich jetzt neu ausrichten und eine neue Art des Zusammenlebens erschaffen. Diese Welt darf jetzt zu dem Ort werden, den wir uns für uns und unsere Kinder schon so lange wünschen.
Wir sind unglaublich kraftvolle, intelligente und liebevolle Wesen. Wir sind in der Lage, friedlich und in Freiheit mitei– nander zu leben. Wir verfügen über unendliche Kreativität, um uns hier auf der Erde auszudrücken und zu erfahren. Unser Bewusstsein wartet nur darauf, dass wir endlich anfangen, bewusst zu «sein».
Ich wünsche dir viel Freude beim Lesen, neue Impulse und spannende Erkenntnisse.
Wer ist die Person hinter der Maske?
Auch was wir am meisten sind, sind wir nicht immer.
Marie von Ebner-Eschenbach
Wenn dich jemand fragen würde, welche Person du bist, was würdest du antworten? Vielleicht möchtest du an dieser Stelle eine kurze Pause einlegen und deine Gedanken dazu auf– schreiben.
Die meisten von uns beantworten diese Frage mit Eigen– schaften wie nett, zuvorkommend, lustig, schüchtern, sportlich… gefolgt von Wesensmerkmalen wie Angestellter, Handwerker, Deutscher, Professor, Schlagzeuger oder Vegetarier usw. Wir neigen dazu, uns über Charaktereigenschaften, Ausweise oder Titel zu definieren, doch sind wir das wirklich?
Die Welt als Bühne
Das Wort «Person» (abgeleitet vom lateinischen «personare») bedeutet im Ursprung «durchklingen». In der Antike trugen die Schauspieler auf der Theaterbühne Masken, damit der Klang ihrer Stimme durch die trichterförmige Mundöffnung verstärkt und so bis in die hinteren Ränge des Theaters gehört werden konnte. Die Person, und davon abgeleitet unsere Persönlichkeit, ist also folglich die Maske, die wir auf der Bühne des Lebens tragen. Wir spielen damit unsere Rollen, in die wir freiwillig geschlüpft sind. Wir identifizieren uns mit diesen Rollen und denken tatsächlich: «Das bin ich.» Möchten wir alles das, was uns in Wirklichkeit ausmacht, nur über eine Maske definieren und damit unsere Individualität auf ein Minimum reduzieren?
Wer sind wir ohne diese Maske? Viele von uns spüren intuitiv, dass wir so viel mehr sind, als uns unser Verstand bei all dem Wissen, das wir von klein auf gelernt haben, versucht einzureden. Als Kinder haben wir diese Rollen bewusst gespielt, aber wir wussten ganz genau, dass wir nur ein Spiel spielen.
Sobald wir uns mit den Rollen, in die wir geschlüpft sind, identifizieren, können wir nur noch reagieren. Wir sind dann nicht mehr in der Lage, etwas völlig Neues zu erschaffen oder uns selbst neu zu erfinden, weil wir die Rollen, und damit unsere scheinbare Persönlichkeit, die Maske, ablegen müssten. Stattdessen gehen wir Kompromisse ein und verzweifeln daran. Wir scheuen uns vor Veränderungen, weil wir intuitiv spüren, dass wir gezwungen wären, unser sorgfältig geform– tes «Ich» aufzugeben. Auch würden wir damit Gefahr laufen, dass uns andere nicht mehr erkennen und wir unsere Zugehörigkeit zur Gruppe verlieren. «Du hast dich aber verändert» bekommen wir dann zu hören, meist abschätzig, aber oftmals auch mit einem leichten Hauch von Neid.
Wir sind also nicht die Person, doch wer sind wir dann? Ohne Maske sind wir zunächst einmal ein Individuum (lat. «individuum» «Unteilbares», «Einzelding») ohne Bestimmung, dafür aber frei in der Wahl. Das heißt, wir sind einfach nur ganz wir selbst. Nur aus dem Selbst heraus können wir selbst«bewusst» sein und mittels Selbstbestimmung selbstständig entscheiden, wer wir sein wollen. Aus dem Selbst heraus sind wir in der Lage, uns selbst zu ermächtigen, zu tun, was wir wirklich wollen. Wir sind für unser gesamtes Denken, Fühlen und Handeln selbstverantwortlich und fühlen viel– leicht zum ersten Mal echte Selbstliebe und Selbstvertrauen.
- Beobachte dich einige Tage. Wo spielst du noch Rollen in deinem Leben? Manche Rollen kannst du vielleicht noch nicht von heute auf morgen ablegen. Spiele sie bewusst, ohne dich damit zu identifizieren.
Was ist eigentlich ein Wert?
Meistens belehrt erst der Verlust uns über den Wert der Dinge.
Arthur Schopenhauer
Viele Menschen glauben an äußere, vorgegebene Werte, an denen sie sich orientieren und ihren eigenen Wert messen können. Das sind zum Beispiel Vorgaben über den Wert des Geldes, also alles, was wir mit dem Etikett «teuer» (wertvoll) oder «billig» (wertlos) versehen. Das Anstreben bestimmter Berufe oder Studienfächer, modern auch Karriere genannt, welche den eigenen Wert erhöhen sollen, steht vor allem bei Männern hoch im Kurs, ganz nach dem Motto «Leiste was, dann hast du was, dann bist du was». Besitz ist ebenfalls ein beliebtes Mittel, um unseren Selbstwert anzuheben. Das Finden des richtigen Partners sowie die Fähigkeit, Kinder zu bekommen werden besonders von Frauen gerne benutzt, um den eigenen Wert zu definieren. Gewinnen, im Sinne von «die Konkurrenz ausschalten», bringt unseren Selbstwert kurz– fristig auf Vordermann, allerdings immer auf Kosten anderer.
Betrachten wir diese vorgegebenen Werte genauer, werden wir schnell feststellen, dass sie nicht aus sich selbst heraus entstanden sind, sondern kollektive, gesellschaftliche Vorgaben darstellen, nach denen wir uns richten können und auch sollen. Sie wurden in uns indoktriniert, entweder von unseren Eltern oder den Großeltern, die diese Werte ebenfalls übernommen haben. In der Schule lernen wir das Konkurrenzdenken, der oder die Beste sein zu müssen, in den Medien wird uns vorgespielt, wie ein erfolgreiches Leben auszusehen hätte und die Werbung offenbart uns, was wir alles brauchen, um überhaupt glücklich sein zu können.
Als Kinder übernehmen wir diese Werte zunächst einmal kritiklos. Wenn wir hier auf die Erde kommen, brauchen wir zu Beginn unseres Lebens Orientierungspunkte, um uns in der physischen Welt zurecht zu finden. Wir verankern deshalb diese Vorgaben als Wahrheiten, die uns von unserem Umfeld vorgelebt und damit bestätigt werden. Zusätzlich zu der Liebe und Geborgenheit, die wir von unseren Eltern erhalten, entwickeln wir auf diese Art und Weise ein Gefühl von Vertrauen, Sicherheit und Struktur.
Ein Wert in der äußeren Welt kann niemals aus sich selbst heraus entstehen, sondern muss diesen Wert zugewiesen bekommen oder, im Umkehrschluss betrachtet, besitzt aus– nahmslos alles in der Außenwelt einen Wert. Mit anderen Worten, alles, was wir im Außen als wertvoll oder minder– wertig betrachten, muss irgendwann einmal von irgend– jemandem eine Wert«schätzung» erhalten haben. Es gibt also, ganz objektiv gesehen, keine objektiven Werte, auch wenn wir glauben, das sei so. Unser Glaube und das Vertrauen in diese kollektiven Vorgaben führen dazu, dass wir die vorgegebenen Werte-Strukturen nicht hinterfragen. Wir erschaffen uns mit ihnen einen Handlungsrahmen, in dem wir sicher und ohne groß darüber nachzudenken agieren können. Durch diese bedingungslose Akzeptanz legitimieren wir vieles in unserem Leben, angefangen bei familiären Verpflichtungen über Berufswahl, Partnerwahl, materiellen Status bis hin zu generationsübergreifendem Verhalten.
Äußere Werte sind immer subjektive Werte, welchen wir als Menschen einen persönlichen Wert verleihen. Somit sind sie völlig individuell und dürfen auch von jedem Menschen ganz individuell bewertet werden. Ein Gemälde, welches kollektiv gesehen vielleicht einen sehr hohen Wert besitzt, bedeutet uns gar nichts im Vergleich zu einem selbstgemachten Schmuck– stück eines Freundes, welchem wir einen hohen Wert ver– leihen, einfach weil der Mensch uns so viel bedeutet.
Bewertungsmuster - aufwerten, abwerten, urteilen
Dinge, Sachverhalte, Aussagen und Meinungen zu bewerten ist für uns Menschen unabdingbar, weil wir auf diese Art und Weise unseren persönlichen Geschmack bilden. Wir ent– scheiden, welche Kleidung uns gefällt, welche Musik uns berührt, was uns schmeckt, welche Art von Kunst und Krea– tivität uns anspricht, welche Hobbys wir pflegen und wie wir uns weiterbilden. Unser gesamter Alltag, ob angenehm oder unangenehm, gestaltet sich durch unsere Vorlieben und Ab– neigungen, ohne diese das Leben äußerst farblos, ja geradezu eintönig und langweilig wäre. Durch diese Einteilung sind wir in der Lage, Intensität wahrzunehmen und gleichzeitig die Welt immer wieder neu zu betrachten und zu erleben.
Kleine Kinder sind wahre Meister im Bewerten. Sie geben uns unmissverständlich und direkt zu verstehen, was sie mögen und was nicht. Wenn wir älter werden, sammeln wir Wissen und bewerten aus dem Verstand heraus mittels Logik und das ist auch gut so. Einen Computer zu kaufen, nur weil das Gehäuse so schön metallisch glänzt, wäre töricht. Unsere Entscheidung treffen wir (unter anderem) natürlich aufgrund der Ausstattung und der technischen Details.
Gibt es nun auf unserer Welt gerade deshalb so viel Leid und Missstände, weil wir eben alles bewerten? Sollten wir deshalb das Bewerten nicht besser schnellstmöglich abstellen? Genau genommen ist dies auch ein Werten. Das Bewerten wird als negativ bewertet und damit abgewertet. Wer hat nun Recht?
Betrachten wir uns die beiden Wörter «bewerten» und «beurteilen» einmal etwas genauer. Wenn ich etwas bewerte, dann weise ich einem Sachverhalt einen Wert zu, der aber nicht zwingend positiv sein muss. Wenn ich etwas beurteile, fälle ich ein Urteil. Ein Urteil hat immer etwas Endgültiges.
Entscheidend dabei ist der Bezug. Bilden wir einen Bezug zu uns selbst, dass uns zum Beispiel die Pizza aus einem bestimmten Restaurant gut schmeckt oder wir gewisse Modeerscheinungen nicht schön finden, dann weisen wir damit Sachverhalten Werte zu, die uns selbst betreffen. Sage ich zum Beispiel zu jemandem, dass er besser Klavier spielt als ich, dann ist das ein Kompliment in Form einer Bewertung. Drehe ich das um und meine, dass ich besser Klavier spielen kann als mein Gegenüber, ist das immer noch ein Werten. Behaupte ich jedoch Klavierspieler sind die besseren Menschen, dann kommt dies einem Urteil gleich. Zum einen fehlt der Ich-Bezug und zum anderen der Ver– gleich, da Klavierspieler mit Nicht-Klavierspielern überhaupt nichts gemeinsam haben und deshalb gar nicht miteinander verglichen werden können. Es gilt also genau zu unter– scheiden, ob wir bewerten oder beurteilen. Urteile sind Bewertungen, die aus dem Kontext gerissen wurden und oft mit Pronomen wie «alle, jeder, niemand» usw. besetzt sind. Sie werden uns als kollektive Werte (fast immer in Form von Glaubenssätzen) vermittelt, nach denen wir uns richten sollen.
Manche Menschen neigen dazu, sich selbst zu verurteilen. Beliebte Ansichten über uns selbst sind zum Beispiel:
Ich kann das nicht
Ich bin nicht intelligent genug
Ich schaffe das nie
Ich bin süchtig
Ich bin hässlich
Ich habe kein Selbstbewusstsein
Ich bin ein Versager
Niemand interessiert sich für mich
usw.
Alle diese Aussagen haben zur Folge, dass wir uns dauerhaft klein und minderwertig fühlen. Wir reagieren dann im täglichen Leben mit bestimmten Verhaltensweisen:
Sätze, die mit «Ja, aber…» beginnen
Jammern über die Zustände
Beschäftigung mit längst vergangenen Situationen
Gestresst sein, ohne zu wissen warum
Sich als Opfer der Umstände fühlen
Sich mit anderen vergleichen
Schnell beleidigt sein
Arrogant oder aggressiv reagieren
Jedes Kind wird mit einem völlig intakten Selbstwertgefühl geboren. Dieser angeborene Selbstwert ist in unserem physischen Körper verankert und bleibt ein Leben lang, auch wenn wir uns selbst verurteilen oder uns von äußeren Umständen oder Menschen demütigen oder niedermachen lassen. Wir fühlen es nur nicht mehr und glauben deshalb, das Selbstbewusstsein sei uns abhandengekommen. Wenn wir uns selbst abwerten, dann tun wir das immer aufgrund einer äußeren Beurteilung, die wir von anderen angenommen haben.
Selbstwert - kein Problem!
Nicht alle Menschen leiden unter einem geringen Selbstwert, es gibt auch diejenigen, für die ein «gesundes» Selbstwertgefühl kein Problem zu sein scheint. Sieht man jedoch genauer hin, ist dies oft nur die Kompensation eines Minderwertigkeitsgefühls mittels eines aufgeblasenen Egos, was sich leicht von echtem Selbstwert unterscheiden lässt. Man erkennt diese Menschen an einer aufgeblähten Ausstrahlung und Handlungen, die vom Kopf gesteuert werden (der dann oftmals durch die Wand will). Das Leben wird zu einer Herausforderung, die nur mit Kampf bewältigt werden kann, ständig Kraft kostet und den Alltag anstrengend werden lässt. Das Ego hat die Funktion, uns an unsere Besonderheit und Einzigartigkeit zu erinnern. Übergehen wir jedoch diesen Punkt, avancieren wir das Ego zum Chef, welcher alles steu– ern und kontrollieren will. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist die Leichtigkeit, die Freude und die Liebe zu uns selbst. Das Ego und seine Tricks werden wir im Kapitel über das Ego noch genauer unter die Lupe nehmen.
- Reflektiere über deine Bewertungen (zum Beispiel was du schön findest und was nicht) und Urteile (zum Beispiel Überzeugungen, die du in der Kommunikation mit anderen austauschst).
Gefühle und Emotionen
Düfte sind die Gefühle der Blumen.
Heinrich Heine
Gefühle und Emotionen scheinen eine große Bedeutung für unser psychisches Wohlbefinden zu haben. Während die Generation der heute Älteren noch dazu angehalten wurde, möglichst wenig Emotionen zu zeigen beziehungsweise diese gut zu kontrollieren, wurde den nachfolgenden Generationen genau das Gegenteil empfohlen, nämlich Gefühle zuzulassen, Ängste loszulassen, Trauer zu erlösen und so weiter.
Ebenso wie alles andere auf der physisch-menschlichen Ebene teilen wir Emotionen gerne in «positiv» und «negativ» ein, also solche, die sich angenehm und andere, die sich eher un– angenehm anfühlen.
Ich möchte an dieser Stelle kurz darauf eingehen, wie Gefühle und Emotionen entstehen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
Ein Gefühl funktioniert wie ein Sensor, mit dem wir etwas wahrnehmen, also erfühlen können. Wir sagen dann zum Beispiel: «Ich habe das Gefühl, ich sollte besser die Bahn nehmen und nicht das Auto.» Eine solche Wahrnehmung hilft uns, schnelle und intuitive Entscheidungen zu treffen. Dabei hat das Gefühl immer einen Bezug zu etwas Aktuellem oder Zukünftigem, das heißt, es steht nicht in Verbindung mit der Vergangenheit.
Eine Emotion erzeugt eine bestimmte Frequenz oder Schwingung und kann sich auf ein Thema aus der Vergangenheit, Gegenwart oder auch der Zukunft beziehen. Wir fühlen uns dann entweder gut oder schlecht und nehmen das auch ganz körperlich wahr. Bei anderen Menschen spüren wir an deren Ausstrahlung, mit der wir in Resonanz gehen, ob jemand zum Beispiel gerade wütend oder traurig ist.
Signalgebung
Emotionen fungieren unter anderem als Signalgeber. Im Gegensatz zu angenehmen Emotionen wie Liebe, Freude und Glück, die aus sich selbst heraus entstehen können, brauchen Wut, Neid und Eifersucht immer einen Startpunkt, also eine Information im Außen. Wir können Liebe und Freude empfinden, wenn wir im Garten sitzen und uns einfach nur wahrnehmen, während uns das mit Wut nicht gelingt. Emotionen wie Wut, Neid und Trauer sind eine physische Reaktion auf unsere Gedanken. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Information aktuell ist oder aus der Vergangenheit stammt. Beispiel: Unser Chef hat uns kritisiert. Sobald wir an dieses Erlebnis denken (gespeicherte Information), entsteht die Emotion dazu (zum Beispiel Wut oder Angst). Ein anderer Fall wäre, wenn wir ein Lied im Radio hören, bei dem wir ein bestimmtes Erlebnis hatten (Information) und uns mittels einer Emotion wieder an das Erlebte erinnern. Die Emotion ist dabei für sich alleine betrachtet zeitlos, das heißt sie kann beliebig gestartet und beendet werden, auch wenn die Information dazu schon «alt» ist, also zum Beispiel aus unserer Kindheit stammt.
«Negative» Emotionen
Vermeintlich negative Emotionen wie Wut und Frustration geben uns das Signal, dass wir etwas verändern möchten. Sie stellen uns dazu den nötigen Antrieb und die Kraft zur Verfügung, indem sie im Körper eine Bewegungsenergie erzeugen, die wir in Aktion umsetzen können. Natürlich brauchen wir nicht jedes Mal wütend oder frustriert zu werden, um Veränderungen in unserem Leben zu bewirken. Das wäre anstrengend und auf Dauer auch ziemlich unangenehm. Je wacher und bewusster wir durchs Leben gehen, desto weniger benötigen wir negative Emotionen als Motor, einfach weil wir Missstände schon erkennen, bevor wir einen Widerstand dazu aufbauen.
Sind wir neidisch auf jemanden, dann meist deshalb, weil der andere etwas besitzt, was wir selbst nicht haben. Neid ist dazu da, uns unsere Wünsche einzugestehen und kann dazu genutzt werden, dass wir unser Leben überdenken und es uns einfach besser gehen lassen. Sind wir neidisch auf den Erfolg oder die Schönheit anderer Menschen, können wir die Energie in Bewunderung umwandeln und das als gutes Signal für uns nutzen, um uns zu verändern. Aus der Sicht heraus, dass uns Emotionen wichtige Signale setzen, macht es wenig Sinn zu versuchen, Wut, Neid oder Trauer loszulassen oder zu beschwichtigen. Ich selbst habe früher oft versucht, meiner Frustration mit Vernunft zu begegnen, wodurch ich jedoch immer das Gefühl hatte, etwas nicht sehen zu wollen.
Uns Menschen stehen Emotionen zur Verfügung, um etwas zu erkennen oder um uns selbst besser wahrzunehmen und zu spüren. Allein aus dieser Perspektive erscheint es unlogisch, etwas loswerden zu wollen, was an sich eigentlich nützlich und sinnvoll ist.
Emotionen zulassen
Manche Menschen machen sich Sorgen, dass sie weniger fühlen als andere, weil sie zum Beispiel nicht wirklich Trauer empfinden, weinen oder Freude zeigen können. Die Ebene der Emotionen existiert gleichwertig neben allen anderen Ebenen, wie die geistige oder physische Ebene, die uns als Menschen zur Verfügung stehen. Wenn wir uns mehr im Geist aufhalten und diese Ebene benutzen, haben wir dadurch viel weniger Bezug zu emotionalen Ausbrüchen und Schwankungen. Wir bewegen uns dann lieber in mentalen Feldern, was völlig in Ordnung ist. Sind wir mehr körperlich orientiert, können wir Emotionen gut wahrnehmen und sind ausgeglichener, einfach weil wir lieber etwas «tun» und damit die emotionale Energie schneller umsetzen oder abbauen.
Woran merken wir nun, ob wir Emotionen möglicherweise verdrängen? Im Gegensatz zu dem Empfinden von nur wenig Emotionen, was sich für die Betroffenen relativ normal anfühlt, empfinden wir unterdrückte Emotionen immer als unangenehm. Wir fühlen uns gestaut, unter Druck oder sogar schwach, weil das Verdrängen noch zusätzliche Kraft kostet. Das Verdrängen und Unterdrücken von Emotionen erfordert eine Menge Energie, was sich auf der körperlichen Ebene in Form von Erschöpfung zeigen und auch zu Schmerzen führen kann, wenn wir es nur lange genug praktizieren. An stressigen Tagen geht dabei viel Kraft verloren, weil wir bestimmte Emotionen nicht zulassen und dann zusätzlich Energie brauchen, um sie zu verdrängen.
«Positive» Emotionen
Im Gegensatz zu negativen Emotionen brauchen wir für angenehme Emotionen wie Liebe, Freude und Glück keinen Auslöser, auch wenn wir meinen, dass sich diese Emotionen erst einstellen, wenn der richtige Partner gefunden oder das Konto gefüllt ist. Deshalb lassen wir uns oft nicht auf diese Emotionen ein, weil wir befürchten, dass uns ein an äußere Bedingungen geknüpftes Glück auch wieder verlassen könnte. Diese «Ent»täuschung wollen wir uns ersparen. Sind wir aus uns selbst heraus glücklich, einfach weil wir hier als Mensch auf der Erde sind und erkennen, dass wir unzählige Möglichkeiten haben, unser Leben zu gestalten, dann wird sich dadurch auch die Liebe zu uns selbst vermehren und wachsen. Während unangenehme Emotionen verschwinden, nachdem wir ihre Botschaft verstanden haben, sind Liebe, Glück und Freude immer da, sobald wir an sie denken und sie dadurch aktivieren.
Selbstvertrauen
Selbstvertrauen ist eine tiefe innere Wahrnehmung, von der wir getragen werden und die uns ein Gefühl von Kraft und innerer Stärke verleiht. Selbstvertrauen ist mit unserer Intuition verbunden und beeinflusst indirekt auch immer unseren eigenen Wert. Wir sprechen dann vom Selbstwertgefühl.
Unser Selbstvertrauen wird während unseres gesamten Daseins immer wieder auf die Probe gestellt, sei es durch Ängste oder durch Glaubensstrukturen, die wir von anderen Menschen als Wahrheit annehmen. Für unser seelisches Gleichgewicht ist es deshalb essentiell, unser Selbstvertrauen zu stärken. Wenn wir uns zum Beispiel mit guter Nahrung versorgen, erfahren wir zusätzlich das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Ebenso hilfreich ist es, sich vorzustellen, dass man einen physischen Körper hat. Das klingt zunächst sehr banal. Mit unserem Körper sind wir fest verbunden. Er gehört nur uns und nur wir bestimmen durch unser Verhalten und unsere Lebensgewohnheiten, wie es ihm geht. Die herrschende Meinung, unser Körper sei schwach, hilfsbedürftig oder unvollkommen, ist ein schwerer Angriff unserer Zivilisation auf unser Vertrauen in unsere Existenz. Das Vertrauen in den physischen Körper kann erheblich gestört und beeinflusst werden durch Informationen, die uns glauben machen sollen, wir müssten gegen unseren Körper kämpfen (zum Beispiel in Form von aggressiven Therapien), um zu überleben. In Wahrheit ist unser Körper immer auf Überleben eingestellt und wird sich niemals selbst zerstören. Jede Krankheit ist ein Reparaturmechanismus, um den Körper zu heilen und um uns Erkenntnisse zu ermöglichen. Unser Körper hat kein Interesse daran, uns auszulöschen, es sei denn, wir treffen bewusst diese Entscheidung. Dann wählen wir zum Beispiel eine schwere Krankheit, um auf diese Weise die Erde verlassen zu können. Der Körper hat von Natur aus die Möglichkeit, sich einfach abzuschalten. Medizinisch würden wir dann sagen, der Mensch ist an Altersschwäche oder an Herzschwäche gestorben.
Kinder haben, wenn sie in einer liebevollen und vertrauten Umgebung aufwachsen, einen freudigen und lustvollen Zugang zu ihrem Körper. Sie spiegeln uns mit einem bedingungslosen «Juhu, ich bin da!» ihre Lebensfreude hier auf der Erde.
- Beobachte dich im Alltag. Welche Emotionen sind deine eigenen und welche bekommst du von anderen angeboten? Wir übernehmen oftmals Emotionen von anderen Menschen, wie zum Beispiel unserem Chef oder von Familienmitgliedern. Wir fühlen uns dann gestresst, ohne genau zu wissen warum.
- Welche Emotionen bietest du anderen bewusst an, um in Kontakt zu treten? (z.B. Freundlichkeit, Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, Rechthaberei, Hilflosigkeit etc.).
Aufwachen - Verhaltensmuster erkennen
Wir sind dem Aufwachen nahe, wenn wir träumen, dass wir träumen.
Novalis
Wie kommt es nun, dass wir uns überhaupt in Frage stellen? Als Kinder werden wir mit einem tiefen Vertrauen in uns selbst geboren. Später erzählt man uns jedoch, dass wir dieses Vertrauen und den damit verbundenen Selbstwert im Laufe des Lebens erst aufbauen oder uns sogar erarbeiten und verdienen müssten. Wenn dem so wäre, hätte das Wort «Minderwertigkeit» seinen Sinn verfehlt. Etwas mindern kann man nämlich nur, was bereits in voller Größe schon einmal da war.