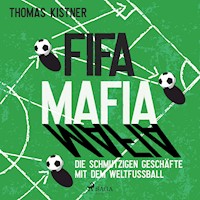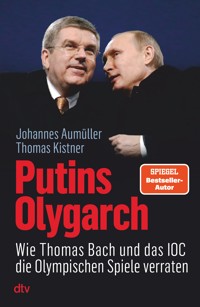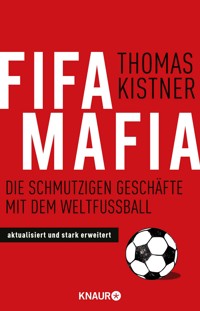7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Im internationalen wie auch im deutschen Fußball gehört organisiertes Doping zum Tagesgeschäft. Kaum einen großen Spieler gibt es noch, den nicht ein dunkles Geheimnis umweht. Von benutzten Ampullen in der Umkleidekabine der Helden von Bern über Todesfälle unter italienischen Spitzensportlern bis hin zur überdurchschnittlichen Quote an Kindern mit Behinderungen unter den Fußballern der »goldenen Generation«. Thomas Kistner erzählt die Geschichte eines kranken Hochleistungssports und seiner kranken Spieler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Thomas Kistner
Schuss
Die geheime Dopinggeschichte des Fußballs
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Fußball bewegt die Massen. Weltweit. Fußball ist ein gigantisches Geschäft – für Spieler, Berater, Vereine, Sponsoren und die Austragungsländer großer Turniere. Und Fußball ist seit Jahren eine Plattform des organisierten Dopings. Denn wo es im Sport um große Erfolge und das große Geld geht, ist der Betrug an der Tagesordnung. Dabei hat es der Fußball, anders etwa als der Radsport, zur Meisterschaft gebracht in der Disziplin des Vertuschens und Verschleierns.
Thomas Kistner, einer der führenden investigativen Sportjournalisten weltweit, schreibt die Geschichte des Fußballs seit dem Zweiten Weltkrieg als Doping- und Kriminalitätsgeschichte. Er setzt ein bei den Helden von Bern, denen in der Halbzeitpause des Finales leistungsfördernde Mittel gespritzt wurden, kommt über die WM-Kicker von 1966 zum Systemdeoping der siebziger und achtziger Jahre in Bundesligavereinen und zeigt, wie – national und international – in der unmittelbaren Gegenwart gedopt und vertuscht wird. Seine für alle Fußballfreunde erschütternde Conclusio: Jede goldene Generation der Meister und Titelgewinner war immer auch eine gedopte Generation. Todesopfer und Sportkrüppel legenheute ein beredtes Zeugnis davon ab.
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorwort
Kapitel 1
Spritzen in Spiez
Sehstörung in Wembley
Tonis Tornado
Kapitel 2
Schlange stehen für die Spritze
Der Fluch der Fiorentina
Einer schlägt alle
Der deutsche Weg
Herzrasen
Kapitel 3
Der Fußball wirft den Turbo an
»Du nimmst alles, was er anbietet«
Der Fußball domestiziert die Fahnder
Im Tal der Ahnungslosen
Kapitel 4
Goldene Zeiten
Hormönchen, Kaffee und K.-o.-Tropfen
Der Spaziergänger von St. Denis
Ruhig Blut
Kann denn Liebe Sünde sein?
Märchenzeit
Grauzone
Fußball modern: härter, brutaler – und viel gesünder
Kapitel 5
Im Königreich des Fußballs
Too big to fail
Gefährdung der öffentlichen Gesundheit
Fuentes’ Statthalter in Deutschland
König, Fitnessqueen und Muskelpäpste
Pandoras Büchse
Zum Cocktail frischen Fisch
Kult, Koks und Schweigen
Kapitel 6
Pillen, Pillen, Pillen
Ärzte im Dienst der Leistung
Unter Geiern
Ausgequetschte Zitronen
»Die wollen spielen. Punkt.«
Zeit der Wunder
Die Gefahr des zweiten Schlags
Neue Stimulanzien
Schlafende Wunden
Jäger als Schoßhündchen
Kapitel 7
»Volle Pulle«
Von Zigaretten in der Kaffeepause und harten Hunden
Die dunkle Seite
Luftkurort im Schlafzimmer
Ross und Reiter
Schneller Test
Kapitel 8
»Witz des Jahrhunderts«
Angst vor den Patientenakten
Gruß vom Genfer See
Liebesgrüße an Moskau
Literaturverzeichnis
Dank
Für Tristan –
den tollsten Fußballer von allen
Vorwort
Monster
»Der Hochleistungssport, der Sport, seine Organisationen und ihre Repräsentanten müssen den Mut zum Schuldigwerden haben. Hohe Gesinnung alleine oder rigorose Unterlassung sind keine gangbaren Wege, um zur Verantwortungsethik im Leistungssport zu finden.«
Professor Armin Klümper,von Sport und Politik verehrter deutscherSpitzensportmediziner
Doppink.
Toping!
Oder: Dobing?
Im März 2015 scheiterten Vertreter der Fußballbranche wie Jürgen Klopp, Mehmet Scholl oder der als wissenschaftlich strukturierter Kopf geltende Robin Dutt einmal mehr öffentlich bei dem Versuch, dieses rätselhafte, ja, schon unheimliche Codewort zu knacken: Doping. Im Fußball? Was, äh, soll das denn bringen?
Nichts, beteuerten sie. Doping könne im Fußball keinerlei hilfreiche Effekte entfalten. Weshalb es in all ihren Karrierejahren auch ein Mysterium für sie geblieben sei, ein luftiges Gerücht, gewiss kein reales Erlebnis. Ehrenwort! Was, wie gesagt, ja schon deshalb logisch sei, weil Doping beim Kicken sinnlos sei. Nein, schlimmer. Hinderlich sei es geradezu, eine echte Plage, weil: Es hemmt die Leistung. Robin Dutt, Sportdirektor des VfB Stuttgart, brachte es eloquent so auf den Punkt. Befragt, wie »effektiv Doping in irgendeiner Art und Weise im Fußball« sei, verkündete er das Branchen-Mantra: »Völlig uneffektiv, weil wir eine Mischsportart aus technisch-taktischer Komponente haben. Es wäre wirklich … der Spieler wäre mit Dummheit gestraft, wenn er versuchen würde, sich darüber zu optimieren. Er würde seine Leistung dadurch sicherlich eher verschlechtern.«1
Leistungsverschlechterung! Das kann man sich in einer Branche, in der Millionenerlöse an Zentimetern und Zehntelsekunden hängen, natürlich ganz und gar nicht leisten.
Ist die Rede von den teuersten Profis der Welt, reden wir mittlerweile über Fußballer. Ihre Saläre treiben selbst US-Baseballstars Tränen in die Augen. Alljährlich ermittelt der Web-Anbieter Sporting Intelligence die Teams mit dem höchsten Durchschnittsgehalt in den reichsten Profiligen der Welt. 2015 finden sich unter den Top Ten nur noch die Baseball-Teams der LA Dodgers und der New York Yankees, auf den Rängen fünf und neun. Die übrigen Plätze belegen Fußballklubs aus Spanien, England, Deutschland. Den Spitzenrang hält, gelobt seien die Pipelines im Emirat Katar: Paris St. Germain. Hier verdient der Durchschnittskicker 9 083 993 Dollar im Jahr, pro Woche sind das 174 692 Dollar. Es folgen Real Madrid (8 641 385 Dollar p. a.), Manchester City (8 597 844 Dollar p. a.), Barcelona (8 083 518 Dollar p. a.), ManUnited (8 022 247 Dollar p. a.), der FC Bayern (7 660 968 Dollar p. a.), Chelsea FC (7 462 809 Dollar p. a.) und der FC Arsenal (6 950 225 Dollar p. a.). In der englischen Premier League verdient im Schnitt jeder Spieler 3,8 Millionen Dollar pro Jahr.
Die Major League Baseball hat immer wieder mit weitreichenden Dopingaffären zu kämpfen, mit Enthüllungen und Geständnissen, die auf eine klare Betrugssystematik verweisen. Was das angeht, gilt sie als großer Bruder des Radsports. Erst 2015 wanderte wieder einmal ein Wellness-Klinikbetreiber in Haft, der gut ein Dutzend Profis mit Verbotenem versorgt hatte, darunter den Superstar Alex Rodriguez. Und schon 2007 hatte ein Untersuchungsreport eine Art Who’s who der Dopingsünder zusammengestellt, in dem sich reichlich Baseballer fanden.
Hingegen Profifußball: noch mehr Geld im Spiel, immerzu wachsende Anforderungen an die Profis – aber Doping? Gibt’s hier nicht. Früher vielleicht einmal, aber auch da nicht bewusst oder vorsätzlich, wie Mehmet Scholl zu berichten weiß: »Man hat da die Fußballer ein bisschen als Versuchskaninchen benutzt.«2 Zum Glück wurde Doping im Fußball dann ausgerottet. Über Nacht sozusagen, vor ungefähr zehn Jahren. Und das Beste: Seit es sauber ist, wird dieses Spiel immer athletischer und spektakulärer. Warum machen es die anderen nicht einfach auch so? Wasser trinken, Äpfel essen, und ab geht die Post!
Ach so. Die können das nicht machen, die anderen, weil deren Sportarten ja längst nicht so komplex sind wie Fußball. Noch einmal Mehmet Scholl: »Nehmen wir mal an, du nimmst was zum Muskelaufbau; darunter leidet die Koordination und die Schnelligkeit. Nein, nicht die Schnelligkeit, die Koordination. Nimmst du was für die Kondition, wirst du langsamer. Im Fußball macht’s nicht wirklich Sinn.«3
Vor einer Leistungsschwächung durch Doping haben nicht nur Deutschlands Fußballweise Angst. Fachliche Unterstützung erhalten sie von Jiří Dvořák, langjähriger Chefmediziner des Weltverbandes Fifa: »Im Fußball ist nichts zu gewinnen mit solchen Drogen. Fußball ist anders als so viele Sportarten, weil es eine ganze Bandbreite von Qualitäten braucht: Ausdauer, Tempo, Stärke, Technik, Koordination und Konzentration, um nur ein paar zu nennen.«4
Dieses fußballspezifische Exklusivwissen über leistungshemmende pharmazeutische Mittelchen ist also der schlüssigste Grund von vielen, warum es im Fußball kein Doppink gibt. Oder Dobing? Egal. Fachleuten jedenfalls, wie dem Heidelberger Professor Gerhard Treutlein, treiben solche Äußerungen die Zornesröte ins Gesicht: »Blödsinn. Doping, je nachdem was man nimmt, bringt sehr wohl was im Fußball.«5
Die Zunft sieht das anders. Mag das Tricksen und Täuschen, Schwindeln und Schauspielern, mögen all die fein einstudierten Formen des strategischen Foulspiels ebenso fester Bestandteil des Berufsalltags sein wie die Allgegenwart von Ärzten und Physios, die mancher Profi öfter als die eigene Ehefrau sieht – und trotz einer Rundumversorgung mit Pillen und Spritzen gilt: Doping gibt’s nicht. Dafür legen viele die Hand ins Feuer, interessanterweise gleich für die ganze Branche. Obwohl auch das großer Blödsinn ist. Wer dopt, lügt natürlich – was, bitte schön, sollte er sonst tun? Es zugeben? Und wer nicht dopt, wer nie etwas mit Leistungsmanipulation am Hut hatte, der wurde auch niemals eingeweiht in die kleinen Geheimnisse anders tickender Kollegen, die ja immer auch Konkurrenten sind. Das gilt ebenso für Sportärzte, die erst recht kein Interesse daran haben können, mit ihrem spezifischen Wissen hausieren zu gehen.
Die Dimension des Problems, das die Kickerbranche mit dem Pharmathema hat, offenbart sich nicht nur in chronischer Amnesie, wenn es um konkrete Vorfälle aus der Vergangenheit geht. Nein, man geht sofort geschlossen in Abwehrhaltung, sobald das Thema aufploppt. 2015 war es wieder einmal so weit. Nach Jahren der Ruhe wurde ein Wunderheiler der Fußballelite als diskreter Dopingversorger entlarvt: Dr. Armin Klümper. Der Guru der siebziger bis neunziger Jahre, zu dem die Kicker in Scharen pilgerten, für den namhafte Stars dicke Spendenschecks ausstellten und sogar öffentlich warben. Als publik wurde, dass Klümper Anabolika an Bundesligateams geliefert hatte, zeigte der Fußball einmal mehr, wie wichtig die Mauer in seiner Welt ist. Abwehrmauern, Freistoßmauern – und die stabilste von allen, die Mauer des Schweigens.
Die Leistung zu steigern, ohne ein Dopingproblem zu haben, das ist die zentrale Herausforderung im Sport. Aber wo beginnt das Problem? Dort, wo betrogen wird? Oder erst da, wo der Betrug auffällt? Wenn eine Branche konsequent in einen kollektiven Abwehrreflex verfällt, sobald eine zutiefst branchentypische Frage gestellt wird, sind Zweifel angebracht. In welchem Leistungssport sind heute nicht Substanzen virulent, die kaum oder gar nicht erfasst werden von der Dopinganalytik? Kann Fußball hier tatsächlich eine Ausnahme sein? Wenn die Akteure eines hochprofitablen Wirtschaftssystems den Diskurs verweigern wie Kleinkinder, die zur Relativitätstheorie befragt werden, dann könnte etwas faul sein.
Alle tun es. Bodybuilder, selbst Schachspieler. Und natürlich wird im Fußball gedopt. Hier wurde immer gedopt. Zu allen Zeiten, seit den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und klar: Fast nie gab es Enthüllungen durch Dopingtests. So wenig wie in anderen Sportarten, die im Gegensatz zum Fußball aber offiziell als belastet gelten, vorneweg der Radsport. Allein bei der Skandal-Tour-de-France 1998 gab es sechzig Verhaftungen und Dutzende Verurteilungen, Zoll und Polizei stellten kistenweise Dopingmittel sicher. Aber es gab nicht einen positiven Test bei den Hunderten Kontrollen während der Tour. Weshalb auch diese Rundfahrt nach den Regeln des Sports blitzsauber war. So sauber wie Lance Armstrong, den schließlich amerikanische Behördenfahnder zur Strecke brachten, keine Tests. So sauber wie die US-Sprintolympiasiegerin Marion Jones, die nie positiv getestet wurde und daraus schloss, sie könne selbst unter Eid noch erzählen, sie habe nie gedopt. Das kann man gefahrlos vor Fans und Medien tun, vor Sportgerichten sowieso – aber nicht vor einer amerikanischen Grand Jury. Für den Meineid musste die junge Mutter ins Gefängnis. All das sagt viel über die Qualität von Dopingkontrollen aus. Und nichts darüber, ob Athleten wirklich »sauber« sind.
Der Fußball dagegen taucht in schöner Regelmäßigkeit in seine Wagenburg ab, wenn Enthüllungen seine Besten und damit das System bedrohen. Kein Sport vollzieht den Schnitt zwischen dem, was das Publikum wissen darf, und dem, was in der Familie bleibt, so radikal wie die Kickerindustrie. Warum? Weil sie es sich leisten kann. Fußball finanziert sich selbst, er hängt weder von Olympias Geldtöpfen noch von staatlichen Zuschüssen ab. Ein Milliardengeschäft, das Milliarden Menschen in seinen Bann zieht. Fußball bindet Aufmerksamkeit und Emotionen, das macht ihn systemrelevant. Und setzt alle Korrektive außer Kraft. Die Suggestivkraft der Fernsehbilder ist unwiderstehlich, man muss nur daran glauben. Mega-Turniere wie WM oder EM sind ein Grundbedürfnis geworden, sie stiften Momente der Identität und der Gemeinsamkeit. Kann ein Sport unwahrhaftig sein, der allein schon in der Art, wie ihn die Massen heute zelebrieren, die Religion abgelöst hat?
Er kann – zumindest so lange, wie die Fußballfamilie ihre Schweigemauern stabil hält. Das Schweigen beginnt bei Personalfragen und Transferdeals auf internationaler Ebene, die naturgemäß gern in strafrechtliche Bereiche lappen; es setzt sich fort über Saläre und Privilegien für Angehörige der Branche, die erst durch die Enthüllungen der Web-Ermittler von »Football-Leaks« Ende 2016 zu Cristiano Ronaldo und Co. erstmals in all ihrer endemischen Gier ausgebreitet wurden; es reicht über das Tabuisieren von Reizthemen wie Depression, Spielsucht oder Homosexualität und umschließt im Innersten die drei Kernbedrohungen für das schöne Spiel: Korruption, Spielmanipulation und Doping. Am Totschweigen gerade letzteren Themas stoßen sich zunehmend sogar die Fans, die ahnen, dass es im Sportuniversum wohl keinen blinderen Fleck gibt als diesen. Wenn ihnen Millionenverdiener in einem Geschäft mit dem menschlichen Körper weismachen wollen, dass Pharmazie das Letzte sei, was hier hilft – dann kommt sich irgendwann auch der letzte Fan, der in Vereinsbettwäsche schläft, veräppelt vor. Der Dopingforscher Perikles Simon berichtete sogar von »erbosten Mails von Vätern von Jugendbundesligaspielern«, nachdem Klopp, Dutt, Scholl und Co. im Fernsehen jeden Dopingverdacht zerstreut hatten. Die Väter hätten ihn gefragt, »ob uns diese Experten auf den Arm nehmen wollen oder ob sie wirklich so unwissend sind«.6
Fakt ist: Es gibt eine hochintensive Dopinggeschichte des Fußballs. Das meint nicht, dass jederzeit und für jedes Spiel gedopt werden würde. Systemisches Doping im Fußball bezieht sich, wie in anderen Sportarten auch, seit je auf die Big Points. Auf wichtige Events, Zeitpunkte, bei denen es sich lohnt, mit erhöhter Leistungskraft den Punkt oder Sieg einzufahren, der über Titel entscheidet, über Aufstieg und Nichtabstieg, über Qualifikations-, Pokal- oder Turniererfolge. Über Reibach und Karrieren. Über Triumph oder Tränen.
Fußball kommt zwar als große Spielgemeinschaft aus 22 Akteuren daher. Aber in kaum einem anderen Sport können winzige Vorteile so entscheidend sein wie hier: Wer Champions League oder WM-Titel gewinnen will, braucht vor allem einen langen Atem. Rein theoretisch muss der Sieger kein einziges Spiel gewinnen. Mit zwei Niederlagen und vier Unentschieden in den Gruppenspielen sowie sechs weiteren Remis in den K.-o.-Runden lässt sich ins Champions-League-Finale einziehen. Dort noch ein letztes Unentschieden, und nach 120 Spielminuten gewinnt die fittere Mannschaft das Elfmeterschießen. Dasselbe lässt sich für WM oder EM errechnen. Mag das Szenario unwahrscheinlich sein, es zeigt, dass es sich lohnt, in bestimmten Momenten zu tun, was ein gewisser Franz Beckenbauer einst so formulierte: Es werde nicht in jedem Spiel gedopt – die Frage sei aber, ob es nicht vor wichtigen Spielen passiere. »Wenn es um Millionen geht – wenn man glaubt, dass die anderen nicht nur Vitaminpillen schlucken. Da muss man aufpassen, denn da könnten Vereine und Manager sagen, jetzt kann es sich lohnen.«7
Geld und Titel sind nicht die einzigen Verlockungen, den Pfad der Tugend zu verlassen. Es drängen sich weitere Motive auf. Da ist der Rekonvaleszent, der schnell zurück ins Training will. Der Reservist, der gegen Stammspieler um einen Platz im Team kämpft. Der Stammspieler, der an die Sonderprämien will: für den Titel, für eine gute Platzierung. Das nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht logische Betrugsschema, das sich um die Big Points rankt und von Beckenbauer einst sogar öffentlich thematisiert wurde (woran er sich später nicht mehr erinnern mochte), dieses Betrugsschema wurde über Jahrzehnte in allen relevanten Ligen gepflegt. Jede große Fußballnation hat eine reiche Dopinghistorie. Sie ruht verborgen in den Nebeln des Vergessens, die keiner lichten mag, weil kein anderer Sport so sehr das Nationalgefühl berührt wie dieser.
Werfen wir also einen Blick auf die Großen Europas: auf traditionsreiche Fußballnationen wie Holland und Portugal, wo systemisch gedopt wurde. Auf Italien und Frankreich, wo die Omertà immer wieder von staatlichen Instanzen durchbrochen wird. In Italien schaffen es weisungsunabhängige Staatsanwälte und eine mafiagestählte Justiz hin und wieder in den Darkroom des Fußballs; auch wenn wohlwollende Gerichte die Dinge dann letztinstanzlich wegen Verjährung abbügeln. Hier lohnt sich das Prinzip der Prozessverschleppung, das keiner so meisterlich beherrscht wie der größte Fußballfunktionär des Landes, Silvio Berlusconi. Aber immerhin: Man bekommt für einen Moment eine Ahnung von dem, was im Fußball vor sich geht.
In Frankreich, geplagt von ewigen Tour-Skandalen, gilt das härteste Antidopinggesetz der Welt. Manchmal wird es sogar angewandt, im Fußball allerdings eher zurückhaltend. Es gab auch einen Dopingausschuss des Senats, der bei einer Untersuchung 2013 entlarvende Fakten zutage gefördert hat. Und Wissenschaftler, die sich mit der konkreten Dopingkultur im Fußball befassen. Hin und wieder geschieht das auch in England, wo schon kickende Teenager Millionensaläre abgreifen. In dieser Casinolandschaft unter der Aufsicht von Scheichs und Oligarchen setzen vor allem die Gesellschaftsdrogen den Kick: Kokain, Marihuana und Alkohol. Derlei Fehltritte werden Fußballprofis am ehesten verziehen. Mit Partykönigen hat die Öffentlichkeit viel weniger Probleme als mit diskreten Dopern, die Kollegen und Fans um Titel bescheißen.
Und was ist mit den beiden aktuellen Supermächten des Planeten Fußball, Spanien und Deutschland? Für Letztere ist Leistungsmanipulation etwas, das aus irgendeinem schwarzen Loch schwuppt: ein Ufo namens Doppink eben. Dabei hat Fußball gerade für die Supermächte der Zunft eine so überragende nationale, identitätsstiftende Bedeutung, dass er diese Länder mit patriotischer Energie erleuchtet – und große Teile ihres intellektuellen Betriebs gleich mit dazu. Jene Meistersinger, die im Rausch der Stadienfeste eine nicht gelebte Sportlervita kompensieren und in einer werbemäßig perfekt getakteten Milliardenindustrie das wiederzuerkennen glauben, was ihnen Funktionäre und Manager von Adidas über Coke bis Visa vorbeten: dass den Profifußball das gute Sportgewissen beseelt, dass er Fairplay und allerlei großartige Integrationsmechanismen birgt.
Da wird offenkundig der Verstand ausgeknipst, denn die Realität sieht so aus: Ein durch und durch mafiöses Milieu regiert den Weltfußball, global untersucht von der amerikanischen Bundespolizei FBI und anderen Ermittlungsinstanzen in mindestens dreißig Ländern. Dieses Milieu wird angeprangert von immer mehr Fans, Menschenrechtsorganisationen und besonnenen Politikern. Korruption und organisiertes Verbrechen sind wesentliche Transmissionsriemen dieses Geschäfts. Aber auch rund um die Topadressen des Klubbetriebs gehören Ermittlungen und Prozesse zum Alltag. Und selbst diejenigen, die auf der sauberen Seite des Geschäfts zu stehen scheinen, trauen sich nicht aufzuräumen. Dabei benutzen sie, bis hin zum DFB, gern eine verblasene Solidaritätsrhetorik. So fanden auch sie es trotz der laufenden Ermittlungen besser, einen Boss wie Sepp Blatter bis zu dessen Untergang weiterwirken zu lassen, um nur nicht die Sportskameraden von Vanuatu, Guam oder Guinea zu verprellen, die den dunklen Fifa-Patron immer wieder wählen. Ausschreitungen in und um die Fußballarenen nehmen zu und werden heftiger. Von der Dauerplage Spielmanipulation sieht das Publikum nur den Teil, den Wettgangster ohne Fußballbezug zu verantworten haben. Und zugleich wird alles, was nur im Entferntesten an sportliche Werte erinnert, einer Turbo-Kommerzialisierung unterworfen.
Fußball ist ein wunderbarer Sport. International spielende Vereine und Länderteams sind die Aushängeschilder einer Nation. In Deutschland, das endlos Fleiß und Organisationsgeist verströmt, aber keinen Appeal, geht Fußball über alles. Hat er nicht 1954 die Bundesrepublik neu begründet? Hat er der Welt nicht 2006 den Blick auf die neuen, locker-leichten Deutschen geöffnet? Dem Land die Nationalfarben zurückgegeben? Und ein Sommermärchen beschert? In der Deutschland AG ist Fußball eine wichtige Marke. Wer als Deutscher auswärts auf der Straße nicht rituell mit »Germany – ah, Bayern Munich, Oktoberfest!« begrüßt wird, hat die EU-Grenzen nicht verlassen. Gleiches gilt für Spanien, bei dem einem sofort Real Madrid und der FC Barcelona in den Sinn kommen. Beide Länder ziehen aus den Erfolgen ihrer Kicker gesellschaftliche Relevanz. Politiker sonnen sich im Glanz jener Männer, die den Kunstfiguren aus Film und Musik längst den Rang abgelaufen haben. Fußballer sind die neuen Rollenvorbilder geworden. Eine Endlosschleife aus weltweiten Sportübertragungen brennt ihre imaginäre Größe in die Köpfe der Menschen. Inszeniert wird eine Botschaft, die sich an die globalisierte Gesellschaft richtet: Alles ist Fußball, alles ist Wettbewerb.
Kein Wunder, dass der seit Jahrzehnten herrschende Fußballkönig vor Stolz platzt. »Fußball bewegt die Welt«, weiß Sepp Blatter zu berichten. »Laut dem deutschen Handelsblatt sind 1,6 Milliarden Menschen direkt oder indirekt mit dem Fußball verbunden. Im Fußball ist eine unglaubliche Energie enthalten. Diese Kraft, die in diesem Sport steckt, ist wunderbar, aber auch etwas beängstigend.« Auf die Frage, ob die Fifa ein Monster geschaffen habe, entgegnet der umständehalber kürzlich zurückgetretene Boss: »Genau das hat mir mein Vorgänger João Havelange einmal gesagt: ›Sepp, tu as créé un monstre.‹ Ich antwortete: ›Ja, aber ich versuche, das Monster zu bändigen.‹«8
Ausgerechnet Blatter. Genau wie Havelange ein Mann von zweifelhaftem Ruf, der sich als Herrscher des Universums sieht – und jahrzehntelang so behandelt wurde. Sein Nachfolger Gianni Infantino passt perfekt in dieses Bild. Der Schweizer stammt sogar aus demselben Walliser Alpensprengel wie Blatter, in der Fifa hat er seit seiner Throneroberung 2016 bereits eine beachtliche Chronique scandaleuse aufgebaut – und als Dankeschön für sein Stimmvolk, das wie üblich in den bedürftigen Teilen der Welt siedelt, hat er die WM zukünftig von 32 auf 48 Teams aufgeblasen. Wie absurd ist es, einen Sport unter Führung solcher Figuren zum Leitbild für friedlichen Wettstreit zu verklären, als etwas Apolitisches, durch und durch Neutrales? Fußball ist und war nie dazu gedacht, Gemeinsamkeit und Eintracht zu stiften. Tatsächlich kreiert er immer öfter das Gegenteil. Ressentiments, Gewaltausbrüche. Nirgendwo geht es mehr ums Gewinnen um jeden Preis als auf dem Rasen. Insofern symbolisiert der Fußball keine Ideale aus einer Wunsch- und Gegenwelt ohne Konflikte. Er steht vielmehr für die raue Realität eines von Profitinteressen getriebenen Systems. Mit allem, was dazugehört.
Nur nicht mit Doping.
Der moderne Profibetrieb ist ein sich selbst kontrollierendes Geschäftsnetzwerk, das an vielerlei Fäden des Betrugs hängt. Hat in diesem Muskel-und-Moneten-Zirkus Doping wirklich keinen Platz? Ist hier kein Bedarf mehr für das, was über Jahrzehnte hoch engagiert betrieben wurde?
Dazu zwei Tatsachen. Erstens: Doping bringt enorm viel. Auch und gerade im Fußball. Mit chemischer Manipulation lassen sich fast alle Leistungsfaktoren wie Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Konzentration steigern. Zweitens: Die Laufwege der einzelnen Spieler auf dem Rasen werden länger, die Sprints nehmen zu, gedankliche Entscheidungen müssen immer schneller erfolgen. Die Zweikämpfe sind rasanter als früher, die Anforderungen an Körper und Geist kontinuierlich gestiegen. Die Leistung muss nicht nur für zehn Minuten oder zehn Sekunden abgerufen werden, der Sportler hat auch im Elfmeterschießen nach 120 Minuten noch zu funktionieren.
Für Experten wie den Heidelberger Werner Franke steht außer Frage, dass im Fußball gedopt wird. Sein Mainzer Kollege Perikles Simon bringt die Fassungslosigkeit der Dopingforscher auf den Punkt: »Dieses System reagiert wirklich nur, wenn ihm der Unrat bis über beide Ohren steht. Das ist eine Unverschämtheit. Ich kann es mir nur so erklären, dass allein die Frage nach Doping im Fußball ein absolutes Tabu ist.«9
So ist es. Und der Rest ist einfach. Es gibt nicht nachweisbare Mittel, die hoch effektiv und im Spitzensport überall im Einsatz sind. Es gibt kontrolliertes Gendoping. Es gibt auch Dopinghämmer, die zwar nachweisbar sind, mit denen Betrüger aber ohne Entdeckungsgefahr unter dem Betrugsradar durchsegeln können – sie müssen diese Mittel nur in wirkungsvollen Mikrodosierungen einnehmen. Im Mai 2015 zeigte eine französische Studie, wie acht Ausdauerathleten dank Dopings mit geringen Gaben des beliebten Blutdopingmittels Epo, mit Wachstumshormonen und Kortikosteroiden ihre Leistungen um bis zu 5 Prozent verbesserten.10 Das macht im Spitzensport den Unterschied zwischen Titelträger und Verlierer aus. Interessanterweise zeigten die von der Weltantidopingagentur Wada erstellten biologischen Blutpässe dieser Athleten keine verdächtigen Veränderungen. Die Studie traf ins Mark derer, die glauben, im organisierten Sport gebe es eine effektive Betrugsbekämpfung. Die gibt es nicht! Die kann es auch nicht geben, weil es viel zu viele Betrugsmöglichkeiten gibt. Die Pharmaindustrie ist immer zehn Schritte voraus. Denn eine Probe kann nur auf etwas getestet werden, das bekannt ist. Daher haben Dopingkontrollen vor allem ein sportpolitisches Ziel: Sie wiegen das Publikum in Sicherheit. Sie suggerieren ihm, dass alles gegen den Pharmabetrug getan werde. Dass man mit den Sündern sozusagen fast gleichauf sei.
Das ist ein Witz – wie die Jahresberichte von Wada und Nada. Geschnappt werden hin und wieder ein paar Handvoll Stümper, mit der Realität hat das nichts zu tun. Über den schönen Schein der Dopingstatistiken legt sich regelmäßig ein dunkler Schatten, sobald eine seriöse wissenschaftliche Umfrage unter anonym befragten Sportlern vorgelegt wird. Die Zahl derer, die schon mit Doping Bekanntschaft gemacht haben, pendelt sich dann hierzulande und anderswo bei 35 bis 40 Prozent ein.
Als 2015 eine Studie der niederländischen Antidopingagentur den Verseuchungsgrad im Elitesport auf bis zu 39 Prozent bezifferte, streckte Wada-Chef David Howman die Waffen: »Wir nehmen zur Kenntnis, dass Studien aus den vergangenen Jahren nahelegen, dass Doping viel verbreiteter ist als die aktuellen ein bis zwei Prozent abweichende Funde, die unsere jährlichen Testberichte ausweisen.« Durch einen überarbeiteten Wada-Code erhoffe man sich immerhin bald mal »ein genaueres Bild über den Stand der Prävalenz von Doping im Sport«.11
Ein genaueres Bild. Dabei hatte die Wada schon 2014 aus einer ARD-Dokumentation erfahren, dass zum Beispiel der russische Sport weitflächig dopingverseucht sei. Und im Jahr zuvor hatte sie von einer selbst einberufenen Expertengruppe ebenfalls Vernichtendes erfahren: 29 Prozent der Sportler bei der Leichtathletik-WM 2011 und 45 Prozent bei den Panarabischen Spielen gaben zu, schon gedopt zu haben.12
Das Kernproblem der wackeren Dopingjäger ist, dass sie nicht laut sagen dürfen, wie sehr sie die Abhängigkeit von den Geldern und Funktionären des Sports in ihrer Arbeit behindert. Tatsächlich ist auch die Dopingbekämpfung ein Monopolbetrieb des Sports. Im Wada-Kontrollgremium saßen Leute wie Spaniens Sportminister, just als die große Dopingaffäre um den spanischen Blutpanscher Eufemiano Fuentes erst im Lande unterdrückt wurde – und dann international. Bis heute fordert die Wada die Herausgabe der Fuentes-Akten, doch Spanien sitzt das aus. Ebenfalls im Wada-Kontrollgremium agierte lange Hein Verbruggen, langjähriger Boss des Radweltverbandes UCI zu dessen größter Dopingära. Die Funktionäre trafen sich sogar, um Dopingfragen zu behandeln, ausdrücklich unter Ausschluss von anderen Wada-Vertretern.13 Die Füchse bewachen den Hühnerstall – schon diese Struktur entlarvt das Antidopingsystem als Humbug.
Der Fußball ist auch hier mittendrin: Im Wada Foundation Board, dem obersten Entscheidungsgremium, saß bis zuletzt Sepp Blatter. Der Sepp Blatter. Eine groteske Situation, die sich nur der Sport leisten kann, weil er als einziger Gesellschaftsbereich überhaupt den Schutz der Autonomie genießt. Eine wirkungsvolle Kontrolle kann aber nur von außen erfolgen: durch finanziell und weisungsunabhängige Instanzen. Doch gerade im Sport, der zwar die Welt umspannt, ist die globale Führung auf höchstens zwei Handvoll Power Broker beschränkt. Diese meist affärenumwitterten Figuren sind tatsächlich das, als was sie sich so stolz bezeichnen: eine Familie.
In diesem gewaltigen Wirtschaftssystem bleibt den Forschern in den Laboren nur die Rolle kleiner Messknechte. Mögen sie noch so fleißig sein – aber sie dürfen gar nicht ran an zentrale Fragen, die in die Zukunft der Spitzenathletik weisen. Den Umgang mit dem endemischen Schmerzmittelgebrauch zum Beispiel, der längst in manipulative Bereiche reicht, wie immer mehr Experten beklagen, den dürfen Fahnder nicht unter die Lupe nehmen. Es ist ihnen zum Beispiel seitens der Verbände und sogar der Wada verwehrt worden, eine Studie zu Ballsportlern und deren Motivation für den Gebrauch solcher Substanzen zu publizieren. Sie liegt seit Jahren unter Verschluss. Behinderungen werden auch bei der Erforschung anderer nicht explizit verbotener Substanzen wie Betäubungs- oder Schlafmitteln beklagt – nicht offen, unter der Hand.
Wie es um die Dopingmentalität im Spitzensport bestellt ist, offenbart das sogenannte Goldman-Dilemma. Der US-Arzt und Publizist Bob Goldman ermittelte in zahlreichen Studien, dass rund die Hälfte der Spitzensportler bereit sind, innerhalb von fünf Jahren zu sterben, wenn ihnen eine bestimmte Droge den Gewinn einer olympischen Goldmedaille sichern würde. Goldman führte die Umfragen von 1982 bis Mitte der neunziger Jahre durch, in Zweijahresintervallen. Stets waren die Resultate ähnlich. 2009 erschien im British Journal of Sports Medicine eine ergänzende Studie australischer Sportmediziner, die belegte, dass im Vergleich dazu nur etwa ein Prozent der Gesamtbevölkerung bereit sei, einen frühen Tod für höchste berufliche Erfolge in Kauf zu nehmen. Leistungssportler sind dramatisch stärker auf Erfolg fokussiert als der Großteil der Restbevölkerung; rund die Hälfte würde alles dafür geben. Das Goldman-Dilemma gilt als sportsoziologisch gut belegt und wird vor allem im Kontext mit Gendoping häufig zitiert: Dabei werden enorme Wirkungen erzielt, die Folge sind aber massive Nebenwirkungen. Auch tödliche.
Aber wir reden ja von Fußball – und da gibt’s bekanntlich kein Doping mehr. Es hat auch nichts zu bedeuten, dass die Kicker immer athletischer wirken. Es wird eben besser und intensiver trainiert als früher. Und zeigen nicht all die negativen Dopingtests, dass da nichts ist? Diese bedeutungslosen Massentests sind alles andere als intelligente Zielkontrollen und stärken letztlich nur das Autoimmunsystem des Fußballs.
Wirft man einen Blick in die paar Studien, die die Branche diesem Thema widmet, zeigt sich dennoch allerlei Merkwürdiges: dass auffallend vielen Kickerhelden die Kunst tatsächlich im Blut liegen könnte. Bei Studien in der Bundesliga und vor den Europameisterschaften 2008 und 2012 lagen die Blutwerte der Profis in der Summe deutlich höher als beim Normalbürger. Es gab Ausreißer deutlich jenseits der Grenzwerte, die in anderen Sparten wie Radsport, Leichtathletik und Wintersport für die Athleten gelten. Im Fußball gibt es diese Grenzwerte nicht. Es finden sich Testosteron-Studien, die nicht dem breiten Publikum präsentiert werden, und viele, sehr viele seltsame Testosteronwerte, nimmt man die Messzahlen zum Maßstab, die auf breiter Ebene in der Normalbevölkerung vorkommen, und die Grenzwerte der Dopingbehörden, die ja auch so definiert werden, dass sie nur in seltenen Fällen auf biologischem Wege erreicht werden können.
Auch im Fußball ist der Weg in die biochemische Manipulation vorgezeichnet – erfolgsorientierte Funktionäre und profitgierige Marketender bereiten ihn.
Fußballhelden wie Cristiano Ronaldo stellen sich selbst schon stolz wie bionische Fabelwesen dar. Cybergeschöpfe aus der Laborshow, die von der Sportartikel-, Mode- und Elektronikindustrie begierig für den Markt modelliert werden. Ein neuer Typus Mensch wird hier kreiert. In aller Stille, mit allen Mitteln wird daran gearbeitet: von München, wo seit Jahren Sportlermuskeln mit einer im Selfmade-Verfahren entwickelten Magnetstimulation angeblich vier- bis fünfmal schneller geheilt werden als auf herkömmlichem Wege, über Barcelona bis Japan, wo Hirnforscher schon am supereffizienten Starkicker von morgen basteln.
Moderne Fußballhelden sind mit Ball am Fuß schneller als 95 Prozent aller Athleten ohne. Sie spielen problemlos mit gerissenen Muskeln, mit frischen Gesichtsfrakturen, Gehirnerschütterungen, mit zerfasernden Bändern, ausgerenkten Halswirbeln, mit gebrochenen Knochen sowieso. Platzwunden werden am Spielfeldrand getackert. Sie ertragen enorme Schmerzen, die kurzerhand weggespritzt, betäubt, mit Schmerzkillern jeden Stärkegrades eliminiert werden. Auch das geht tief hinein in einen veritablen Leistungsbetrug, denn unter »normalen« Umständen sind in solchen Verfassungen kaum noch nennenswerte Körperleistungen möglich. Erst recht keine im Spitzensportbereich. Zumal die verabreichten Pharmaka ja nicht der Heilbehandlung dienen, sondern der Aufrüstung für die gerade stattfindende, spätestens aber für die nächste Schlacht.
Schmerzmitteldoping ist ein »heißes Eisen« im Fußball – auch wenn das hier niemand so nennen würde. Dabei stünden Schmerzmittel, würde im Sinne des Manipulationsverbots und des Schutzes der Athleten vor Folgeschäden gehandelt, je nach Anwendungsziel auf der Verbotsliste. Aber das kann im Fußball niemand wollen. Wie sollten die strammen Saisonprogramme mit Spielen oftmals im Dreitagerhythmus gestemmt werden, wenn ständig 30 oder mehr Prozent der Akteure schmerzbedingt ausfielen? Auch dieses Dilemma zeigt, wie fest der Fußball auf der Pharma-Schiene verankert ist.
Stammzellen-Tuning ist, in abgemilderter Variante, en vogue. Genutzt wird alles, was sich irgendwie als therapiebedingt verkaufen lässt. Wenn es in Untersuchungen bei großen Turnieren zu erstaunlichen Ballungen in Grenzwertbereichen kommt, wird beim nächsten Mal einfach weniger detailliert hingeschaut. Sowieso mangelt es Branchenbeteiligten nie an Erklärungen für seltsame Phänomene – sie reichen, wie wir noch sehen werden, von der Ernährung bis zur Dehydrierung.
Es sind aber natürlich nicht die Sportmediziner, die diese Entwicklung vorantreiben. Es sind eher wenige, die sich dem Leistungserhalt im Spitzensport verschrieben haben und nicht der Gesunderhaltung des Spitzensportlers. Auch viele Fußballärzte können nur vermuten, was nebenbei abläuft. Hinter den Kulissen wirken Gurus, die regen Zulauf haben. Spielerberater reden immer stärker bei der medizinischen Versorgung ihrer Cashcows mit. Es gibt gut frequentierte Spas und Anti-Aging-Kliniken, die das Blut auffrischen und allerlei mehr im Angebot haben.
Kein Wunder, dass bei allen Medizin- und Körperthemen Grabesstille herrscht. Vom Bänder- bis zum Seelenriss. Wer herumschnüffelt, stößt auf verschlossene Türen. Wer das nicht akzeptieren will, ist ein Feind des Sports. Bruchstücke der Wahrheit kommen nur auf Umwegen ans Licht. Durch Ermittlungen und Untersuchungsausschüsse; durch Gerichtsprozesse und, gar nicht so selten, durch Biografien früherer Fußballhelden. Ehemalige Spieler, die sich meist lange nach Karriereende von Erinnerungen befreien wollen, die sie belasten.
Auch um zu verhindern, dass der Fußball zur Designermesse für Humanmaterial wird, die Minderjährige fasziniert und generell Aufmerksamkeit absorbiert, die es für wichtigere Zeitthemen bräuchte, gehört die Frage geklärt: Mit welchen medizinischen Begleithilfen werden heute Höchstleistungen erbracht? Härteres Training, häufigere Wettkämpfe, höhere Leistungsanforderungen, wachsender Mediendruck, dazu die exorbitanten Geldsummen, um die es bei diesem Spiel geht. All das weist in eine Richtung: Was einst als Gemauschel Einzelner im Selbstversuch begonnen haben mag, ist inzwischen zu einer systemischen Komponente des Sports geworden.
Das mit der fehlenden Doping-Wahrnehmung im Fußball ist ein bisschen wie die Sache mit den Videospielen. Ständiges Rumdaddeln führt irgendwann zu Wahrnehmungsdefiziten in der Realität, das ist unbestritten. Ähnlich führt die Dauerberieselung durch den Sport und seine PR-Maschine zu Problemen, das Unwirkliche vom Wirklichen zu unterscheiden. Den Rest regelt die schon fast bedingungslose Gier nach Unterhaltung: Wer will den Athleten, der als strahlender Held daherkommt, wirklich als Getriebenen sehen, der Leib und oft genug auch Seele an Geld und Ruhm verpfändet hat? Und dafür auch nicht – siehe Goldman-Dilemma – vor dem Pakt mit dem pharmazeutischen Teufel zurückschreckt?
Der Fußball selbst wird uns nicht verraten, wo die Demarkationslinie zwischen Playstation und Realität verläuft. Hier, wo maximaler Finanzdruck herrscht und die stärkste Gefährdung für alle Akteure, darf nichts sein, was stört. Kein Pharmaproblem. Keine Homosexuellen. Keine Suchtkranken. All das beschädigt diese Parallelwelt aus Helden. Fußball vereinnahmt allmählich die ganze Gesellschaft als Kundschaft, aber ihre Ansprüche ignoriert er. Er will nur eines: Geld. Und weil er bei alledem mehr als jedes andere Segment des industriellen Leistungssports vom Glauben seiner Fans lebt, kennt er nur diese Bedrohung: Transparenz und Aufklärung.
Der Glaube ist eine gefährliche Sache. Das könnte sich zeigen, wenn im Fußball D-Day ist.
Kapitel 1
Von Bern bis in die achtziger Jahre
»Herberger! Sie sind ein Lump und Betrüger und gehörten eigentlich hinter schwedische Gardinen!«
»Ein Glück, dass Sie sich nicht blicken ließen, sonst hätten Ihre Nächsten Gelegenheit gehabt, Sie auszustopfen!«
Deutsche Schmähbriefe im Juni 1954 an Sepp Herberger, der im WM-Gruppenspiel gegen Ungarn ein Reserveteam aufs Feld geschickt hatte, das 3 : 8 verlor
Spritzen in Spiez
»Aus! Aus! Auuus! Das Spiel ist aus!«
Die Gefahr ist gering, dass der nationale Erweckungsschrei des Radioreporters Herbert Zimmermann beim Abpfiff des WM-Endspiels zwischen Deutschland und Ungarn einmal einen tieferen Sinn erfahren könnte. Zeugen für mögliches Doping bei diesem größten nationalen Sporttriumph 1954 in Bern, der als Wiedergeburt eines leistungsstarken, selbstbewussten Deutschlands mystifiziert wurde, gibt es kaum mehr. Zeitgenossen, die die Frage beantworten könnten, ob die Kicker um Fritz Walter die Ungarn in jener Regen- und Schlammschlacht nur dank ihres von Adolf Dassler mit Schraubstollen versehenen Schuhwerks und eines Placeboeffekts aus Vitamin C im Körper niederrangen – oder ob etwas anderes in der Kanüle steckte, die den Helden vor dem Berner Endspiel injiziert worden war.
Nie zuvor, niemals danach gab es eine Fußballmannschaft, die ihre Zeit so dominiert hat wie die Ungarn. Bis zu jenem Tag. In 32 Länderspielen ohne Niederlage, darunter ein rauschendes 6 : 3 in Englands Fußballheiligtum Wembley, hatten die Künstler um Ferenc Puskás 144 Tore erzielt. Bei nur 33 Gegentoren. Auch in Bern lagen sie nach acht Minuten 2 : 0 in Führung. Aber dann drehten Sepp Herbergers Männer das Spiel gegen die hochüberlegenen Magyaren, die in der Gruppenrunde noch 8 : 3 triumphiert hatten. Nach dem Endspiel fand der Wankdorfer Platzwart Walter Brönnimann Spritzampullen in der Weltmeister-Kabine. Und Ungarns Puskás äußerte später im Fachblatt France Football den Verdacht des Dopings. Die deutsche Fußballzunft ächtete ihn dafür: Der DFB erteilte dem Weltstar Stadionverbot, das erst 1964 aufgehoben wurde, nachdem sich Puskás halbwegs entschuldigt hatte.
Nein: Nicht einmal der größte Fußballer jener Zeit durfte das böse D-Wort in Umlauf bringen. So wenig, wie später der junge Franz Beckenbauer oder andere Größen. Reihen und Münder blieben fest geschlossen: Das ist fester Brauch im Kameradschaftssystem der Kicker. Gerade im Fußball hat die Omertà, wie das sizilianische Schweigegelübde heißt, selbst abgebrühte Kriminalermittler immer wieder überrascht.
Was die Helden von Bern angeht, bleibt wohl für immer die Frage, wofür oder wogegen es vor dem Finale in der Umkleide Injektionen gegeben hat. Über die Inhalte mutmaßte Walter Brönnimann, dass wohl »etwas Verbotenes drin [gewesen] sein musste damals, denn es waren Ampullen, die abgesägt [worden waren], und da war sicher was zum Spritzen drin. Was, weiß ich nicht.«14 Außerdem waren sie versteckt worden, sie lagen unter den Wasserablaufgittern. Gab es etwas zu verbergen?
Es gibt gleich zwei Versionen, wie die Spritzen damals nach Spiez gekommen waren. Der einen zufolge hat Helmut Rahn die Sache angestoßen: Nach einer Südamerikareise mit Rot-Weiß Essen habe er Herberger von geheimnisvollen Spritzen berichtet, die die Brasilianer beflügelt hätten. Rahn soll die »Latinos« dabei selbst beobachtet haben.15 Tatsächlich war Doping zu jener Zeit in Brasilien etabliert, wie sich nicht nur aus Zeitberichten, sondern Jahre später auch bei den ersten Tests herausstellte: Zwölf von 13 A-Liga-Teams dopten da bereits regelmäßig mit Amphetaminen, rund 60 Prozent der kontrollierten Spieler waren positiv.16
Rahns Schilderung sei nicht ohne Folgen geblieben. Weil es die Kameraden so beschäftigt habe, »sind wir auf den Dreh gekommen, ein Vitamin C den Spielern zu geben«, räumte Teamarzt Franz Loogen fünfzig Jahre später ein. Er habe Herbergers Spieler gespritzt, klar, aber bekommen hätten sie nur: »Vitamin C, sonst nichts.«
Auch Albert Sing kratzte im Jahr 2004 mit kryptischen Sätzen am Heldenmythos: »Bis jetzt habe ich immer geschwiegen. Ich spreche das erste Mal darüber. Ich bin siebenundachtzig, ich muss das noch loswerden.« Herbergers Assistenztrainer sagte, einige deutsche Spieler hätten vor dem WM-Halbfinale gegen Österreich von Teamarzt Loogen stärkende Spritzen erhalten – in denen seines Wissens nur Traubenzucker gewesen sei. Dauerläufer Horst Eckel bestätigte »die Praxis, dass flüssiger Traubenzucker gespritzt worden ist«.17 Er selbst habe nur einmal eine Vergabe erlebt, beteuerte Eckel, vor dem Ungarn-Spiel: Er meinte die Gruppenpartie, in der Herbergers Männer mit 3 : 8 unterlagen.
Was die Vergabe der Spritzen angeht, hat Teamarzt Loogen selbst für Klarheit gesorgt. Injiziert habe er »zwischen den Spielen – wenn sonntags ein Spiel war und das nächste am Mittwoch, dann haben die Spieler am Montag die Spritzen bekommen. Medizinisch gesehen haben die Spritzen überhaupt nichts gebracht, es war der typische Placeboeffekt. Aber es hatte diesen psychologischen Effekt auf die Spieler, und Herberger wollte, dass ich immer wieder spritze.«18
Alles nur Traubenzucker? Es gab vielleicht nur einen, der wirklich wusste, was gespritzt wurde: Loogen. Und der sagte: »Nennen Sie mir einen, der mir das Gegenteil beweisen kann, dass da nicht Vitamin C drin war. Mit dem würde ich mich treffen, aber nur mit Zeugen.«19
Allerdings deutet manches darauf hin, dass nicht nur Vitamine aus der Spritze gekommen waren. Warum sonst hätte man eine so harmlose Vergabe in jenen Schweizer WM-Tagen mit höchster Geheimhaltung betreiben müssen? Und warum wurde für eine verzichtbare Placebobehandlung das Risiko grauenhafter Auswirkungen in Kauf genommen? Allein die Folgen der Spritzerei von Spiez – dazu später mehr – verlangen nach einer gründlichen Aufarbeitung der Vorgänge. Doch die hat es nie gegeben, wiewohl Loogen selbst bis zu seinem Tod 2010 offenbar darunter gelitten hat: »Es waren harte Zeiten für mich. Vor allem, weil Richard Herrmann dann auch noch gestorben ist.«20
Alle Fragen ranken sich um Herberger und seinen Betreuerstab. Aus diesem Kreis stammt auch die zweite Version, wie es zu der Spritzerei von Bern gekommen war. Herberger wirkte in seiner obsessiven Akribie, aber auch in der weit über die Sportgrenze hinaus reichenden Ehrerbietung, die ihm zuteilwurde, wie ein Vorläufer des modernen Trainergurus Pep Guardiola. Gottheiten aus der archaischen Glaubenswelt des Fußballs, die nie etwas Falsches sagen oder tun. Doch die Autoritätsfigur von der Bergstraße, enthüllte Teamarzt Loogen ein halbes Jahrhundert später gegenüber TV-Journalisten, habe vor der WM in der Schweiz ihm gegenüber »leistungssteigernde Spritzen« gefordert. Loogen will dieses Ansinnen klar zurückgewiesen haben, er »mache keine Sauereien«.21 Zugleich sagte Loogen auch, er selbst habe vor der WM »gelesen, dass Vitamin C in Tierversuchen gespritzt wurde. Die Tiere hatten dann eine längere Ausdauer.«22
Zunächst kam Loogen, der früher für Bayern München und Fortuna Düsseldorf gekickt hatte, in Sachen ärztliche WM-Betreuung nicht mit Herberger zusammen. Der Bundestrainer bearbeitete daraufhin einen Arzt im Fränkischen. Nachdem der kurz vor dem Aufbruch in die Schweiz abgesprungen war, ging er erneut auf Loogen zu. Und diesmal willigte der ein. Brisant ist, was Loogen in einem Gespräch im Juni 2003 zu Protokoll gab: Er sei in der Kürze der Zeit nicht mal mehr in den Genuss der offiziellen Reisekleidung, des grünen DFB-Sakkos, gelangt. Tatsächlich hebt sich der Arzt, der auf der Bank stets neben Herberger saß, auf den alten Bildern durch seine Zivilgarderobe ab. Die Last-Minute-Entscheidung hatte aber weit gravierendere Folgen: In der Eile, sagte Loogen, habe er nicht genug Spritzen auftreiben können. Er habe daher gebrauchte Kanülen mitgenommen – und zu deren Sterilisierung einen alten Abkocher. Das Gerät hatte er »als Kriegsandenken 1944 aus einer zerschossenen Arztpraxis vor Leningrad« mit nach Hause gebracht.23
Als es losging, seien die Spieler »verrückt nach den Spritzen« gewesen, erinnerte sich Loogen, der nur bei dieser WM dabei war und sich später als Herzspezialist einen Ruf erwarb. Neun der elf Endspielteilnehmer sollen sich Spritzkuren unterzogen haben. Heinrich Kwiatkowski (»Ich habe das abgelehnt, genauso wie ich jede Tablette abgelehnt habe, habe ich auch jede Spritze abgelehnt, ich hab’ gesagt, ich weiß nicht, was das ist, ihr könnt mir viel erzählen.«24) oder auch Albert Pfaff hätten sich allerdings verweigert. Obwohl ihn Herberger deshalb zur Rede gestellt habe, wie der Frankfurter klagte. Unter den Kickern sei über Traubenzuckergaben gemunkelt worden, gekannt habe den Inhalt aber keiner.
Fachleute und Sporthistoriker hingegen tragen Argumente für den Verdacht vor, dass gedopt wurde; dafür, dass Herbergers Männer mit Pervitin oder ähnlichen Wirkstoffen unterwegs gewesen sein könnten. Pervitin ist eine stimulierende Substanz, die schon im WM-Jahr 1954 laut einer Studie des Freiburger Doktoranden Oskar Wegener als »stärkste und anhaltendste« Droge galt: Das Mittel vertreibe »jedes Müdigkeitsgefühl und durch seine euphorische Komponente das Startfieber, da hier der Drang zum Sieg jedes Bedenken überwiegt«. Bei Athleten steigere Pervitin die Leistungsfähigkeit um bis zu 23,5 Prozent – das ergab Wegeners zwischen 1952 und 1954 an Sportstudenten erprobte Studie zur »Wirkung von Dopingmitteln auf den Kreislauf und die körperliche Leistung«.
Das untersuchte Mittel Pervitin war ein alter Bekannter. Die berüchtigte »Panzerschokolade« wurde im Zweiten Weltkrieg massenhaft von der Wehrmacht genutzt. 1937 hatten sich die Tremmler-Werke in Berlin ihr Verfahren zur Methamphetamin-Herstellung patentieren lassen. Mit Kriegsausbruch kam die Produktion kaum noch nach, allein zwischen April und Mai 1940 orderten Wehrmacht und Luftwaffe 35 000 000 Tabletten. Pervitin unterdrückte Schmerz, Hunger, Müdigkeit – und vor allem die Angst vor der Schlacht und ihren grässlichen Folgen. Auch unter Medizinstudenten, zu denen Franz Loogen zählte, galt die Substanz in Kriegszeiten als wunderwirkende Fliegerdroge.
Sepp Herberger wiederum war während des Zweiten Weltkriegs eng mit der Soldatenmannschaft der Fliegergruppe »Rote Jäger« verbunden, bei der er Fritz Walter und weitere Nationalspieler untergebracht hatte. Für den Dopinghistoriker Giselher Spitzer ist dies die Nahtstelle, an der das Wissen um die Fliegerdroge in den Fußball kam. Übrigens eine unverwüstliche Droge: Was damals Pervitin war, ist heute Crystal Meth, die Partydroge und Geißel unserer Zeit.
Von Herberger selbst gibt es Aufschlussreiches zur Physis seiner Truppe zu berichten. Nach dem Halbfinale, in dem sie die als stärker eingestuften Österreicher mit 6 : 1 überrannt hatte, habe er sogar die Trainingsintensität drosseln müssen: »Ich wusste, wenn wir morgens zum Training nach Thun fuhren, musste ich immer höllisch aufpassen, dass die im Gefühl ihrer Kraft nicht zu viel hergaben, Kräfte, die wir ja im Endspiel gut brauchen konnten.«25 Seine Spieler hingegen beteuerten, dass Herberger stets den vollen körperlichen Einsatz gefordert habe. Wie deftig sie grätschten, ist in den ersten WM-Spielen gegen die Türkei und Ungarn dokumentiert. Und im Viertelfinale gegen Jugoslawien gelang die frühe Führung durch ein Eigentor – das Schäfer mit einem rauen Sprung gegen den gegnerischen Abwehrspieler erzwang. Auch im Finale, vor Rahns 3 : 2, eroberte der Kölner Linksaußen den Ball mit massivem Körpereinsatz gegen Bodzik – jedenfalls sahen es die Ungarn so. Bilder von der Szene, der die entscheidende Flanke folgte, gibt es nicht, nur die Tonspur.
Die Antwort auf die erste Frage, die der ungarische Radioreporter György Szepesi vor dem Endspiel an Herberger richtete, deutet nicht darauf hin, dass der Trainer seine Mannen schonte: »Glauben Sie nicht, dass das übertrieben ist? Gestern hatten sie ein schweres Spiel, heute regnet es – müssen Sie denn jetzt trainieren?« Herberger verwies auf die spielerische Überlegenheit der Ungarn. »Aber was, wenn es am 4. Juli regnen sollte und der Boden schwer wird – wer wird dann der Bessere sein?«26 Diese Frage Herbergers wurde im Endspiel beantwortet.
So klar die Aussagen von Spielern wie von Loogen selbst kontinuierliche Injektionen nahelegen, die geheimniskrämerisch vonstattengingen – im Keller verabreicht, versteckte Ampullen –, so unklar bleibt die treibende Kraft dahinter. Assistenztrainer Sing sah Loogen in dieser Rolle: Der Arzt habe »Herberger überzeugen können, dass die Spieler flüssige Drogen zu sich nehmen sollen«.27 Welcher Art sie waren, darüber sagt er nichts. Der Konsum von Pervitin ohne medizinische Indikation hätte schon zu Berner Wunderzeiten gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen. Zugleich wurde das Thema Doping damals kontrovers diskutiert. Sportärzte geißelten das Treiben in Ostblockländern, die bei den Olympischen Spielen 1952 mit Pillen nachgeholfen hatten. Bei den Winterspielen in Oslo hatte der Wiener Sportarzt Ludwig Prokop »zerbrochene Spritzen und Ampullen« in den Umkleiden der Eisschnellläufer gefunden. Im gleichen Jahr gab es eine erste ablehnende Erklärung des Deutschen Sportärztebundes, der auch der DFB zustimmte: Jedes Medikament, das mit der Absicht der Leistungssteigerung gegeben wird – gleichgültig, ob es wirksam ist oder nicht –, sei Doping.
Gleichwohl war man auch im Fußball stets begierig auf wissenschaftliche Neuerungen. Im Frühjahr 1953 verwies der Sportfunktionär Guido von Mengden darauf, dass die Inhalation von reinem Sauerstoff Presseartikeln zufolge »sensationelle Ergebnisse« im Fußball zeitige und »Fabeln und Histörchen« produziert habe. Nach dem Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz am 25. April in Basel, in dem die Schweizer einen 0 : 4-Pausenrückstand fast noch umgedreht und am Ende 3 : 5 verloren hatten, erklärte der eidgenössische Coach Karl Rappan die intensive Aufholjagd so: »Unsere Spieler haben in der Halbzeit eine Sauerstoffpumpe erhalten.«28
Bereits 1948 hatten englische Kicker bei Gastspielen in Südamerika beobachtet, wie ihre Gegner in der Pause an Atemgeräten saugten. 1952 brachte eine portugiesische Fußballexpedition eine Apparatur von Brasilien nach Lissabon. Dann rochen die Spanier Lunte, bald versorgte der RCD Espanyol Barcelona seine Kicker mit Sauerstoff. Von deren Erfolgen animiert, pumpte im November 1952 die Frankfurter Eintracht ihre Spieler damit auf.29 Vereinsarzt Dr. Runzheimer lieh sich das Gerät aus einem Krankenhaus. Auch für den DFB wurde die Sauerstoffpumpe interessant, Doping hin oder her. Kurz vor der Reise zur WM in die Schweiz bat Herberger den Eintracht-Teamarzt Runzheimer zum Gespräch. Und DFB-Sprecher Carl Koppehel teilte mit: »Wenn wir in die Schweiz fahren und die anderen werden mit Sauerstoff aufgepumpt, weiß ich nicht, ob wir es nicht doch ebenso machen sollen.«30
Horst Eckel sagte, mit Sauerstoff sei experimentiert, die Sache aber verworfen worden.31 Auch Loogen berichtete, bezogen auf seine Gespräche vor der WM mit Herberger: »Es war Anfang der fünfziger Jahre schon einiges möglich, was hartes Doping betrifft.«32 All das zeigt nicht nur, dass die künstliche Leistungssteigerung ein zentrales Thema war, sondern auch, dass man von Einsatzmöglichkeiten im Fußball wusste. Heute wissen wir allerdings, dass Doping gerade im Fußball nichts bringt.
In der Schweiz jedenfalls wurde das deutsche Team mit Injektionen aus der Mehrwegspritze behandelt. Eine dramatische Verirrung – zumal, wenn es angeblich nur um Placeboeffekte gegangen war. Denn die Folgen waren verheerend. Loogen selbst äußerte den Verdacht, dass vom häufigen Gebrauch derselben Kanüle jene mysteriöse Gelbsuchtepidemie herrühren könnte, die Monate nach dem WM-Triumph acht Kicker in die Kur zwang. Darunter die Walter-Brüder und die Endspieltorschützen Helmut Rahn und Max Morlock. »Alle die, die sich haben spritzen lassen, sind später nach der Weltmeisterschaft krank geworden«, sagte Co-Trainer Sing. Er sagte auch: »Aber Doping – nie.«33
Wie passt dazu, dass DFB-Präsident Peco Bauwens, als die erkrankten Spieler im Herbst 1954 nicht berufen werden konnten, sogleich befürchtete, dass »Verdächtigungen gegen uns erhoben werden wegen eines Doppings (sic!)«?34
Nur Tage nach Bauwens’ besorgter Reaktion stand nach einer Reihenuntersuchung fest, dass »mehr oder minder die gesamte Nationalelf leichtere Leberschädigungen davongetragen hat«.35 Mehrere deutsche WM-Teilnehmer starben später an Leberzirrhose. Den Anfang machte 1962 der Frankfurter Richard Herrmann. Der Stürmer wurde nur 39 Jahre alt. »In DFB-Kreisen«, heißt es in einer Festschrift zum neunzigjährigen Bestehen des FSV Frankfurt, wo Herrmann kickte, »wollte kein Funktionär gerne über den Tod des achtfachen Nationalspielers sprechen. Man wusste längst, dass in Spiez der DFB-Arzt Dr. Loogen eine ärztliche Sünde begangen hatte. Doch wer wollte seinerzeit verlautbaren lassen, dass der feine Herr Doktor die Nationalspieler nacheinander mit (sagen wir mal gelinde Traubenzucker) gespritzt und keine sterilen Nadeln eingesetzt hatte?«
Zynische Reaktion des DFB auf das Ableben des Kickers: »Als materiellen Trost stellt DFB-Präsident Dr. Peco Bauwens der Witwe einen Scheck in Höhe von dreitausend Mark aus – damit sie ›mal in Urlaub‹ fahren kann.«36 Sepp Herberger, dessen Hilfsbereitschaft gegenüber der Familie brüsk vom DFB gestoppt worden war, »damit kein Präzedenzfall geschaffen wird«37, bedachte Herrmanns Söhne später sogar in seinem Testament.38
Der Fluch lastete weiter auf den Wundermännern. Es folgten die Herztode von Werner Kohlmeyer (1974) und Toni Turek (1984). 1995 starb Abwehrchef Werner Liebrich an Leberversagen, das auf Hepatitis C zurückzuführen war. Sein Arzt erklärte, für die Infektion komme nur die Zeit um die WM 1954 in Frage. Zunächst war Herzversagen als Todesursache publiziert worden, die Wahrheit kam erst später ans Licht – obwohl laut Witwe Anne-Marie Liebrich sogar »ein Schild mit der Warnung ›Vorsicht, Hepatitis C‹« über dem Krankenhausbett ihres Mannes gehangen habe.39 Und schließlich soll auch Außenläufer Karl Mai den Spätfolgen einer Gelbsucht zum Opfer gefallen sein. Dessen Witwe Elsa Mai berichtete, dass bei ihrem Mann neben Herzproblemen auch Hepatitis C festgestellt worden sei.40
Im Deutschen Ärzteblatt trug 2010 ein medizinisches Autorenteam Indizien für den Verdacht zusammen, dass Helmut Rahn der Überträger des Virus für die mutmaßliche HCV-Infektion der Helden gewesen sein könnte. Südamerika sei ein »Hochprävalenzgebiet« sowohl für Heptitis B als auch für Hepatitis C. Allerdings wiesen vor allem Sportler dieser Region eine hohe HCV-Rate auf. »So lag die Anti-HCV-Prävalenz unter 208 brasilianischen Profis, die zwischen 1960 bis 1985 aktiv waren, immerhin bei elf Prozent. Unter jenen Profis, die von leistungssteigernden Injektionen während ihrer Laufbahn berichteten, betrug die Rate sogar 22 Prozent. Für die Hypothese einer aus Südamerika importierten HCV-Infektion spricht auch, dass Helmut Rahn unmittelbar vor der WM mit seinem Verein Rot-Weiß Essen in Südamerika weilte und als erster Spieler erkrankte.«41 War Rahn der Überträger? Tor- und Stimmungskanone aus Essen, der sich viele Jahre später verbittert von den Kollegen abwandte, kein Treffen mehr besuchte und 1994 sogar die Einladung von Bundeskanzler Helmut Kohl ausschlug, ihn zur WM in die USA zu begleiten? In seinen Memoiren schildert er nur, dass seine Gattin Gerti sofort die richtige Diagnose gestellt habe: »Ich fühlte mich gesundheitlich gar nicht auf dem Posten. Nach der kleinsten Anstrengung wurde ich müde, das Essen ekelte mich an. Rechts unterhalb von meinem Magen schien ein Ziegelstein zu liegen. ›Helmut, du kriegst die Gelbsucht‹, sagte meine Frau.«42
Wer immer der Erstüberträger gewesen war, als gesichert gilt, dass die Verbreitung über das Mehrwegspritzbesteck erfolgt war. Und diese Art der Spritzerei wurde auch nach der Schweizer Siegestour fortgesetzt. Torwart Fritz Herkenrath, der nach der WM den Platz des erkrankten Toni Turek eingenommen hatte, berichtete: »Der Arzt hat die Spritze kurz in heißes Wasser getaucht – das war’s.« Auch Herkenrath, der nicht im Schweizer WM-Aufgebot stand, kam im Dezember 1954 wegen Gelbsucht auf die Intensivstation, nachdem einem Arzt die »merkwürdige Farbe meiner Augen« aufgefallen war.43
Es gab in der Zeit bis Sommer 2004, im Hinblick auf das 50. Jubiläum des Berner Wunders, durchaus Bemühungen von Sporthistorikern und manchen Medien, die Vergangenheit aufzuhellen. Aber die Branche mauerte. Die Vorgänge wurden nie konsequent beleuchtet, obwohl seinerzeit ja noch einige zentrale Zeitzeugen am Leben waren, in deren Auskünften durchaus Gesprächsbereitschaft lag. Aber wer will das? Das schadet nur der Verklärung, dem Gründungsmythos und der quasireligiösen Strahlkraft des Geschäftsbetriebs. Es verschont alle Romantiker, die sich den nationalen Blick auf Bern nicht verdüstern lassen wollen. Die Realität aber zeigt, dass mit der konzertierten Weigerung der Branche, hier für Aufklärung zu sorgen, der Sündenfall des Fußballs beginnt. Der Wunsch, die Wahrheit hinter den Schicksalen zu ergründen, war nie da. Bern 1954 muss ein Mythos bleiben. Und Mythen vertragen eines nicht: Aufklärung.
Die Spritztour von Spiez spielte in einer Zeit, in der viele Aspekte des Dopings erkundet waren. Schon im Sport der dreißiger Jahre war die Einnahme von Hormonen diskutiert worden. Der dänische Leistungsphysiologe Ove Boje schrieb 1939: »Vor kurzem war in den Zeitungen zu lesen, dass die bemerkenswerten Leistungen der Fußballmannschaft Wolverhampton Wanderers auf eine Behandlung mit Drüsenextrakten zurückzuführen war, die ihr Manager Major Buckley durchgeführt hatte. Die Mannschaft von Portsmouth entschloss sich, diesem Beispiel zu folgen. Derartige Fälle zeigen, dass man heute nicht zögert, selbst Hormonbehandlungen durchzuführen, um die sportliche Leistung zu verbessern.«44
Die Einnahme von Aufputschmitteln ist in England erstmals aus der Partie Arsenal gegen West Ham in der Saison 1925/26 belegt. Und Stürmerlegende Stanley Matthews beschrieb den Gebrauch von Amphetaminen im FA-Cup 1946. Aus den fünfziger Jahren ist der Einsatz von Amphetaminen bei den ManU-Spielern Harry Gregg und Albert Scanlon verbrieft.45 1963 war der Missbrauch bereits so verbreitet, dass die britische Regierung im Zuge einer Untersuchung des Europarats den Fußball zu den Sportarten mit Drogenproblemen rechnete.
Hierzulande wurde die Sporthistorie der Amphetamine erst in jüngerer Zeit intensiver beleuchtet. 2009 bewilligte das Bundesinnenministerium (BMI) eine halbe Million Euro Steuergeld für die Untersuchung der deutschen Pharmavergangenheit. Das Projekt wurde zwei Forschergruppen aus Berlin und Münster anvertraut. Ambitionierter Titel: »Doping in Deutschland von 1950 bis heute«. Nur drei Jahre später war die Sache spektakulär gescheitert, 550 000 Euro Fördermittel konnten der deutschen Dopingvergangenheit wenig anhaben. Die Studie bricht ab, als sie die Zeit der wiedervereinigten Republik erreicht hatte.
Immerhin, 2010 und 2011 wurden einige Zwischenergebnisse präsentiert. Die Wissenschaftlergruppe der Berliner Humboldt-Universität (HU) legte eine brisante Materialsammlung vor, die mit der breiten Erforschung von Amphetaminen ab 1938 im Dritten Reich beginnt. 1947 beschrieb der Frankfurter Pharmakologe Otto Riesser, dass Trainer, Sportler und Sportärzte oft mit der Frage nach Dopingmitteln an Apotheker heranträten. Weshalb er alle Apotheker aufforderte, solche Anfragen zu melden und »jeder Art von Missbrauch mit aller Entschiedenheit entgegenzuwirken«.
Die Pervitin-Studie des Freiburger Doktoranden Oskar Wegener klassifizierten die HU-Wissenschaftler als »Geheimforschung«, denn Wegeners Gutachter Herbert Reindell hatte die brisanten Erkenntnisse nicht während der ersten großen Dopingdebatte der bundesdeutschen Sportmedizin in den Fünfzigern publiziert – sondern erst nach deren Ende, 1959.46 Gleichwohl sei der Effekt des Mittels dank der »Panzerschokolade« hinlänglich bekannt gewesen. In seinem Gutachten empfahl Reindell den Einsatz der von Wegener erforschten Substanz, mit verharmlosendem Verweis auf die Nebenwirkungen. Für die Wissenschaftler ist Reindells Vorgehen ein klassisches Beispiel, »wie sportmedizinische Forschung zur Dopingforschung wurde«. Reindell war Institutsleiter an der Universität Freiburg und Nestor der deutschen Sportmedizin. Sein Nachfolger war der umstrittene Joseph Keul, ein anderer namhafter Schützling ist der nicht minder umstrittene Armin Klümper. Dem klandestinen Wirken dieses Dreigestirns widmete sich ab 2007 eine hochkarätig besetzte, in ihrer Arbeit aber stark behinderte Doping-Aufklärungskommission an der Breisgau-Universität.
Die These der Berliner HU-Wissenschaftler, dass Amphetaminmissbrauch »bereits gegen Ende der 1940er Jahre im deutschen Leistungsfußball zur Normalität gehörte«, wird auch durch die Dissertation des Göttingers Heinz-Adolf Heper aus dem Jahr 1949 erhärtet. Heper war selbst Fußballer beim 1. SC Göttingen 05 in der Oberliga, der damals höchsten westdeutschen Spielklasse. Er verabreichte den Kollegen »Fußballsportlern« Dosen von je zehn Milligramm und beschrieb Effekte wie die »Erhöhung des Siegeswillens« oder »schnellere Auffassungsgabe«. Er stellte aber auch »unangenehme Nebenwirkungen« wie Luftmangel und erhöhte Ventilation fest. Insgesamt diagnostizierte er eine »große Gefahr für den Sportsmann«. Noch ein weiterer Fußballarzt, der zwischen 1949 und 1953 prominente süddeutsche Oberligateams betreute, berichtete von Amphetamingaben: Man habe den Kickern vor dem Spiel die »Kampfflieger-Schokolade« verabreicht. Die Frage drängt sich auf, ob der Einsatz von Amphetaminen nur ein Problem innerhalb der Liga war.
Führend in der nationalen Dopingforschung waren seit je die Sportmedizin-Hochburgen Freiburg und Köln. Auch in der Domstadt wurde früh mit Pervitin hantiert, zudem mit Testosteron. Richtig bekannt wurde das erst dank der HU-Studie. Die Forscher fanden Hinweise für systematisches Amphetamindoping bis Anfang der sechziger Jahre. Im Radsport, in der Leichtathletik, beim Rudern – und im Fußball.
Als die Studie das Land in Aufruhr zu versetzen begann, verteidigten sich Funktionäre und Ärzte massiv. Ins Visier geraten war auch der ab 1958 als DFB-Teamarzt amtierende Wildor Hollmann, ein weiterer Doyen der Sportmedizin. Der offenbarte im Zuge seiner Selbstverteidigung, wie unerbittlich Herberger seine Ideen von der richtigen körperlichen Versorgung der Nationalspieler durchfocht; selbst wenn es bizarr wurde. »Vor dem WM-Spiel um den dritten Platz 1958 gegen Frankreich rief mich Fritz Walter an und erklärte, Herberger hätte ihnen alle Wasserkräne zugedreht; sie dürften nur so viel wie unbedingt nötig trinken. Ich möchte doch intervenieren. Das geschah, aber Herberger hörte nicht auf mich. Am 28. Juni 1958 unterlag eine völlig mit Flüssigkeit unterversorgte Mannschaft gegen Frankreich mit 3 : 6.«47
Diese Rigorosität des »Chefs« hatte auch Franz Loogen kennengelernt. In der Halbzeitpause des Berner Finales habe Herberger den Teamarzt aufgefordert, Eckel zu spritzen; der hatte einen bösen Tritt gegen den Oberschenkel erhalten. Loogen will das mit der Begründung verweigert haben, dass er eine Blutbahn treffen könne, dann wäre Eckel – taktisch einer der wichtigsten Männer auf dem Platz – »völlig ausgefallen«. Wie Herberger auf die Idee gekommen sein könnte, Vitamine in einen Bluterguss zu spritzen, wird nicht mehr zu eruieren sein.
Sicher ist: Rahn schoss aus dem Hintergrund.
Sehstörung in Wembley
Die Berliner Dopingforscher fanden noch einen anderen interessanten WM-Hinweis: Einen Brief des Fifa-Funktionärs Prof. Mihailo Andrejević an den Chef des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV), Max Danz. In dem Schreiben vom 29. November 1966 berichtet Andrejević, während der Dopingtests des Weltfußballverbandes bei der WM 1966 in England seien »bei der deutschen Mannschaft bei drei Spielern sehr feine Zeichen von der Einnahme [eines] gewissen Ephedrinmittels gegen Schnupfen entdeckt« worden. Genaue Testresultate sind zwar nicht bekannt, dennoch zweifelten die HU-Forscher an einem nicht: »Dass es sich dabei sportrechtlich um Dopingvergehen handelte.«48
Ephedrin stand damals unter Punkt 2 (»Drogen der Amphetamine-Gruppe«) auf der Verbotsliste, die alle Delegationen vor dem Turnier erhalten hatten. Vielleicht hat es ja sein Gutes, dass die deutschen Kicker nicht auch das WM-Finale 1966 gewannen. Denn die Insel hätte gebebt nach diesem wissenschaftlichen Nachbrenner. So blieben die Reaktionen auf der Scherzebene. Weltmeister George Cohen zum Beispiel spottete in Bezug auf das umstrittene Wembley-Tor: »Kein Wunder, dass die nicht erkannt haben, wo der Ball gelandet ist« – die aufgeputschten Deutschen hätten wohl alles doppelt gesehen.
Ernsthaft besehen, stellt sich die Frage, warum das heikle Schreiben 45 Jahre lang in der Versenkung geblieben war. Gewiss, die Fifa hat nie einen Dopingfall im Zusammenhang mit der WM 1966 publiziert. Und Sportverbände belasten sich ungern selbst. Das sollte man aber auch im Hinterkopf haben, wenn Funktionäre ständig jede Art Vorwürfe von sich weisen. Der DFB hat den Wissenschaftlern seinerzeit die Arbeit nicht leichtgemacht. Die Forscher warfen ihm vor, ihnen den Archivzugang quasi verwehrt, weil nur unter »inakzeptablen Auflagen« erlaubt zu haben. Der DFB habe nach einem vereinbarten Termin »durch einen juristischen Beistand plötzlich Forderungen« gestellt, wissenschaftliche Standards ausgehebelt und gegen den Vertrag mit dem Auftraggeber BISp (Bundesinstitut für Sportwissenschaft) verstoßen. Deshalb sei kein Besuch des DFB-Archivs zustande gekommen. DFB-Vize Rainer Koch widersprach: »Das Archiv stand den Forschern offen. Natürlich verknüpft mit geltenden Datenschutzauflagen.« Die Wissenschaftler hätten lediglich erklären sollen, das gesichtete Material nur zu Forschungszwecken zu verwenden. »Ein Forscher der Uni Münster war einverstanden, seine Kollegen aus Berlin nicht.«49 Koch erwähnte allerdings nicht, dass die beiden an der Studie beteiligten Forschergruppen unterschiedliche Bereiche bearbeiteten. Und was Münster vorlegte, war von gepflegter Blässe. Die Berliner Forscher hängten ihrem Bericht demonstrativ die vier Seiten der Vereinbarung an, die der DFB ihnen hatte abringen wollen.
Immerhin: Der DFB war aufgescheucht worden durch die schockierende Kunde von der WM 1966. Er gab ein Gutachten bei einem Sportrechtler in Auftrag. Martin Nolte, der 2014 für die Fifa eine gewogene Expertise zu deren geheimniskrämerischen Umgang mit ihrem Ermittlungsreport über die WM-Vergaben an Russland und Katar erstellte, sollte klären, ob DFB-Spieler 1966 gegen die damaligen Antidopingregeln verstoßen hatten. »Das war nicht der Fall«, fasste DFB-Vize Koch das Gutachten zusammen. Auch habe die Fifa 1966 ja »keinen der genannten Spieler wegen Dopings verurteilt oder gesperrt«. Nolte befand, dass trotz des Fundes einer verbotenen Substanz »die notwendige subjektive Leistungssteigerungsabsicht« gefehlt habe. Wie er zu dieser Gewissheit gekommen war? Nun, Spieler und Teamleitung hätten glaubhaft versichert, dass die Spuren auf den Gebrauch von Nasensprays zurückzuführen waren. Dann ist ja alles gut. Unwissenheit schützt vor Strafe, ließe sich das Ganze zusammenfassen. Die Forscher beurteilten das anders.
1966 wusste aber nicht nur ein hoher Fifa-Funktionär, dass drei deutsche Profis positiv getestet worden waren. Auch der britische Dopingfahnder Arnold Beckett, Direktor des Drogenkontrollcenters am Chelsea-College, schrieb über die WM 1966. Ihm fiel auf, »dass es aufgrund der Dopingkontrollen viel weniger Aggressivität als erwartet gab. Eine weitere bemerkenswerte Beobachtung war: Gewisse ältere Spieler spielten nur über kurze Zeit, und man vermutete, dass sie ohne Doping nicht mehr in der Lage waren, gut zu spielen. Es gab insgesamt nur drei positive Fälle.«50
Positive Fälle? Das ist interessant. Denn den offiziell ersten WM-Dopingfall gab es erst zwei Turniere später, 1974 in Deutschland.