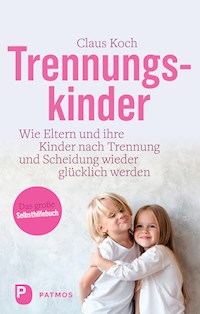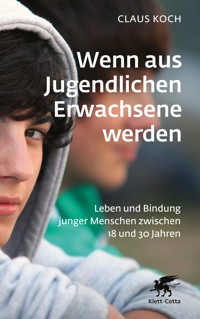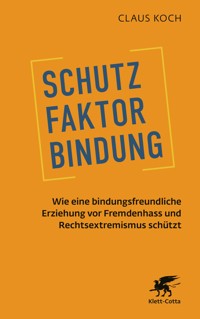
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Geborgenheit statt Hass: Wie Bindung Extremismus verhindert Oder: Erfahren Sie, wie Bindung der Schlüssel zu einer toleranteren Gesellschaft sein kann Hochaktuelles und gesellschaftlich relevantes Thema Die Verbindung zwischen Bindungsgeschichte und politischem Extremismus ist neu und bietet wertvolle Einsichten Konkrete Ansätze und Vorschläge, wie Erziehung zu Weltoffenheit gelingt Zum ersten Mal wird aus bindungstheoretischer Perspektive beleuchtet, wie das »bedrohliche Draußen« im Kindesalter entsteht und als Nährboden für Fremdenfeindlichkeit, Verschwörungstheorien und rechtsextreme Propaganda dient. Claus Koch geht der wichtigen Frage nach, warum bestimmte Menschen aufgrund ihrer Bindungsgeschichte besonders anfällig für rechtspopulistische und demokratiefeindliche Ideologien sind. Damit schließt dieses Buch eine entscheidende Lücke in der politischen Analyse, die bisher vor allem äußere gesellschaftliche Umstände in den Fokus nahm. Claus Koch zeigt, wie individuelle Bindungserfahrungen das politische Denken beeinflussen. Gleichzeitig bietet er konkrete Ansätze, wie eine bindungsfreundliche Erziehung und Umgebung als Schutzfaktoren wirken können. Erfahren Sie, wie Bindung der Schlüssel zu einer toleranteren, weltoffenen Gesellschaft sein kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Claus Koch
Schutzfaktor Bindung
Wie eine bindungsfreundliche Erziehung vor Fremdenhass und Rechtsextremismus schützt
Klett-Cotta
Impressum
Dieses Werk wurde vermittelt durch Aenne Glienke/Agentur für Autoren und Verlage, http://www.aenneglienkeagentur.de
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: produktsicherheit@klett-cotta.de
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: © Jutta Herden, Stuttgart
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
Lektorat: Susanne Klein, Hamburg
ISBN 978-3-608-98875-8
E-Book ISBN 978-3-608-12515-3
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20729-3
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Einleitung
TEIL 1
Die Entstehung des »bedrohlichen Draußen« beim Kind
1 Die sichere Bindung: Eine Welt, die mir guttut
2 Existenzielle Bedürfnisse und unsichere Bindung
3 Verloren gehen: Das bindungslose Kind
4 Ungebunden allein: Die Welt wird zum unberechenbaren Ort
5 Bindungslosigkeit als politische Waffe: Erziehung im Nationalsozialismus
6 Gewalttätige und mitleidslose Väter: Wie aus Opfern Täter werden
7 Unterordnung und Gehorsam: Vom Fortdauern bindungsfeindlicher Erziehung nach 1945
8 Auf Augenhöhe oder von »oben«? Erziehung heute
9 Der Feind im Kinderzimmer: Das herabgewürdigte Kind
10 Die Unfähigkeit, Freiheit zu ertragen: Die Folgen autoritärer Erziehung
11 Einsamkeit: Beziehungslos allein
12 Das bedrohliche Draußen als Phantasma
TEIL 2
Das große Versprechen: Endlich Sicherheit und Anerkennung
1 Den Feind sichtbar machen: Wie ein Phantasma zu Wirklichkeit wird
2 Die Migration als »Mutter aller Probleme«: Die Dämonisierung des »Fremden« und das Schüren von Ausländerhass
3 Angsträume
4 Das gesäuberte Draußen: Remigration
5 Reinheitsfantasien: Kampf der »links-grün versifften« Republik
6 Das unsichtbare Böse: Verschwörungstheorien und Antisemitismus
7 »Genderwahn« und »Wokeness«: Bedeutungsverlust des Mannes, Bedrohung der traditionellen Familie und Zerfall der Gesellschaft
8 Vaterland, Volksgemeinschaft, Heimat: Sehnsucht nach Sicherheit, Schutz und Bindung
TEIL 3
Die Brücke zur Weltoffenheit: Bindung als Schutzwall gegen Fremdenhass, Antisemitismus, Verschwörungstheorien und autoritären Nationalismus
1 Brückenbau: Die ersten drei Jahre
2 Befestigungsarbeiten und weitere Ausflüge: 3–6 Jahre
3 Halt geben und begehbar bleiben: 6–12 Jahre
4 Restaurationsarbeiten: 12–18 Jahre
5 Tragfähigkeit: Weltoffenheit und Erwachsenwerden: 18+
Was bisher geschah
Transitphase Erwachsenwerden
Die Grundlagen für ein weltoffenes Leben im Erwachsenenalter
TEIL 4
Begleitschutz: Bindungsfreundliche Angebote, Empathie und eine offene Gesellschaft
1 Kitas und Schulen zu bindungssicheren Orten machen
Auch Schulen sind Beziehungsorte
Vom Nutzen pädagogischer Beziehungskompetenz
Herausfordernden Kindern Bindungsangebote machen
Schulen müssen Türen zur Welt öffnen
2 Freiheit und Selbstwirksamkeit: Lebendige Demokratie
Demokratie und Bindung
Demokratie braucht offenen Dialog, persönliche Teilhabe und Resonanz
Demokratie, Selbstwirksamkeit und der freie Gestaltungswille
3 Empathie, die keine Grenzen kennt: Die Würde des Menschen ist unteilbar
Nachwort
Dank
Anmerkungen
Einleitung
TEIL 1 Die Entstehung des »bedrohlichen Draußen« beim Kind
TEIL 2 Das große Versprechen: Endlich Sicherheit und Anerkennung
TEIL 3
Die Brücke zur Weltoffenheit: Bindung als Schutzwall gegen Fremdenhass, Antisemitismus Verschwörungstheorien und autoritären Nationalismus
TEIL 4
Begleitschutz: Bindungsfreundliche Angebote, Empathie und eine offene Gesellschaft
Literatur
»Die Forderung, daß Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung.«
Theodor W. Adorno
Einleitung
Nach repräsentativen Umfragen ist allein in Deutschland bis zu einem Drittel der Bevölkerung rechtspopulistischen bis hin zu eindeutig rechtsextremen Positionen zugeneigt.[1] Diese äußern sich vornehmlich in unverhohlen vorgetragenen fremdenfeindlichen Ansichten und werden häufig begleitet von der Propagierung eines ethnisch gesäuberten, autoritär geführten Vaterlands und von antisemitisch verbrämten Verschwörungstheorien. Hinzukommt die Sehnsucht nach einem besseren »Gestern«, die sich in rückwärtsgewandten Vorstellungen von Familie, Erziehung und eines traditionellen Geschlechterverhältnisses ausdrückt. Die »Alternative für Deutschland« (AfD) und ihre prominenten Vertreter und Vertreterinnen, die bei der Bundestagswahl im Februar 2025 insgesamt 20 Prozent und in vielen Regionen weit mehr Wählerstimmen auf sich vereinigen konnten, bündeln diese Vorstellungen programmatisch und leiten daraus für ihre Gefolgschaft konkrete Handlungsschritte im öffentlichen Raum ab. Dazu zählen eine rassistisch motivierte Verfolgung von »Ausländern«, Angriffe auf Flüchtlingsheime, queerfeindliche Gewalt, die Verharmlosung der NS-Diktatur und ihrer Verbrechen sowie die zunehmende Bedrohung kultureller Einrichtungen und gewaltsame Einschüchterung all derer, die sich ihren Absichten und Plänen entgegenstellen.
Was aber machen die Attraktivität dieses Angebots und dazugehörige Säuberungs- und Abschiebungsfantasien aus, die den Wahlkampf 2025 – auch über Parteigrenzen hinweg – begleitet haben? Warum finden nationalistische, völkische, antisemitische und fremdenfeindliche Ansichten bei vielen, auch jüngeren Menschen und in nahezu allen Schichten der Bevölkerung so großen Anklang? Und umgekehrt: Warum scheinen gut zwei Drittel der Gesellschaft rechtspopulistischen bis hin zu rechtsextremen Vorstellungen nur wenig zugeneigt, wenn nicht sogar ihnen gegenüber immun zu sein?[2]
Für den Erfolg von Rechtspopulisten und Rechtsextremen gibt es von Politikwissenschaftlern, Ökonomen, Soziologen und Angehörigen anderer wissenschaftlicher Disziplinen auf der Grundlage umfassender empirischer Studien eine Fülle unterschiedlicher Erklärungsansätze.[3] Betrachtet man die darin vielfach genannten äußeren Beweggründe wie Angst vor unkontrollierter Einwanderung, Abstiegssorgen, das Gefühl sozialer Benachteiligung, Zukunftsängste, Globalisierung oder die Zuspitzung multipler gesellschaftlicher Krisen, sind dies durchaus plausible und nachvollziehbare Erklärungsmuster. Doch obwohl sie viele betreffen, führen sie beim Einzelnen ganz offensichtlich nicht zwangsläufig hin zu rechtspopulistischen und rechtsextremen Ansichten. Weshalb es schon verwundert, dass in Publikationen, die sich ausführlich und akribisch mit dem Entstehen und der zunehmenden Verbreitung rechtspopulistischer und rechtsextremer Einstellungen in unserer Gesellschaft beschäftigen, nahezu jeglicher Hinweis darauf fehlt, dass dies auch etwas mit den inneren Beweggründen ihrer Anhängerinnen und Anhänger, also deren intrapsychischen Disposition, zu tun haben könnte. So wird der Zusammenhang zwischen autoritär-nationalistischen Vorstellungen und möglichen Kindheitserfahrungen, wie er in der Autoritarismusforschung kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Sieg über die nationalsozialistische Gewaltherrschaft immer wieder thematisiert wurde, heute in nur wenigen sozialwissenschaftlichen Arbeiten angesprochen, oft aber auch systematisch ausgeblendet.[4]
Ein gutes Beispiel für Letzteres liefert das zweibändige Werk, in dem der renommierte Soziologe und Erziehungswissenschaftler Wilhelm Heitmeyer ausführliche Ursachenforschung betreibt hinsichtlich der Entstehung eines in Deutschland von der Neuen Rechten verfolgten »autoritären Nationalradikalismus«. Obwohl schon die Titel beider Bücher – »Autoritäre Versuchungen« und »Rechte Bedrohungsallianzen« – auf die Beteiligung auch psychischer Dispositionen und deren Folgen verweisen, finden sich auf Hunderten von Seiten nahezu keine Hinweise darauf.[5] Soziologische, ökonomische oder politische Erklärungsmuster aber stoßen besonders dort an ihre Grenzen, wenn es – wie bei der Propaganda von Rechtspopulisten und Rechtsextremen – weniger um Fakten, sondern um die Beschwörung von starken Emotionen geht. Im Vordergrund, und darauf wird zurückzukommen sein, steht dabei das Schüren von Angst angesichts eines den Menschen ständig bedrohenden Draußen.
Ich thematisiere in diesem Buch deswegen etwas, das allen Erklärungsansätzen, die Fremdenfeindlichkeit und den stetig zunehmenden Rechtspopulismus und Rechtsextremismus hauptsächlich auf äußere Umstände und mangelnde Aufklärung zurückführen, noch fehlt. Es geht um die bislang vernachlässigte Frage, was Menschen aus ihrer individuellen Bindungsgeschichte heraus, also aufgrund ihrer frühkindlichen Erfahrungen, besonders anfällig werden lässt für rechtspopulistische, rechtsextreme und demokratiefeindliche Vorstellungen. Es geht um die auf der Basis der Bindungstheorie[6] zu verortende Entstehungsgeschichte eines Phantasmas vom bedrohlichen Draußen in der frühen Kindheit. Dabei handelt es sich nicht von ungefähr um das zentrale, über allem stehende Narrativ, das bis heute sämtliche dieser politischen Strömungen in unseren westlichen Gesellschaften miteinander verbindet.
Dies wird nicht die einzige Erklärung dafür sein, dass sich Menschen bereitwillig den Parolen der Neuen Rechten zuwenden. Aber dieser bindungstheoretisch motivierte Ansatz eröffnet vor allem, ohne andere Erklärungsansätze infrage zu stellen, eine niederschwellige Möglichkeit zur Prävention von autoritärem Nationalradikalismus, indem eine bindungsfreundliche Atmosphäre und Umgebung geschaffen werden, und zwar sowohl in der Familie als auch außerhalb des Elternhauses in Kita und Schule. Hauptanliegen dieses Buches ist deswegen auch zu zeigen, wie und warum eine bindungsfreundliche Erziehung helfen kann, Kinder und Jugendliche davor zu schützen, für rechtsextreme und völkisch inszenierte Bedrohungsszenarien anfällig zu werden. Dabei geht es um die Entstehung von Weltoffenheit schon in der frühesten Kindheit, um ein weltoffenes Kind, das sich mithilfe seiner Neugierde und Entdeckungslust dem Narrativ eines »bedrohlichen Draußen« von Beginn seines Lebens an entgegenstellt. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung, dass es sich später autoritäre und nationalradikale Parolen erst gar nicht zu eigen macht. Es geht um eine Erziehung, die beim heranwachsenden Kind die Gefühle von Schutzlosigkeit, Kontrollverlust und innerer Leere erst gar nicht aufkommen lässt und stattdessen eintauscht gegen Gefühle von Sicherheit, Geborgenheit, Anerkennung und Sichtbarkeit. Hier sind es die wichtigsten Bezugspersonen, in den meisten Fällen seine Eltern, die dem Kind von Geburt an eine tragfähige und belastbare Brücke hin zur Welt bauen. Bekommt diese Brücke aber Risse oder bricht ganz entzwei, hat dies weitreichende Folgen hinsichtlich der kindlichen Vorstellung dessen, was in der Welt am anderen Ende der Brücke stattfindet. Ohne festen Halt und Bindung zu seinen Eltern bekommt das Kind zunehmend Angst vor dem, was ohne seinen Einfluss und ohne seine Wirksamkeit außerhalb von ihm passiert. Aus solcher Entfremdung und Ohnmachtserfahrung entsteht bei ihm nach und nach eben jene Vorstellung von einem bedrohlichen Draußen. Anders gesagt, wird das Geschehen am anderen Ende der Brücke dem Kind unheimlich.
Die innere Leere des Kindes, seine Ohnmachtsgefühle, seine Ängste, aber auch seine Wut beziehen sich anfangs noch auf die unmittelbare Umgebung des allein sich selbst überlassenen Kindes, das ohne den Rückhalt ausreichender Bindungserfahrungen zu den ihm wichtigsten Bezugspersonen heranwächst.[7] Doch später löst sich dies nach und nach von der frühkindlichen Erfahrung ab, obwohl alle diese Gefühle in ihm weiter bestehen. Und an dieser Schnittstelle entsteht nach und nach die Vorstellung einer stets bedrohlichen und unberechenbaren Welt, die später, wenn das Kind älter und erwachsen geworden ist, mit der Erfahrung wirklicher Bedrohung kaum noch etwas zu tun hat. Vielmehr verselbstständigt sich diese Vorstellung in ihm immer weiter als ein Phantasma vom bedrohlichen Draußen.
Stets konfrontiert mit diesem inneren Bild von Bedrohung können dem erwachsenen Menschen jetzt nur noch Forderungen nach immer mehr Schutz und Kontrolle weiterhelfen, um sämtliche Gefahren abzuwehren, die ihm aus einer in seinen Vorstellungen per se und auch unabhängig von konkreten, Angst auslösenden Anlässen feindlich gesonnenen und immer unübersichtlicheren Welt drohen. Dies aber macht ihn anfällig für Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und Demokratiefeindlichkeit, weil scheinbar nur in einem autoritären Staat Sicherheit, Kontrolle, Schutz und Anerkennung für ihn zu finden sind. Eine Einstellung, die völkischem Nationalismus, Antisemitismus, Remigrationsfantasien, identitärem Rausch bis hin zu gewalttätigen Übergriffen auf alles, was »anders«, »fremd«, unheimlich oder »bedrohlich« erscheint, Legitimation verschafft.
»Kopftuchmädchen«, die für das Verborgen-Unsichtbare und Fremde stehen, »Messermänner«, die uns jederzeit bedrohen, angreifen und töten wollen, »Taugenichtse«, die unserer Gesellschaft nicht nützlich sind und deswegen bei uns auch nichts zu suchen haben, so hat Alice Weidel, Frontfrau und Co-Vorsitzende der AfD, dieses Horrorszenarium im Deutschen Bundestag schon vor einigen Jahren mit eindrücklichen und gefühlskalten Worten beschrieben und auf den Begriff gebracht.[8] Das Angebot ist verlockend: Immer geht es darum zu eliminieren, was ein bedrohliches Draußen auszumachen scheint, und es unter politischer Führung in ein sauberes, ethnisch bereinigtes »Vaterland« zu verwandeln, von dem für den Einzelnen keinerlei Gefahr mehr ausgeht und das stattdessen Schutz und Geborgenheit verspricht.
In diesem Buch gehe ich dem nach, was der Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno in seinem Rundfunkbeitrag »Erziehung nach Auschwitz« bereits vor sechzig Jahren formulierte: dass nämlich »die Forderung, daß Auschwitz nicht noch einmal sei, die allererste an Erziehung« sei bzw. dass »jede Debatte über Erziehungsideale nichtig und gleichgültig sei diesem einen gegenüber, daß Auschwitz sich nicht wiederhole«.[9] Die Auseinandersetzung mit den psychologischen Wurzeln des Faschismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus findet heute aber nur noch selten statt. Wenn überhaupt, wird die Neigung hin zu solchen politischen Einstellungen von Sozialpsychologen, Erziehungswissenschaftlern und weiteren Experten häufig mit einer streng autoritären Erziehung in Verbindung gebracht.[10] Aber auch wenn eine autoritäre Erziehung, wie Studien immer wieder zeigen konnten, zu Bindungsarmut und später beim Erwachsenen selbst zu autoritären Vorstellungen und Handlungsmustern führen kann, folgt daraus keinesfalls linear eine Tendenz zu rechtspopulistischen oder rechtsextremen Einstellungen. Der autoritäre Vater oder die autoritäre Mutter, die dennoch vermögen, ihren Kindern auch Liebe und Zuversicht für ihr Leben mitzugeben, können deren Vertrauen in demokratisch ausgehandelte Entscheidungen durchaus stärken. Auch in Staaten, die im Zweiten Weltkrieg ihre Demokratie und Freiheit gegenüber dem faschistischen Deutschland verteidigten, waren autoritäre Erziehungsprinzipien schließlich gang und gäbe.
Insofern ist es notwendig, noch einen weiteren Schritt zurückzugehen. So geht es in meinem Buch vor allem um die durch Bindungslosigkeit und Bindungsarmut entstandene Schutzlosigkeit des Kindes, um die persönliche Anerkennung und das Gefühl von Selbstwirksamkeit, die ihm fehlen. Denn diese schaffen zuallererst die Voraussetzungen dafür, ihm die Welt zu einem gefährlichen Ort werden zu lassen. Es ist weniger die strenge Erziehung, obwohl sie zur Bindungsarmut des Kindes beitragen kann, als die Bindungslosigkeit des Kindes selbst, seine daraus resultierende Orientierungslosigkeit, Verlustangst und innere Leere, die es anfällig werden lässt für rechtspopulistische und rechtsextreme Macht-, Kontroll- und Gewaltfantasien, um dem von ihm ständig imaginierten gefährlichen Draußen endlich zu entkommen.
Frühkindlich erfahrene Bindungsarmut führt, auch davon wird die Rede sein, beim erwachsenen Menschen jedoch nicht zwangsläufig zu einem rechtspopulistischen oder rechtsextrem geprägten Weltbild. Besonders wenn bindungsstärkende und fürsorgliche Personen und Institutionen außerhalb der familiären Erfahrungswelt vorhandene Defizite in der frühkindlichen Erziehung kompensieren können, bleiben politische Einstellungen in der Biografie jedes Einzelnen wandlungsfähig. Auch diese Personen und Institutionen außerhalb der Familie spielen bei der Prävention von fremdenfeindlichen und rechtsextremen Einstellungen also eine bedeutende Rolle.
Dieses Buch gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil geht es darum, wie die Welt dem Kind zu einem unwirtlichen und unberechenbaren Ort wird, ergänzt um die Entstehung des Phantasmas von einem gefährlichen Draußen. Ich beschreibe, wie eine offen propagierte Erziehung hin zu Bindungsarmut und Bindungslosigkeit im Nationalsozialismus zur politischen Waffe wurde und dass bindungsfeindliche Erziehungseinstellungen entgegen den mehrheitlich vorhandenen Vorstellungen von human geprägter Kindererziehung bis heute überleben konnten und weiterhin propagiert werden. Schließlich geht es darum, wie die empfundene Einsamkeit und innere Leere des unsicher gebundenen Kindes zu einer übermächtigen Angst vor einem stets bedrohlichen Draußen führen kann.
Im zweiten Teil geht es um die politische Instrumentalisierung der Vorstellung von einem »bedrohlichen Außen« durch rechte Akteure. Ich zeige, wie Rechtspopulisten und Rechtsextremisten mit ihrem sich gebetsmühlenartig wiederholenden fremdenfeindlichen Narrativ und ihren Bedrohungs- und Verschwörungsmythen versuchen, dem Kontroll- und Bedeutungsverlust des Einzelnen durch Remigrationsfantasien und einem daran anschließenden »autoritären Nationalradikalismus«[11] beizukommen.
Im dritten Teil werden schließlich Wege aufgezeigt, wie durch eine bindungsfreundliche Erziehung Schutzfaktoren entstehen, mit denen der Vorstellung eines stets bedrohlichen Draußen, der sie begleitenden Anfälligkeit für rechtspopulistische und rechtsextreme Ansichten und der Handlungen, die sich daraus ergeben, vorgebeugt werden können. Es geht um die Erziehung hin zu einem weltoffenen Kind, dem sich ein Weg darbietet, sich mit der zunächst fremden Welt vertraut zu machen und sie sich zunehmend anzueignen. Entscheidend dafür wird sein, dem Kind in seiner Entwicklung Geborgenheit, Sicherheit, Resonanz und Anerkennung zu vermitteln, sodass später der erwachsene Mensch für seine Kinder selbst zum Brückenbauer werden kann hin zu einer immer vertrauter werdenden Welt. Mit anderen Worten geht es einfach nur darum, dem Kind von Geburt an die Welt zu einem angenehmen und sicheren Ort zu machen.
Eine unsichere familiäre Bindungsatmosphäre lässt sich kompensieren und die daraus resultierenden Bindungsmuster sind wandlungsfähig, wenn dem Kind außerhalb seines Zuhauses entsprechende Bindungsangebote gemacht werden. Darum und um die zunehmenden Aufgaben von Kita und Schule, in denen heutzutage die meisten Kinder einen Großteil ihrer Zeit verbringen, geht es im vierten und letzten Teil dieses Buches. Auch sie müssen ihrer Aufgabe nachkommen, eine lebendige Demokratie zu fördern, die autonomes und selbstwirksames Handeln verlangt, statt Eigenverantwortung an autoritäre Führer zu delegieren, die vermeintlich Sicherheit und Schutz versprechen. Entsprechend bedarf eine Erziehung zu Toleranz, Empathievermögen und Weltoffenheit immer auch der besonderen Förderung entsprechender Bildungspolitik sowie der Anteilnahme und Unterstützung vonseiten der Zivilgesellschaft.
TEIL 1
Die Entstehung des »bedrohlichen Draußen« beim Kind
Das Kind erlebt die Welt, in die es hineingeboren wird, als etwas von sich selbst Verschiedenes, etwas anderes. Laut und unendlich groß erscheint sie ihm. Aber dieses Anderssein außerhalb von sich selbst verliert den Schrecken seiner Unendlichkeit und den bedrohlichen Klang der vielen Stimmen durch die Fixpunkte und die fürsorgliche Haltung seiner engsten Bezugspersonen. Durch einen ständigen Austausch entsteht nach und nach ein festes Band zwischen ihm und seiner nächsten Umgebung, das viel mehr bedeutet, als bloß sein Überleben zu sichern. Solcherart Bindung hat entscheidenden Anteil daran, die Brücke zur äußeren Welt überhaupt begehbar zu machen und das sichere Empfinden zu vermitteln, dass sie beim Betreten nicht bricht. Das Kind wird mit all den Signalen, die es an seine Bezugspersonen aussendet, nach und nach selbst zum Brückenbauer. Und es versucht, um im Bild zu bleiben, das andere Ende der Brücke, also die ihm äußerliche Welt, immer wieder durch sein Handeln zu erreichen und für sich zu begeistern. Aber um sich bei dem, was hier passiert, sicher zu fühlen, braucht es an dieser Stelle entsprechende Antworten, braucht es Resonanz und ein Echo, die ihm das Gefühl geben, nicht allein zu sein. Damit kann es sich in dem, was ihm zunächst fremd erscheint, sicher und geborgen fühlen. Die Welt, wie sie sich ihm zeigt, wird so zum sicheren Ort. Ohne den erfahrenen Halt in ihr verliert sich das Kind, fühlt sich ungebunden in ihr, allein und schutzlos. Eine solche Welt wird dem Kind immer mehr zur Bedrohung.
1 Die sichere Bindung: Eine Welt, die mir guttut
Unzählige Studien über unterschiedliche Kulturen hinweg und die moderne Säuglings- und Bindungsforschung haben zeigen können, dass Kinder bereits von Geburt an aktiv auf einen wechselseitigen sozialen Austausch mit ihren wichtigsten Bezugspersonen hin ausgerichtet sind. Von sich aus und mit allen ihnen zu Verfügung stehenden Mitteln wenden sie sich diesen Menschen zu und reagieren besonders empfindlich, wenn sie von ihnen getrennt werden. Aus nachvollziehbarer Verlustangst und auf der Suche nach Schutz und Geborgenheit suchen sie ihre Nähe, die sie anfangs nach Möglichkeit immer aufrechterhalten wollen. Mit ihren ersten Gesten, Blicken und später mit Worten suchen sie ganz von allein die Bereitschaft ihrer Eltern, sich ihnen zuzuwenden, sie wohlwollend zu empfangen und auf die an sie gerichteten Signale, zu denen auch Zeichen von Kummer und Schmerz gehören, zu reagieren und ihnen feinfühlig zu begegnen. Wenn ein Säugling bei seiner Geburt bereits sprechen könnte, würde er seine Bedürfnisse vermutlich so formulieren:
»Ich brauche euch! Ohne euch kann ich nicht leben. Wenn ihr für mich da seid, fühle ich mich vor äußeren Gefahren beschützt und geborgen. Diese mir vertraute und sichere Basis bietet mir die notwendige Sicherheit, die Welt um mich herum nach und nach für mich zu erobern. Deswegen suche ich von meiner Geburt an den Kontakt zu euch, wann immer es möglich ist, und hoffe darauf, entsprechend von euch angenommen zu werden.«
Eine solche, sich aus wechselseitiger Kommunikation ergebende enge und gute Bindung an seine primären Bezugspersonen erfüllt mit zunehmendem Alter die Funktion, dem Kind ein Gefühl von Sicherheit, Schutz und Vertrauen in die Welt zu verschaffen. Zahlreiche bindungstheoretische Studien haben zeigen können, dass dieses Vertrauen, das aus dem Wissen um einen »sicheren Hafen« entsteht, beim Kind dazu führt, seine Umwelt aktiv, angstfrei und neugierig zu erforschen.
Eine sichere Bindung, neugierige Anteilnahme an dem, was »draußen« geschieht, und eine daraus resultierende Weltoffenheit haben also viel miteinander zu tun. Mit den Fragen, wie genau sich die sichere Bindung in der Kindheit, Jugend und der Lebensphase des Erwachsenwerdens entwickelt und woran sie sich später im Leben eines Erwachsenen bemerkbar macht, beschäftigen wir uns im dritten Teil dieses Buches. Auch hier spielt der bereits erwähnte Zusammenhang von guter Bindung und der Fähigkeit des Kindes, seine Welt aktiv zu erleben und zu gestalten, eine entscheidende Rolle. Denn auf zunächst Fremdes oder Unvorhergesehenes, das vielleicht erschreckt, reagieren Kinder, die gute Bindungserfahrungen gemacht haben, mit zunehmendem Alter immer gelassener. Es macht sie eher neugierig, sie möchten es buchstäblich begreifen, näher kennenlernen, sich mit ihm vertraut machen und in »ihre Welt« aufnehmen.
Mit der ihnen angeborenen Zugewandtheit und Erkundungslust haben sicher gebundene Kinder in ihrer frühkindlichen Entwicklung und den Jahren darauf die Erfahrung gemacht, dass ihnen die Welt meistens wohlwollend und mit guten Absichten begegnet. Auch als Erwachsene bleiben sie motiviert, sich neuen und unbekannten Situationen angemessen zu öffnen, und sie vertrauen dabei auf ihre eigene Stärke und Wirksamkeit. Ihre Erfahrung, von Beginn ihres Lebens an gehört und gesehen worden zu sein, stärkt nicht nur ihre Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und Empathie auch für diejenigen zu entwickeln, die ihnen anfangs fremd sind. Anerkannt zu werden, macht auch unabhängig vom anderen, verleiht Autonomie.
Erwachsene mit sicherer Bindung suchen und nutzen die Welt, um sich in ihr zu verwirklichen. Der Kontakt und die Beziehung zu anderen Menschen sind ihnen wichtig. In einer Atmosphäre des beständigen und wohlwollenden gemeinsamen Austauschs mit dem »anderen«, mit dem, was sich von ihnen unterscheidet, sind sie schließlich groß geworden. Sie vertrauen resonanten Beziehungen und widerstehen dem Ressentiment, die Welt nicht ertragen zu können, weil sie ihnen bedrohlich, ungerecht und demütigend vorkommt.[1] Ein solches Ressentiment entsteht immer dann, wenn man sich in seinen Verdiensten nicht gewürdigt sieht, und auch dies hat viel mit dem Fehlen von frühkindlicher Zuwendung und Annahme zu tun. Dem Ressentiment des »Wutbürgers«, seiner beständigen Opferhaltung und der Befürchtung, übersehen zu werden, steht die offene und vorurteilslose Hinwendung des Kindes und späteren Erwachsenen zur Welt entgegen.
Was nicht bedeutet, dass nicht auch Kinder Krisen durchleben und auf echte Bedrohungen stoßen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Eine gute Bindung geht niemals mit völliger Angstfreiheit einher, vielmehr signalisieren die empfundenen Ängste die Notwendigkeit, sich mit drohenden Gefahren ernsthaft und angemessen auseinanderzusetzen, ohne sich dabei von den eigenen Gefühlen und Angst machenden Parolen überwältigen zu lassen. Sicher gebundene Kinder gehen später als Jugendliche und Erwachsene relativ angstfrei auf die Welt zu und sind vor allem in der Lage, zwischen tatsächlicher Bedrohung und erfundenen bzw. politisch instrumentalisierten Bedrohungsszenarien, zwischen »Fake« und Wirklichkeit zu unterscheiden. Darauf werde ich noch zurückkommen.
2 Existenzielle Bedürfnisse und unsichere Bindung
Die Bindungsentwicklung eines Kindes ist, wie die Bindungsforschung gezeigt hat, in hohem Maße davon abhängig, inwieweit die ihm wichtigsten Bezugspersonen – zumeist sind es die Eltern – seinen existenziellen Bedürfnissen nachkommen. Ob sie fürsorglich und feinfühlig auf die Gesten, Blicke und Worte, in denen sich sein Wunsch nach verlässlicher Bindung ausdrückt, eingehen oder ob sie ihm gegenüber eher reserviert oder unstet erscheinen, bis dahin, dass sie den an sie gerichteten Signalen und Äußerungen des Kindes kaum oder gar keine Beachtung schenken. Dabei geht es dem Kind mit seinen Bindungswünschen immer darum, Vertrauen zu sich selbst und zu der ihm äußeren Welt fassen zu können, um dort Geborgenheit und Sicherheit zu finden. Um sich wertvoll und anerkannt zu fühlen, hofft es bei denen, die ihm am nächsten sind, auf Resonanz und will auch mit seinen eigenen Absichten wirksam sein.
Aus der Sicht des Kindes heißt das: »Wenn ich mich an euch wende, kann ich mit euch rechnen«, »Hier fühle ich mich gut aufgehoben«, »Ich werde gehört und gesehen«, »So, wie ich geworden bin, darf ich sein«, »Was ich mir vornehme, kann mir gelingen«.
»Der Ausdruck von Bedürfnissen, mit dem das Kind auf die Welt kommt, ist das Fundament der Bindungstheorie« – so die beiden führenden deutschen Bindungsforscher Karin und Klaus E. Grossmann in ihrem Hauptwerk »Bindungen – das Gefüge psychischer Sicherheit«.[2] Die Art und Weise, wie die dem Kind nächsten Bezugspersonen auf diese Bedürfnisse eingehen, entscheidet darüber, ob dem Kind nach und nach eine sichere Bindung gelingt. Sie wirkt wie ein unsichtbares Band, das dem ein Kind ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen vermittelt.
Die Erfüllung grundlegender Bedürfnisse entscheidet aber nicht nur über die Entwicklung einer sicheren Bindung des Kindes in seinem Verhältnis zu seinen primären Bezugspersonen, sondern auch darüber, ob das Kind einen angstfreien, von Neugierde und Wissensdurst geprägten zuversichtlichen Zugang zu seiner Umgebung und die in ihr handelnden Personen finden kann. Der Begründer der Bindungstheorie, John Bowlby, fasst dies wie folgt zusammen: »Das Bindungsmuster, von dem man glaubt, es gehöre zu einer gesunden Entwicklung, ist das der sicheren Bindung, bei der das Individuum zuversichtlich ist, dass ein Elternteil (oder eine Elternfigur) in widrigen oder furchteinflößenden Situationen verfügbar, antwortbereit und hilfreich ist. Mit dieser Gewissheit fühlt sich das Kind bei der Entdeckung der Welt ermutigt und fühlt sich auch fähig, damit umzugehen.«[3] Und an anderer Stelle schreibt er: »Ebenso wichtig wie die Achtung der Eltern vor den Bindungswünschen des Kindes ist ihre Achtung vor seinem Wunsch, seine Umwelt zu erkunden und allmählich seine Beziehungen zu Gleichaltrigen als auch zu Erwachsenen zu erweitern.«[4]
Bleiben die oben genannten existenziellen Bedürfnisse des Kindes und seine damit einhergehenden Bindungswünsche über einen längeren Zeitraum hinweg jedoch unberücksichtigt, entwickelt sich für das Kind ein unsicheres Bindungsmuster mit entsprechenden Auswirkungen – sowohl auf sein Verhältnis zu den ihm nächsten Bezugspersonen als auch hinsichtlich seines Zugangs zur Welt.
Auf der Grundlage verschiedener Forschungsansätze und Beobachtungen zum Bindungsverhalten eines Kindes unterscheidet die Bindungstheorie hier zwischen einer unsicher-vermeidenden Bindung und einer unsicher-ambivalenten Bindung.[5]