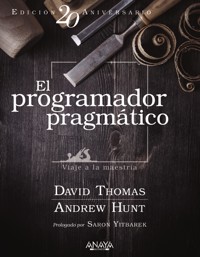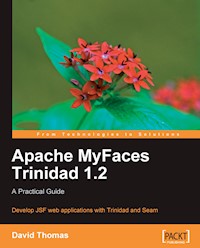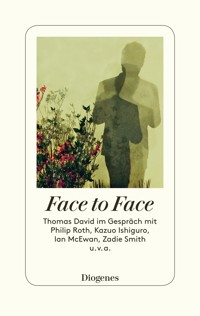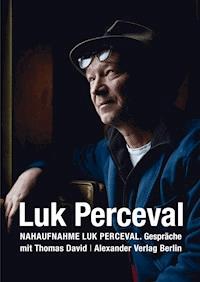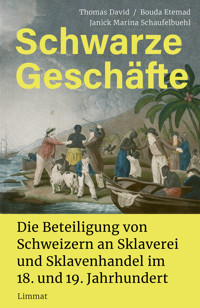
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limmat Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als im Herbst 2001 anlässlich der UNO-Konferenz gegen Rassismus Sklavenhandel zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit erklärt wurde, gehörte die Schweiz zu den 163 unterzeichnenden Ländern und und von offizieller Seite wurde betont, das Land habe im 18. und 19. Jahrhundert nichts mit Sklaverei, Sklavenhandel und Kolonialismus zu tun gehabt. Die drei Historiker Thomas David, Bouda Etemad und Janick Marina Schaufelbuehl kommen zu anderen Ergebnissen: Auf der Basis von neu erarbeiteten Quellen liefern sie erstmals eine umfassende Studie zu dieser Frage. Aufgezeigt wird, dass Basler und Neuenburger Indienne-Fabrikanten einen Grossteil der Ware liefertern, die in Afrika gegen die Sklaven eingetauscht wurde. Auch waren Schweizer Investoren in nahezu hundert Schiffsexpeditionen involviert, die ebenfalls solche Transporte durchführten. Zudem besassen Schweizer Aktien von Gesellschaften, die über 172'000 Afrikaner in die Karibik brachten. Schwarze Sklaven waren aber auch auf Plantagen von Schweizern zu finden. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts, als in den meisten Kolonien die Sklaverei schon verboten war, arbeiteten hunderte von Sklaven für Schweizer Gutsbesitzer in Brasilien. Der Schweizer Bundesrat befand, dass die Exil-Schweizer dazu ein Recht hätten. Nicht zuletzt halfen Schweizer Söldner und Offiziere bei der Niederschlagung von Sklavenaufständen in der Karibik. Die schweizerischen Antisklaverei-Organisationen, deren Engagement von gewissen konservativen und evangelischen Kreisen ausging, richteten sich nicht gegen die transatlantischen Geschäfte, sondern gegen den arabischen Sklavenhandel, der in Afrika existierte und gewissen Kolonisationsprojekten im Wege stand.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
«In diesem ausgezeichneten Buch, das Epoche machen wird, zeigen die Autoren auf, inwiefern das europäische Mitwirken an der Sklaverei von Afrikanern auch Länder betraf, die selbst keine Sklavenhandelsnationen waren.»
Doudou Diène, UNO-Kommission für Menschenrechte
Die Autoren, die Autorin und die Übersetzerin
Thomas David ist Assistenzprofessor am Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Universität Lausanne.
Bouda Etemad ist Professor für Neuer Geschichte an den Universitäten Lausanne und Genf.
Janick Marina Schaufelbuehl ist Historikerin und arbeitet an der Universität Lausanne.
Birgit Althaler hat Romanistik und Germanistik in Wien studiert und arbeitet seit 1995 als freischaffende Übersetzerin in Basel.
Thomas David
Bouda Etemad
Janick Marina Schaufelbuehl
Schwarze Geschäfte
Die Beteiligung von Schweizern an Sklaverei und Sklavenhandel im 18. und 19.Jahrhundert
Aus dem Französischen von Birgit Althaler
Limmat Verlag Zürich
Inhalt
Einleitung
Über die Beteiligung von Schweizern am transatlantischen Sklavenhandel
Die Schweizer und die Sklaverei in Amerika
Die schweizerische Bewegung gegen Sklaverei und Sklavenhandel
Anhang
Einleitung
Die Idee, ein Buch über die Schweiz und den Sklavenhandel zu schreiben, mag auf den ersten Blick unsinnig erscheinen. Alle wissen doch, dass die Schweiz nie eine Sklavenhandelsflotte oder Kolonien mit Zuckerplantagen in der Karibik oder auf dem amerikanischen Kontinent besessen hat. Zudem wurde die Schweiz zu einem Zeitpunkt Bundesstaat, als der transatlantische Sklavenhandel mit Schwarzen und die Sklaverei in Europa und Amerika kurz vor der Abschaffung standen. Folglich kann sich die Schweiz als Staat von dieser Frage in keiner Weise betroffen fühlen.
Trotzdem nimmt die offizielle Schweiz heute Stellung zu diesen Themen. Im März 2001 veröffentlichte die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus ein Memorandum, in dem sie erklärte, dass «die Schweiz den Sklavenhandel, die Sklaverei und den Kolonialismus als historische Manifestationen, die […] einem die betroffenen Menschen und Völker zutiefst verletzenden und schädigenden rassischen Menschenbild angehören, verurteilen kann und muss». Die Kommission ist zudem der Ansicht, dass «die vergangenen, bis heute nachwirkenden Folgen dieser historischen Ereignisse und insbesondere ihr Anteil am wirtschaftlichen Entwicklungsrückstand der betroffenen Länder und an der verzögerten politischen und sozialen Umstrukturierung anerkannt werden müssen». Aus diesem Grund unterstützt sie «das Prinzip einer Wiedergutmachung […], bekräftigt aber die ihrer Ansicht nach vorrangige Bedeutung einer öffentlichen moralischen Anerkennung des durch Sklavenhandel, Sklaverei und Kolonialismus verursachten Unrechts durch die Schweiz».
Wenige Monate später unterzeichnete die Schweiz die Erklärung von Durban zum Abschluss der dritten Weltkonferenz gegen Rassismus, die im September 2001 in Südafrika stattfand. Hier zwei interessante Ausschnitte aus diesem Text, auf den sich die Schweiz und die anderen 162 an der Konferenz teilnehmenden Ländern geeinigt hatten. In Paragraph 13 heisst es: «Wir erkennen […] ferner an, dass Sklaverei und Sklavenhandel ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind.» In Paragraph 158 (des Aktionsprogramms) hält die Konferenz fest, «dass diese historischen Ungerechtigkeiten unleugbar zu Armut, Unterentwicklung, Marginalisierung, sozialer Ausgrenzung, wirtschaftlicher Ungleichheit, Instabilität und Unsicherheit beigetragen haben, wovon viele Menschen in verschiedenen Teilen der Welt betroffen sind […]. Die Konferenz erkennt die Notwendigkeit an, im Rahmen einer neuen […] Partnerschaft Programme für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung dieser [afrikanischen, vom Sklavenhandel betroffenen] Gesellschaften und der Diaspora […] auszuarbeiten […].»
Der beschlossene Wortlaut lässt, wie man sieht, die Tür offen für ein öffentliches Schuldbekenntnis und stellt Möglichkeiten einer verstärkten Entwicklungshilfe, einer besseren Eingliederung in die westlichen Märkte und der Schuldenstreichung, wenn auch keine Wiedergutmachung in Aussicht. Die westlichen Staaten und mit ihnen die Schweiz scheinen bereit, das Unrecht anzuerkennen, das dem afrikanischen Kontinent angetan wurde, und Formen der Wiedergutmachung für die Vergangenheit zu erwägen, sind aber nicht besonders erpicht darauf, mit ihrem Reuebekenntnis rechtlichen Schritten Vorschub zu leisten. «Wir sind bereit, uns unserer Vergangenheit zu stellen, doch das Ziel von Durban ist nicht, Experten- und Juristenkammern zusätzliche Fälle aufzuhalsen, indem wir sie beauftragen, die durch Kolonisierung und Handel verursachten Schäden zu beziffern», meinte etwa Charles Josselin, der nach Südafrika entsandte französische Minister für Entwicklungszusammenarbeit.
Der Vertreter der Schweiz in Durban, Jean-Daniel Vigny, betonte in Reaktion auf die Entschädigungsforderungen, die von afrikanischer Seite an Länder gestellt werden, die vom Handel mit Schwarzen profitiert haben, eine solche Forderung stelle für die Schweiz kein besonderes Problem dar, da «wir mit Sklaverei, dem Sklavenhandel und dem Kolonialismus nichts zu tun haben». Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus liess im März 2002 an einer nationalen Konferenz zum Thema «Die Schatten der Vergangenheit und die Last der Bilder. Rassismus gegen Schwarze in der Schweiz» ähnliche Töne vernehmen. Sie verurteilte den Sklavenhandel und unterstützte das Prinzip der Entschädigung, betonte bei dieser Gelegenheit aber, dass «die Schweiz keine Kolonialmacht war und sich auch nicht an der Sklaverei in Afrika beteiligt hat».
Anfang 2003 forderten verschiedene Politikerinnen und Politiker, die Zweifel an der historischen Haltbarkeit dieser Erklärungen hegten, den Nationalrat und mehrere kantonale Parlamente und Regierungen, namentlich in Basel, Bern, Zürich, St.Gallen und Appenzell, um nur die Deutschschweizer Kantone zu nennen, dazu auf, Forschungen über die Rolle der Schweiz und/oder der Schweizer im Sklavenhandel anzustellen und zu fördern. Diesen Interpellationen und schriftlichen Anfragen lag eine vom unabhängigen Forscher und Kabarettisten Hans Fässler koordinierte Aktion zugrunde. Fässler hatte im Rahmen der Zweihundertjahrfeiern des Beitritts St.Gallens zur Eidgenossenschaft ein Stück präsentiert, das von der Beteiligung eines Schweizer Söldners an der Niederschlagung des Sklavenaufstands von Haiti 1803 handelt. Wie Fässler betont, sei er bei der Vorbereitung dieses Stücks auf die zahlreichen Verbindungen der Schweiz zur Sklaverei aufmerksam geworden. Das habe ihn zu dieser Initiative bewogen, die von verschiedenen Abgeordneten aufgegriffen wurde.
Es lohnt sich, die Antworten der angesprochenen Kantons- und Bundesbehörden (siehe Anhang) genauer anzusehen. Alle bekräftigen zuerst, dass sie die Durban-Erklärung unterstützen. Mehrere begrüssen die Forderung, Forschungsarbeiten über die Beteiligung der Schweiz am Sklavenhandel durchzuführen, und bekunden teilweise sogar ihre Bereitschaft, entsprechende Studienprojekte zu diesem Thema zu unterstützen. Niemand ist jedoch der Ansicht, es sei Aufgabe des Staates, selbst eigene Studien in Auftrag zu geben. In Beantwortung einer schriftlichen Anfrage des sozialdemokratischen Abgeordneten Jean Guignard von November 2003 rechtfertigt der Staatsrat des Kantons Waadt, warum er sich in dieser Frage nicht engagieren wird: «Im Gegensatz zu anderen Themen (nachrichtenlose Vermögen, Sterilisierung von geistig Behinderten), zu denen er [der Staatsrat] Studien in Auftrag gegeben hatte, scheint in diesem Fall eine direkte Verantwortung der Behörden […] nicht vorzuliegen. Eine solche Verantwortung liegt allerdings für Familien und Personen mit Waadtländer Herkunft oder damaligem Wohnsitz in der Waadt vor, deren Reichtum auf dem Sklavenhandel und seinen Nebenerzeugnissen beruhen dürfte.»
Auf der Grundlage dieser Unterscheidung erklärt der Staatsrat des Kantons Waadt, er hoffe aber, «dass durch Forschungen die Fakten ans Licht kommen und das genaue Ausmass der Beteiligung von Schweizern am Sklavenhandel festgestellt wird, dass er aber keine Verantwortung für die Taten von Familien übernehmen kann, die ausschliesslich ihren eigenen Interessen gemäss gehandelt haben». Daher könne er «nur befürworten, wenn auf nationaler Ebene unter Leitung mehrerer Universitäten gemeinsame Forschungen durchgeführt würden, die der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung finanziere».
Die Regierung des Kantons Waadt betont nebenbei die Schwierigkeit dieser Aufgabe: «Obwohl die schweizerische Beteiligung am transatlantischen Handel unbestritten ist, müssen Ausmass, Formen und Dauer dieser Beteiligung erst untersucht werden. Die von Schweizer Kaufleuten benutzten Finanzierungsformen und Geldkreisläufe sind bisher wenig bekannt. Von historischer Seite wurden über den schweizerischen Kapitalismus im Ausland, der sich entlang protestantischer Beziehungsnetze und der Ausbreitung des Sklavenhandels entfaltete, bisher nur bruchstückhafte, isolierte Informationen vorgelegt. […] Das Fehlen neuerer, systematischer Studien erklärt sich weitgehend aus der Schwierigkeit, in der Schweiz direkte Quellen über den Sklavenhandel finden […] zu können. Da die Regierungen der Schweizer Kantone an der Politik des Sklavenhandels und der Sklaverei nicht beteiligt waren, fehlen in den offiziellen Dokumenten entsprechende Hinweise. Von seltenen Ausnahmen abgesehen, befinden sich die Archivunterlagen, mit anderen Worten, noch in privaten Händen und sind damit nicht zugänglich. Um in den im Ausland aufbewahrten Archiven auf Spuren von Schweizern zu stossen, sind umfangreiche Sichtungsarbeiten erforderlich, deren Ergebnisse oft vom Zufall abhängen und angesichts der vagen, oberflächlichen Informationen oft enttäuschend sind.» (Vgl. auch Anhang)
Die Antwort der waadtländischen Regierung erinnert an die etwas knapper gehaltene Antwort des Bundesrats einige Wochen zuvor (am 16. Juni 2003) an die St.Galler Abgeordnete der Grünen, Pia Hollenstein (vgl. Anhang). Darin heisst es, dass «verschiedene Schweizer Bürger mehr oder weniger stark am transatlantischen Sklavenhandel beteiligt [waren], was der Bundesrat aus heutiger Perspektive zutiefst bedauert». Der Bundesrat erklärt sich bereit, die politisch notwendige Aufarbeitung der Vergangenheit zu unterstützen, und erinnert daran, dass «für die Aufarbeitung die üblichen Instrumente der Wissenschafts- und Forschungsförderung zur Verfügung [stehen]».
Aus den bisherigen Ausführungen folgt, dass sich der Schleier über der schweizerischen Beteiligung am Sklavenhandel erst seit kurzer Zeit langsam lüftet. Bisher hielten sich alle im Wesentlichen an die offizielle Version, es habe keine Schweizer Beteiligung am Sklavenhandel oder an der Sklaverei gegeben. Die Antworten auf neuere Interpellationen bringen drei interessante Aspekte zum Vorschein. Zwar wird die Schweizer Beteiligung an der Versklavung der Schwarzen anerkannt, doch es wird deutlich zwischen Bundesstaat und Kantonsregierungen auf der einen sowie Einzelpersonen und Privatfirmen auf der anderen Seite unterschieden. Auf der Grundlage dieser Unterscheidung wird klar die Ansicht vertreten, die offizielle Schweiz trage keine Verantwortung. Seit diese Fragen öffentlich diskutiert werden, ist deutlich geworden, wie unvollständig unsere Kenntnisse über ein historisches Thema sind, das kaum behandelt wurde, da es heikel, aber auch schwer zugänglich ist.
Die vorliegende Arbeit erhebt den Anspruch, diese Lücke zumindest teilweise zu schliessen und damit einer Frage, mit der sich bisher vor allem Politikerinnen und Journalisten befasst haben, mehr Substanz zu verleihen. Das Buch ist in drei Abschnitte gegliedert und verfolgt zwei Ziele: In einem ersten Schritt wird die Beteiligung von Schweizer Händlern, Handelshäusern und Finanzkreisen untersucht. Danach befassen wir uns mit den Beziehungen zwischen der Schweiz und dem System der Sklavenplantagen in Amerika. Zuletzt erfassen und untersuchen wir die Bewegungen und Vereine, die sich in der Schweiz für das Verbot der Sklaverei eingesetzt haben.
Zu diesen drei Arten von Bezug der Schweiz zur Sklaverei liegt eine Fachliteratur vor, die nicht nur veraltet und dürftig, sondern auch schwer zugänglich ist, da sie über Zeitschriften und Studien verstreut ist, die nur einer Hand voll lokaler Spezialisten bekannt sind. Das erste Ziel unserer Arbeit war daher, dieses verstreute Material zusammenzutragen und eine Bestandesaufnahme der Thematik vorzunehmen. Allein der Anspruch, das lückenhafte Material aufzuarbeiten, um es einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, ist bereits ein schwieriges Vorhaben. Damit wollten wir uns aber nicht begnügen. Unser zweites Ziel bestand darin, diese Unterlagen durch neue Beiträge zu vervollständigen, die im Rahmen einer im November 2003 an der Universität Lausanne organisierten wissenschaftlichen Tagung geprüft und präzisiert werden konnten. Um uns nicht mit einer reinen Bestandesaufnahme zu begnügen, die nur Unterlagen aus zweiter Hand untersucht, mussten wir archivarische Quellen erschliessen, von denen insbesondere das Bundesarchiv in Bern, die kantonalen Archive, das Wirtschaftsarchiv in Basel und die Archive der französischen Sklavereihäfen zu nennen sind.
Wie gut unser Vorhaben geglückt ist, mögen die Leserinnen und Leser beurteilen; das vorliegende Material ist jedenfalls reichhaltig: Es wird präzise gezeigt, in welcher Form Schweizer am transatlantischen Sklavenhandel beteiligt waren. Zum Ausmass dieser Beteiligung wird eine konkrete Schätzung vorgelegt. Ihre Besonderheiten werden in einer vergleichenden Darstellung herausgearbeitet. Schliesslich wird versucht, in Fallstudien zu beurteilen, inwieweit die Aktivitäten Profite einbrachten.
Zudem werden der Lebenslauf und das Schicksal der Schweizer, die auf verschiedene Weise mit den schwarzen Sklaven in Amerika und Afrika in Berührung gekommen sind, nachgezeichnet. Anhand zahlreicher Beispiele wird ihre Einstellung zu Sklavenarbeiterinnen und -arbeitern sowie zum System der Sklaverei beleuchtet. Ein einziges Mal bezieht der Bundesrat in den 60er-Jahren des 19. Jahrhunderts Stellung zum Sklavenbesitz von Schweizern, die sich in der Neuen Welt niedergelassen haben. Dieses Dokument wird interpretiert und zeitlich situiert. Inhaltlich erinnert die Stellungnahme des Bundesrates an die Meinung, die Alexis de Tocqueville 1848 aus Anlass der Abschaffung der Sklaverei durch Frankreich formuliert: «Wenn den Negern auch das Recht auf Freiheit zusteht, ist dennoch unbestritten, dass die Kolonisten das Recht haben, durch die Freiheit der Neger nicht ruiniert zu werden.» (Tocqueville 1962, S. 94) Die Forderung an die zur Sklaverei gezwungenen Schwarzen Entschädigungszahlungen zu leisten, stösst heute auf wenig Zustimmung; im Falle der um ihren Sklavenbesitz gebrachten Plantagenbesitzer wurde das dazumal als selbstverständlich angesehen.
Schliesslich können durch eine sorgfältige Untersuchung der Bewegung gegen Sklaverei und Sklavenhandel in der Schweiz deren genaue zeitliche Situierung, die Motivation ihrer Mitglieder, ihre Einbindung in ein internationales Netzwerk, die von ihnen vertretenen Werthaltungen und die politischen oder sozialen Strömungen und Ideologien, aus denen sie hervorgegangen ist, dargestellt werden.
Das Besondere an unserer Arbeit ist, dass die Gesamtheit dieser Verbindungen der Schweiz zur Versklavung der Schwarzen in den Blick genommen wird, indem Vergangenheit und Gegenwart aufeinander bezogen werden. Die Abfassung dieser Studie fiel erfreulicherweise mit dem von den Vereinten Nationen beschlossenen Internationalen Jahr zum Gedenken an den Kampf gegen die Sklaverei und an ihre Abschaffung zusammen, das unter Federführung der Unesco begangen wurde. Die Eröffnungsfeier fand in Cape Coast (Ghana) an der afrikanischen Küste, einer Drehscheibe des transatlantischen Sklavenhandels im 18. Jahrhundert, statt. An diesem Ort, der heute zum Welterbe der Unesco zählt, war von der Schwedischen Afrikagesellschaft eine Festung errichtet worden. Der erste Europäer, der sie 1652 leitete, der Basler Isaak Miville, war vermutlich als erster Schweizer am Sklavenhandel beteiligt.
Zum Schluss noch eine Bemerkung: Während der Arbeit an diesem Buch haben wir keinerlei finanzielle Unterstützung von irgendeiner öffentlichen oder privaten Stelle erhalten. Es ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von zwei Mitarbeitern und einer Mitarbeiterin des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Lausanne, die uns in ein fruchtbares, befriedigendes wissenschaftliches Abenteuer geführt hat. Möge es bei den Leserinnen und Lesern auf dasselbe Interesse stossen wie bei den Verfassern und der Verfasserin.
Folgenden Personen, die einzelne Kapitel oder das gesamte Manuskript gelesen haben, möchten wir unseren Dank aussprechen: Frédérique Beauvois, Sandra Bott, Catherine Chène, Alain Clavien, Matthieu Leimgruber, Claude Lützelschwab, Olivier Pétré-Grenouilleau, Frédéric Sardet und Laurent Tissot.
Verschiedene Textteile konnten an Konferenzen in Basel, Lausanne und Lorient vorgestellt werden. Wir danken den Teilnehmern und Teilnehmerinnen für alle Rückmeldungen, die wir bei dieser Gelegenheit erhalten haben. Unser Dank gilt schliesslich auch den Archivaren und Archivarinnen in Frankreich und der Schweiz, die uns in unserer Forschungsarbeit beratend zur Seite standen und ohne deren wertvolle Hilfe das Buch nicht hätte entstehen können.
Über die Beteiligung von Schweizern am transatlantischen Sklavenhandel
Von Anfang des 16. bis Ende des 19. Jahrhunderts werden im transatlantischen Sklavenhandel zwischen elf und zwölf Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner, vorwiegend junge Männer, nach Amerika deportiert. Das Ausmass dieses «schändlichen Handels» variiert im Verlauf der Zeit erheblich. 55 Prozent des Sklavenhandels erfolgen im 18. Jahrhundert, etwa 14 Prozent vorher und der Rest (rund 30 Prozent) im 19. Jahrhundert, das durch den illegalen Sklavenhandel und die Abolitionisten-Bewegung geprägt ist. Der Aufschwung im 18. Jahrhundert fällt mit der Einrichtung des Systems der Plantagenwirtschaft in Brasilien und der Karibik zusammen, die sich auf Sklavenarbeit stützt. Allein diese beiden Regionen absorbieren nahezu 85 Prozent aller über den Atlantik gehandelten Sklaven. Das Hauptversorgungsgebiet für den transatlantischen Sklavenhandel ist Westafrika, wo sich die wichtigsten Ausbeutungsstätten zunehmend nach Süden verlagern. Angola ist während der gesamten Zeit eines der wichtigsten Exportländer von Sklaven.
Die Schweiz ist auf dem amerikanischen Kontinent nie im Besitz von Zuckerkolonien, die als Prototyp des auf Sklaverei gestützten Plantagensystems gelten können. Sie ist keine Sklavenhändlernation wie Portugal, Spanien, Grossbritannien, Frankreich, die Niederlande, Dänemark oder die Vereinigten Staaten. Zum Zeitpunkt, als sich die Schweiz als Bundesstaat konstituiert (1848), haben alle amerikanischen Kolonien die Unabhängigkeit erlangt, und auch der Handel mit schwarzen Sklaven ist fast im gesamten Atlantikraum abgeschafft. So muss sich die Schweiz als Staat praktisch nie mit entsprechenden Fragen befassen (siehe im folgenden Kapitel den Sonderfall Brasilien).
Was sich über das Land als Ganzes sagen lässt, trifft auf einzelne seiner Bürgerinnen und Bürger allerdings nicht zu. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts besitzen Schweizer Plantagenbesitzer auf den Antillen, in Surinam und in Brasilien Sklavinnen und Sklaven und setzen diese für die Herstellung von Zucker und anderen tropischen Genussmitteln ein (siehe zweites Kapitel). Im 18. und 19. Jahrhundert beliefern Handelshäuser, namentlich aus Basel und Neuenburg, Sklavenschiffe, die von den Häfen der Atlantikküste auslaufen, mit gewerblichen Erzeugnissen. Sie begnügen sich nicht damit, in die Tauschfracht zu investieren, sondern beteiligen sich auch finanziell an Sklavenexpeditionen entlang der afrikanischen Küste. Zeitweise rüsten sie selbst Sklavenschiffe aus. Manche schrecken auch nicht davor zurück, sich illegal im Sklavenhandel zu betätigen, nachdem die europäischen Mächte diesen am Wiener Kongress (1815) formell verboten haben.
Die Beteiligung von Schweizer Händlern und Finanzleuten am System des Sklavenhandels hat einen einfachen Grund. Das Besondere an diesem Geschäft ist, dass es bedeutende Kapitalanlagen erfordert. Dass für die Ausrüstung eines Sklavenschiffs enorme Beträge aufgebracht werden müssen, hängt hauptsächlich mit der Art der afrikanischen Nachfrage zusammen. Dieser Aspekt ist wenig bekannt, weshalb er hier betont und vorweg klargestellt wird, um von Anfang an jedes Missverständnis zu vermeiden.
Die Genfer Behörden werden aufgefordert, zum Sklavenhandel (1814–1815) Stellung zu beziehen
Am 12. Dezember 1814 schlägt Abraham Trembley Colladon (1754–1821), Mitglied des Repräsentativrats und ein entfernter Cousin von Jean Trembley (vgl. S. 83), dem Staatsrat und dem Repräsentativrat vor, Stellung zur möglichen Beteiligung von Genfer Geschäftsleuten am Sklavenhandel zu beziehen.
«Ich habe mit Schmerz erfahren, dass Geschäftsleute, die sich in französischen Häfen niedergelassen haben, Genfer Händlern den Vorschlag unterbreitet haben, sich an Meeresexpeditionen zu beteiligen, die den Handel mit Negersklaven zum Ziel haben; ich glaube, dass Moral und Vorsicht unsere Händler dazu bewogen haben, diese Vorschläge zurückzuweisen; dennoch sehe ich mich veranlasst, den Staatsrat einzuladen, in seiner Weisheit zu prüfen, ob es nicht angemessen wäre, einen Beschluss zu fassen, der die Ablehnung jeglicher solchen Spekulation durch die beiden Räte zum Ausdruck brächte.
12 Xter 1814
gezeichnet Abraham Trembley»
(Register des Repräsentativrats, individuelle Voten 1814–1821, Nr. 5)
Andere Mitglieder des Repräsentativrats beziehen Stellung:
«Ein Mitglied zieht vor, dass die Regierung ein Gesetz macht, indem festgelegt ist, dass jene, die sich in einer Angelegenheit, die mit der Beteiligung am Sklavenhandel zu tun hat, an ein Gericht wenden, keinen Zugang zu einem solchen erhalten. Ein anderer will, dass die Räte sich darauf beschränken, in der Diskussion ihre Ablehnung dieser Art von Handel zu bekunden.»
(Register des Repräsentativrats, 12. Oktober 1814 bis 28. Dezember 1815, 113)
Die Antwort des Staatsrats der Stadt und Republik Genf fällt lakonisch aus: «Der Rat erachtet es als unnütz, sich um diese Vorlage zu kümmern, da er davon überzeugt ist, dass die moralische Gesinnung der Genfer diesen nicht erlaubt, sich am genannten Handel zu beteiligen.»
(Register des Repräsentativrats: Antworten auf individuelle Vorlagen 1815–1820, 18. April 1815, Nr. 5)
Entgegen einer vorgefassten Meinung ist Westafrika, von wo die meisten Afrikaner und Afrikanerinnen, die verkauft werden, herkommen, um in den amerikanischen Plantagen zur Sklavenarbeit herangezogen zu werden, kein Markt mit leichtfertigen oder naiven Konsumentinnen und Konsumenten, die bereit wären, Menschen gegen Lappalien einzutauschen. Art und Herkunft der Ladung der Sklavenschiffe belegen das Gegenteil. Die Fracht setzt sich aus einem Sortiment zusammen, in dem Textilien bei weitem dominieren, gefolgt von Metallen, Feuerwaffen, Pulver und Alkohol. Der Rest besteht aus Tabak, Kaurismuscheln (weisse Muscheln aus dem Indischen Ozean, die vor allem als Währung verwendet werden) und so genannten Guinéailleries (diverser Kram wie Spiegel, Klingeln, Glas- oder Korallenperlen). Textilien spielen bei der Ladung von Sklavenschiffen eine so wichtige Rolle, dass sie als «Grosshandelswaren» und alle anderen Artikel als «Kleinhandelswaren» bezeichnet werden.
Auf dieses Warensortiment, in dem gewerbliche Erzeugnisse deutlich überwiegen, entfallen im 18. Jahrhundert etwa zwei Drittel der Investitionen in eine Sklavenexpedition. Die Tauschfracht hat also nichts mit wertlosen Waren zu tun, die abschätzig als «Pacotille», Ramsch, bezeichnet werden. Gemäss einer 1772 verfassten Denkschrift der Handelsrichter von Nantes, die für die Kontrolle der Qualität der Erzeugnisse zuständig waren, ist es «fast unmöglich, die Neger zu täuschen, auch wenn man das wollte, da sie bekanntlich […] alle Stoffe, die man ihnen liefert, ausbreiten und eingehend prüfen», um sich ihrer Qualität und der Masse zu versichern.
Das vom afrikanischen Markt verlangte Warensortiment ist so vielfältig, dass es von keiner Sklavenhändlernation allein hergestellt werden kann. So überwiegen beispielsweise in der Kategorie der Textilien die «Indiennes» (gefärbte oder bedruckte Baumwollstoffe), die zuerst aus Ostindien eingeführt und später in verschiedenen europäischen Ländern verarbeitet werden. Die Vielzahl an Fabrikationsstätten auf dem Alten Kontinent, in denen die Tauschware hergestellt wird, bewegt einige Historikerinnen und Historiker dazu, von einer «internationalen Sklavenhandelsgesellschaft» zu sprechen. Darin sind unabhängig von der Atlantikquerung und noch vor dem eigentlichen Sklavenhandel Personen und Kapital involviert, die sich an der Herstellung der mannigfaltigen Produkte beteiligen, die von der afrikanischen Kundschaft verlangt werden.
Die seltenen älteren, auf die Auswertung öffentlicher und privater Archive gestützten Untersuchungen über die europäische Geschäftswelt des 18. Jahrhunderts belegen, dass dieser «internationalen Sklavenhandelsgesellschaft» auch Schweizer angehören. Das Faktum wird meist nur andeutungsweise erwähnt, wenn nicht ganz in Fussnoten verbannt. Ein so unklarer Umgang mit dem Thema lässt sich schwer nachvollziehen.
Sind die Historiker und Historikerinnen einfach nur zurückhaltend? Sind sie verunsichert, sobald die Rede auf den Sklavenhandel kommt? Oder geht es schlicht darum, die Ausrüstung von Sklavenschiffen durch Schweizer auf die Bedeutung zu reduzieren, die ihr im Rahmen der ausgesprochen vielfältigen Handels-, Industrie- und Finanzgeschäfte damaliger Unternehmer tatsächlich zukommt? Gibt es Probleme mit den Quellen? Serge Daget, der profundeste Kenner des französischen Sklavenhandels, hat vor rund 15 Jahren darauf hingewiesen, dass einerseits die öffentlichen Archive nicht «die gesamte Wahrheit» enthalten und andererseits die Besitzer von Privatarchiven, die Auskunft über den Sklavenhandel geben könnten, diese Informationen üblicherweise in einer «kleinen Schatulle», in der sie ihre Familiendokumente aufbewahren, ablegen, wo sie zum Schweigen verurteilt sind.
In der Schweiz werden diese «Schatullen» wie im übrigen Europa meist unter Verschluss gehalten – mit oft unbeabsichtigten Folgen, denn dies leistet Gerüchten und Verdächtigungen Vorschub, die umso hartnäckiger sind, als das, was verborgen gehalten wird, üblicherweise als unlauter gilt.
Nicht alle Türen und «Schatullen» sind verschlossen geblieben. Allerdings hängt es nicht immer vom Bemühen um Transparenz ab, ob sie sich öffnen. Der einzige heute in der Schweiz verfügbare Manuskriptbestand, der ausführlich über die Sklavenhandelsgeschäfte eines schweizerischen Unternehmens Auskunft gibt, ist jener der Firma Burckhardt. Dieses Basler Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Indiennes spezialisiert hat, gründet 1790 in Nantes ein Tochterunternehmen, die Bourcard Fils&Cie., um vom führenden französischen Sklavenhafen aus unter anderem mit bedruckten Stoffen aus der eigenen Produktion den afrikanischen Markt zu beliefern. Christoph Burckhardt, Begründer der Niederlassung, der seinen Namen in Nantes französisiert, stirbt am 20. Oktober 1815. Seine Mutter Dorothée Merian ist Alleinerbin. Sie schickt ihren Sohn Leonhard Burckhardt nach Nantes, wo dieser seine Vollmachten an lokale Mittelsmänner überträgt, um die Hinterlassenschaft des verstorbenen Christophe Bourcard zu erfassen und zu verwalten und das Geschäft in Nantes aufzulösen. Nach Verschwinden der Filiale im Jahr 1815 werden die Archive aus Nantes nach Basel verlegt. Sie werden 1935 während des Abrisses des Segerhofs, wo sich im 18. Jahrhundert der Firmensitz befunden hat, zwischen zwei niedergerissenen Mauern entdeckt. Heute kann dieser Bestand im Basler Wirtschaftsarchiv eingesehen werden.
Typologie der am Sklavenhandel beteiligten Schweizer
Die Mauer des Schweigens zu durchbrechen, wäre eine reizvolle Aufgabe. Angesichts der Dürftigkeit der schweizerischen Geschichtsschreibung zu diesem Thema muss der erste Schritt aber darin bestehen, eine Bestandesaufnahme zu machen, die verstreut vorliegenden Informationen zusammenzutragen, sie zu gewichten und richtig einzuordnen. Das wird hier teilweise mittels einer Kurztypologie versucht, die drei Gruppen unterscheidet. Die erste umfasst Fabrikanten und Händler, die von der Schweiz aus Waren liefern, die gegen Sklavinnen und Sklaven eingetauscht werden. Zur zweiten Gruppe gehören Indienne-Fabrikanten schweizerischer Herkunft, die ausgewandert sind, um ihren Beruf in der Nähe der Absatzmärkte auszuüben. Handels- und Finanzleute, die ihre zahlreichen Geschäfte um ein weiteres, den Sklavenhandel, bereichern, bilden die dritte Gruppe.
Bevor auf jede dieser Gruppen eingegangen wird, erfolgt ein kurzer Abriss über die Indienne-Manufakturen. Die ersten Versuche der Herstellung dieser bedruckten Baumwollstoffe auf dem Alten Kontinent gehen auf die 70er-Jahre des 17. Jahrhunderts zurück. Sie stossen auf erbitterten Widerstand. In Frankreich wird die Indiennerie, die von Anfang an eng mit den Hugenotten verbunden ist, im Oktober 1686, genau ein Jahr nach Widerrufung des Edikts von Nantes, das Zehntausende Protestanten ins Exil treibt, verboten. Der Erlass, der aus Indien kommende oder im Königreich nachgeahmte farbige Baumwollstoffe verbietet, soll vor allem die traditionelle Textilindustrie, die durch die Konkurrenz der Baumwollgewebe bedroht ist, schützen.
Seither beruht der Aufschwung der Baumwollindustrie in Europa grösstenteils auf den protestantischen Emigranten in Holland, vor allem aber in Deutschland und der Schweiz, wo sich die Indienne-Herstellung über Genf, Neuenburg und Basel nach Solothurn ausbreitet, bevor sie Bern, den Aargau, Zürich und Glarus erreicht. In diesen «kleinen Indienne-Ländern» erlebt die Indienne-Industrie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen Aufschwung, der sich auf die Hugenottenflüchtlinge stützt, die in den Genuss einer liberalen Einbürgerungspolitik kommen. Hier erhält die Indiennage ihren technischen Schliff und erobert den Handel. Den wichtigsten Absatz finden die Indiennes im Mittelmeerraum und in Frankreich, wohin die gefärbten Stoffe über Schleichwege gelangen. Rund zwei Drittel des weissen Tuchs, das der Indienne-Industrie als Rohstoff dient, kommen aus Indien, der wichtigsten Bezugsquelle. Darin liegt die Bedeutung des Überseehandels, den Louis Dermigny als «natürliche Komponente der Indienne-Manufakturen» bezeichnet.
Es erstaunt daher kaum, dass sich die Kaufleute der «kleinen Indienne-Länder» für die Ausrüstung von Schiffen interessieren, die nach Indien fahren, oder dass sie an den Verkäufen von Handelsgesellschaften in Lorient, London oder Amsterdam teilnehmen. Zwischen der Indienne-Industrie und den Hugenotten einerseits sowie den protestantischen Indienne-Fabrikanten und Indien andererseits besteht also ein zweifacher enger Zusammenhang.
Kehren wir zurück zu unserer Typologie und zur Gruppe Fabrikanten/Händler, die von der Schweiz aus für den Sklavenhandel bestimmte Tauschwaren liefern. Ein Teil der schweizerischen Indienne-Produktion dient im 18. Jahrhundert der Zusammensetzung der Handelsfracht, die für den Eintausch gegen Sklavinnen und Sklaven bestimmt ist. Die Tatsache ist unumstritten, auch wenn sich der genaue Anteil unmöglich feststellen lässt und es nur wenige Anhaltspunkte gibt, die den Verwendungszweck beweisen. Konkret findet sich verstreut über die Fachliteratur etwa ein halbes Dutzend durchwegs überzeugender Hinweise.
Den ersten Anhaltspunkt liefert eine Ausnahmeverfügung, um das seit 1686 geltende Verbot der Einfuhr von gefärbten Tüchern nach Frankreich zu umgehen. Den Händlern in Nantes und Lorient wird 1720 von der französischen Regierung das Privileg eingeräumt, gefärbte Tücher aus England, Holland und der Schweiz, die für den Sklaven- und Kolonialhandel bestimmt sind, zwischenzulagern.
Den zweiten Anhaltspunkt liefert eine ausgesprochen detaillierte und genaue Ausstattungsliste von Baron de Binder, der 1789 von La Rochelle aus zu einer Sklavenexpedition aufbricht. Das Besondere an dieser Expedition ist, dass das Schiff eine bislang unübertroffene Menge an Tauschfracht mitführt und für die Kategorie «Grosshandelswaren» Indiennes aus der Schweiz auflistet. Zudem ist einer Akte im Basler Wirtschaftsarchiv zu entnehmen, dass die Zweigniederlassung des Hauses Burckhardt in Nantes dem Sklavenschiff La Bonne-Mère (Abfahrt in Nantes 1815, 203-Tonner, ausgestattet von Sallentin und Van Neunen, Zahl der eingehandelten Sklaven unbekannt) in der Schweiz hergestellte Indienne-Stoffe liefert.
Für den Tauschhandel bestimmter Indienne-Stoff, Ende 18.Jahrhundert. Die in Nantes niedergelassenen Schweizer Fabrikanten spezialisieren sich auf die Ansprüche der afrikanischen Kundschaft. Die Farben und Motive sind vollständig auf deren Geschmack ausgerichtet. (Stoffdruckmuseum, Mulhouse)
Der dritte Anhaltspunkt findet sich in den Archiven der Firma Burckhardt in Basel, die für den Sklavenhandel bestimmte Stoffe exportiert und im Gegenzug dafür Anteile für die Ausrüstung von Schiffen erhält. Das geschieht mindestens zwei Mal, nämlich im Fall der Véronique und im Fall der Georges, zweier Sklavenschiffe, die 1787 und 1789 von Nantes auslaufen und von den schweizerischen Protestanten Roques, Riedy&Thurninger ausgerüstet werden (vgl. Tabelle 1 und 2). Die Firma wiederholt die Operation offenbar 1789 und 1815 mit der Necker und der Petite Louise, die ebenfalls von Nantes auslaufen, und mit der Conquérant, die 1791 von Le Havre aus in See sticht (Tabelle 3).
Der vierte Anhaltspunkt findet sich in einem Museum in Honfleur, einem gegenüber Le Havre liegenden Hafen, der zwischen 1743 und 1792 in den Sklavenhandel einsteigt. Das Museum des alten Honfleur besitzt eine Sammlung von 400 Stoffmustern (Leinen, Hanfgarn, Baumwolle, Indienne), die im Sklavenhandel als Tauschware dienen. 133 der 400 Muster sind Indiennes mit Herkunft aus Lenzburg (Kanton Aargau). Die vollständige Sammlung dieser gefärbten Stoffmuster wird 1788 vom Sklavenschiff La Seine in die Handelskontore der afrikanischen Küste gebracht.
Der fünfte Anhaltspunkt findet sich im Journal du Havre, in dem Anzeigen erscheinen, die sich an die Händler richten, die Schiffe für Guinea, Angola und die Goldküste ausrüsten. In den Inseraten werden Handelswaren angepriesen, die nach Ankunft im Normandie-Hafen zwischengelagert werden. Eine dieser Anzeigen, datiert auf März bis Juli 1789, bietet «für den Sklavenhandel blaue Guinée- und Schweizer Indienne-Stoffe aus dem Lager» an (zitiert in Dardel 1963, S. 140–143).
Der sechste Anhaltspunkt ist aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als sich mehrere Schweizer Firmen aus Zürich, Winterthur, Bern und Genf in Bordeaux niederlassen, um im Wesentlichen Kommissionsgeschäfte für fremde Rechnung zu tätigen. Sie versorgen die Schweiz mit Kolonialwaren (Indigo, Zucker, Kaffee) und liefern den Reedern in Bordeaux gefärbte Stoffe schweizerischer Erzeugung, die für den Kolonial- und Sklavenhandel benötigt werden. Die aus der Deutschschweiz kommende Firma Hegner, Gier&Cie., die sich in den 60er-Jahren des 18. Jahrhunderts in Bordeaux niedergelassen hat, steht im Zentrum eines Netzwerks, das auch mit diesen beiden Produktarten handelt. Sie vertreibt insbesondere in der Schweiz den Indigo-Farbstoff, der in der Textilindustrie zur Färbung von Stoffen eingesetzt wird, die in Aarau, Zofingen, Zürich und Winterthur hergestellt und in den grossen europäischen Hochseehäfen abgesetzt werden (Butel 1973, S. 358, 368 und 605).
Der letzte, besonders viel sagende Anhaltspunkt ist die Verlagerung eines Teils der schweizerischen Indienne-Manufakturen nach Frankreich nach 1759. Sie zieht die Gründung von Firmen nach sich, die der zweiten Gruppe unserer Typologie zugerechnet werden können. Auch in diesem Fall drängt sich ein kleiner geschichtlicher Exkurs auf.
Zwei in Frankreich 1759 und 1785 getroffene Entscheidungen bewegen schweizerische Indienne-Fabrikanten dazu, ihre Tätigkeit in die Nähe der bevorzugten Märkte und Bezugsquellen zu verlagern. Die hugenottischen Pioniere der Indiennerie aus Genf, Neuenburg und Basel lassen sich wieder in Frankreich nieder, nachdem 1759 das Verbot der Herstellung und des Imports von bedruckten Stoffen aufgehoben wird. Durch Zusammenlegung ihrer Handelsunternehmen und -netze bilden sie grenzüberschreitende Kartelle.
Die Auslagerungen halten auch an, als im Jahr 1785 die 1759 gewährte Einfuhrgenehmigung für bedruckte Stoffe widerrufen wird. Das Einfuhrverbot für gefärbte und bedruckte Stoffe ausländischer Herkunft erfolgt zu einem Zeitpunkt, als in der Schweiz die Herstellung von Indiennes ihren Höhepunkt erreicht. Die Massnahme von 1785 trifft Neuenburg, das mehr als die Hälfte der Indienne-Produktion in Frankreich absetzt, besonders hart.
In diesem Zusammenhang gründen Neuenburger und Basler Bürger ab den 60er-Jahren des 18. Jahrhunderts in Nantes bedeutende Indienne-Manufakturen. Dieser Entscheid ist bezeichnend. Nantes ist der führende Sklavereihafen Frankreichs, der im 18. Jahrhundert 18 Prozent des transatlantischen Handels abdeckt, verglichen mit Grossbritannien und Portugal, die 40 bzw. 31 Prozent bestreiten. Nach Nantes kehrt die Hälfte der 3709 Sklavenexpeditionen zurück, die während der gesamten Phase des transatlantischen Sklavenhandels von Frankreich aus in See stechen. Zu erwähnen ist, dass Nantes seine Stellung der Tatsache verdankt, dass in diesem Hafen die Ausrüstung von Sklavenschiffen und die aus Indien einlaufenden, mehrheitlich mit Textilien beladenen Schiffe aufeinander treffen. Aus diesem Grund ist neben Nantes auch Lorient zu nennen, wo sich ab 1733 die französische Indien-Gesellschaft niederlässt und ihren Handel betreibt.
Firmenembleme der verschiedenen Schweizer Manufakturen in Nantes (Petitpierre, Favre, Gorgerat). Diese Fabrikzeichen werden auf die Webkante der Stoffstücke gedruckt. Die Kennzeichnung ist eine Art von «Label», das für die Qualität bürgt. (B. Roy, Nantes, une capitale de lʼindiennage)
Die ersten Schweizer, die in Nantes Indienne-Manufakturen zum Bedrucken von Stoffen gründen, die für den Eintausch gegen Sklaven bestimmt sind, stammen offenbar aus Neuenburg; es sind dies die Familien Gorgerat (aus Boudry) sowie Petitpierre und Favre (aus Couvet). Ihnen folgt bald der Basler Hans-Ulrich Pelloutier, der Ende der 60er-Jahre des 18. Jahrhunderts eine Manufaktur gründet. Ihm schliessen sich nach und nach André-Gottlieb Kuster, Benoît Bourcard, Henry Roques und Augustin Simon, der Sohn eines Plantagenbesitzers auf Saint-Domingue und vermutlich ein Schwager von Pelloutier, an. Zu den Neuenburgern und Baslern kommen die in Bern bzw. Biel geborenen Brüder Abraham und Samuel Rother. Die Indienne-Fabrikanten holen sich unter anderem Unterstützung von Arbeiterinnen und Arbeitern sowie Technikern aus Neuenburg, Boudry, Fleurier, Biel, Morges und Lausanne. Nach Ansicht eines Lokalberichterstatters sind die Schweizer in Nantes so zahlreich, dass sie einen eigenen Kanton am rechten Loire-Ufer bilden könnten. Das Gewicht der Neuenburger Gruppe belegt, welch bedeutende Rolle der französische Markt für die Druckstoffindustrie des Fürstentums Neuenburg spielt.
In den 80er-Jahren des 18. Jahrhunderts werden 80 bis 90 Prozent der in Nantes hergestellten Indienne-Stoffe von Fabrikanten schweizerischer Herkunft erzeugt, der Hauptabsatzmarkt liegt in Afrika. Wofür die in Nantes hergestellten Indiennes bestimmt waren, ist völlig unbestritten. Die Handelsstatistiken des französischen Sklavereihafens zeigen, dass Westafrika als wichtigster Bestimmungsort für die Indiennes eindeutig überwiegt. Die Firma Favre, Petitpierre&Cie., ein Zusammenschluss zweier bedeutender Schweizer Indienne-Drucker in Nantes, produziert fast ausschliesslich für die Sklavenschiffe. Sie veröffentlicht regelmässig Anzeigen in der Lokalpresse, um ihre «für den Eintausch von Sklaven bestimmten Waren» anzupreisen. Eine ihrer Reklamen erscheint am 3. Januar 1815 im Feuille commerciale et judiciaire de Nantes: «Die Firma Favre, Petitpierre&Cie. […] macht die Ausrüster von Sklaven- und Kolonialschiffen darauf aufmerksam, dass sie in ihren auf Hochtouren arbeitenden Werkstätten alle für den Tauschhandel mit Schwarzen benötigten Waren wie Indiennes, Liménéas und Taschentücher herstellt und liefert …»
In den 80er-Jahren des 18. Jahrhunderts zählen die Fabriken in Nantes bis zu 5000 Arbeiterinnen und Arbeiter und kommen damit auf nahezu gleich viel Beschäftigte wie die rund 30 Indienne-Druckereien in Genf, Neuenburg und Basel, die 1790 rund 5560 Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigen. Petitpierre&Cie., die grösste Indienne-Manufaktur in Nantes, stellt um 1785 rund 25000 Stück jährlich her, Pelloutier, Kuster&Bourcard rund 20000, die Gebrüder Gorgerat bedrucken 15000 und die Gebrüder Rother 6000 Stück. Im Vergleich dazu liegt die Jahresproduktion in den Indienne-Manufakturen in Basel, Neuenburg und Genf bei durchschnittlich 14000 Stück. Diese Produktionszahlen sind nur grobe Schätzungen. Zudem sind sie nicht direkt vergleichbar, da die Länge der im Stück gelieferten Indiennes zwischen elf und 15 Ellen schwankt. Eine Elle entspricht 1,18 bis 1,20 Meter. In Nantes, in der Schweiz und im restlichen Europa herrschen in dieser Branche ausgesprochen harte Arbeitsbedingungen. Angesichts der Gesundheitsbelastung, der fehlenden Hygiene und eines 16-stündigen Arbeitstags ohne Pause, für den ein Elendslohn bezahlt wird, liegt die Lebenserwartung der Arbeiterinnen und Arbeiter im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts bei höchstens 30 Jahren.
Manche der Schweizer Indienne-Fabrikanten mit Sitz in Nantes lassen es sich nicht nehmen, zeitweise von der Stoffherstellung auf den Sklavenhandel umzusteigen. Das gilt für H. Roques, den Geschäftspartner von A. Simon, und für Pelloutier, Petitpierre&Favre sowie Benoît Bourcard (vgl. Tabelle 1). Pelloutier beteiligt sich an den Expeditionen der Comte de Tréville und der Necker