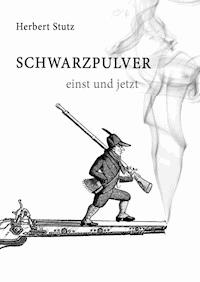
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Schwarzpulver hat in unseren modernen Zeiten unverändert seine Faszination als ein reiches Experimentier- und Studienobjekt beibehalten. Das vorliegende Buch charakterisiert und vergleicht die Leistungen historischer mit modernen Pulvern und öffnet einen Weg zur Charakterisierung früher Feuerwaffen. Der Autor spannt den Bogen von den Anfängen bis zum modernen Scheibenschießen mit Vorderladern, gibt eine Übersicht über moderne Produkte, diskutiert ballistische Besonderheiten und präsentiert Anregungen zur Auswahl von geeigneten Geschossen für Vorderlader.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1) Einführung
2) Zusammensetzung und Eigenschaften von Schwarzpulver
3) Abbrandverhalten von Schwarzpulver
3.1) Entzündungsverhalten von Schwarzpulver
3.2) Druckabhängigkeit des Abbrandverhaltens
3.3) Einfluss von Feuchtigkeit auf das Abbrandverhalten
4) Charakteristik von kommerziellen Schwarzpulvern
4.1) Schweizer Schwarzpulver
4.1.1) Ladungsverhältnis und Anfangsgeschwindigkeit
4.1.2) Einfluss der Lauflänge auf die Anfangsgeschwindigkeit
4.2) WANO PP und DN Jagdschwarzpulver Nr. 1
4.2.1) Einfluss der Pulverkörnung
4.3) Curtis & Harvey
4.4) DuPont
4.5) Gearhart-Owen
4.6.) Schwarzpulver-Ersatzprodukte
5) Vergleich der Leistungen von historischen und neuen Pulvern
6) Schwarzpulverballistik
6.1) Bedeutung der Pulverkonstanten C1 und a
6.2) Theoretische Leistungsgrenzen
6.3) Welches ist das beste Pulver?
6.4) Einfluss des Geschossgewichts auf Anfangsgeschwindigkeit und Wirkungsgrad
6.5. Ladedichte und Pulververdichtung beim Laden
6.6) Treibladung und Gasdruck
6.7) Einfluss der Korngröße auf Gasdruck und Druckverlauf
6.8) Zulässige Ladungs- und Geschosstoleranzen
6.9) Einfluss der Geschosskalibrierung
6.10) "Hohlladungen"
6.11) Treffpunktverlagerung beim Verkanten
7) Gedanken zur Auswahl von Geschossen für Vorderlader
7.1) Auswahl des Geschosstyps
7.2) Rotationsfrequenz und Geschossstabilität
7.3) Ballistische Koeffizienten von Geschossen
8) Atmosphärische Einflüsse
8.1) Windeinflüsse
8.2) Mirage
9) Geschossfette für Vorderlader
10) Schießen mit Steinschlosswaffen
10.1) Zeitlicher Ablauf von Steinschlossen
10.2) Einfluss des Steins: Flint oder Achat ?
10.3) Korngröße des Pfannenpulvers
10.4) Teilschritte der Schlosszeiten
10.5) Möglichkeiten zur Optimierung der Zündung
10.6) Einfluss der Zündlochgröße
11) Literatur
Vorwort
Die Beschäftigung mit Schwarzpulver erscheint im ersten Moment als ein archaischer Zeitvertreib mit einem Medium aus längst vergangenen Zeiten. Mit dem Aufkommen des Vorderladerschießens änderte sich dies jedoch gründlich, da sich schnell zeigte, dass alles dazu vorhandene Wissen unserer Ahnen längst verlorengegangen ist und die Erfahrungen mit modernen Systemen auf die alten nicht übertragbar sind. Dies gilt besonders dann, wenn man sich bemüht, alte originale Exemplare wieder zum Leben zu erwecken. Versucht man dann aber etwas zu systematisieren, dann stößt man schnell an Grenzen und muss herausfinden, wie und warum die Alten dieses oder jenes gerade so und nicht anders gemacht haben.
Dieses Vorhaben verwandelt sich dann schnell in einen faszinierenden Rundgang aus Historie, Physik, Chemie, Ballistik, Technik und Experimentieren. Gelegentliche Hinweise auf Versuche sollte der Leser nicht als Anregung interpretieren, sie nachzumachen, der Autor hat ein Chemiestudium absolviert und darf dies deshalb tun. Zu Dank verpflichtet bin ich den Herren Koschnick, Rehmann und Schanno für ihre Geduld und freundliche Unterstützung sowie meinem Sohn für seine tatkräftige Hilfe bei der Vorbereitung des Manuskripts.
Möge der Leser beim Studium ähnlich viel Spaß haben wie der Autor beim Experimentieren und Schreiben.
Karlsruhe, im November 2015
Dr. Herbert Stutz
1. Einführung
Schwarzpulver ist auch in modernen Zeiten ein reizvolles Thema sowohl unter technischen als auch kulturhistorischen Aspekten. Seine Anfänge verlieren sich im Dunkel der Geschichte. So weit es sich nachvollziehen lässt, entstand es im asiatischen Raum, vermutlich in China oder Indien und verbreitete sich von da aus über den arabischen Raum bis nach Europa.
Seine Einstufung schwankte zwangsläufig je nach Zeit und Standpunkt zwischen Gottesgnade und Teufelswerk, immerhin wurde und blieb es für fast ein Jahrtausend zum alleinigen Treibmittel für Feuerwerke aller Art. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass dies nicht nur für kriegerische Zwecke gebraucht wurde, unsere Vorfahren hatten sich über die Jagd damit auch ernährt. Überwiegend vegetarische Ernährungsweisen ergaben sich damals eher zwangsläufig und unfreiwillig.
Mit dem Aufkommen der modernen Chemie und den Nitropulvern wurde es obsolet und fristete ein Nischendasein für spezielle Anwendungen, bis in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts im Zuge der Nostalgiewelle ausgehend von Amerika auch das Schießen mit Vorderladern wiederbelebt wurde. Dabei zeigte sich dann schnell, dass das gesamte Wissen unserer Vorfahren dazu inzwischen weitgehend verlorengegangen war.
2. Zusammensetzung und Eigenschaften von Schwarzpulver
Das heute käufliche Schwarzpulver weist die klassische Zusammensetzung von 75% Salpeter (KNO3), 15% Kohle und 10% Schwefel auf. Zur Schwarzpulverzeit variierten die Zusammensetzungen etwas je nach Verwendungszweck und Zeit. So war z.B. in Österreich (1) die Mischung für Scheibenpulver 80,5/15,5/10, für Gewehrpulver 78,5/14,5/10 sowie für Musketen- und Geschützpulver 76,5/13,5/12,5. In Preußen waren bis zur friderizianischen Zeit die Zusammensetzungen für Musketenpulver 73,6/16,2/10,2, für besonders gutes (extraordinäres) Pulver 78/12,3/9,7 sowie für Pirschpulver 81/12,7/6,3, wobei für Pirschpulver auch der reinere Importsalpeter verwendet wurde. Nach den Befreiungskriegen wurde die Zusammensetzung mit 75/13,5/11,5 angegeben, ab 1831 änderte man dies auf 74/16/10 (2-7).
Der Salpeter ist in diesem Gemisch der Sauerstofflieferant, er hat einen Schmelzpunkt von 334°C und ist nicht hygroskopisch. Die dem Schwarzpulver nachgesagte Feuchtigkeitsempfindlichkeit hat eher historische Gründe, sie war auf Verunreinigungen mit Ca- oder Na-Nitrat zurückzuführen, die beide sehr hygroskopisch sind und in früheren Zeiten herstellungsbedingt als Verunreinigung vorhanden waren (8). Ca-Nitrat stammte dabei aus dem Grubensalpeter (Gewinnung von Salpeter aus Jauche in Erdgruben), das Na-Nitrat aus dem Chilesalpeter. Beide wurden zu Kalium-Nitrat umgewandelt, dabei konnten die Verunreinigungen mitgeschleppt werden. Heute ist dies kein Problem mehr.
Die Kohle ist der Energielieferant, sie wird bei der Umsetzung im wesentlichen zu Kohlenmonoxid (~5%) und Kohlendioxid verbrannt. Sie bestimmt die Qualität des damit hergestellten Pulvers (9, 10). Gewöhnliche Holzkohle, wie sie zum Grillen verwendet wird, ist dafür nicht geeignet. Man erhält damit zwar ein Pulver, das Lärm und Rauch macht, aber keine konstante Leistung liefert (vor allem, weil Hobbypulverfabrikanten das Gemisch nicht im nötigen Maß verdichten können und bei diesen Arbeiten in der Küche Ärger mit den dortigen höheren Autoritäten bekommen).
Für Schwarzpulver benötigt man speziell hergestellte Kohlen, im allgemeinen aus Weichhölzern (wegen derer lockeren Zellstruktur und gleichmäßigen Zellwänden) wie Faulbaum, Weißerle, Weide, Hasel und ähnliche, die in speziellen Öfen (Retorten) unter Luftabschluss bei niedrigen Temperaturen, etwa um 270-350°C, hergestellt werden. Die Temperatur muss dabei sehr sorgfältig kontrolliert werden, da der Kohlenstoffgehalt und die Verbrennungseigenschaften sehr empfindlich von der Verkokungstemperatur abhängen.
Bei niedrigen Temperaturen erhält man die sog. Rotkohle mit einem Kohlenstoffgehalt von 60-70%, sie ist sehr porös und verbrennt deshalb sehr schnell. Bei der Verbrennung liefert sie einen höheren Anteil an Wasserdampf, sie wurde deshalb für das sog. Nassbrandpulver eingesetzt. Dadurch wurden die Pulverrückstände weich gehalten. Sie sieht etwas rötlich-bräunlich aus, das daraus hergestellte Pulver wurde deshalb in Österreich auch als Braunpulver bezeichnet. Nach (11) wies eine typische Pulverkohle einen C-Gehalt von 68,4% auf, demnach dürfte es damals bei sehr niedrigen Temperaturen, etwa um 250°C, hergestellt worden sein (12).
Nach einer anderen Quelle (13) soll Nassbrandpulver mit einem höheren Schwefelanteil hergestellt worden sein. Das bei der Verbrennung mit entstehende Kaliumsulfid (∼5%) ist sehr hygroskopisch, zieht aus der Luft schnell Feuchtigkeit an und soll so die Pulverrückstände weichhalten. Bei höheren Temperaturen erhält man die sog. Schwarzkohle mit Kohlenstoffgehalten um 75-82%, die besten Pulverqualitäten erhält man mit Kohlenstoffgehalten um 78-80%. Nassbrandpulver werden heute nicht mehr hergestellt.
In Preußen wurde für Militärpulver Haselholzkohle, für Pirschpulver Faulbaumholzkohle (preußisch: Schießbeere) verwendet, in Österreich solche aus Weißerle, für Scheibenpulver ebenfalls Faulbaum- oder Hundsbeerkohle. Schweizer Schwarzpulver wird ebenfalls aus Faulbaumkohle hergestellt, Böllerpulver aus Erlenkohle (14), WANO-Pulver aus Erlenholzkohle.
Der Schwefel bildet gelbliche, hornartige Kristalle, die bereits bei 113°C schmelzen. Er dient in der Mischung einmal dazu, als Klebstoff die Kohle und den Salpeter miteinander zu verbinden, damit das Pulver nicht auseinanderfällt. Bei der Herstellung und Trocknung des Pulvers treten Temperaturen auf, die ausreichen, den zerkleinerten Schwefel zu erweichen und alles miteinander zu verbinden. Seine Hauptaufgabe ist jedoch, die Entflammbarkeit zu verbessern.
Schwefelfreies Pulver kann man zwar prinzipiell herstellen, dessen Entzündungsverhalten ist aber sehr schlecht, so dass man bei Steinschlosswaffen ständig Fehlzündungen erhält (12). In früheren Untersuchungen (15, 16) wurde es als für das (Steinschloss)Gewehr untauglich, für Kanonen aber als brauchbar befunden, wobei dessen Leistung dann stark ladungsabhängig war. So brachte es im Probiermörser etwa 60%, im grossen 9"-Mörser aber bereits 75% der Leistung des normalen Pulvers.
Bei der Pulverherstellung werden die Komponenten zunächst vorgemahlen, vermischt und in sog. Kollergängen (Mühlen) gemahlen und auf eine Dichte von etwa 1,5 g/cm3 vorverdichtet. Da diese Masse dann noch eine sehr inhomogene Verdichtung aufweist, wird sie anschließend wieder mehlfein zerkleinert und in hydraulischen Pressen auf ihre endgültige Dichte gepresst.
Die Dichte liegt dann um etwa 1,75 g/cm3, sie ist neben der Qualität der Kohle für die Leistung entscheidend. Nach Greener (17) bewirkt eine Schwankung der Dichte um 0,05 g/cm3 eine v0-Änderung um etwa 15 m/sec. Solche Dichteunterschiede dürften (neben der verwendeten Kohle) auch die wesentlichsten Ursachen für die bekannten Qualitätsunterschiede der diversen Hersteller sein.
Von Schweizer Pulver und WANO PP wurden die Schüttgewichte (Raumgewichte einer losen Schüttung nach Klopfen) ermittelt. Bei PP beträgt das Schüttgewicht 1,02 g/cm3, CH1 und CH2 weisen mit 1,08 g/cm3 beide identische Schüttgewichte auf. Demnach sind vom Volumen einer Pulversäule im Lauf etwa 60% vom Pulver ausgefüllt, der Rest ist Luft.
Zur Beziehung zwischen Zusammensetzung und Leistung gibt es eine Untersuchung von Bretscher (12), bei der mittels Geschwindigkeitsmessungen an Eigenlaboraten die Leistung des Pulvers als Geschossenergie pro Gramm Pulver charakterisiert wurde (Enfield .58, Pflasterkugel 17,3 g, 2,0 g Pulver). Die Ergebnisse sind in der Abb. 2.1. wiedergegeben. Zur besseren Darstellung wurden die Mengen jeweils auf 100 Teile Salpeter umgerechnet.
Abb. 2.1. Zusammensetzung und Leistung von Schwarzpulver
Aus der Abb. 2.1. wird deutlich, dass es einen Plateaubereich etwa zwischen 10 und 27 Teilen Kohle (entsprechend ∼10-20%) sowie von 3-12 Teilen (∼3-10%) Schwefel gibt, in dem sich die Pulverleistung nur wenig ändert. Dies erklärt die Vielfalt der beschriebenen Rezepturen im Lauf der Zeit.
Von den im Handel befindlichen Pulvern sind nach DWJ- und Firmenangaben folgende Korngrößen bekannt:
CH1
0,25-0,5
mm
10-15000
Körner /g
CH2
0,5-0,8
mm
3000-4000
CH3
0,65-1,2
mm
1000-2000
CH4
0,85-1,2
mm
700-900
CH5
1,2-1,6
mm
470-520
Zündpulver
0,19-0,224
mm
Böllerpulver CH5B
1,0-2,2
mm
Artilleriepulver CH5A
1,3-1,6
mm
Sprengpulver CH6/10
2,65-7,6
mm
Sprengpulver CH6/7
1,6-5,5
mm
Elephant Fg
1,19-1,68
mm
Elephant FFg
0,59-1,19
mm
Elephant FFFg
0,297-0,84
mm
Elephant FFFFg
0,149-0,42
mm
WANO Fg
1,18-1,7
mm
WANO FFg
0,6-1,18
mm
WANO FFFg
0,3-0,85
mm
WANO FFFFg
0,15-0,425
mm
WANO P
0,93-1,04
mm
WANO PP
0,7-0,93
mm
WANO PPP
0,44-0,70
mm
DN Jagdschwarzpulver 00
0,1-0,4
mm
DN Jagdschwarzpulver 0
0,2-0,6
mm
DN Jagdschwarzpulver 1
0,6-1,2
mm
Musketenpulver
0,2-1
mm
Böllerpulver
0,2-2
mm
Pfannenpulver
0,15-0,35
mm
Böllerpulver von Dynamit Nobel besteht aus 70% Kaliumsalpeter, 18% Kohle und 12% Schwefel, es weist eine Dichte von 1,45-1,55 g/cm3 auf.
Österreichisches Gewehrpulver M81 bestand aus Weißerlenholzkohle, es wies eine Dichte von 1,50 g/cm3 und eine Körnung von 0,57-1,5 mm auf.
Das preußische Gewehrpulver M/71 wies eine Zusammensetzung von 76/15/9 Salpeter/Kohle/Schwefel auf. Es hatte eine höhere Dichte und gleichmäßigere Kornform als die früheren Pulver, die unbefriedigende ballistische Eigenschaften ergaben.
Von Jagdschwarzpulver Nr. 1 von Dynamit Nobel sind folgende Spezifikationen bekannt:
Zusammensetzung
75/15/10
Dichte
1,72 g/cm3
Korngröße
0,6-1,2 mm
Feuchtigkeit
0,4 %
Abbrandgeschwindigkeit in offener Rinne
85 cm/sec
Beschußprobe Eprouvette 10 kg
74 cm
(Dies ist eine Pulverprüfung, bei der ein kleiner Probiermörser durch ein aufgelegtes Gewicht verschlossen wird. Das Gewicht wird durch eine gezündete Pulverladung hochgeschossen und die Höhe gemessen. Die Steighöhe ist ein Maß für die Pulverkraft)
Schwarzpulver ist schlagempfindlich. Die Schlagempfindlichkeit ist jedoch bedeutend geringer als die von Nitropulver. So benötigt Schwarzpulver mit einem Fallgewicht von 2 kg zur Zündung eine Fallhöhe von 60-70 cm, Nitropulver zündet dagegen bereits ab ca. 20-30 cm Fallhöhe. Die Schlagempfindlichkeit nimmt mit abnehmender Korngröße und bei Zusätzen von Fremdstoffen wie Sand oder Salzen zu.
Im Gegensatz zu Angaben mancher neuerer amerikanischer Bücher ist Schwarzpulver jedoch nicht reibempfindlich (18, 19). Reibversuche zwischen Stahlplatten (die nicht miteinander in Kontakt waren) und Lasten bis 500 kg ergaben keine Zündung, auch nicht in Gegenwart von Sand. Im Gegensatz dazu zünden Sprengstoffe wie RDX (Hexogen : Cyclotrimethylentrinitramin) oder Nitropenta (Pentaerythrittetranitrat) bereits unter viel milderen Bedingungen.
Durch elektrostatische Funken kann Schwarzpulver nicht entzündet werden (18). Im Internet gibt es dazu auch recht eindrucksvolle und perfekt inszenierte Videos
(www.muzzleloaders.com/ctml_experiments/sparks/sparls.html)
Die Lagerfähigkeit von Schwarzpulver ist praktisch unbegrenzt, sofern dabei Feuchtigkeit ferngehalten wird. In Preußen hatte man 1813 Pulver mit unveränderter Qualität aufgefunden, das bereits 1741 hergestellt worden war (3).
Medizinische Anwendungen von Schwarzpulver sind ebenfalls bekannt. So hatten z. B. Goldgräber in Kalifornien um 1850 bei Fiebererkrankungen Schwarzpulver eingenommen (20). Die Wirkung beruht auf dem Salpeter, der fiebersenkend wirkt. Daneben diente es auch zum Ausbrennen von Wunden und zum Pökeln von Fleisch. Bereits um 1460 wurde es auch als Bestandteil eines Rezepts gegen Würmer genannt.
3. Abbrandverhalten von Schwarzpulver
Zunächst sollten einige Begriffe zu Abbrand und Explosion geklärt werden, die häufig durcheinander gebracht werden.
Schwarzpulver verbrennt genau wie Nitropulver schichtweise von außen nach innen. Im Inneren des Korns findet keine Reaktion statt, es platzen nur manchmal kleine Stücke von der Oberfläche ab.
Unter Abbrandgeschwindigkeit versteht man dabei die Geschwindigkeit (in mm oder cm pro Sekunde) mit der ein einzelnes Pulverkorn von aussen nach innen aufgefressen wird. Sie ist unabhängig von der Korngröße.
Davon zu unterscheiden ist die Entzündungsgeschwindigkeit.Dies ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Flammenfront von Korn zu Korn über die gesamte Pulverladung ausbreitet. Sie ist abhängig von der Korngröße und meist größer als die Abbrandgeschwindigkeit.
Daneben ist noch die Detonationsgeschwindigkeit zu erwähnen. Im Gegensatz zum mehr oder weniger schnellen Abbrennen einer Pulverladung läuft bei einer Detonation eine zusammenhängende Stoßwellenfront mit sehr hoher Geschwindigkeit durch die Ladung.
Die einzelnen Körner werden dabei nicht mehr durch die Flamme oder Hitze gezündet, sondern durch die Erschütterung beim Durchgang der Stoßwelle.
Zum Auslösen einer Detonation muss deshalb der Sprengstoff dicht gepackt sein und man benötigt dazu einen Initialsprengstoff, der diese Stoßwelle erzeugt. Er muss in direktem Kontakt zur Ladung stehen und überträgt seine Stoßwelle auf die Ladung. Zum Zünden vor allem großer Sprengladungen benötigt man deshalb kunstvolle Anordnungen. Bei brisanten Sprengstoffen liegen die Detonationsgeschwindigkeiten um 6000-8000 m/sec.
Schwarzpulver kann ebenso wie Nitropulver zur Detonation gebracht werden, allerdings nur bei dichter Packung (siehe Kap. 5.5.) und einer kräftigen Initialzündung. Mit einer Zündschnur gezündet brennt Schwarzpulver nur schnell ab und sprengt seine Verdämmung durch den entstehenden Gasdruck (nach Greener (17) etwa 6500 bar), bildet aber keine Stoßwelle aus.
Die dem Schwarzpulver zugeschriebene "schiebende" Wirkung beruht auf dieser relativ langsamen Reaktion und dem entwickelten Gas. Nur bei hohen Ladedichten (wenn das Pulver praktisch zum Block verdichtet ist und es keine Zwischenräume mehr zwischen den Körnern gibt), wird die Abbrandgeschwindigkeit allerdings auch so hoch, dass sie in den unkontrollierbaren Bereich der Explosion übergeht. Dieser Effekt wird unter 5.5. bei der Diskussion der Ladedichten beschrieben.
Schwarzpulver weist im Vergleich zu Nitropulver und Nitroglycerin die in der nachfolgenden Tabelle 3.1. zusammengestellten charakteristischen Daten auf:
Tabelle 3.1. Charakteristische Daten von Pulvern und Nitroglycerin
3.1. Entzündungsverhalten von Schwarzpulver
Besonders interessant ist das Entzündungsverhalten. Schwarzpulver ist bekanntermaßen sehr gefährlich wegen seiner leichten Entzündbarkeit. Seine Entzündungstemperatur liegt mit etwa 300°C jedoch sehr viel höher als die von Nitropulvern.
Dies rührt daher, dass Schwarzpulver ein mechanisches Gemenge von drei Feststoffen, nämlich Salpeter, Kohle und Schwefel ist. Chemische Reaktionen zwischen Feststoffen verlaufen jedoch außerordentlich langsam. Die Verbrennung setzt deshalb erst ein, wenn die Temperatur so weit angestiegen ist, dass der Salpeter schmilzt und mit dem Schwefel, der bis dahin ebenfalls geschmolzen ist, reagieren kann. Dessen Verbrennung zündet dann auch die Verbrennung der Kohle. Zunächst beginnt also der Schwefel zu brennen, dieser entzündet dann die Kohle. Dies konnte auch bereits um 1750 experimentell verifiziert werden (15).
Kaliumsalpeter schmilzt jedoch erst etwas oberhalb 300°C, deshalb hat Schwarzpulver eine so hohe Entzündungstemperatur. Zur Entzündung muss allerdings nicht die gesamte Ladung auf Temperatur gebracht werden, eine kleine Ecke eines Pulverkorns reicht dazu aus. Da die Verbrennung viel Wärme erzeugt, heizt sich die Umgebung der reagierenden Stelle von alleine auf und die Entzündung breitet sich über die gesamte Ladung aus (18, 21).
Dies bedeutet jedoch, dass der Funken, der in Kontakt mit einem Pulverkorn kommt, eine ausreichende Wärmekapazität haben muss, um einen Punkt an der Oberfläche eines Korns auf die zur Zündung nötigen 300°C aufzuheizen.
Der Funken eines Steinschlosses besitzt die dazu nötige Wärmekapazität. Diese Funken sind kleine Stahlpartikel, die vom Stein aus der Batterieoberfläche herausgerissen werden. Da dies mit großer Geschwindigkeit geschieht, heizen sich diese Partikel so weit auf, dass sie an der Luft anfangen zu verbrennen. Sie werden dabei so heiß, dass sie das Pulver entzünden können.
Damit hängt auch zusammen, dass die Batterie gehärtet sein muss, um Funken zu geben. Die zum Herausreißen eines Partikels nötige Arbeit ist von der Härte der Batterieoberfläche abhängig. Bei einer weichen Batterie geht dies sehr leicht, dabei wird dieses Partikel aber nicht genügend aufgeheizt, so dass es an der Luft nicht zu brennen beginnt.
Etwas unklar ist das Verhalten gegen elektrische Funken, wie z.B. die von statischen Aufladungen. In neueren amerikanischen Büchern (22) wird auf die Möglichkeit der Zündung durch statische Aufladungen hingewiesen. Nach (18) ist Schwarzpulver durch elektrische Funken jedoch nicht zu entzünden. Dabei wurde durch Entladung eines Kondensators ein Funkenüberschlag zwischen zwei Elektroden mit einer Dauer von etwa 10 Mikrosekunden erzeugt, wobei die Elektroden mit Pulver bedeckt waren. Dabei wurde bei allen Versuchen das Pulver nur weggeschleudert und zerstreut, aber nicht gezündet.
Auch einer anderen Literaturstelle (19) ist kein Hinweis auf eine mögliche Gefahr der Zündung durch elektrostatische Aufladungen zu entnehmen. Abgesehen davon gibt es dazu inzwischen im Internet recht eindrucksvolle Videos.
Durch heiße Gase (ebenfalls wegen derer geringen Wärmekapazität) wird Schwarzpulver ebenfalls nur schlecht bzw. mit etwas Verzögerung entzündet. Jeder, der einmal Pulverreste mit einem Gasfeuerzeug entzündet hat, kennt diesen Effekt (zuerst zündet es nicht, und wenn es zündet, bekommt man die Hand nicht schnell genug weg). Ein Heizdraht oder ein glimmender Holzspan (Streichholz) zünden jedoch augenblicklich.





























