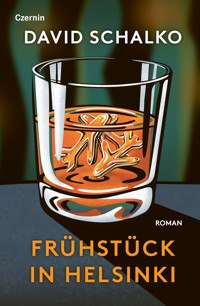9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein großes Epos über die schillerndste Verbrecherszene der Nachkriegszeit. Inspiriert durch wahre Begebenheiten, erzählt mit viel schwarzem Humor und dennoch großer Empathie: David Schalko ist mit seinem Verbrecher-Epos »Schwere Knochen« ein fulminanter, einzigartiger Roman über die österreichische Nachkriegsgesellschaft gelungen – und ein faszinierender Einblick in das Innere von Menschen, deren Seelen durch den Nationalsozialismus zerstört wurden. Wien, März 1938, »Anschluss« Österreichs ans Deutsche Reich: Am Tag, als halb Wien am Heldenplatz seinem neuen Führer zujubelt, raubt eine Bande jugendlicher Kleinganoven einen stadtbekannten Nazi aus. Sieben Jahre lang müssen die Kleinkriminellen daraufhin als sogenannte Kapos für die »Aufrechterhaltung des Betriebs« in den KZs Dachau und Mauthausen sorgen und wachsen so zu Schwerverbrechern heran. Nach Kriegsende übernimmt die Bande um Ferdinand Krutzler die Wiener Unterwelt. Mit ungekannter Brutalität nutzt sie ihre Macht nicht zuletzt, um ehemalige Nazi-Widersacher aus dem Weg zu räumen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
David Schalko
Schwere Knochen
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über David Schalko
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über David Schalko
David Schalko, geboren 1973, lebt als Autor und Regisseur in Wien. Er begann mit 22 Jahren als Lyriker zu veröffentlichen. Bekannt wurde er mit revolutionären Fernsehformaten wie der »Sendung ohne Namen«. Seine Filme wie »Aufschneider« mit Josef Hader und die Serien »Braunschlag« und »Altes Geld« genießen Kultstatus und wurden mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Im Frühjahr wurde seine neue Mini-Serie »M – Eine Stadt sucht einen Mörder« – ein Remake von Fritz Langs berühmtem Film – im ORF erstausgestrahlt.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Wien, März 1938, »Anschluss« Österreichs ans Deutsche Reich. Am Tag, als halb Wien am Heldenplatz seinem neuen Führer zujubelt, raubt eine Bande jugendlicher Kleinganoven, die sich darauf spezialisiert hat, Wohnungen zu »evakuieren«, einen stadtbekannten Nazi aus. Sieben Jahre lang müssen die Kleinkriminellen daraufhin als sogenannte Kapos für die »Aufrechterhaltung des Betriebs« in den KZs Dachau und Mauthausen sorgen – und wachsen so zu Schwerverbrechern heran, die lernen, dass der Unterschied zwischen Mensch und Tier eine Illusion ist. Zurück in der österreichischen Hauptstadt übernimmt die Bande um Ferdinand Krutzler die Wiener Unterwelt. Mit ungekannter Brutalität nutzt sie ihre Macht nicht zuletzt, um ehemalige Nazi-Widersacher aus dem Weg zu räumen. Aber der eingeschworene Zusammenhalt täuscht. Zunehmend verlieren sie einander in verräterischen Verstrickungen und verhängnisvollen Liebschaften. So lange, bis sie ihren Ehrenkodex aufgeben und aus Freunden unerbittliche Feinde werden.
Inspiriert durch wahre Begebenheiten, erzählt mit viel schwarzem Humor und dennoch großer Empathie: David Schalko ist mit seinem Verbrecher-Epos »Schwere Knochen« ein fulminanter, einzigartiger Roman über die österreichische Nachkriegsgesellschaft gelungen – und ein faszinierender Einblick in das Innere von Menschen, deren Seelen durch den Nationalsozialismus zerstört wurden.
»David Schalko sieht unbestritten aus wie ein Genie. Es spricht aber auch einiges dafür, dass er eins ist.«Josef Hader
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Hinweis
Die Erdberger Spedition
Die große Reise
Die Frau im Turban
Der Weg ins Paradies
Dresden
Milady
Lenin
Old Shatterhand
Old Firehand
Karpfen
Stalin
Dinge, die es nicht gibt
Fleischburgen
Metamorphosen
Das Lied vom traurigen Sonntag
Fernweh
Geheimagenten
Asphalt
Glossar
Dank
Für Evi, Elsa und Frida.
Und meine Großeltern.
Es gibt die Geschichte des Tages und die der Nacht. Die eine steht in den Büchern. Die andere erzählt man sich hinter vorgehaltener Hand. Diese Geschichte ist bestimmt nicht wahr. Aber so wird sie erzählt.
Im hinteren Teil des Buches finden Sie ein Glossar zur Erläuterung von Begriffen.
Die Erdberger Spedition
Ferdinand Krutzler war damals der wichtigste Notwehrspezialist Wiens. Elfmal wurde er wegen tödlicher Notwehr freigesprochen. Nur am Schluss hatte er es übertrieben. Da saß er inmitten des gefürchteten Bregovic-Clans. Bloß waren die sonst so lauten Jugoslawen ganz still. Das Einzige, was man hörte, war ihr Blut, das auf den Boden tropfte. Es war Notwehr, hatte der Krutzler geflüstert. Dann hatte er die Pistole vor sich auf den Tisch gelegt und seelenruhig auf seine Verhaftung gewartet.
Wobei es viele gab, die ihm gar keine Seele attestierten. Aber eine Persönlichkeit sei er gewesen. Und eine solche erkannte man aus der Ferne. Mit seinen zwei Metern, seinem steifen Oberkörper, seinem riesigen Kopf und seiner schwarzen Hornbrille sah er aus wie ein zu groß geratenes Insekt. Schönheit war er keine. Sogar seine Mutter, die vermutlich nur deshalb so alt wurde, weil sie sich nie bei jemandem entschuldigt hatte, sagte über ihren Sohn, dass er schon bei der Geburt wie ein Hirschkäfer ausgesehen habe. Richtig erschreckt habe sie sich, als sie den unfreiwilligen Nachzügler in Händen gehalten habe. Ein sechs Kilo schweres Ungetüm habe sie mit dem Hintern voran in die Welt pressen müssen. Und das im Alter von vierundvierzig Jahren. Wer rechne da noch mit einer Schwangerschaft. Da müsse eine Seele schon richtig desperat auf die Welt kommen wollen. Und das könne selten etwas Gutes bedeuten. Denn desperat war nur der Teufel. Gott hielt sich höflich fern von der Welt.
Auf jeden Fall sei ihr dieses Ungetüm von Anfang an fremd gewesen. Keinen einzigen Moment seien sie sich nahe gekommen. Selbst bei der Geburt sei er nichts als Lärm und Schmerz gewesen. Wenn sie geahnt hätte, dass ihr Sohn einmal der gefährlichste Mann Wiens werden würde, hätte sie ihn vielleicht doch weggemacht. Wobei vermutlich nicht einmal die Hitlermutter ihren Welpen abgetrieben hätte, wenn sie gewusst hätte, was für ein Monster sie auf die Welt setzen würde.
Damals ahnte man ja noch nichts von den späteren Qualitäten des Ferdinand Krutzler. Erst vierzig Jahre später flüsterte man sich hinter vorgehaltener Hand die rankenden Legenden zu. Zum Beispiel, dass keiner seinen beigen Kamelhaarmantel berühren durfte. Dass er in seinem ganzen Leben keine Frau geküsst hatte. Dass er angeblich bei Nacht genauso gut sehen konnte wie bei Tag. Und dass er jeder Lüge auf die Spur kam.
Vieles war übertrieben. Genauso wie der Respekt, den man ihm entgegenbrachte. Man bewunderte seinen Geschmack. Seinen Stil. Und seine Großzügigkeit. Besonders den Frauen gegenüber. Manche sagten, die Geschenke ersetzten ihm den nicht vorhandenen Charme. Der Krutzler war kein Mann der großen Worte. Eher der Taten. Wenn der Krutzler einen aufforderte, als Erster zuzuschlagen, dann wusste derjenige, was zu tun war: die Stadt verlassen und sein Gesicht nie wieder zeigen.
Wobei der Krutzler kein Feigling war. Er hatte seine Prinzipien. Und seine Methode. Der Krutzler’sche Halsstich hatte damals nicht nur in Wien Furore gemacht. Sein Ruf reichte bis nach Hamburg. Und viele sagten, dass es mit dem Krutzler zu Ende ging, als er vom Messer auf die Maschinenpistole umgestiegen war. Da sei eine richtige Ära zu Ende gegangen. Eine Ära mit Persönlichkeiten, für die es später keine Ersatzteile mehr gegeben habe.
Natürlich kam so einer wie der Krutzler nicht als Persönlichkeit auf die Welt. Eine solche musste man sich erst verdienen. Und da war der Krutzler durch die härteste Schule gegangen, die man sich vorstellen konnte. Viele sagten, er habe gar keine andere Chance gehabt, als Notwehrspezialist zu werden. Und die Mutter sei sein erster Feind gewesen. Denn geliebt habe sie nur den schönen Gottfried – den zehn Jahre älteren Bruder, der ab dem 42er-Jahr als Schwarz-Weiß-Porträt im Schlafzimmer hing.
Über Helsinki sei er vom Himmel gefallen. Drei Jahre lang habe sie seine Ansichtskarten vom zerbombten Kairo, vom brennenden Paris oder vom zerstörten Athen erhalten. Wenigstens habe er dank dem Führer etwas von der Welt gesehen.
Nachdem er im wahrsten Sinne des Wortes gefallen war und es naturgemäß keine Leiche gab, hing der verglühte Gottfried als zeitlose Schönheit an der Schlafzimmerwand. Jeden Tag vor dem Schlafengehen redete die alte Krutzler mit ihrem uniformierten Prinzen. Und da er im Gegensatz zu allen anderen nicht zurückredete, steigerte sich die Mutterliebe post mortem enorm.
So viel Schönheit habe von Anfang an nichts Gutes verheißen, sagte man. Um so einen wie den Gottfried hätten sich eben nicht nur die Weibsbilder gerissen. Auch der Herrgott hole einen solchen so früh wie möglich zu sich. Dem Ferdinand hingegen habe schon als Kind keiner über den Weg getraut. Ganz dem Vater habe er nachgegraben, von dem es immer nur geheißen hatte, er sei ein lebensfroher Mensch gewesen.
Die Mutter hatte ihn einen Wilderer genannt. Da es in Gramatneusiedl nicht nur kaum Menschen, sondern auch kaum Rehe gab, wusste man, was sie damit meinte. Der alte Praschak, der es wissen musste – schließlich war er Fleischer –, hatte einmal gesagt, dass er einen Krutzler aus weiter Ferne erkennen würde, denn alle Krutzlers hätten die gleichen schweren Knochen. In Gramatneusiedl hatten viele schwere Knochen. Auch die Frauen. Was noch nichts hieß. In so einem Ort hatten schnell alle die gleiche Physiognomie.
Trotzdem hatte der Nachzügler Ferdinand über seinen Vater zu Lebzeiten kaum mehr in Erfahrung gebracht, als dass er ein lebensfroher Mensch gewesen sei. Aber die Blicke auf den zu groß geratenen Sohn erzählten ohnehin Bände über den Gemüsehändler, der kaum ein Obst je ungepflückt ließ. Da wurde viel gemunkelt und viele sagten, dass man Gramatneusiedl eigentlich nach ihm hätte benennen sollen. Wenn der alte Krutzler mit seinem Obstwagen länger vor einem Haus stand, dann wusste man, was es geschlagen hatte. Da wurde vermutlich wieder eine Frucht gepflückt. Oder am Watschenbaum gerüttelt. Oder auf fremden Äckern gesät. Der kleine Ferdinand verstand nicht, was die Großen damit meinten, wenn sie das Unaussprechliche mit ihrem Geschwätz bekleideten. Alle wussten Bescheid, während das Krutzlerkind im Obstwagen nichts ahnend auf seinen Vater wartete. Selbst als es der Ferdinand einmal wagte, nach dem Alten zu sehen, weil er die Hitze in dem Gefährt nicht länger aushielt, und ihn in flagranti beim Pflücken erwischte, erntete er keine Erklärung, sondern nur angedrohte Prügel. Er solle sich wieder zurück in den Wagen schleichen und dort warten, bis man mit den Geschäften fertig sei. Man sagte, schon als Kind habe der Krutzler das Geschlechtliche mit dem Geschäftlichen verwechselt. Das habe er von seinem Alten gelernt, der eben ein lebensfroher Mensch gewesen sei.
Wenn man den Krutzler später nach seiner Kindheit fragte, dann sagte er, er könne sich an keine erinnern. Man munkelte, dass man seine Kleidung deshalb nicht berühren durfte, weil er als Nachzügler die vom schönen Gottfried hatte anziehen müssen. Dass er stets Erster sein wollte, weil er von Geburt an Zweiter war. Dass er sich ein Leben lang an seinem Bruder rächte und alle anderen nur Stellvertreter waren. Dieser hatte ihn angeblich als Kind öfter am Marterpfahl vergessen und ihn auch sonst gelehrt, dass die Lüge zwar kurze, aber die Wahrheit überhaupt keine Beine hatte. Und vom Vater hatte er sowieso nur gelernt, dass sich mit Fäusten jede Frage beantworten ließ. Sogar die nach der Existenz Gottes. Aber das waren alles nur Gerüchte, weil sich der Krutzler, wie gesagt, an seine Kindheit nicht erinnern konnte.
Über den Tod des Vaters wurde damals genauso viel gemunkelt wie über sein Leben. Viele sagten, der Unfall sei die erste Notwehr vom jungen Krutzler gewesen. Es ist nach so langer Zeit schwierig, die Teile zusammenzufügen. Es war noch vor dem Krieg.
Auf jeden Fall hatte sich der Krutzlervater einen lebensfrohen Abend gegönnt. Nach der letzten Fuhr hatte der Gemüsehändler zunächst sein Tageseinkommen beim Wirt verspielt. Dann hatte er sich die Wut weggetrunken. Übrig blieb eine sentimentale Liebesbedürftigkeit, der sich niemand annehmen wollte. Der alte Krutzler hatte nahe am Wasser gebaut. Körperlicher Trost blieb ihm aber verwehrt. Und so kehrte der Wilderer ohne Beute und dementsprechend jähzornig gegen drei Uhr heim, wo er als torkelnder Riese im Zwergenhaus mit den Fäusten wedelte. Der schöne Gottfried ließ sich von der Mutter beschützen, der ungeliebte Ferdinand wiederum stellte sich vor die beiden, die es ihm ohnehin nicht dankten. In solchen Situationen ist es dann im Nachhinein schwer zu sagen, was war Unfall, was war Absicht, was war Schicksal. Es ist sowieso immer alles eine Mischung aus allem. Und der Ferdinand war noch ein Kind. Nicht, dass man ein Kind von jeglicher Schuld freisprechen sollte. Aber damals wäre es noch möglich gewesen, dass aus dem Krutzler einmal nicht der Notwehr-Krutzler werden würde.
Auf jeden Fall munkelte man, es sei der Ferdinand gewesen, der dem lebensfrohen Vater das Leben genommen habe. Weggestoßen habe er ihn. Um die Mutter zu schützen. Und da sei er halt blöd gefallen. In so einem Zwergenhaus liege schnell etwas Spitzes im Weg. Die Krutzlermutter verlor über diesen Vorfall weder bei der Polizei noch bei irgendwem jemals ein Wort. So wie es überhaupt ihre Art war, die Dinge mit Schweigen zu ersticken. Insofern war ihre spätere Todesursache nicht weiter verwunderlich. So wie die meisten Todesursachen immer zum Leben der jeweiligen Person passten. Selbst die des Notwehr-Krutzlers, die genau genommen auch nichts anderes als Notwehr war.
Seit dem Unfall wurde in Gramatneusiedl mehr gemunkelt, als in so einem kleinen Krutzler-Haus passieren konnte. Kein Wunder also, dass die Verbliebenen die Flucht ergriffen und zur Schwester der Krutzlermutter ins berüchtigte Wiener Erdberg zogen. Besagte Tante Elvira stand ihrer Verwandtschaft bezüglich Herzlosigkeit um nichts nach. Man sagte, sie habe zweiundvierzig Infarkte überlebt, ohne auch nur einen bemerkt zu haben. Gestorben ist sie aber an ihrer Eitelkeit. Weil sie stets den Männern gefallen wollte. Nach dem Krieg war sie verschrien, was sie alles für ein Paar Nylonstrümpfe anstellen würde. Und da sie wusste, dass den Amerikanern besonders gesunde Girls gefielen, hatte sie viel Aufmerksamkeit für ihren Teint über. An ihrem Todestag war sie beim Sonnenbräunen eingeschlafen. Richtig durchgegrillt habe sie ausgesehen. Da habe man kein Arzt sein müssen, um Hitzeschlag zu diagnostizieren.
Aber das war alles viel später. Vor dem Krieg war die Krutzlerschwester noch eine blasse Person gewesen. Und trotz ihrer Herzlosigkeit wurde die Verwandtschaft aufgenommen. Man sagte, sie habe sich von den Kindern eine finanzielle Erleichterung erhofft. Schließlich befanden sie sich im arbeitsfähigen Alter. Der schöne Gottfried zählte fünfundzwanzig Jahre und die Erdberger Rosen lagen ihm zu Füßen. Aber vom Heiraten wollte der genauso wenig wissen wie von Arbeit. Er träumte schon damals vom Fliegen. Der bodenständige Gemüsehandel konnte ihm gestohlen bleiben. Stattdessen fütterte ihn Tante Elvira durch, weil sie ihm angeblich genauso verfallen war wie der Rest des Bezirkes. Was da wieder gemunkelt wurde, kann man sich vorstellen. Aber die Frauen stellten sich stets schützend vor den schönen Gottfried. Und den zu großen Ferdinand goutierten sie mit Verachtung. Deshalb sah die Verteilung so aus, dass dem Gottfried die Zuneigung und dem Ferdinand die Arbeit blieb. Darunter litt auch einer wie der Notwehr-Krutzler. Kein Wunder also, dass er später der Zuneigung nicht traute. Da brauchte man kein Psychologe zu sein.
Sicher, der Ferdinand hätte sich als Kind auch mit den anderen, an die sich heute keiner mehr erinnert, anfreunden können. Vermutlich hatte es mit seiner Körpergröße zu tun. Vom ersten Tag an war er in Erdberg eine Erscheinung gewesen. Und als solche musste er seiner Körperlichkeit gerecht werden. Das nannte man Entwicklung. Wir sprechen von einem Erdberg, wo der Straßenname stets mehr zählte als der Familienname. Und in die Schule, in die man den Ferdinand steckte, trauten sich die Lehrer schon damals kaum hinein. Denn mit Schlägen brauchte man solchen Kindern nicht zu kommen. Davon kassierten sie zu Hause genug. Dementsprechend genossen die ratlosen Lehrer weder den Respekt der Schüler noch den der Eltern. Beide hielten sie für Versager.
Der erste Auftritt vom damals zwölfjährigen Ferdinand Krutzler blieb sowohl Schülern als auch Lehrern in nachhaltiger Erinnerung. Da erschien ein Bursche, der alle anderen um einen Kopf überragte. Er setzte sich in die Mitte der Klasse, ohne mit irgendjemandem ein Wort zu wechseln. Die Plätze der Schüler waren streng hierarchisch aufgeteilt. Und ein Neuer wie der Krutzler hatte sich zunächst mal vorne zu platzieren. Der Riese Ferdinand saß aber wie dreißig Jahre später bei seiner Verhaftung in der Mitte des Raumes und wartete seelenruhig auf das Eintrudeln der Schüler. Die Erdberger Kinder blieben wie eingefroren stehen, als sie den Koloss erblickten, und warteten auf das Eintreffen ihres Anführers. Selbst der Lehrer suchte das Weite und harrte aus, wie sich die Situation entwickeln würde. Als der bleiche Wessely mit seiner Entourage, dem vierschrötigen Praschak und dem schlaksigen Sikora, naturgemäß zehn Minuten nach dem Läuten in Erscheinung trat, präsentierte ihnen der Krutzler einen monumentalen Rücken, an dem die gesamte Klasse hätte runterrutschen können.
Der Wessely war ebenfalls keiner der großen Worte. Was daran lag, dass er stotterte und vorzugsweise seine Fäuste sprechen ließ. Einer wie der Krutzler flößte ihm aber Respekt ein. Ein solcher ließ sich weder mit Worten noch mit Fäusten verschieben. Trotzdem konnte er den Affront des Neuen nicht im Raum stehen lassen. Alle warteten, was der wendige Wessely tun würde. Schließlich hatte er eine Position zu verlieren, die man jeden Herbst neu untermauern musste. Die Untergebenen Praschak und Sikora merkten die Unsicherheit ihres Anführers und wollten schon losbrüllen, als der Wessely etwas ganz Erstaunliches vollbrachte. Er nahm zwei Stühle und trug sie auf den Gang. Dann kam er zurück, nahm die nächsten beiden und so weiter. Die Klasse schloss sich an. So lang, bis der Krutzler alleine in einem leeren Raum saß und der Lehrer hinter ihm die Tür schloss. Kurzerhand verlegte man auf das stumme Geheiß vom Wessely den Unterricht auf den Gang.
Ob es der allein gelassene Krutzler als Triumph oder Demütigung empfand, sei dahingestellt. Auf jeden Fall musste er sich bewegen. Er konnte schließlich nicht bis in die Nacht in diesem Klassenzimmer hocken bleiben. Es dauerte mehrere Stunden, bis er hinaustrat. Er sah die aufgestellten Reihen, und außer dem Wessely saß dort niemand. Dieser bedeutete ihm ohne Worte, neben ihm Platz zu nehmen. Der Krutzler ließ sich seufzend nieder. Sie sahen sich lange an. Dann mussten beide so schallend lachen, dass man im Lehrerzimmer in Deckung ging. In diesem Moment schworen sich die beiden eine Freundschaft, die noch vielen zum Verhängnis werden sollte.
Der Wessely wies den Krutzler in die Erdberger Verhältnisse ein. Die kannte er von Geburt an. Der stotternde Wessely war ein Waisenkind, das keiner adoptieren wollte. Der Vater war nach einem Arbeitsunfall verblutet. Die Mutter war gestorben, während ihn die Nonnen aus ihrem Leib geprügelt hatten. Schon bei der Geburt war er unnatürlich bleich gewesen. Die Nonnen sagten, ein so blutarmes Kind schaue nur nach Scherereien aus. Ein solches sei weder zum Arbeiten noch zum Herzeigen geeignet. Einer wie der Bleiche würde nur Kosten bedeuten, weil ihm schon jetzt die Krankheit ins Gesicht geschrieben stehe. Sie sagten, wenn ihn keiner wolle, würde er ganz alleine Gott gehören.
Das hatte ihm die Sprache verschlagen. Der Wessely hatte schon aufgehört, in ganzen Sätzen zu sprechen, bevor er solche bilden konnte. Was wiederum an den Schlägen lag, mit denen man jede seiner Lügen unterbrach. Jedenfalls hatte der Wessely sehr schnell begriffen, dass mit Worten nicht viel auszurichten war, und irgendwann hatte er begonnen, auch die Nonnen für ihre Übergriffigkeiten zu verdreschen. Was wiederum mit Schlägen im Namen Gottes vergolten wurde.
Ab dann war eine Adoption eigentlich aussichtslos gewesen. Hätte sich nicht der alte Schrack gefunden, dessen Hund gerade gestorben war und der sich dachte, mit einem Menschenkind würde sich nicht viel ändern, außer dass es ihm von größerem Nutzen wäre. Man kann einem Hund viel beibringen, aber dass ein solcher am Werkzeug spurt, das wäre selbst dem Schrack nicht geglückt. Insofern geriet ihm dieses Menschenkind zum Meisterstück. Der bleiche Wessely wurde täglich vom Bett in die Küche geprügelt, wo er dem Schrack ein Frühstück auf Hotelniveau zubereiten musste. Dann wurde er in den Haushalt eingepflegt. Waschen, bügeln, putzen. Zu Mittag kam der Schrack nach Hause, um eine warme Mahlzeit einzunehmen. So gut konnte kein Chef der Welt kochen, dass der Schrack nicht einen Grund für seine Rage fand. Schon gar nicht dieses Straßenkind, das ein stabiles Leben zwischen vier Wänden offenbar nicht zu schätzen wusste. Ob er ihn wieder davonjagen solle? Ob ihm sein neues Gehege nicht gefalle? Ob er nicht fähig sei, wenigstens im Zubereiten der Speisen Dankbarkeit zu zeigen? Wenn er es mit seinem Gestammel schon nicht fertigbringe!
Der Wessely begriff schnell, dass mit Beruhigung nicht viel auszurichten war. Deshalb schlug er die entgegengesetzte Richtung ein. Er versalzte die Suppen, zerkochte das Rindfleisch, mischte verdorbenes Gemüse bei und servierte faulen Fisch. Nach einem Gulasch, dessen Schärfe selbst zwanzig Schracks zerrissen hätte, lief der Kopf desselben so rot an, dass Stiere auf ihn losgegangen wären. Doch zum Wutanfall reichte es nicht mehr. Das Herz war der Aufregung zuvorgekommen und hatte sich schmerzhaft zu Wort gemeldet, was dem Schrack röchelnd das Leben kostete. Die Wut, dass der bleiche Wessely tatenlos dabei zusah, war ihm unmissverständlich ins hochrote Gesicht geschrieben, aber das konnte später kein Amtsarzt mehr lesen. Herzinfarkt, sagte man und bemitleidete das kränkliche Kind für sein Schicksal. Mehr Zuneigung als die betretenen Blicke der Nachbarn, als er wieder ins Heim abgeführt wurde, konnte einer wie der Wessely nicht ernten. Danach rührte er nie wieder einen Kochlöffel an. Nicht einmal einen Kaffee bereitete sich der Wessely zeit seines Lebens zu.
Nach dem Tod des Schrack fand sich niemand mehr, der ihn adoptieren wollte. Und die Erdberger Freunde avancierten zur Familie. Dass sowohl der Krutzler als auch der Wessely ihren Ödipus frühzeitig gelöst hatten, verband die beiden umso mehr. Jeden Abend ging der Wessely ins Heim schlafen. Aber untertags träumten die Freunde von der Weltherrschaft über Erdberg. Frühzeitig erlernten sie ihr Handwerk, das damals noch hochgehalten wurde. Die alten Herren von der großen Galerie wiesen die Jungen in die Kunst der Schränker ein. Bereits mit sechzehn konnten die Burschen jeden Tresor zum Aufmachen überreden. Kein Taschenspielertrick, der ihnen unbekannt war. Und keine Waffe, die sie nicht schneller zogen als jeder dilettantische Schauspieler in den Stummfilmwestern. Wobei das Schießen damals noch verpönt war. Das kam erst später in Mode.
Der Krutzler, der Wessely, der Praschak und der Sikora zogen durch Erdberg und probierten sich aus. An Fantasie und Handschrift mangelte es ihnen nicht. Besonders stolz waren sie auf den Hundertertrick. Man sagte, dieser sei so raffiniert gewesen, dass selbst der betrogene Wirt im Nachhinein nicht verstanden habe, was eigentlich passiert sei.
Dabei bestach er durch seine Einfachheit. Der Wessely, der schon damals ein Meister der Karten war, betrat ein Lokal, um dort unaufgefordert ein paar Kunststücke zum Besten zu geben. Schnell hatte sich eine Traube von Schaulustigen um ihn gebildet. Der Riese Krutzler mischte sich auffällig in die Menge und stachelte die Stimmung an. Der vierschrötige Praschak wartete draußen und stand Schmiere. Der Sikora schlich schlaksig durch das Lokal und bestellte sich ein Getränk. Irgendwann forderte der Krutzler den bleichen Kartenspieler auf, mit dem Geplänkel aufzuhören und endlich zur Sache zu kommen. Was er damit meine, gab sich der Wessely ganz unbedarft. Diese billigen Tricks kenne doch jeder, provozierte der Krutzler die ausgezehrte Erscheinung. Der Wessely ließ das nicht auf sich sitzen. Er habe ein ganz besonderes Kunststück für die Herrschaften vorbereitet. Aber dafür müsse man zahlen. Nicht viel. Jeden Gast koste es fünf Schilling. Das sei kein Vermögen für eine Verblüffung dieser Art. Die bereits angestachelte Menge zahlte bereitwillig.
Der Wessely forderte daraufhin den Wirt auf, aus seiner Kasse einen Hundertschillingschein herauszunehmen. Er solle sich die Seriennummer aufschreiben, damit er ihn wiedererkenne. Der Wirt befolgte die Anweisung mit einem gewissen Misstrauen. Der Erdberger an sich war zwar neugierig, aber gleichzeitig skeptisch. Meistens überwog die Neugier. Und so übergab er dem Bleichen den Hunderter, der damit allerhand anstellte, ihn schließlich verschwinden ließ, um mit anderen Kunststücken fortzufahren.
Irgendwann überwog dann doch das Misstrauen und der Wirt fragte nach seinem Geldschein. Ach, sagte der Wessely triumphierend, den habe er längst wieder in seine Kasse zurückgezaubert. Der Wirt sah ihn an, wie man jemanden ansah, der einem die eigene Mutter als Hure kredenzte. Ob er jetzt völlig deppert sei, fuhr er den halbstarken Spieler an. Er solle sich selbst überzeugen, grinste der Wessely zurück. Der Krutzler und der Sikora waren mit dem Praschak längst über alle Berge. Langsam öffnete der Wirt seine Kasse. Er ließ den Wessely nicht aus den Augen. Sagte den Gästen, sie sollten den Gauner festhalten, bevor er die Flucht ergreife. Dann fiel sein Blick in die Kasse. Und tatsächlich. Der Hunderter lag obenauf. Nach mehrmaliger Prüfung der Seriennummer musste der Wirt konstatieren, dass es sich um seinen Geldschein handelte. Auch wenn er ahnte, dass es zu einem bösen Erwachen führen würde, gab er sich geschlagen, fragte den Wessely noch, wie er das angestellt habe. Dieser zuckte nur mit den Achseln, ließ sich vom Wirt auf ein Getränk einladen und ging erhobenen Hauptes aus dem Lokal.
Zur Sperrstunde stellte der Wirt fest, dass ihm achtundneunzig Schilling in der Kasse fehlten. Aber zu diesem Zeitpunkt hatten die vier ihren Tagesverdienst längst ausgegeben. Selbst die Polizei nahm die Angelegenheit ratlos zur Kenntnis. Meistens waren die Wirte auch ihre besten Kunden. Daher schob man es auf den Alkohol. Wobei sich die Vorfälle häuften. Und stets war von einem bleichen, ausgezehrten Jugendlichen die Rede. Und einem unbekannten Riesen. Nur den schlaksigen Sikora hatte nie einer bemerkt. Der spätere Zauberer konnte schon damals in sich selbst verschwinden.
Meistens gaben die vier ihr Geld in irgendwelchen Bordellen aus. Man war im geschlechtsreifen Alter und im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen hatte man schon mit mehr Frauen geschlafen, als die meisten in ihrem ganzen Leben verbuchen konnten. Wenn die Beute nicht für vier Damen reichte, mussten die Karten entscheiden. Meistens blieb der Praschak übrig. Was einerseits gerecht war, andererseits vom Wessely beeinflusst wurde. Schließlich hatte der Praschak am wenigsten zur Beute beigetragen.
Der bullige Fleischersohn hatte überhaupt kein Talent für das Milieu. Er empfand auch keine Lust dabei, anderen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Er konnte über einen gelungenen Coup nicht lachen. Und stand im Ruf, feig und antriebslos zu sein. Er wurde eben dazu erzogen, das Geschäft des Vaters zu übernehmen. Für das Schlachten von Kühen und Schweinen brauchte es andere Fertigkeiten. Da die Freunde aber unzertrennlich waren, ließ man ihn Schmiere stehen. Selbst dann, wenn es eigentlich nicht notwendig war. Da könne sogar der Praschak nicht viel verhauen, hatte der Wessely gesagt, wobei dieser zumindest einmal eindrucksvoll das Gegenteil bewies.
Denn eigentlich hätte er eins und eins zusammenzählen müssen. Keine Ahnung, von was dieser Muskelzwerg geträumt habe, fluchte der Wessely. Vielleicht von irgendwelchen prächtigen Kühen und Säuen. Er kenne doch den Geldscheißer-Franz. Der habe die halbe Wiener Falschspielerbrigade ausgebildet. Dreißig Jahre lang habe der ausschließlich vom Glücksspiel gelebt. Als dieser am Praschak vorbeimarschiert war, um das Lokal zu betreten, wo der Wessely gerade den letzten Kartentrick vorführte, bevor er den Wirt dazu auffordern würde, ihm den Hunderter aus der Kasse zu reichen, da habe der Herr Fleischersohn wieder einmal nicht mitgedacht, so der Bleiche. Da sei ihm offenbar nicht der Gedanke gekommen, dass der alte Hase den Trick durchschauen und auch nicht untätig bleiben würde.
Denn der Geldscheißer-Franz hatte nicht nur ein ausgeprägtes Handwerk, sondern auch einen nicht zu unterschätzenden Geltungsdrang. Außerdem warfen die Alten stets ein argwöhnisches Auge auf den Nachwuchs und ließen diesen gern ihre Überlegenheit spüren.
Auf jeden Fall hatte der Praschak dem Geldscheißer-Franz noch grüßend zugenickt, als dieser das Lokal betrat. Solange keine Polizei im Anmarsch war, bestand in seinen Augen kein Handlungsbedarf. Der Krutzler hatte gerade gesagt, der Kartentrickser solle mit dem Geplänkel aufhören. Der Geldscheißer-Franz stellte sich unbemerkt in eine Ecke und beobachtete nicht nur den Wirt dabei, wie er dem Wessely den Hunderter übergab, sondern auch, wie dieser den Schein unauffällig dem Sikora zusteckte, während alle auf seine wedelnden Zauberhände starrten. Der Schlaksige schlurfte gemütlich zur Bar. Er nahm den Hunderter und bezahlte bei der Kellnerin sein Getränk. Er bekam achtundneunzig Schilling retour. Der Wirt beaufsichtigte derweil den Wessely, weil er sich Sorgen um seinen Geldschein machte. Der Sikora verschwand genauso unauffällig wie der Krutzler.
Das Szenario amüsierte den Geldscheißer-Franz. Die Burschen hatten Talent. Gleichzeitig brauchten sie eine Lektion. Sie erschienen ihm recht übermütig. Erinnerten ihn an seine eigene Jugend. Auch den Geldscheißer-Franz hatte der Hochmut verdorben. Also ging er zur Kasse, rief die Kellnerin zu sich und fragte sie, ob sie ihm zwei Fünfziger zu einem Hunderter wechseln könne. Sie nickte grantig und übergab ihm den oben aufliegenden Geldschein, mit dem der Sikora eben bezahlt hatte und dessen Seriennummer auf dem Block des Wirtes stand. Als dieser nach seinem Hunderter fragte und der Wessely hochmütig verkündete, dass er ihn längst in die Kasse zurückgezaubert habe, lächelte der Geldscheißer-Franz still in sich hinein. Der Krutzler, der Sikora und der Praschak waren längst über alle Berge. Und als der Wirt seinen Hunderter nicht vorfand, drohte er nicht nur damit, den Geldschein aus dem jetzt kreidebleichen Wessely herauszuprügeln, er setzte Angedrohtes auch mit tatkräftiger Unterstützung seiner angetrunkenen Kundschaft um.
So viel Farbe wie in den nächsten Wochen habe der Wessely sein Lebtag nicht im Gesicht gehabt, spottete der Alte vom Praschak, dem die halbseidenen Aktivitäten seines Sohnes längst ein Dorn im Auge waren. Er verpasste ihm eine Kopfnuss, ohne zu wissen wofür. Der Mutter sagte er, dass sie nicht so schauen solle. Der Bastard wisse ganz genau, wofür er die Schläge kassiere. Er verbot seinem Sohn nicht nur den Umgang mit dieser Bagage, sondern verdammte ihn auch zu wochenlangen Diensten im Kühlhaus der Fleischerei.
Ein paar Tage nach dem Reinfall flatterte ein Brief ins Krankenbett vom Wessely. Die Nonnen gaben sich erstaunt, denn der Junge hatte noch nie Post erhalten. Trotzdem öffneten sie das Kuvert nicht. Vermutlich um Probleme zu vermeiden. Im Falle des Bleichen musste man immer auf Unannehmlichkeiten gefasst sein.
Der Wessely wartete, bis sich die Nonnen verflüchtigt hatten. Die freudige Überraschung ließ ihn für einen Moment die Schmerzen in seinem Gesicht vergessen. Der Geldscheißer-Franz hatte seinem Namen alle Ehre gemacht. Der Wessely zog die zwei Fünfziger heraus. Auf dem beigelegten Zettel stand nur ein Wort: Respekt. Die Initialen des Absenders G. F. kannte in Erdberg damals jeder, der sie kennen wollte. Da der Wessely für die nächste Bordellrunde ausfiel, teilte er die Beute zwischen dem Krutzler und dem Sikora auf. Die Respektsbekundung vom Geldscheißer-Franz hob er sich auf. Sie war ihm wertvoller als die zwei Fünfziger.
Die beiden Geldscheine hatten allerdings auf den Sikora und den Krutzler nicht die Wirkung, die er sich erhofft hatte. Gleichmütig übernahmen sie die Beute. Ob irgendwer gestorben sei?, fragte der Wessely. Ob sie etwas verbockt hätten? Ob sie sich gestritten hätten? Ob sie sich in dieselbe Frau verschaut hätten?
Letzteres traf schon eher zu, wobei es sich wesentlich prekärer verhielt. Die beiden schwiegen sich aus. Man löse das untereinander. Der Wessely vertrug es schlecht, wenn man ihn nicht einweihte. Außerdem war er der Ansicht, dass man die Finger von gewissen Frauen zu lassen hatte. Man könne viele Freunde, aber nur eine Liebe haben. Und wenn sich auch noch zwei Mannsbilder auf das gleiche Weibsbild würfen, dann sei das, als ob man sich um ein Kellerloch streite. Die Welt sei groß genug. Also entweder die beiden würden sich diese Frau wie Freunde eine Packung Zigaretten teilen oder beide vergäßen sie auf der Stelle wieder. Der Krutzler und der Sikora seufzten und sagten, dass er die Sache völlig falsch verstehe. Nein, auch die Karten seien der Sache nicht zuträglich. Dann gingen sie und der Wessely wäre in seinem Lebtag nicht draufgekommen, dass es sich um die Mutter vom Sikora handelte.
Der Sikora war der Sohn einer Hure, die halb Erdberg in die körperliche Liebe eingeführt hatte. Man sagte, sie habe sich sogar von ihrem eigenen Sohn dafür bezahlen lassen. Wobei, man munkelte viel, und dass der schlaksige Sikora ausgerechnet mit der gestauchten Sikora schlief, das glaubte eigentlich niemand. Aber es gab eine starke Verbindung zwischen Mutter und Sohn, weil der Sikora seinen Vater nie kennengelernt hatte. Nicht, dass die alte Hure den Namen nicht gekannt hätte. Sie verriet ihn ihrem Sohn bloß nicht. Warum? Weil es ihn nichts angehe. Ob er eine wichtige Persönlichkeit sei? Nein. Ob er verheiratet sei? Nein. Ob er besonders groß sei? Na, größer als sie sei bald wer. Ob er ein Zuhälter sei? Nein. Ob er ihn kenne? Vielleicht. Die Lieblosigkeit seiner Mutter war bestimmt ein Grund, warum das Herz vom Sikora später so frequentiert wie ein Laufhaus war. Der Sikora schaffte es, sich in jede letztklassige Hure zu verlieben. Und letztendlich waren es der Wessely und der Krutzler, die ihn oft vor dem Schlimmsten bewahrten.
In diesem Fall verhielt sich die Sache allerdings anders. Die Sikoramutter hatte es nämlich schon länger auf den jungen Krutzler abgesehen. Ihr war es völlig egal, ob er ein Freund ihres nichtsnutzigen Sohnes war. Eine wie die Sikora wusste: Am Ende bedeutete Freundschaft nichts. Auch die Liebe nicht. Für diese Erkenntnis hätte es all die Enttäuschungen gar nicht gebraucht. Jede Freundschaft wurde für fünf Minuten Geschlechtsverkehr verraten. Und die Liebe landete sowieso stets bei denen, die sie nicht verdienten. Als ob sie ein Produkt des Teufels wäre. Wie gesagt, die Sikora kannte ja den Vater vom Sikora. Mit erhobenem Haupte sei sie Hure geworden. Sie stehe jetzt auf der anderen Seite der Theke. Denn in Wahrheit gebe es nur zwei Arten von Menschen. Kunden und Anbieter. Und der Kunde sei nie König. Jemand, der glaube, er sei der König, sei in Wahrheit immer der Knecht, hatte die Sikora ihrem schlaksigen Nichtsnutz mit auf den Weg gegeben. Aber der interessierte sich nicht für die Lebensweisheiten seiner Hurenmutter. Verlass dich auf keinen Menschen. Nicht einmal auf dich selbst. Die Hure und der Dieb sind die einzigen freien Menschen. Ihnen kann keiner etwas anhaben.
Wobei die Sikora eine ehrgeizige Hure war. Für sie zählte nur, ob sie einen so weit brachte oder nicht. Das war eine messbare Größe. Und wenn nicht, dann nahm sie das persönlich. Da ihre Persönlichkeit wie ihr Körper von zwergenhaftem Ausmaß war, ließ sie so lange nicht locker, bis sie eines Mannes Herr geworden war.
Zwei Jahre lang widerstand ihr der Krutzler, obwohl sie ihn dafür bezahlt hätte. Der Gedanke, mit der Mutter eines Freundes geschlechtlich zu werden, stieß ihn ähnlich ab, wie mit seiner eigenen Mutter zu schlafen. Aber genau in der Woche, als der Wessely ausfiel und man deshalb von allen Einnahmen abgeschnitten war, gab er ihr nach. Aufgrund der monetären Durststrecke war es dem Krutzler verwehrt gewesen, die käuflichen Damen in Anspruch zu nehmen. Er hatte sich aber recht schnell an den häufigen Geschlechtsverkehr gewöhnt. Der Krutzler musste sich sowohl cholerisch als auch sexuell regelmäßig entladen, sonst drohte er aus der Haut zu fahren. Nach sieben Tagen Entzug hatte die alte Sikora ein leichtes Spiel. Der Riese soll die Zwergin förmlich in die Ohnmacht befördert haben. Man sagte, sie habe nicht genau gewusst, ob es mehr das Temperament oder die Libido gewesen sei, die sich Erleichterung verschafft habe.
Auf jeden Fall hatte der Sikora die beiden dabei erwischt. Wie ein kleiner Junge war er plötzlich im Zimmer gestanden. Ähnlich wie der Krutzler als Kind seinen Alten gestellt hatte. Ähnlich war auch dessen Reaktion. Er drohte dem schlaksigen Freund Prügel an, die ihn auf die Größe seiner Mutter korrigieren würden, wenn er nicht augenblicklich das Zimmer verlasse. Er war ganz sein eigener Vater geworden. Als er das merkte, schob er die Hure zur Seite und übergab sich so ausgiebig, bis er das Gefühl hatte, dass kein Partikel seines Alten mehr in ihm vorhanden war. Dann hatte er wortlos die Tür hinter sich zugeschlagen und den Sikora bis zum Besuch beim Wessely gemieden.
Als sie das Heim verließen, trotteten sie schweigend nebeneinanderher. Der Sikora schlurfte schlaksig und der Krutzler schleppte seine schweren Knochen. Beide gesenkten Hauptes. Stur wichen sie keinen Millimeter voneinander. Ohne ein Wort. Ohne Ziel. Ohne Verständigung. Sie schwiegen die Sache gemeinsam aus. Am Ende blieben sie stehen, sahen sich lange an und der Krutzler erdrückte den Sikora mit einer Umarmung, die diesen beinahe das Leben gekostet hätte.
Damit war die Sache gegessen. Ein paar Jahre später starb die alte Sikora an Syphilis, was halb Erdberg in Panik versetzte. Das war während des Krieges. Daher war ihr Sohn verhindert, am Begräbnis teilzunehmen. Vermutlich wäre er auch in Friedenszeiten nicht gekommen. Die Umstände hatten es nicht mehr erlaubt, dass sie ihm den Vater offenbarte. Das war auch nicht nötig. Der Sikora fand es später auch ohne sie heraus.
Als der Wessely nach vier Wochen zum ersten Mal das Heim verließ, machte man genau dort weiter, wo man aufgehört hatte. Man schwor sich, dass eine Frauengeschichte niemals ihre Freundschaft stechen dürfe. Das verhielt sich wie beim Kartenspiel, das die vier immer dann strapazierten, wenn Konflikte nicht zu lösen waren. Der Wessely hatte schon damals stets seinen gefürchteten Stoß dabei. Angeblich hatte er die Karten sein Leben lang nicht ausgetauscht. Sie brachten ihm Glück. Und Glück war das Gegenteil von Kischew. Wenn einer Unglück brachte, musste man sich dessen entledigen. Denn das Schicksal war wie ein zu warmer Mantel, den man ausziehen konnte.
Mit zunehmendem Alter gab es immer weniger Entscheidungen, die der Wessely nicht von den Karten treffen ließ. Man sagte, das sei ihm am Ende zum Verhängnis geworden. Jemand, der sich beim Kartenspiel aufs Glück verließ, verstand nichts vom Mischen. Das war ähnlich wie mit dem Schicksal. Wer keinen Plan hatte, musste an den Zufall glauben.
In den jungen Jahren gab es aber kaum Umstände, bei denen man die Karten sprechen ließ. Da ging es meistens um Frauen und dabei kam man sich so gut wie nie in die Quere. Der schlaksige Sikora verliebte sich schneller, als der Wind drehen konnte. Der grobschlächtige Praschak bevorzugte solche, bei denen es genügend zum Abschneiden gab. Der blutarme Wessely hatte überhaupt kein Interesse an ihnen. Er nahm daher jede, die er kriegen konnte. Und dem Krutzler ging es von Beginn an um das Geschäftliche. Er fühlte sich nur bei den käuflichen Damen daheim. Zusammengezählt hatten sie in weiblicher Hinsicht schon damals die Herrschaft über Erdberg inne.
Nur an einer bissen sie sich die Zähne aus. Sie hieß Muschkowitz, kurz Musch, war siebzehn Jahre alt und eine Männerfresserin, weil ihr der Feuervogel – so nannte man den rothaarigen Hausmeister, von dem nicht wenige glaubten, dass er der Teufel sei – bereits mit dreizehn einen Balg in den Unterleib bugsiert hatte. Bevor sie ihn aber zur Rechenschaft ziehen konnte, hatte sich dieser mittels eines Schlaganfalls auf die Baumgartner Höhe absentiert. Sabbernd saß er im Heim und ahnte nichts von seinem Kind, von dem er vermutlich ohnehin nichts wissen wollte.
Die Musch, die zwar klein, aber dafür umso unberechenbarer war, ließ keinen Mann näher als auf Schlagnähe an sich heran. Natürlich weckte das nicht nur den Sportsgeist vom Krutzler. Auch die anderen sahen es als eine Art Mutprobe an. Denn mit einer ernsthaften Eroberung rechnete niemand. Eher trachtete man danach, mit dem Leben davonzukommen.
Im Falle der Musch mussten die Karten entscheiden. Der Wessely mischte, jeder zog und die höchste Karte gewann. Das Erdberger Stoßspiel war noch primitiver als das gängige, das nur unter strenger Regulation der großen Galerie stattfinden durfte. Und wo es um ungeheuer viel Geld ging. Von einer echten Stoßpartie waren die vier damals noch so weit entfernt wie Erdberg von Madagaskar. Die höchste Karte zog der Krutzler und damit begann eine Geschichte, die ihn sein Leben lang begleiten sollte. Man konnte es nicht Liebe nennen. Eher eine Art Nahkampfdisziplin, bei der es darum ging, wer am Ende stehen blieb. Wobei der junge Ferdinand nicht unraffiniert zur Sache ging. Vorgegebenes Ziel war es, die Unterhose der Musch als Pfand einzuheimsen. Originell in Sachen Amour waren die vier schon in frühen Jahren nicht. Stellte sich nur die Frage, wie man einem Polyphem sein Heiligstes abnimmt.
Der Krutzler entschied sich für eine Art Trojanisches Pferd. Und spielte es über den damals vierjährigen Herwig, der nicht nur die roten Haare seines Vaters geerbt hatte, sondern auch die Gemütsschwankungen seiner Mutter. Er galt als unnahbar und außer mit seiner Mutter sprach er mit niemandem. Lange wurde er deshalb für stumm gehalten. Es sei eben nicht jedes Kind mit Sommersprossen niedlich. Dieser Herwig sei eine richtig hinterfotzige Sau, sagten viele. Da man aber die Mutterliebe der Musch mehr fürchtete als jede Naturkatastrophe, machte man einen Bogen um das Kind. Vielleicht wäre die Geschichte mit dem Herwig später anders ausgegangen, wenn man ihm wenigstens einen Freund zugestanden hätte.
Den Krutzler schreckte das naturgemäß nicht ab. Er konnte immer mit den Schwierigen besser als mit den Einfachen. Einer, der allen gleich sympathisch sei, stelle sich später mit Sicherheit als mordstrumm Unsympathler heraus. Umgekehrt sei niemand nur ein Arschloch, so gesehen seien ihm die sogenannten Arschlöcher auf Anhieb weniger suspekt gewesen, weil sie meistens ihre guten Seiten vor den anderen nur verborgen hielten. Schließlich gehe es im Leben nicht darum, was einem offenbart, sondern was einem vorenthalten werde. Von der Schatzsuche verstand der Krutzler schon damals mehr als die anderen. Das nannte man Menschenkenntnis.
Zum Herwig fand er sofort einen Zugang, weil der Krutzler dessen Achillesferse kannte. Denn bereits im zarten Alter von vier hatte der Rotschopf eine Vorliebe für animalische Raritäten. Ein Laster, das wiederum dem Herwig später zum Verhängnis wurde und woran der Krutzler nicht ganz unschuldig war.
In den Dreißigerjahren war es in Erdberg kein Leichtes, jemanden mit einer exotischen Spezies zu versorgen. Allerdings war es dem Krutzler gelungen, ein prachtvolles Exemplar einer Vogelspinne zu ergattern, das er dem Herwig in einer Schuhschachtel zum Spielen überließ. Das Vergnügen währte nicht lang. Denn als die Musch von etwas zurückkam, über das sie nie redete, über das man aber in ganz Erdberg munkelte, saß das fette Untier auf Herwigs Schulter, was zu einer Reaktion führte, die selbst der Krutzler nicht für möglich gehalten hätte.
Die Musch kannte keine Angst. Selbst eine Armee Erdberger Halbstarker vermochte ihr keinen Respekt einzuflößen. Aber beim Anblick dieser Spinne boxten ihre Fäuste gegen unsichtbare Windmühlen. Sie schrie wie am Spieß. Nicht einmal bei der Geburt ihres Balgs hatte sie so geschrien. Die Nachbarschaft ging in Deckung und rechnete mit Mord. Doch der Krutzler fasste sie an der Gurgel und unterbreitete ihr ein Angebot, das kurzfristig Frieden, langfristig aber Krieg bedeutete. Denn selbst als die Herzen der beiden aufeinander einschlugen, wurde dieses damals begonnene Spiel nie beendet. Am Ende ihres Lebens waren sie sich nichts schuldig geblieben. Widerwillig händigte ihm die Musch ihre Unterhose aus. Im Gegenzug befreite der Krutzler ihren Sohn von dem Ungetüm. Er solle sich damit sein Schwanzgift wegwischen, wenn er von ihr träume, fauchte sie. Stattdessen legte er die Unterhose säuberlich in seine Schatzkiste, wo er sonst nur Geld und Waffen aufbewahrte.
Der ausgezehrte Wessely, der riesige Krutzler, der schlaksige Sikora und der vierschrötige Praschak. Später dann der Bleiche, der Notwehrspezialist, der Zauberer – nur der Praschak blieb der Praschak, weil man über seine eigentliche Qualität schon immer kein Wort verlieren durfte. Als Sohn des Fleischers hätte er eigentlich ausgesorgt gehabt, weil Fleisch wurde in Erdberg immer gegessen, selbst als es keines gab. Aber im zarten Alter von siebzehn stand man verständlicherweise lieber Schmiere, als dass man irgendwelche Schweinshaxen zerlegte.
Schnell gab man sich nicht mehr mit kleinkarierten Gaunereien zufrieden. Man machte sich selbstständig, auch wenn der Erdberger Markt ein regulierter war. Die Herren der großen Galerie sahen es nicht gern, wenn man sich über ihre Herrschaft hinwegsetzte, aber gleichzeitig goutierte man die Zielstrebigkeit der neuen Generation. Solange es mit Stil passierte, drückte man ein Auge zu. Und Stil konnte man den vieren nie absprechen. Sie begriffen schnell die Bedeutung einer persönlichen Handschrift.
Die Erdberger Spedition, wie die vier ihre Unternehmung nannten, hatte sich weniger auf das Bringen als auf das Abtransportieren von Dingen spezialisiert. Wobei die Aufgabenstellung klar verteilt war. Der Sikora konnte schon damals durch Wände gehen. Kein Schloss, das sich nicht auf seine Bitte öffnete. Der Wessely spähte die infrage kommende Kundschaft aus und der Krutzler, der mit seinem Salär noch immer den schönen Gottfried und den Rest der Familie durchfütterte, konnte eine Wohnung in weniger als zehn Minuten evakuieren. Diese Handschrift rang selbst den alten Galeristen Respekt ab. Da waren junge Persönlichkeiten am Werk. Das goutierte man. Und deshalb ließ man ihnen ihre Entwicklung.
Natürlich musste man vorsichtig agieren. Die Evakuierung einer Liegenschaft war kein Hundertertrick. Man hatte aus der Geschichte mit dem Geldscheißer-Franz gelernt. Übermut war der Feind des Erfolges. Man einigte sich darauf, nie mehr als eine Wohnung im Monat auszuräumen. Eine umso größere Bedeutung kam dadurch dem Wessely zu. Wochenlang spähte er Häuser aus, um das geeignete Objekt zu finden. Er gab sich als Handwerker, Postmann, Makler oder Vertreter aus, um Einblick in diverse Immobilien zu erhalten. Er sagte, man könne sich gar nicht vorstellen, wie manche Leute hausen. Wenn man bedenke, dass Gott Einblick in alle Existenzen habe, verstehe man dessen Abwesenheit.
Der Wessely trug seine Beute stets bei sich. Im Futter seiner Lederjacke, die er nie auszog, hatte sich mehr Geld angesammelt als in gängigen Schweizer Schließfächern. Der Wessely war davon überzeugt, dass er selbst uneinnehmbarer als jeder Tresor war. Der Sikora versteckte sein Hab und Gut bei unterschiedlichen Frauen. Da man ohnehin keiner trauen könne, achtete er darauf, dass sich die Damen nicht kannten. Der Praschak hob sich gar nichts auf. Er investierte alles in die Fleischerei. Vermutlich aus schlechtem Gewissen gegenüber dem Vater, der in diesem Fall nicht lang fragte, woher das Geld stammte. Und der Krutzler hatte sich für die Frau im Turban entschieden, die er unter dem Parkettboden der Tante Elvira versteckt hielt.
Ihr Blick betörte ihn. Ihre schwarz geschminkten Augen verhießen Unerreichbarkeit. Die Brosche mit den ägyptischen Ornamenten gab keine Geheimnisse preis. Der schwarze Hintergrund verriet keinen Ort. Die leichte Verächtlichkeit in ihrem Blick. Er fragte sich, welche Farbe ihre orientalischen Kleider hatten. Er schätzte Gold und Rot und Türkis. Aber er konnte es sich nicht vorstellen. Egal, wie lange er das schwarz-weiße Bild anstarrte. Woher kam sie? War sie Engländerin, Deutsche, Französin? Vielleicht sogar Lettin? Alles schien möglich. Er wusste nichts. Aber ihr Blick fing ihn jedes Mal, wenn er frische Beute in die Schatulle legte, deren Deckel die Fotografie dieser Frau zierte.
Der Krutzler hatte seine Schatzkiste einem besonderen Coup zu verdanken. Obwohl der Wessely natürlich nicht geahnt hatte, welchen Glücksfall er da ausgesucht hatte. Es war die Bleibe eines jungen Mannes, der angeblich mit Wohnungen reich geworden war. Da er Banken offenbar nicht vertraute, hob er sein gesamtes Vermögen in ebendieser Schatulle auf, die der Krutzler später im Parkettboden der Tante Elvira versteckte. Und dieses Vermögen war beträchtlich. Zumindest für die vier Erdberger, die gerade ihr achtzehntes Lebensjahr vollendet hatten.
Aufgrund der Menge des gefundenen Geldes hatte sich natürlich die Frage gestellt, ob man die Wohnung überhaupt evakuieren sollte. So eine Räumungsaktion stellte ein Risiko dar. Während der Praschak unten Schmiere stand und noch nichts ahnte von dem Fund, wurde oben gestritten. Der Riese, der in wenigen Minuten ganze Wohnungen zerlegen konnte, fühlte sich nicht nur um den halben Spaß betrogen, sondern war auch der Ansicht, dass man gerade in solchen Fällen nicht auf die Handschrift verzichten durfte. Er empfinde es als Übermut, großspurig auf die Einnahmen des Interieurs zu verzichten. Übermütig wäre es viel eher, jetzt gierig zu werden, so der Wessely. Man müsse wissen, wann es genug sei. Er, der Krutzler, könne als Erinnerung gerne die Schatulle behalten. Aber der Rest bleibe hier. Der Sikora begann nervös auf seinen langen Beinen herumzuzappeln. Wenn man noch lang diskutiere, dann könne man sich gleich selbst die Handschellen anlegen.
Wie meistens gewann die Sturheit vom Krutzler. Trotzig hielt er seine Arme verschränkt und drohte unverrückbar stehen zu bleiben, wenn man sich nicht an die Statuten der Erdberger Spedition halte. Ob er jetzt völlig deppert sei, fluchte der Wessely. Man sei ja nicht bei einem beschissenen Verein. Widerwillig begann er die Wohnung auszuräumen. Der Nachbar fragte die Spediteure, wohin der sympathische junge Mann denn ziehen würde. Nach Timbuktu, gab der missgelaunte Wessely zurück. Beinahe wäre ihm der falsche Schnurrbart von der Oberlippe gerutscht. Ob sie Brüder seien? Der Herr solle nicht so neugierig sein, fauchte der Bleiche. Der Sikora musste dazwischengehen. Ja, Brüder. Der alte Mann musterte die drei. Außer den Schnurrbärten würden sie gar keine Ähnlichkeit aufweisen, stellte er misstrauisch fest. Worauf der Krutzler nur meinte: Unterschiedliche Mütter. Mütter? Nicht Väter? Nein, Mütter. Das sei selten, so der alte Mann, der genau das zu Protokoll gab, als ihn die Polizei später vernahm. Mehr falle ihm nicht ein. Auch daran war die Polizei gewohnt. Man kannte inzwischen die Handschrift der Erdberger Spedition. Trotzdem gelang es nicht, sie zu überführen.
Die vier verstanden ihr Metier als Kunst. Aber anders als der Kunstmaler, der Jahre zuvor noch wenige Hundert Meter Luftlinie entfernt gewohnt hatte. Der wähnte sich auch in der Politik als Künstler, wäre aber besser Maler geblieben. Trotzdem schien das Schicksal der Erdberger Buben und des Führers auf unsägliche Weise miteinander verstrickt zu sein. Denn es war jener Großverbrecher, der aus den Kleinganoven der Vorkriegszeit die Großverbrecher der Nachkriegszeit machen sollte.
Der Tag, der alles veränderte, war der Tag des Anschlusses. Am 15. März 1938 stand halb Wien bei Kaiserwetter am Heldenplatz. Die Straßen waren leer gefegt. Außer Weihnachten hätte es keinen idealeren Tag für Evakuierungen gegeben. Und so täuschten die damals gerade volljährigen Burschen vor, sich für den Führer schön anzuziehen, um eine Arbeitsschicht einzulegen. Der Nazi-Huber sagte später, die Tatsache, dass sie den Führer als Alibi missbraucht hätten, käme einer Blasphemie gleich und verschärfe die Angelegenheit enorm.
Der Nazi-Huber hatte zuvor schon viele Götter angebetet. Zuerst den Kaiser, dann den Dollfuß, jetzt den Führer. Die alte Krutzler nannte ihn einen Springer. Und ganz Erdberg lachte hinter seinem Rücken, auch wenn es da wenig zu lachen gab, denn während der Nazizeit baute sich der Huber seine eigene Spedition auf, die sich um die liegen gelassenen Wohnungen der Juden kümmerte. Der Nazi-Huber war kein Ideologe, sondern eine richtige Sau, von der man eine ähnliche Meinung hatte wie von Kinderschändern im Gefängnis. Und so schob er von Anfang an Hitler vor, obwohl es natürlich nur um ihn selbst ging, denn die Burschen hatten nicht ganz zufällig die Wohnung vom Nazi-Huber evakuiert. Einerseits, weil sie von ihm sicher waren, dass er am Heldenplatz stand. Andererseits, weil man dem aufgeblasenen Nazi einen Denkzettel verpassen wollte. Insofern konnte man das Ganze auch als politischen Widerstand deuten, was natürlich dem Nazi-Huber zusätzlich in die Hände spielte. Weil mit Kritik konnte der Gröfaz schon damals nicht umgehen.
Auf jeden Fall war der Nazi-Huber nach der Hitlerrede beseelt heimgekommen. Er hatte eine ganze Entourage an Lakaien und leichten Mädchen dabei. In aufgekratzter Vorfreude auf die stattzufindende Orgie sperrte er seine Palaiswohnung auf. Diese hatte er sehr günstig einem jüdischen Kaufmann abgeluchst, der die politische Großwetterlage rechtzeitig erkannt und seine Beine in die Hand genommen hatte, solange es noch ging.
Der Nazi-Huber wollte gerade zu einem triumphalen Monolog vor der Entourage ansetzen. Der spätere Sturmbannführer kam aus kleinen Verhältnissen. Dementsprechend wichtig war ihm alles, was groß war. Man hatte den Eindruck, sein eingefrorenes Gesicht falle vom vierten Stock runter auf die Straße und zerschelle dort vor den Augen der feiernden Nazibrut, als er die ausgeräumte Wohnung sah. Nicht einen Sessel hatten sie stehen gelassen. Schlüsselfertig. Gerade, dass sie nicht auch noch den Boden aufgewischt hatten. Einer der Schergen scherzte, ob der Herr Sturmbannführer erst einziehe.
Mehr hatte der arme Kerl nicht gebraucht. Mit Humor taten sich die Nazis noch schwerer als mit Bolschewiken. Dem armen Scherzer wurde aufgetragen, die Übeltäter zu finden. Sollte ihm das bis zum Abend nicht gelingen, würde man an ihm ein Exempel statuieren, was passiere, wenn man sich über den Führer lustig mache. Dass sich der Scherz auf den Nazi-Huber und nicht auf den Führer bezog, das verbiss sich der Scherzer. Auch wenn es ihm schwerfiel. Da ihm sein Leben, das jetzt plötzlich voller Hoffnung auf Karriere und Reichtum war, gerade sehr wertvoll erschien, strengte er sich an, die Schuldigen zu finden. Mit SA- und SS-Uniformierten zog er durch Erdberg, drohte, versprach, erpresste so lange, bis die in Wien gut geölte Denunziationsmaschine angeworfen war und gegen späten Nachmittag die ersten Hinweise eintrafen.
Noch vor dem Abendessen hatten sie den Krutzler, den Wessely und den Sikora verhaftet. Nur der Praschak war davongekommen. Sein Vater, ein alter Sozialist ohne Nationalstolz, hatte seinen einzigen Sohn gedeckt. Gleichzeitig hatte er dessen Not dazu benutzt, ihm das Versprechen abzuringen, die Fleischerei zu übernehmen. Ansonsten würde er den Dreckspatz, so nannte er seinen Sohn in zärtlichen Momenten, an die Nazibrut ausliefern. Weiß der Teufel, was denen dann einfalle. Wie die Viecher seien die Herrenmenschen. Der Fleischer hasste die Nazis noch mehr als die Katholiken.
Und tatsächlich konnte der junge Praschak froh sein, auf so große Vaterliebe gestoßen zu sein. Denn schon kurze Zeit später brachte man den Wessely, den Krutzler und den Sikora zum Westbahnhof und setzte sie in einen Zug nach Dachau. In Summe waren sie siebenundfünfzig Jahre alt. Und danach war nichts mehr, wie es zuvor gewesen war.
Die große Reise
Als die Krutzlermutter von der Deportation ihres Sohnes erfuhr, sagte sie nur, dass sie von Anfang an kein gutes Gefühl bei dem Bastard gehabt habe. Schon bei der Geburt habe sie gespürt, dass alles nur vergebene Mühe gewesen sein würde. Was mache es für einen Sinn, einem Kind das Laufen, das Sprechen und das Essen beizubringen, wenn es am Ende ohnehin vor einem sterbe.
Ihre Schwester Elvira fragte sich, wer in Zukunft für den Unterhalt aufkommen würde. Schließlich wohne die ganze Bagage in ihrem Haus und liege ihr auf der Tasche. Sie habe sich über die letzten Jahre einen gewissen Standard erarbeitet und sehe jetzt nicht ein, von diesem abzuweichen. Sie lachte sich schließlich einen Arier mit tschechischem Namen an, der die Aufgaben des jungen Krutzler schnell übernahm. Schließlich waren die Verbrecher an der Macht und verunmöglichten es naturgemäß den anderen Verbrechern, ihrer Tätigkeit nachzukommen.
Die Elvira brauchte aufgrund der neuen Situation ganz plötzlich Lebensraum und stellte die verbliebenen Krutzlers vor die Tür. Da ging der Alten vermutlich für einen kurzen Moment ihr Jüngster ab, weil auf den schönen Gottfried in finanziellen Dingen kein Verlass war. Ihr blieb nichts anderes übrig, als sich bei einem alten Juden namens Goldberg einzuschmeicheln, der offenbar ein schiefes Auge auf den schönen Gottfried geworfen hatte, was die alte Krutzler zwar nicht goutierte, aber für sich nutzte. Als Ergebnis ihrer freundschaftlichen Zuwendung vermachte ihr Goldberg ein Haus im Strombad Kritzendorf. So erzählte es zumindest die alte Krutzler jedem, der nach fünfundvierzig gefragt hatte. Faktum war, dass es den alten Goldberg aufgrund der widrigen Umstände von der Donau nach Übersee zog und er die beiden Vertrauenspersonen bat, das Haus im Hochwassergebiet für ihn unter die Fittiche zu nehmen.
Unter die Fittiche hieß konkret, dass er der Krutzler das Haus überschrieb, damit es nicht in germanische Hände fiel. Selbstverständlich in der Annahme, dass die Krutzler, nachdem das Intermezzo der Herrenmenschen überwunden sein würde, rückerstattete, was nicht ihr gehörte. So verbrachte die Krutzler die Kriegsjahre im Stelzenhaus an der Donau und wartete auf ein Hochwasser, das nie kam. Der schöne Gottfried durfte ab achtunddreißig endlich seiner Fliegerleidenschaft nachgehen und schickte ihr die Ansichtskarten, die den Krieg wie eine organisierte Rundreise erscheinen ließen. Mit der Elvira sprach sie bis zu ihrem Tod kein Wort mehr. Erst als diese braun gebrannt unter der Erde lag, ging sie ihre Schwester täglich besuchen. Wahrscheinlich, weil sie nicht mehr zurückreden konnte.
Der Krutzler, der Wessely und der Sikora gingen also niemandem ab. Das spürten die drei sofort. Nicht einmal der Praschak war am Bahnhof erschienen. Der musste bereits in der Fleischerei seine Dienste versehen. Nur die Musch winkte von Weitem. Sie hatte keine Angst vor den Nazis. Aber sie staunte nicht schlecht, als sie dort die halbe Wiener Prominenz aufgefädelt stehen sah. Den kenne sie, den kenne sie. Woher? Aus der Zeitung, sagte sie dem Krutzler. Also wenn da so viel Prominenz mitreise, würde es bestimmt nicht schlimm werden. Vielleicht werde der Krutzler von dem einen oder anderen sogar ein Autogramm ergattern. Man komme ja selten mit so viel Persönlichkeiten zusammen. Der Krutzler fragte, ob sie jetzt völlig deppert sei. Daraufhin steckte sie ihm eine Unterhose zu. Wenn ihm die Nazis auf die Nerven gehen würden, dann solle er daran riechen. Sie habe ein besonderes Odeur für ihn zusammengebraut. Alles handgemacht, sagte sie. Und zwinkerte ihm zu. Er solle ja nicht vergessen, dem Herwig ein Geschenk mitzubringen. Der sei ganz enttäuscht, dass sie ihm die Vogelspinne weggenommen habe. Dann wurden die drei unsanft in den Zug bugsiert. Und selbst die Musch hatte kein gutes Gefühl.
Die drei stiegen schon als Persönlichkeiten in den Zug. Aber als sie zurückkamen, waren sie geschliffene Diamanten. Weniger was den Glanz als was die Härte betraf. Im Zug war der Krutzler fast ein wenig stolz, dass er mit so vielen Berühmtheiten inhaftiert wurde. Das war gut für den Stand. So viele Brillenträger hatte er sein Lebtag noch nicht gesehen. Gegenüber von ihm saß der Wessely, der sich schon nach Ausreißmöglichkeiten umsah. Das erkannte der Krutzler sofort. Vergeblich allerdings. Auch das erkannte er sofort.
Der Sikora, der ein paar Reihen weiter saß, starrte auf sein Gegenüber, der seine Blicke nicht bemerkte, weil er wie besessen Worte zwischen Noten kritzelte. Offenbar war der Librettist stark kurzsichtig. Er hatte für seine Arbeit die runde randlose Brille abgelegt, was ihn vollends von der Welt zu trennen schien. Der Sikora starrte ihn unverhohlen an. Aus diesem Geschöpf war sie entstanden. Er hatte sie gezeugt. War es schnell gegangen? War er laut gewesen? War es dunkel oder hell gewesen? Tag oder Nacht? Liebe oder Hass? Würde der Sikora seinen Vater erkennen, wenn er ihm gegenübersäße? Er prägte sich die Ähnlichkeiten ein wie Puzzlesteine, damit er sie jederzeit zu ihrem Gesicht zusammensetzen konnte.
Er hatte sie nur kurz am Bahnhof gesehen. Wie sie ihrem Vater die Notenblätter zusteckte, als hätte er sie für einen Arbeitstermin vergessen. Als hätte das Werk einen Abgabetermin, der unbedingt eingehalten werden müsste. Als könnte die Unterbrechung der täglichen Routine den sofortigen Tod bedeuten.
Ihre spitze Nase. Ihre grünen Augen. Ihr hochgestecktes braunes Haar. Ihre langen dünnen Finger. Ihre geschwungenen Backenknochen. Ihre souveränen Lippen. Er hatte die Librettistentochter angesehen, wie man jemanden ansah, von dem man wusste, dass man ihm wiederbegegnen würde. Er hatte ihr einen Blick zugeworfen. Einer, der sie kurz aus ihrem Schlafwandel gerissen hatte. Er hatte sie sofort geliebt. Vermutlich weil er keine Noten lesen konnte. Man sagte, viele danach hätten der jungen Frau ähnlich gesehen. Aber keine hätte das Puzzle vollendet.
Der Sikora sah den Vater an. Sollte er ihn ansprechen? Würde er ihm von seiner Tochter erzählen? Würde nicht jedes Wissen die Insel verkleinern? Jetzt war sie ein Kontinent, in dem alle Klimazonen vorkamen. Das durfte er nicht gefährden. Lieber starrte er auf den Mann wie auf ein Stück Landschaft, das einem gefällt, das einem aber nichts zu erzählen hat. Verschlossene Menschen weckten stets den Einbrecher im Sikora. Erst jetzt sah er den handschriftlichen Titel, der über den stummen Noten geschrieben stand. Zu viele Hunde sind des Hasen Tod.
Keiner der drei sprach später mit irgendjemandem über das, was in diesen Jahren passiert war. Wenn einer fragte, dann waren sie in Klausur gewesen. Mehr war aus keinem rauszukriegen. Die Klausur sollte aber alles ändern. Nur eines blieb gleich. Nämlich die ewige Freundschaft, die sie sich partout ein paar Tage vor der Verhaftung geschworen hatten. Ein Ehrenkodex, der gebot, stets für den anderen sein Leben aufs Spiel zu setzen, nichts zu verraten und das Eigentum der Freunde auch als das eigene anzusehen. Das bezog sich sowohl auf Gegenstände als auf Frauen. Da machten die drei keinen Unterschied.
Untermauert wurde dieser Schwur durch ein Ritual, das gleichzeitig eine Absicherung darstellte. Weil Schwur war gut. Aber deshalb traute man einem anderen Erdberger noch lange nicht über den Weg. Mit Blut unterzeichnete man einen Vertrag, der festhielt, dass jedem der drei bei den anderen ein Wunsch freistand, den derjenige unter gar keinen Umständen ablehnen durfte. Selbst wenn man nach seinem Leben trachtete. Genau genommen war ein Todeswunsch mit einem Gegenwunsch zu neutralisieren. Man sollte also behutsam mit seinen Begehrlichkeiten umgehen. Sollte man dem Wunsch nicht nachkommen, würde das gesamte Vermögen auf die beiden anderen übergehen.
Ob das juristisch hielt oder nicht, war im Wesentlichen egal. Ein Schwur zählte mehr als jedes Gesetz und stand sogar über dem Willen Gottes, von dem in Erdberg gar nicht so wenige fürchteten, dass es ihn gab.
In Dachau wurde den Prominenten ein großer Empfang bereitet. Sie sorgten schon beim Appell für eine mordstrumm Gaudi. Man stellte die Juden nackt in einer Reihe auf und stellte mit ihnen Späße an, die noch über Jahrzehnte im deutschen Humor nachhallten. Mehrere SS-Kommandanten musterten die Prominenten, ob sie für körperliche Arbeit taugten. Die meisten Intelligenzler konnten die Blicke nicht halten, weil man ihnen die Brillen abgenommen hatte und vor ihren Gesichtern nur verschwommene Gestalten auftauchten, die auf sie zeigten oder nicht. Ohne Brille überlebte keiner lange im KZ. Auch der Librettist musste hervortreten. Offenbar hatte man für seine Texte keine Verwendung. Es brauchte nur drei Schläge, bis er tot zusammensackte. Sein unvollendetes Werk verschwand in der Effektenkammer, wo man die Habseligkeiten der Insassen in Kuverts archivierte.
Ein paar Wochen später wurde auch seine Tochter unvollendeter Dinge aus dem Leben gerissen. Und auch hier bewies das Schicksal seine unbändige Lust an der Ironie. Denn der Wunsch vom Sikora, sie zumindest ein zweites Mal zu sehen, wurde zwar erfüllt, möblierte aber sein Herz mit einer Leere, die sich ein Leben lang nicht mehr evakuieren ließ.