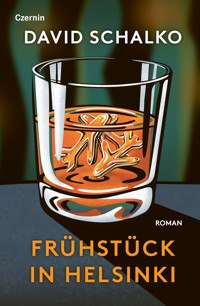19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer sind wir ohne Arbeit? Was brauchen wir zum Leben? Was macht uns aus? David Schalkos »Was der Tag bringt« ist ein bestechender Kommentar auf unsere sich radikal verändernde Arbeitswelt – ein Roman, komisch und aufwühlend bis zuletzt. Eine brillante Groteske über unsere postpandemische Gegenwart. Felix ist Ende dreißig, Single und Unternehmer. Mit seinem Start-up für nachhaltiges Catering ist er, endlich, auf einem guten Weg. Dann aber kommt die Pandemie, bleiben die Aufträge aus, gewährt ihm die Bank keinen weiteren Kredit. Felix muss die Firma schließen und sich reduzieren, muss Auto, Möbel, Schmuck verkaufen, um wenigstens die von der Mutter geerbte Wohnung behalten zu dürfen. Um über die Runden zu kommen, ist er fortan gezwungen, die Wohnung monatlich für acht Tage zu vermieten. Monat für Monat zieht Felix also von Gästecouch zu Gästecouch, verstrickt sich vor Scham in bizarren Geschichten, gerät mit guten Freunden aneinander, zweifelt, taumelt durch die Ruinen seines früheren Lebens, sucht nach einem Sinn, der nicht in der Arbeit liegt, und zieht sich schließlich immer weiter zurück, wird sich selbst fremd, fällt und fällt. Wo schlägt er auf? Wer kann ihn halten? Mit unnachahmlichem Witz und Scharfsinn erzählt David Schalko von einem, dem das Leben entgleist und die Gesellschaft abhandenkommt, der um Existenz und Sinn ringt in einer ihm immer fremder werdenden Welt. »Was der Tag bringt« ist ein faszinierendes Psychogramm der Post-Covid-Gesellschaft und ein Text, der die großen Fragen der Zeit mit erzählerischer Leichtigkeit verhandelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
David Schalko
Was der Tag bringt
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über David Schalko
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über David Schalko
David Schalko, geboren 1973 in Wien, lebt als Autor und Regisseur in Wien. Bekannt wurde er mit revolutionären Fernsehformaten wie der »Sendung ohne Namen«. Seine Filme und Serien »Aufschneider«, »Braunschlag«, »Altes Geld«, »Ich und die Anderen« und das Remake von »M – eine Stadt sucht einen Mörder« wurden mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt erschienen seine Romane »Schwere Knochen« und »Bad Regina«.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Felix ist Ende dreißig, Single und Unternehmer. Mit seinem Start-up für nachhaltiges Catering ist er, endlich, auf einem guten Weg. Dann aber kommt die Pandemie, bleiben die Aufträge aus, gewährt ihm die Bank keinen weiteren Kredit. Felix muss die Firma schließen und sich reduzieren, muss Auto, Möbel, Schmuck verkaufen, um wenigstens die von der Mutter geerbte Wohnung behalten zu dürfen. Um über die Runden zu kommen, ist er fortan gezwungen, die Wohnung monatlich für acht Tage zu vermieten. Monat für Monat zieht Felix also von Gästecouch zu Gästecouch, verstrickt sich vor Scham in bizarren Geschichten, gerät mit guten Freunden aneinander, zweifelt, taumelt durch die Ruinen seines früheren Lebens, sucht nach einem Sinn, der nicht in der Arbeit liegt, und zieht sich schließlich immer weiter zurück, wird sich selbst fremd, fällt und fällt. Wo schlägt er auf? Wer kann ihn halten?
Mit unnachahmlichem Witz und Scharfsinn erzählt David Schalko von einem, dem das Leben entgleist und die Gesellschaft abhandenkommt, der um Existenz und Sinn ringt in einer ihm immer fremder werdenden Welt. »Was der Tag bringt« ist ein faszinierendes Psychogramm der Post-Covid-Gesellschaft und ein Text, der die großen Fragen der Zeit mit erzählerischer Leichtigkeit verhandelt.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Danksagung
Zitatnachweis
Abbildungsnachweis
Nichts ist so heilsam wie eine menschliche Berührung.
Bobby Fischer
Für Tobias
Felix erhielt einen Anruf. Sonst nichts. Keiner kam, um ihn zu verhaften. Nur die Stimme des Bankberaters, die sagte, sie würden ihm den Hahn abdrehen. Dafür müsse er aber persönlich vorbeikommen.
– Wenn es nach mir ginge, dann natürlich nicht. Aber sie, also die anderen, nein, nicht einmal sie, vielmehr der Algorithmus, gegen den ist man machtlos.
Der Bankberater faltete die Hände. Und Felix nahm die Brille ab. Um ihn nicht mehr deutlich sehen zu müssen. Um den Nachdenklichen zu geben. Um der Ernsthaftigkeit der Lage mit einer ernsthaften Geste zu begegnen. Um vermeintlich die Waffen zu strecken.
– Es ist eine ganz einfache Rechnung, so der aufgekratzte Bankberater. Hier die Kurve. Der Kontostand der letzten 24 Monate. Wenn das deine Herzfrequenz wäre, dann gute Nacht! Aber eines ist erkennbar. Der Rahmen wurde seit Monaten überschritten. Da ist kein Spielraum mehr. Überstrapaziert. Jetzt geht es darum, wieder hineinzusteigen. Der Versuch des Bankberaters, mit den Händen einen Rahmen nachzubilden.
– Ich werde dich selbstverständlich nicht hängen lassen. Das Persönliche steht immer über dem Geschäftlichen. Schließlich kennen wir uns nicht erst seit gestern.
Ob der Bankberater auch am Wochenende Anzüge trug? Felix begann seine Brille zu putzen. Eine Geste der Reue? Der Ordnung? Der Gelassenheit? Der Ignoranz? Der Provokation? Der Verstimmung? Der Resignation?
– Never kill the messenger, scherzte der Anzugträger. Nichts für ungut. Wir kriegen das schon hin. Wäre doch gelacht. Mit achtunddreißig steht dir noch das halbe Leben bevor.
Felix fühlte sich krank. Nein. Erschöpft.
– Man muss da jetzt Kampfgeist zeigen.
Ein Lächeln wie ein Schulterklopfen.
– Pferde satteln. Weiterreiten.
Fragte sich nur, wohin. Die Kurve des Bankberaters zeigte vermutlich immer nach oben. Felix hatte noch nie zu jenen gehört, deren Kontostand proportional zum Lebensabschnitt wuchs. Die glaubten, so ein Leben funktioniere wie ein Computerspiel. Von einem Level zum nächsten. Und sich dann wunderten, dass am Ende Game over blinkte, obwohl sie alles richtig gemacht hatten.
Den vorläufigen Höchststand hatte Felix bereits mit achtzehn erreicht. Gut: eine Erbschaft. Aber er war Mutter nichts schuldig geblieben. 50 Prozent solide. 50 Prozent Investment. Und in der Wohnung wohnte er schließlich heute noch. Ja, noch. Sie würde es ihm nie verzeihen, wenn er die Wohnung ihrer Kindheit verkaufte. Obwohl nichts mehr darauf hinwies. Er hatte alles entsorgt. Nein. Er hatte alles in den Keller geräumt. Zumindest das Wesentliche. Auch er hätte es nicht übers Herz gebracht, die Sachen der Großeltern in den Müll zu werfen. Stattdessen lagerten sie ebenfalls im Keller. Eine Art Zwischenstation, um des Friedens willen. Obwohl es ihnen egal sein konnte. Schließlich waren sie tot. Alle waren sie tot. Bis auf Vater. Alle lebten sie weiter. Und hatten sich in ihm eingenistet. Wenn er in den Spiegel sah, erkannte er den Vater. Wenn er die Augen schloss, vermisste er die Mutter. Und wenn er in den Keller ging, besuchte er die Großeltern. Was bliebe von ihm, wenn er sie alle löschen könnte?
Der Bankberater blätterte in den Unterlagen. Das gehörte wohl zum Ritual. Er war einer der Ersten gewesen, die er kennenlernte, als er in der Großstadt aufschlug. Er kam, um ein Konto zu eröffnen. Und er kam nicht ohne Ideen. Carpe diem. Aber so einen Rahmen musste man sich erst verdienen. Der Beginn einer Freundschaft. Niedrigste Pflegestufe. Alle paar Wochen ein paar Bier nach der Arbeit. Nie privat. Immer Anzug. Schließlich hatte er Potenzial. Und Kapital.
Mit achtzehn hatte er sein Erbe endlich antreten dürfen. Das war kein schöner Anblick. Auch so eine Wohnung verweste. Dieser Geruch. Mindestens so ekelerregend wie Friedhofspflanzen, wenn sie in trübem Wasser verwelkten. Nach Mutters Tod hatte man die Großelternwohnung sich selbst überlassen. Felix hatte die alte Putzfrau dann wiedereingestellt, nachdem sie der Vater Jahre zuvor entlassen hatte. Warum solle man eine leere Wohnung putzen? Das sehe er nicht ein. Das sei, als ob man ein Grab pflegen würde. Mutter habe sie jahrelang nur aus schlechtem Gewissen beschäftigt. Swetlanas beleidigter Blick. Hätte man ihr nicht gekündigt, wäre die Wohnung in einem anderen Zustand gewesen. Die Sachen der Mutter hatte der Vater gleich nach dem Begräbnis entsorgt. Da wurde nicht lange gefackelt. Danach waren sie aufs Land gezogen. Wie hätte er sich als Achtjähriger wehren sollen? Auffällig schnell war Helga in Vaters Leben aufgetaucht. Eine Hiesige.
Ab da hatte Felix darauf gewartet, endlich achtzehn zu werden. Als es so weit war, hatte er die Wohnung entrümpelt, gestrichen und ausgeräuchert. Er hatte sie neutralisiert. Und zu seiner gemacht. Dann hatte er begonnen, sich auch die Stadt zu eigen zu machen. Niemanden hatte er gekannt. Hatte sich vorgehantelt. Hatte Kontakte gesammelt. Einen nach dem anderen. Die Methode mit den Schnappschüssen hatte sich bewährt. Damals wollte er noch Fotograf werden. Hatte stets eine Kamera dabei. Sie fühlten sich alle geschmeichelt, wenn er ihnen die Fotos zusteckte. Er achtete natürlich darauf, dass keiner im schlechten Licht stand. Wurde keinem gefährlich. War das perfekte Publikum. Er war beliebt. Die Frauen schliefen mit ihm, um ihm danach alles zu erzählen. Die Männer protegierten ihn, um vor ihm anzugeben.
Besonders Eugen war von den Fotos angetan. Er fragte ihn, ob er sein Chronist werden wolle. Eugen hatte große Pläne. Er litt an Ideendurchfall. War dann aber mit Bitcoins reich geworden. Nicht reich. Wohlhabend. Heute verkaufte er Dinge, die es nicht gab. Als Architekt einer virtuellen Stadt. Neue Räume schaffen. Kein Kapitalismus ohne Kolonialismus. Seine Worte.
Eugen sei die perfekte Beute. Er habe das Gefühl, es würde ihn aufgrund der Fotos überhaupt erst geben, so Moira. Er brauche den Blick der anderen, um sich seiner eigenen Existenz zu vergewissern. Felix hingegen sei ein Geist. Sie wolle seinen Blick nicht auf ihr spüren. Sie durchschaue sein Spiel. Finde es aber amüsant. Moiras schiefer Mund und ihr verächtlicher Blick. Eugen und sie galten als digitales Traumpaar. Aber Felix fantasierte von der analogen Moira.
– Ich lasse mich von dir nicht einfangen. Jedes Foto ist ein Gehege.
Er hatte sie alle aufgehoben. Hatte von jeder Aufnahme einen zweiten Abzug angefertigt. Die Kiste hatte er zu den Großeltern in den Keller gestellt. Für später. Falls er sie einmal brauchte. Fotos konnten nicht nur das Bild einer Person verändern. Sie waren oft das Einzige, was blieb. Ruinen. Selbst das Ich bestand nur aus Bruchstücken. Eine einzige Anhäufung. Der durchschnittliche Mensch bestand aus 10000 Gegenständen. Felix hatte bei 2.432 aufgehört zu zählen. Zu viele offene Fragen. Wurde ein Paar Schuhe als ein Gegenstand gewertet? War die Bleistiftmine Teil des Bleistifts? Zählten Lebensmittel dazu? Wie verhielt es sich mit digitalen Käufen? Ein Film ja, ein Zeitungsartikel nein, ein E-Book ja, ein Abo vielleicht. Der Keller platzte inzwischen aus allen Nähten. Die Grenzen der Anhäufung waren erreicht. Das ganze Ich eine einzige Anhäufung. Von Erlebtem. Von Erreichtem. Von Befreundeten. Von Geliebten. Von Worten. Von allem. Nichts durfte je verloren gehen. Alles musste atemlos angehäuft werden. Das Leben, eine einzige Produktionsstätte. Er konnte einfach nicht aufhören, Gedanken zu produzieren. Er war durchgehend wach. Im Schlaflabor hatten sie festgestellt, dass er keine REM-Phasen hatte. Dass er selbst dann, wenn er vermeintlich schlief, hellwach war. Was seine ständige Erschöpfung erklärte. Das war sein Antrieb. Diese Erschöpfung zu überwinden. Er hörte die Stimme seiner Mutter. Wie sie sagte: Geh weiter, sonst beginnst du, Wurzeln zu schlagen. Das Bild hatte ihm schon als Kind Angst eingejagt. Nein. Das würde sie ihm nie verzeihen. Dass er ihre Wurzeln wie Unkraut jätete. Und ihre Kindheit für Müll erklärte. Doch wovor hatte er Angst? Es würde keine Wiederbegegnung geben. Vielleicht in Träumen. Aber nicht in Form von Berührungen. Er glaubte nicht an die Wiederauferstehung der Körper. Glaubte nicht an Zombiereligionen. Er war Atheist durch und durch. Aber kein Nihilist. Noch nicht. Noch konnte er daran glauben, dass der Höchststand vor ihm lag.
Nur sein Gegenüber glaubte nicht mehr an ihn. Das sagten der gesenkte Blick und die einstudierten Gesten. Der Bankberater hielt sich selbst an der Hand. Wünschte sich gerade, kein Bankberater zu sein. War es aber inzwischen mehr als alles andere. Weil alles andere zerfallen war. Seine Kindheit durch die Scheidung der Eltern. Seine eigene Ehe, die wegen jener Scheidung zu spät geschieden wurde und damit alle zukünftigen Ehen verhinderte. Diverse Freundschaften durch diverse Ehen. Das Verhältnis zu den Kindern durch die eigene Scheidung. Und die Zukunft, weil ihm keiner mehr irgendetwas glaubte. Schon gar nicht er selbst. Nur in der Bank war es anders. Dort war er der Gläubiger.
Der Bankberater holte tief Luft. Als müsste er gleich zum Meeresgrund tauchen. Er legte die Fingerspitzen aneinander und formte sie zu einem Dreieck. Als wären sie beim gleichen Geheimbund gewesen. Er sagte, er habe das Gröbste noch verhindern können. In ein paar Monaten hätte es jeden Rahmen gesprengt. Da wäre es ein finanzielles Hiroshima geworden. Aber man habe rechtzeitig die Notbremse gezogen. Er hielt ihm das Fingerdreieck näher ans Gesicht. Dass er überhaupt so einen Rahmen bekommen habe, sei ausschließlich ihrer persönlichen Verbundenheit zu verdanken. Mit einem solchen Rahmen sei es nämlich generell schwierig, wenn man keinen Beruf habe. Er habe einen Beruf, sagte Felix. Er sei Unternehmer. Das sei noch kein Beruf. Eher ein Zustand. Vielleicht eine Mentalität. In seinem Fall eher eine Behauptung, wenn er das als Freund anmerken dürfe. Denn so sehe er sich. Als Freund. Ein Beruf sei etwas, das man zu Ende bringe. Daher habe er, Felix, noch nie einen Beruf ausgeübt. Er habe vieles angefangen. Aber nichts zu Ende gebracht. Er, der Bankberater, würde als Bankberater in Rente gehen. Er sei durch und durch nichts anderes. Und dadurch kreditwürdig. Aber Unternehmer … wenn er hingegen auch noch Tischler wäre. Dann hätte man etwas, worauf man sich verlassen könne. Darum gehe es bei Krediten. Um Verlässlichkeit. In seinem Fall sei es mehr ein Investment der Bank gewesen. So müsse er das jetzt auch intern verkaufen. Ob ihm eigentlich bewusst sei, dass er seinen Kopf für ihn hinhalte? Schließlich vergebe er Kredite und sei kein Investmentbanker. Auch kein Beruf in seinen Augen. Was aber jetzt zu weit führe. Und dann dieser Blick. Die ganze Arroganz des Angestellten. Als ob einer wie er je etwas riskiert hätte. Als ob irgendetwas je auf seinem Mist gewachsen wäre. Als ob er je persönlich gehaftet hätte.
Felix war sein Leben lang nicht angestellt gewesen. Angestellte waren in seinen Augen wie Kinder, die nie auf sich allein gestellt waren. Wirtschaftlich gesehen, hatten sie die Nabelschnur nie durchschnitten. Glaubten sie deshalb, dass ihnen nichts passieren konnte? Wie ein Bischof saß der Bankangestellte da und faltete seine Hände bedächtig zu jenem Dreieck, das eine Dreifaltigkeit behauptete. Felix fühlte sich exkommuniziert. Obwohl er Atheist war. In einem unerträglich väterlichen Tonfall dozierte dieser Vorschriftsgläubige, dass er, Felix, jetzt etwas anderes probieren müsse. Oder vielleicht eben nichts mehr probieren sollte. Mit Ende dreißig wäre es an der Zeit, auch mal wirtschaftlich anzukommen. Schließlich habe er schon alles gemacht, wofür man gemeinhin keine Ausbildung brauche. Wofür der Charakter reiche. Wobei man sagen müsse, die Idee zu Wastefood sei schon vielversprechend gewesen. Da habe er sich mitgeirrt. Auch er, der Bankberater, habe gedacht, dass die Welt bereit sei für mehr Nachhaltigkeit. Auch er habe nicht gewusst, dass so viel weggeschmissen werde. Nur weil eine Gurke nicht der Brüsseler Norm entspreche – eine unfassbare Vulgarität, der man etwas entgegensetzen müsse. Vielleicht hätte man es nicht Wastefood nennen sollen. Schließlich habe man keinen Müll verkocht, sondern anständiges Essen kredenzt. Wastefood Catering. Zu viel Erklärungsbedarf. Nachhaltigkeit dürfe kein Synonym für Umständlichkeit werden. Dabei sei es ja anfangs wirklich gut gelaufen. Und für eine Pandemie könne keiner was. Die Pandemie habe alles übertüncht. Man habe ja in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, die Welt bestünde nur noch aus Gesundheitsministern. Man könne die Pandemie aber wiederum auch nicht für alles verantwortlich machen. Auch wenn es mit Catering sicherlich besonders schwer gewesen sei, weil es ja kaum Veranstaltungen gegeben habe. Das verstehe er. Und auch die Bank. Selbst der Algorithmus. Aber jetzt sei diese Zeit eben vorbei und man müsse sich eingestehen, dass sich Wastefood nicht mehr erholen würde. Wastefood habe sich als ein Vor-Corona-Konzept erwiesen. Es sei aus dem Winterschlaf nicht mehr aufgewacht.
Felix nickte. Nicht nur, weil in dem Satz etwas Versöhnliches lag und man ihm eine Absolution in Aussicht stellte. Sondern weil er es genauso empfand. Er war aus dem Winterschlaf nicht mehr aufgewacht. Er war einfach liegen geblieben.
Als mit der Pandemie die Telefone aufhörten zu läuten, war es auch sonst ganz still geworden. Alle waren sie in ihren Wohnungen verschwunden. Niemand meldete sich. Niemand fragte, wie es ihm ging. Selbst F hörte auf, ihn zu besuchen. Gut, wie hätte sie es ihrem Mann erklären sollen? Es gab für sie keinen Grund, das Haus zu verlassen. Schließlich musste sie ihr Kind betreuen. Irgendwann hatte sie aufgehört, ihm Nachrichten zu schreiben. Und hatte damit auch nicht mehr angefangen, als alle wieder herauskamen. Sie war genauso kommentarlos aus seinem Leben verschwunden, wie sie aufgetaucht war. Als sie sich auf der Geburtstagsfeier betrunken geküsst und eine monatelange Affäre begonnen hatten, die ebenfalls nie besprochen wurde. F nannte eine Zeit. Sie kam zu ihm in die Wohnung. Sie liebten sich. Dann ging sie wieder. Es war nicht F, die ihm fehlte. Es waren ihre Berührungen. Es waren nicht die Menschen, die er misste. Es war ihre Anwesenheit. Es war nicht die Arbeit. Es war die Struktur, die den Tag zu einem Tag machte. Die Sinn simulierte. Die einem das Gefühl gab, dass die Zeit nicht ungenutzt vorüberstrich. Jetzt fühlten sich die Tage wie im freien Fall an. Es war egal, wann man aufstand. Es war egal, wann man schlafen ging. Es war egal, was man mit ihnen anfing.
Oft saß er den ganzen Tag in den leeren Büros und starrte vor sich hin. Wie schnell Räume nichts mehr mit einem zu tun hatten. Der schale Geruch der Abwesenheit. Ähnlich der Großelternwohnung – als dort noch geputzt wurde. Man spürte einfach, dass da keiner mehr wohnte. Als ob die Menschen die Seele eines Raumes wären. Diese Stille. Er begriff, dass diese Stille immer da war. Dass er sie nur nie bemerkt hatte. Dass sie stets unter allem gelegen hatte. Egal wie laut es rundherum war. Sie rührte sich nicht. Als ob sie mit endloser Geduld auf einen lauern würde.
Als die Stimmen aus dem Winterschlaf erwachten und auf die Straßen zurückkehrten, war es bei ihm still geblieben. Das Virus hatte bei ihm eine chronische Müdigkeit hinterlassen, die er nicht mehr wegschlafen konnte. Das Wachsein hatte sich kaum noch vom Schlaf unterschieden. War es ein Schlaf ohne REM-Phase gewesen? Er hatte jegliches Wollen verlernt. Die Bilder waren ihm abhandengekommen. Die Bilder und der Wille, ihnen hinterherzujagen. Gleichzeitig saß die Ungeduld in ihm. Die Angst, dass alles an ihm vorüberzog. Ohne dass er den Drang verspürte, nach etwas zu greifen. Eine Unrast machte sich breit. Die für zusätzliche Erschöpfung sorgte.
– Felix. Ich habe eine Liste gemacht. Von Dingen, die du verkaufen könntest. Dann kannst du wenigstens deine Wohnung behalten. Der Bankangestellte übergab ihm zwei A4-Zettel. Er überflog sie.
Die Büroräume und ihr Interieur. Das Auto, mit dem er und Sandra monatelang durch Europa gefahren waren. Das Bild, das sie in Amsterdam gekauft hatten. Das Bild, das sie in Paris gekauft hatten. Das Bild, für das sie auf New York verzichtet hatten. Es war ein Abzug des Fotos, auf dem Duchamp mit einer nackten Frau Schach spielte. In dieses Bild hatte er sich schon als Jugendlicher hineinfantasiert. Von diesem Bild würde er sich bestimmt nicht trennen. Was noch? Der Schmuck der Mutter. Die Kamerasammlung des Vaters, ohne die er nie jemanden kennengelernt hätte. Die Moormann-Bücherregale. Die Bücher. Welches würde er aufheben, wenn er nur eines behalten dürfte? Die Platten. Antwort: Bill Evans, From Left to Right. Das Boxspringbett, das er sich nach Sandras Auszug angeschafft hatte. Die Schmetterlingssammlung. Würden Insekten im Wert steigen, jetzt, da ihr Bestand dezimiert war? Die Rauchutensilien des Großvaters aus echtem Silber (Aschenbecher, Feuerzeug, Etui). Ein ausgestopfter Fuchs von Deyrolle. Laptop, Stereoanlage, Mobiltelefon. Er hatte Lust, das Papier zu zerreißen. Sah darin nur die Übergriffigkeit der Bank. Nicht aber die Mühe des Bankberaters. Der wusste genau, was da war. Aus was sich sein Gegenüber zusammensetzte. Wie viel würden sie von ihm übrig lassen? Von was sollte er seine monatlichen Kosten decken? Es fiel ihm nichts mehr ein. Ab jetzt würde er kein Geld mehr verdienen. Er würde es beschaffen. Aber nicht verdienen. Er würde seine Tage nicht mehr mit sinnvollen Tätigkeiten verbringen, mit denen er gleichzeitig sein finanzielles Auslangen fände, sondern sich täglich das Gehirn zermartern, wie er an das Geld herankäme. Alles würde ab jetzt anders werden.
– Und von was soll ich leben?
– Du könntest ein paar Tage im Monat die Wohnung vermieten. Das könnte reichen, wenn du dich reduzierst. Dann wärst du unabhängig. Überleg dir, was du wirklich brauchst. Der Bankberater sah ihn an. Zusammengepresste Lippen. Kopfnicken. Zuversicht.
– Denk dran. Sie können dir alles nehmen. Nur dich selbst nicht.
Der Bankberater tat ihm fast leid. In seiner empathischen Verlegenheit spürte man seine Angst, selbst einmal auf der anderen Seite des Tisches zu landen. Natürlich konnten sie einem das Selbst nehmen. Ein zarter Schüttelfrost durchdrang ihn. Felix wünschte, der Bankberater wäre eine Frau gewesen. Eine Frau, die ihn jetzt in die Arme genommen hätte.
Er hatte die Koffer gepackt, als würde er verreisen. Er hatte die Wohnung zwei Tage lang geputzt. Swetlana hatte alles poliert. Bis nichts mehr nach ihm roch. Er hatte stundenlang gelüftet. Hatte mehrere Tage die Toilette nur noch zum Urinieren benutzt. Er hatte Beweisfotos gemacht. Laut Vertrag musste er alles so vorfinden, wie er es hinterlassen hatte. Unbehagen bei dem Gedanken, dass zwei Fremde seine Dinge berühren würden. Zu welchen Platten würden sie greifen? Bestimmt würden sie alles durchstöbern. In seine Bücher reinlesen. Womöglich mit angefeuchteten Zeigefingern. Würden Dinge verstellen. Würden sich ausmalen, wie sein Leben aussähe. Würden sich vielleicht über ihn lustig machen. Sie würden in seinem Bett kopulieren. Würden an seinen Lebensmitteln schnuppern. Mit seinem Besteck essen. Sein Geschirr benutzen. Die Pflanzen vergessen zu gießen. Seine Toilette benutzen. Würden die Dinge ihren Geruch annehmen? Er vermietete weit mehr als seine Wohnung. Er vermietete sein Leben.
Sonnige Vierzimmerwohnung in Zentrumsnähe. 75 Quadratmeter. Dachgeschoss mit kleiner, charmanter Terrasse. Zahlreiche Vintagemöbel, eine großräumige Bibliothek und geschmackvolle moderne Kunst verleihen dem Ort einen starken Charakter. Für kalte Wintertage steht ein Kamin zur Verfügung. Das Schlafzimmer, das sich unter einer kleinen Kuppel befindet, bietet eine traumhafte Aussicht auf die Altstadt …
Es war nicht schwer gewesen, Interessenten zu finden. Er hätte die Wohnung wesentlich länger als die acht Tage vermieten können. Aber er hatte es sich genau ausgerechnet. Mit dem Geld würde er über die Runden kommen. Nein. Er würde eigentlich auf nichts verzichten müssen. Solange er in diesen acht Tagen keine allzu großen Unkosten verursachte.
Die Wohnung hatte Charakter. Seinen Charakter. Das Paar, das in Kürze läuten würde, hatte sich die Wohnung aufgrund der Fotos ausgesucht. Eine Zielgruppe war eine Glaubensgemeinschaft. Man kannte sich. Ohne sich zu kennen. Nur die heikelsten Dinge hatte er in die Speisekammer gesperrt. Persönliche Gegenstände, wie man so schön sagte. Wobei er nicht wusste, was an einem Buch weniger persönlich sein sollte als an einem Schmuckstück. Es handelte sich wohl eher um Dinge, die man in Sicherheit brachte. Schließlich misstraute man der Kundschaft. Großvaters Raucherset. Mutters Schmuckschatulle. Fotoalben aus der Kindheit. Dokumente. Kosmetika. Die gesamte Kleidung. Eine halb gefüllte Erinnerungsbox. Die Summe seiner persönlichen Gegenstände beanspruchte kaum die Hälfte der Kammer, die an die Küche schloss und auch als Lager für die übrig gebliebenen Einweckgläser von Wastefood diente. Haltbarkeit mehrere Monate. Es wäre schade, so viel Nachhaltigkeit an Touristen zu verfüttern.
Er könnte nach seiner Rückkehr Freunde einladen. Die Wohnung wieder mit seiner eigenen Energie durchfluten. Er hatte viele Freunde. Verlor sie nie aus den Augen. Milan kochte gerade Fischsuppe. Heinz ging auf ein Konzert. Pia präsentierte ihre Babykatze. Georg echauffierte sich über Rechtsextreme. Christian über Amerika. Hanna über Russland. Thomas über alles. Jonas und Melanie verschoben ihre Hochzeit. Barbara hatte Geburtstag und feierte mit den Kindern. Florian hatte seinen Status in ledig geändert. Akin fotografierte Menschen, die Bäume umarmten. Veronika hielt das Cover eines finnischen Klassikers in die Kamera. Norbert sang Karaoke. Felix hatte eine gute Freundschaftsquote. Mindestens ein Viertel würde auf seine Nachricht innerhalb einer Stunde antworten. Aber nur vier wollte er nach einem Schlafplatz fragen. Acht Tage waren eine lange Zeit. Für beide Seiten. Am Ende hatte er sich entschieden, bei Eugen zu wohnen. Vermutlich, weil er das Gefühl hatte, ihm die Wahrheit sagen zu können.
– Acht Tage, sagst du. Und darauf verlässt du dich? Das wären die ersten Handwerker, die pünktlich fertig werden.
– Sie sehen mir ziemlich verlässlich aus.
– Sie werden dir mit einem Lächeln sagen, dass es länger dauern wird. Wenn sie es überhaupt sagen werden. Meistens sagen sie gar nichts. Und gehen einfach. Manchmal kommen sie wieder. Dazwischen lächeln sie einen aus. Handwerker sind die wahren Herren der Neuzeit.
So wie Architekten, dachte Felix, dem eine fliederfarbene Couch vor einer jadefarbenen Dschungeltapete zugeteilt wurde, auf der bereits ein malvenfarbenes Bettzeug lag. Bei Felix stellte sich ein Boutiquehotelgefühl ein, das die beiden vermutlich mit Gastfreundschaft verwechselten. Es gab nichts, was man den Räumen vorwerfen konnte. Aber auch nichts, was mit Moira und Eugen zu tun hatte. Felix dividierte die Dinge in der Wohnung auseinander. Was würde wem gehören, wenn sie sich trennten? Es war unmöglich festzustellen. Selbst die Gastgeber mussten sich hier wie Gäste fühlen. Felix machte keinen einzigen persönlichen Gegenstand ausfindig, den man in eine Kammer sperren müsste. Eine perfekte Wohnung, um sie zu vermieten. Selbst die Makel wie patinierte Wände, Kratzer im Boden, Flecken am Tisch, Kerben im Türstock wirkten gestaltet. Nichts stand im Weg. Die Leere der Räume strahlte Ruhe, Ausgeglichenheit, Aufgeräumtheit und Entschlossenheit aus. Es war die Wohnung von Menschen, die wussten, was sie wollten. Die zu allem eine klare Meinung hatten.
Eugen war seiner Zeit stets einen Schritt voraus geblieben. Immer nur den einen, um noch als Visionär erkannt zu werden. Felix hatte das Konzept der virtuellen Immobilien erst verstanden, als ihm Eugen die VR-Brille aufgesetzt und ihn durch die Architektur von EUGENIA geführt hatte. Seine Höhenangst war auf den simulierten Wolkenkratzern noch größer gewesen als auf den realen.
– Das hier, Felix, geht über die bloße Nachahmung der sogenannten Wirklichkeit hinaus. Das ist Schöpfung. Es geht hier nicht nur um neue Kolonien. Es geht um eine neue Welt. Die sogenannte Realität verkümmert. Sie ist fahl und banal. Hier aber ist alles Denkbare möglich. Hier werden alle Grenzen des Wachstums gesprengt. Hier wird der Mensch erst Mensch.
Vielleicht lag es an der Schöpfungskraft von Eugen. Vielleicht auch an den begrenzten Kapazitäten des Menschen. Aber für Felix machte es keinen großen Unterschied, ob ein Haus eine Pflanzenform hatte, ob die öffentlichen Busse fliegenden Fischen glichen oder ob man die Skipisten mit Zuckerwatte präparierte. Letztendlich blieb es Nachahmung. Auch dass man selbst Formen annehmen konnte, die dem inneren Aggregatzustand entsprachen – Felix wurde von Eugen zu einem Windwesen erklärt –, änderte daran nichts. Es war einfach nur eine grellere Form der Realität, die sich genauso abnutzen würde. Vielleicht würde man irgendwann die analoge Welt ihrem Abbild anpassen müssen. Vielleicht würde sie irgendwann nur noch aus leeren Räumen bestehen. Selbst das Ich war eine Anhäufung von Versatzstücken, die sich in unendlichen Mutationen zusammensetzen ließ. Keines der Elemente war neu. Jedes hatte es schon milliardenfach gegeben.
Eugen blieb auch virtuell ganz Eugen. Diese randlose Brille mit den farbverändernden Gläsern. Diese Glatze. Kein Haar durfte aus seinem Körper sprießen. Diese Babyhaut. Trotz seiner vierzig Jahre. Das nannte man Charakter. Da steckte Arbeit drin. Während man das Gesicht von Felix gerne vergaß. Nein. Verwechselte.
Als Felix ihm ein vergilbtes Foto überreichte, es zeigte Eugen beim Dozieren, war er ganz gerührt von sich selbst.
– Was ist das für eine entsetzliche Brille, lächelte er.
– Eine andere Zeit, sagte Felix.
– Ein anderer Mensch. Du kannst natürlich so lange bleiben, wie du willst. Moira würde sich genauso freuen wie ich.
Ihr Gesicht war teigiger geworden. Ihre schiefen Lippen und ihr verächtlicher Blick wie mit zu viel Haarspray fixiert. Als ob sie sich selbst auf dem Weg zurückgelassen hätte. Als wäre sie ihr eigener Avatar. Seit der Operation sah sie endlich aus wie die Statue, die man von ihr angefertigt hatte. Moira, ein Denkmal. Und Felix dachte an sie. An die alte Moira. Die er anhand der Avatar-Moira wachrufen konnte.
– Es ist so schön, dass du da bist, sagte Moira. Beide freuten sich überschwänglich. Als wäre Felix der erste Hotelgast seit der Öffnung.
Man wurde das Gefühl nicht los, dass sie Publikum für ihre Beziehung brauchten. Felix war ein gutes Publikum. Dafür war er beliebt. Er sprach selten von sich. Konnte zuhören. Und spendete Beifall statt Kritik. Sein Gemüt war wie das Wetter am Äquator. Zu allen Jahreszeiten gleich.
Bereits beim ersten Glas Wein aber sagte er:
– Ich habe gelernt, das Leben nicht mehr ernst zu nehmen. Sonst ist es am Ende eine Anhäufung von Enttäuschungen. Man muss sich von gewissen Vorstellungen verabschieden. Man ist nur frei, wenn man nichts mehr erwartet. Das Leben ist wie ein unzuverlässiger Freund, der sich ausschließlich um einen schert, wenn es ihm passt. Wenn man das akzeptiert, kann man Spaß mit ihm haben.
Sowohl Eugen als auch Moira machten sich Sorgen. Anstelle eines Publikums hatten sie sich einen tragischen Akteur auf die Couch gesetzt.
– Was ist los, Felix?
Insgeheim hoffte Eugen, sein alter Freund würde so etwas antworten wie: Nicht der Rede wert. Stattdessen schenkte sich Felix nach, als müsste er sich Mut antrinken.
– Ich vermiete meine Wohnung. Acht Tage lang. Jeden Monat.
Eugen hob die Hand und bedeutete ihm, er brauche nicht weiterzureden.
– Du musst dich nicht schämen.
– Ich schäme mich nicht. Sonst würde ich es nicht nach dem ersten Glas Wein erzählen.
– Warum dann die Handwerker?
– Weniger Erklärungsbedarf.
Eugen nickte zufrieden. Felix begann sich wieder wie ein Publikum zu benehmen. Als er Eugen die Umstände erklärte, bot ihm dieser überraschenderweise keinen Hausmeisterjob in EUGENIA an.
– Das ist eine Riesenchance, Felix. Du bist Mensch 2.0. Und dir ist es gar nicht bewusst.
Felix nickte. Auch wenn er das Gefühl hatte, dass er das als Mensch 2.0 nicht sollte.
– Du bist dort, wo viele bald ankommen werden. Dein Tag wird nicht mehr von Arbeit strukturiert. Aber du hast Glück. Du stehst nicht vor dem Abgrund. Du hast eine Möglichkeit. Du bist eine Art Mini-Kapitalist. Und dein Kapital kannst du vermieten. Es ist ein wenig unangenehm, immerhin ist es der Ort, wo du wohnst. Du empfindest es zumindest als deinen intimen Bereich. Warum eigentlich? Weil er dir gehört? Du verwechselst das Eigentum mit dir selbst. Ich weiß, wovon ich spreche. Eigentum heißt immer Einverleibung. Egal, ob ein Ding virtuell oder real existiert. Die Phänomenologie ist dieselbe. Und nein: Das virtuelle Klavier ist nicht die Phänomenologie des realen Klaviers. Darüber habe ich selbstverständlich nachgedacht. Letztlich geht es nur um die Behauptung der begrenzten Ressourcen. Egal. Wichtig ist, dass du glaubst, es gehört ganz dir. Nein. Zu dir. Und dass niemand anderer den Schlüssel hat. Dein Rückzugsbereich. Dein Mutterbauch. In den du zurückkriechst. Das ist auch eine Form der Abtreibung, Felix.
Moira, die auf dem Sofa gegenüber saß, seufzte. Sie wusste, dass dies erst der Anfang einer langen Einbahnstraße war. Und sie wusste, wo sie enden würde. Sie nahm sich eine Zigarette und warf Felix diesen Blick zu. Ging es um Verschwörung? Ging es um eine zweite Ebene, um an diesem Abend noch etwas anderes zu erleben, als von Eugens Kaskaden verschüttet zu werden? Moiras Aggregatzustand verfestigte sich. Ihr Blick wollte fusionieren. Felix nahm einen Schluck Wein. Er entschied sich, ihr zu folgen. Sie stand am Strand. Der Wind. Die Palmen. Nein. Sie war die nackte Frau, die mit Marcel Duchamp Schach spielte.
– Du hast Glück. Du bist frei. Du musst nicht mehr arbeiten. Du musst nicht mehr funktionieren. Musst kein Roboter mehr sein. Man hat dir den Tag zurückgeschenkt. Du kannst abwarten, was er dir bringt. Du hast den Homo oeconomicus überwunden. Du hast Nietzsche überwunden. Du bist der purste Existenzialist. Während andere um ihr Überleben kämpfen, kannst du dich aufs Leben konzentrieren. Dich ausschließlich damit beschäftigen, was vom Tag übrig bleibt, wenn die Arbeit wegfällt. Man müsste ein Buch über dich schreiben.
Felix stieg ins Bild. Er saß ihr gegenüber. Ihre Dame bedrohte seinen König. Gleich würde er schachmatt sein. Es gab keinen Ausweg. Sie sah ihn an. Legte ihre Dame aufs Brett. Kapitulation. Dann stand sie auf und ging davon. Ihr Schritt war langsam genug, um ihm begreiflich zu machen, dass er ihr folgen solle. An den Wänden Porträts von Eugen. Sie hielt inne. Betrachtete ihn. Als wäre er nicht ihr Mann, sondern eine Erfindung. Diese Haut. Wie ein selbstreinigender Herd. Wie faltenloses Nylon. Er stellte sich hinter sie. Roch an ihrem Hals. Ihre Fingerspitzen suchten die seinen. Sie lehnte sich zurück. Stand auf den Zehenspitzen, als trüge sie Schuhe. Er nahm eine Zigarette und führte sie zu ihrem Mund. Feuer. Klack. Die Indifferenz machte ihn geschickt. Ihr Seufzen ein lasziver Applaus. Jeder Moment ein Angebot, das er nicht annahm. Das Wesen der Eleganz. Sie sah Eugen in die Augen. Ein Bild muss das Ergebnis einer langen Betrachtung sein. Das macht es zu Kunst. Sie blies Eugen den Rauch ins Gesicht. Keine Reaktion. Nur ein gemaltes Bild war noch indifferenter als er selbst. Sie nahm Felix an der Hand. König und Königin verließen das Brett. Als sie sich entfernten, spürte er den gemalten Blick im Rücken. Er schloss das Jackett.
– Arbeitslosigkeit, Felix, heißt nicht Aufgabenlosigkeit. Dir steht alles frei. Du kannst dich auf alles einlassen. Niemand sagt dir, was du zu tun hast. Niemand wartet auf dich. Mit dieser Freiheit muss man erst mal umgehen. Carpe diem, Felix. Kann man die Tage so gestalten, dass man sich am Ende an jeden einzelnen erinnern kann? Ich spüre keinen Neid. Ich brauche das Abrackern. Die Erschöpfung. Das Machen. Aber dir kann keiner mehr was anhaben. Du kannst Nein sagen. Du kannst schlechte Jobs ablehnen. Du hast keinen Stress. Keinen Druck. Es spricht jetzt nichts dagegen, ein guter Mensch zu sein. Dich ganz den Wohltaten zu widmen. Altruismus ist ein Luxus, den man sich erst mal leisten können muss. Du musst niemandem gefallen. Hast nichts zu befürchten. Du kannst die Wahrheit aussprechen, die keiner hören will. Du könntest die Welt verbessern. So wie alle, denen die Dringlichkeit fehlt. Ach, mir fiele so viel ein für dich, Felix. Du kannst dir Arbeit suchen, die keiner braucht. Nein, verzeih. Die niemand bezahlen will. Du könntest Sterbenden ihre letzten Wünsche erfüllen. Flüchtlinge begleiten. Oder einfach nur reisen. Du hättest Zeit für die Liebe. Du könntest endlich in Ruhe über Selbstmord nachdenken. Was wäre, wenn es allen so ginge? Wenn sie Geld für keine Arbeit bekämen? Ein liebender Staat. Würden sie ihre unwürdigen Arbeiten niederlegen? Würde eine Putzfrau noch putzen? Ein Pfleger noch pflegen? Kein demütigendes Anstellen um Arbeitslosengeld. Jeder käme mit Geld auf die Welt. Hätte von Beginn an das Gefühl, etwas wert zu sein. Sogar die demente Mutter bekäme ein Grundeinkommen. Selbst ein Haftentlassener müsste sich keine Sorgen machen. Er könnte in Ruhe über das nächste Verbrechen sinnieren. Ein Junkie könnte sich Drogen kaufen. Es würde keine Alimente geben, weil jedes Kind über sein eigenes Geld verfügen würde. Die Leute hätten womöglich Ideen! Viele würden nichts tun. Doch niemand würde untätig werden. Niemand müsste ausziehen. Eine völlig andere Situation. Aber vergleichbar. Du bist es dem Tag schuldig, Felix.
Moira seufzte erneut. Sie streckte sich auf dem Sofa wie ein liegender Buddha. Bin ich ein Mensch oder erfahre ich die Welt nur als Mensch? Sie zog an der Zigarette. Eine postkoitale Ellen Barkin, dachte Felix. Selbst ihr genervter Tonfall hatte etwas Beruhigendes. Diese sonore Stimme.
– Muss jetzt auch der Müßiggang schon effizient sein? Muss man aus allem immer das meiste rausholen? Was ist aus der Schönheit des Makels geworden?
Sie blies den Rauch in sein Gesicht. Felix hatte solche Lust, sein Leben zu vergeuden. Erst jetzt fiel ihm auf, dass die nackte Moira in der Galerie humpelte. War sie deshalb auf Zehenspitzen gestanden? Sie drehte sich um und flüsterte in sein Ohr: Angezogen hast du mehr Charakter.
Felix schüttelte den Kopf. Moira sah ihn an. Eugen sah Moira an, wie sie Felix ansah. Felix sah beide an. Und nahm einen relevanten Schluck Wein.
– Ich könnte dir natürlich das Geld leihen. Aber wäre das eine gute Idee? Ich bezweifle es. Es würde diese große Chance zunichtemachen. Denn ich würde es zurückhaben wollen. Du müsstest umschulen. Aber auf was? Ich würde dich nötigen, dir eine Arbeit zu suchen, wenn ich nach ein paar Monaten noch immer keine Perspektive sähe. Du bist keiner von uns, Felix. Du gehörst auf die andere Seite.
– Aha, sagte Moira. Ich wusste gar nicht, dass es zwei Seiten gibt. Wir sitzen doch alle im gleichen Boot.
– Du meinst den Staat? Das stimmt. Der muss alle nehmen, wie sie sind. Unflexibel, feig, xenophob, faul, untalentiert und primitiv. Aber der Staat existiert schon lange nicht mehr. Irgendjemand wird den Karren aus dem Dreck ziehen müssen. Es werden nicht Leute wie Felix sein. Die meisten sind zu nichts mehr fähig. Man kann sie weder für den Krieg noch für den Frieden gebrauchen. Auch den Müßiggang beherrschen sie nicht. Aber bald wird es endlich wieder ans Eingemachte gehen. Ums nackte Überleben. Mit allem anderen kann der Mensch letztlich nicht umgehen. Da verzettelt er sich in Demokratie. Und Beschäftigungstherapien. Da beginnt er über Nichtigkeiten nachzudenken. Damit er sich nicht leer fühlt. Aber bald werden die Tage endlich wieder davon geprägt sein, ob man die nächsten überhaupt überlebt. Dann wird das Leben wieder Sinn machen. Es ist im Grunde beneidenswert, wie du ums finanzielle Überleben kämpfen darfst, während unsereins die Klimakrise bewältigen muss.
Eugen blickte Felix mit einem hochmütigen Lächeln an. Er sieht aus wie Hunter S. Thompson, wenn aus ihm ein rechtes Arschloch geworden wäre, dachte Felix, während er sich und Moira randvoll Whisky eingoss.
– Ich habe ein anderes Verhältnis zu Geld als du, sagte Eugen. Ich halte Distanz. Ich verwechsle es nicht mit mir selbst. Für mich ist Geld wie eine Pflanze, die man hochzieht. Ich bin anders als du. Ich habe längst keinen Bezug mehr zu den Dingen. Für mich macht es keinen Unterschied, ob ich ein Klavier im Wohnzimmer stehen habe oder nur virtuell im Netz. Man muss sich von den Dingen lösen. Sie bedeuten mir nichts. Man muss aufhören, zu denken, dass einem irgendetwas gehört. Dass einem etwas zusteht. Dass irgendetwas nur für einen selbst bestimmt ist. Dann ist man innerlich frei. Ich habe keine Angst, etwas zu verlieren. Weil man nur etwas verlieren kann, das einem gehört. Es wäre mir auch egal, wenn du mit meiner Frau schlafen würdest. Ich sehe deine Fantasien. Menschen, die ihr eigenes Gebiet verlieren, versuchen oft, das Gebiet des anderen zu erobern. Bist du ein Kuckuck, Felix? Bist du im Krieg? Willst du mich einnehmen? Willst du mich aus meinem eigenen Leben schmeißen?
– Eugen, bitte. Hör auf. Du bringst Felix in Verlegenheit.
Erst jetzt bemerkte er Eugens Zungenschlag. Die nackte Frau stand am Fenster. Duchamp saß rauchend auf dem Sofa. Die Beine verschränkt. Der Anzug faltenfrei.
– Geld mag eine begrenzte Ressource sein. Aber die Liebe meiner Frau ist es nicht. Sie wird nicht gemindert, weil sie dich küsst. Würdest du Felix gerne küssen, Moira?
– Klar. Willst du zusehen?
Duchamp senkte die Plattennadel. Knistern.
Wie sollen wir es benennen?
Sie drehte sich nicht um. Das alte Lied setzte ein.
Meine Gefühle sind scheu. Sie lassen sich nicht gern benennen. Jedes Wort ist ein vereister Gedanke, dachte Duchamp.
Wie wird sich ihr Kuss anfühlen?
Moira stand auf. Sie ging auf Zehenspitzen. Blieb vor Felix stehen. Sie sah ihn an. Sie sah ihn an, damit Eugen sie ansah. Sie wollte von Eugen gesehen werden. Sie wollte, dass er sah, wie sie Felix ansah. Dieser wusste nicht, wie er zurücksehen sollte. Denn auch sein Blick wurde von Eugen fixiert, dessen Blick wiederum undurchschaubar blieb. Der Blick des Betrachters, der vortäuscht, nicht gesehen zu werden.