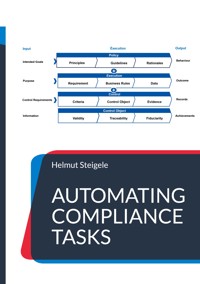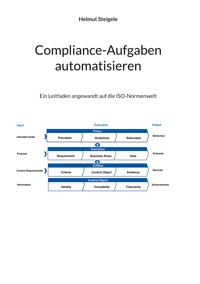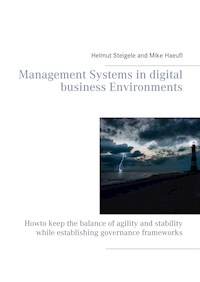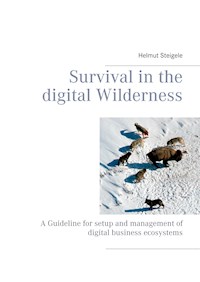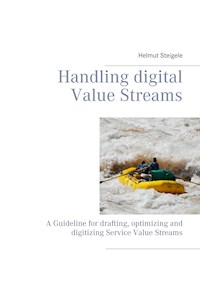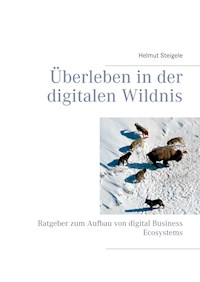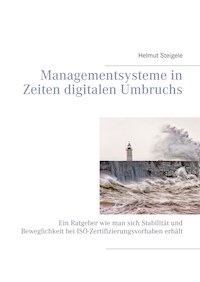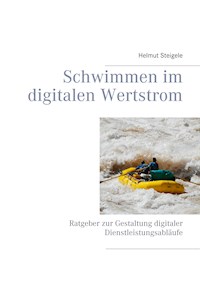
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wer heute im digitalen Wettbewerb in ruhigere, planbarere und nachhaltigere Fahrwasser gelangen will, muss sich vor allem um ein Thema kümmern. Das Erhalten von Kundenbeziehungen, das Sichern des Kundenvertrauens und das Errichten nachhaltiger digitaler Brücken zum Kunden. Diese Brücken sollten so gestaltet und gebaut sein, dass es für diese Kunden keinen Grund mehr gibt, sich andernorts umzusehen. Die "Silver Bullet" hierzu wäre die Gestaltung digital nachhaltiger Wertströme beginnend beim Kunde, abgestimmt mit den internen Abläufen bis hin zu den-Supply-Chains der Zulieferanten. Wie dies umgesetzt werden kann, zeigt dieser Ratgeber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort – Wie man Stabilität in seine digitale Kundenbeziehung bekommt
Was ist wertvoll in einer digitalen Welt
Was hat die Servicedominant Logic mit dem Wertstrom zu tun?
Value Co-Creation - Kleines Wort - grosse Veränderung
Erfahrungsumfeld, Customer Journey und Value Experience
Was sind Wertströme (Value Streams)
Was macht einen strukturierten Ablauf zum Wertstrom
Schlüsselfaktor Customer- oder User-Journey?
Welche Anforderungen werden an digitale Value Streams gestellt
UX/CX/DX und die Folgen für das digitale Valuestreamdesign?
Gilt die «Wertstromdenke» auch für interne Abläufe?
Wie Value Streams aufgebaut sind
Value Streams und Unternehmensfähigkeiten
Sind nun Prozesse, Value Chains und Policies als Steuerungshilfe obsolet?
Wie baut man eine «digitale Organisation» auf?
Wie man Value Streams digitalisiert
Sich in den Leistungsempfänger einfühlen
Wertstrom absichern
Ablauf optimieren
Daten und Messpunkte festhalten
Gesamtanforderungen ermitteln – Operationalisierung vorbereiten
Systeme anpassen – Wertstrom in «Code» transformieren
Wertstrom mit weiteren Abläufen verketten
Betrieb und Verbesserung absichern
Wo beginnen, wie weitermachen, wo aufhören
Zusammenfassung
Literatur- und Quellenverzeichnis
Copyright Statements zu Begrifflichkeiten, welche unter Markenschutz stehen
Ecosystem Management and Design / Ecosystem Lifecycles
Business Ecosystems und Value Co-Creation
Weitere Publikationen
Blogs – Sites – Kontakt
Über den Autor
Vorwort – Wie man Stabilität in eine digitale Kundenbeziehung bekommt
Die Themenstellung für diesen Ratgeber kann mit dieser Ausgangssituation beschrieben werden. Stellen Sie sich vor Sie sind Leiter eines Unternehmens, eines Unternehmensbereiches oder einer Unternehmens-IT und müssen folgende Fragen beantworten.
Wenn in Zukunft mehr als 50 % unserer Kunden, die Beziehung zu uns nur noch via digitalen Trägertechnologien pflegen, wie gestalten wir dann unsere externen und internen Abläufe so, dass unsere Kunden nicht sang- und klanglos zu anderen Anbietern wechseln.
Im Grunde bedeutet dies für viele, sich auf eine komplett neue Welt der Erwerbstätigkeit einzustellen. Wohl geht der Faktor Mensch nicht verloren, aber durch die vielen kleinen Aktivitäten die zwischen Unternehmen und Kunden via digitalem Kommunikationskanal abgewickelt werden, entsteht, wenn man nicht aufpasst eine nicht bemerkbare «Glaswand» zwischen den Kunden und ihren Lieferanten.
Anfangs scheint alles in Ordnung zu sein, irgendwann merkt man nicht mehr, dass Leute bestimmte Kanäle nicht mehr beanspruchen. Zum Teil werden Beschwerden, Anregungen, Unmutsäusserungen sowohl von Kunden, wie von internen Ablaufsbetroffenen eingetütet, von Pontius zu Pilatus verschickt, in Prozessen verhackstückelt und am Ende bleibt die Frage, warum dies alles geschehen konnte.
Der Grund für all das ist ein simpler; Ignoranz gegenüber einer Tatsache:
Ein digitaler Kunde hat mehr denn je, die Wahl, und wenn man das nicht akzeptiert, ist man selbst abgemeldett, ehe es Klick gemacht hat!
Nun aber zu glauben, man sei nun hilflos einer Übermacht launischer Kunden ausgeliefert, ist nicht ganz korrekt.
Im Grunde ist es sogar ziemlich einfach. Sobald man sich in die Haut des Kunden begibt und akzeptiert, dass der reine Akt des Konsumierens nur ein Teil der Miete ist., wird’s klarer. Denn es zählt die gesamte Beziehung und nicht nur das «ich liefere und Du lieber Kunde hast glücklich zu sein».
«Value Co-Creation» heisst das Zauberwort. Sobald klar wird, dass jeder einzelne Interaktionsschritt zwischen Kunden und potentiellem Lösungsanbieter von Wertempfinden und Austausch (zumeist von Informationen) geprägt ist, ist schon viel gewonnen. Kurz ohne Einnahme der Kundensicht vor der Gestaltung aller Interaktionsabläufe wird man immer scheitern.
Die Fachwelt hat dafür aus der produzierenden Wirtschaft sogar einen Fachbegriff geschaffen. Mit Hilfe von "Service Value Streams" wird dieser «Value-Co-Creation” eine logische Form gegeben, mit der man danach das «Digitalisieren im engeren Sinne», sprich die digitale Brücke zum Kunden wieder neu aufbauen kann.
Genau hier aber kommt ein zweiter Fakt zum Tragen. Menschen haben zwar heute die Möglichkeit sich umfänglich zu informieren und Alternativen zu suchen. Aber, je vertrauter, je werthaltiger und je konstanter immer wieder ein «Konsumerlebnis», respektive die Resulate aus der «Value-Co-Creation» empfunden werden, desto stabiler die Kunden-Lieferanten-Beziehung.
Dort aber, wo es eine stabile Beziehung gibt, gibt es auch weniger Nachdenken und ungeliebte Überraschungen zu neuen Bedürfnissen.
Der Hektik immer wieder neu zu erfindendender Features, der Angst um die schleichende Erosion der Kundenbasis und dem substanzzehrenden Innovieren, Reorganisieren und sich selbst disruptieren kann also entgegengewirkt werden.
Will man also für sich selbst als Unternehmen in all diesem «digitalen Gestürme» ein solides Ertragsumfeld bewirtschaften, so gilt es den harmonischen Akkord aus Kundenbedürfnis, Konsumationserlebnis und vertrauensbildenden Ergebnissen anzuspielen.
Wenn sich Anbieter gezielt ins Handlungsumfeld des Kunden einfühlen und integrieren, durch die Nutzung von «Value Streams oder Wertstömen» die digitale Brücke zum Kunden schlagen und mit System und Disziplien die Unternehmensfähigkeiten aufbauen kann, sind sie in der Lage nachhaltiges Kundenvertrauen aufzubauen. Ein Kunde der vertraut hat schlichtweg keinen Grund mehr, sich nach Alternativen umzusehen.
Das ergibt im besten Falle für einen Anbieter die Situationen absoluter «Konkurrenzlosigkeit».
In diesem Band wird erläutert, wie man diesen Zustand erreichen kann, welche Wissenselemente dazu vonnöten sind und wie man Wertströme «digitalisieren» kann.
Was ist wertvoll in einer digitalen Welt
Im Grunde genommen ist der Wertbegriff sowohl für die digitale wie für die analoge Welt im selben Spektrum anzusiedeln
Sobald ein zufriedenes Lächeln im Gesicht des Kunden auftaucht, kurz sein Wohlbefinden sich verbessert hat, ist Wert entstanden!
Das «Dumme» ist nur, dass uns gestählten Betriebswirten, Technikern und Ökonomen oft nur eine eingeschränkte Sicht des Wertempfindens vermittelt wurde (funktionelle und der ökonomische Sichtweisen).
Ein «Mensch» ist aber mehr als nur eine Ansammlung funktions- und kostengetriebener Entscheidungsmechanismen. Jeder Verkäufer, jeder Prozessberater und jeder Ehemann müsste das eigentlich aus der täglichen Erfahrung wissen.
Und doch ignoriert man dies. Bisweilen, um seine Verhandlungsposition nicht zu verschlechtern, manchmal aus der Überzeugung heraus, dass der Wert offensichtlich ist, manchmal schlichtweg aus der Angst heraus, sich nicht mehr an interne Prozesse halten zu können.
Gute Marketingspezialisten wissen aber trotzdem damit umzugehen. Für sie spielt der «Wertekanon» die auf der Folgeseite gelisteten Grundtöne an. Wi Konsumenten lassen uns auch nach diesen Tönen, je nach charakterlichem Dispositiv» zu einer Empfindung bewegen.
Funktioneller Wert
Smartphone X läuft über die Dauer von 36 Stunden, funktioniert auf 2G bis 5G Netzen, bietet folgende Features und hat auch Garantie
Hedonistischer Wert
Sobald ich mein Smartphone X in Händen habe, fühle ich mich besser
Symbolischer Wert
Endlich sieht alle Welt, dass ich mir ein Smartphone X leisten konnte
Ökonomischer Wert
Mit Smartphone X, spare ich Zeit bis zum Office, weil ich Agenda und Tagesplanung schon am Arbeitsweg erledigen kann
Beziehungswert
Smartphone X ist Teil eines Lebensgefühls, wir «Xler» sind eben besonders kreativ, innovativ und dynamisch
Was aber hat dies nun für eine Auswirkung:
Eine wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Gedeihen eines Unternehmens besteht darin, Verständnis für das Erfahrungsumfeld (inkl. sozialer Kontakte und Interaktionen mit anderen Konsumenten, Organisationen etc.) und Wertschöpfungsprozesse seiner (potenziellen) Kunden aufzubauen und daraus für sich Nutzen zu ziehen.
Wer also nicht weiss, was die Kunden bewegt, was sie bedrückt, was Ihnen ein erinnerungswürdiges Konsumerlebnis beschert, das Erleichterung, Bestätigung und Motivation für Folgeschritte nach sich zieht, dem bleibt nur eine einzige Möglichkeit wirtschaftlich zu überleben:
Sich dem vernichtenden Wettbewerb im Rahmen einer Preis-Schlacht stellen, weil alles fehlt was Vertrauen und Beziehung zum Kunden herstellen kann.
Was hat die "Service-Dominant Logic" mit dem Wertstrom zu tun?
Digitales Handeln und digitales Denken sollte man eigentlich jenen unterstellen dürfen, die sich alltäglich mit digitalen Technologien auseinandersetzen müssen.
Weit gefehlt, just jene, die sich in der IT bewegen müssen, IT-Serviceleistungen als interne IT-Einheit anbieten oder als marktwirksamer Dienstleister auftreten, haben die letzten zwei bis drei Jahrzehnte nur eines gelernt und kultiviert:
Technologie ist nur Mittel zur Effizienzsteigerung!
Just jene, die sich um die digitalen Brücken zum Kunden, also darum kümmern hätten müssen, waren eher den Versuchungen erlegen zuerst Effizienz und Effektivität in die iAbläufe zu bringen, als sich um die Bedürfnisse derer zu kümmern, die sie finanzieren
Die Sicht der funktionellen und prozessualen Effizienz verleitet automatisch dazu, den internen Nabel mit immer neuen Perspektiven so lange zu betrachten, bis es in der Kundenbeziehung zu folgendem Zerrbild führt:
Der Kunde bekommt ein Produkt oder Dienstleistung bereitgestellt und hat gefälligst zufrieden zu sein. Wenn nicht, wird so lange an einer Lösung gearbeitet, bis sich der Kunde zufriedengibt.
Dieses Paradigma nannten und nennen die Marketingspezis von Welt bis zum Jahre 2004 «Product dominant Logic».