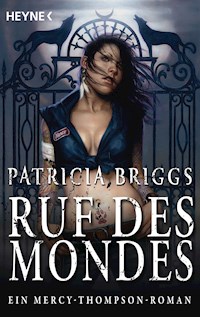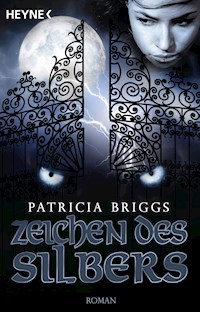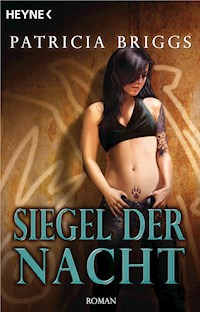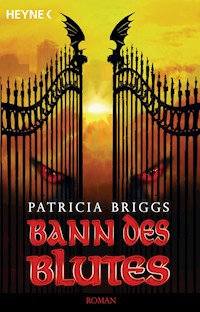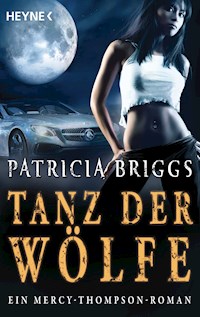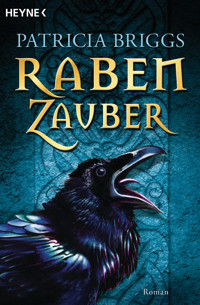9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mercy-Thompson-Reihe
- Sprache: Deutsch
Als der Vampir Wulfe spurlos verschwindet, hat Automechanikerin und Gestaltwandlerin Mercy Thompson ein Problem: Wulfe ist nicht nur verrückt und brandgefährlich, er ist auch Mercys Stalker. Und so gerät ihr ganzes Rudel unter Verdacht, etwas mit seinem Verschwinden zu tun zu haben. Gelingt es Mercy nicht, Wulfe zu finden, kündigen die Vampire das Bündnis mit den Werwölfen auf. Widerwillig macht sie sich auf die Suche nach ihrem Erzfeind und entdeckt, dass er nicht das einzige magische Wesen in den Tri-Cities ist, das vermisst wird. Bei ihren weiteren Ermittlungen stößt sie auf die uralte Legende des Seelendiebs ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Gerade als Mercy und ihr Gefährte Adam glauben, es sei endlich ein wenig Ruhe ins Columbia-Basin-Rudel eingekehrt, stehen die Vampire mit ihrer Anführerin Marsilia vor der Tür: Wulfe, einer der Ihren, wird vermisst. Wulfe ist nicht nur uralt und mächtig, sondern auch brandgefährlich und ein wenig verrückt. Mercy soll herausfinden, wo er steckt, bevor er Unheil anrichtet. Dann verschwinden weitere magische Wesen in den Tri-Cities, und schnell ist klar, dass die mysteriösen Fälle zusammenhängen. Bei ihren Ermittlungen stoßen Mercy und Adam auf die Legende des Seelendiebs: ein mächtiges Artefakt, das Tod und Zerstörung in sich trägt. Wer seiner Magie zum Opfer fällt, auf den wartet der gähnende Abgrund der Finsternis. Nicht auszumalen, was geschieht, wenn der Seelendieb in die falschen Hände gerät. Mercy benötigt die Hilfe ihres alten Freundes Zee, der auch als der dunkle Schmied von Drontheim bekannt ist. Doch Zee gehört zum Feenvolk, und auch wenn Mercy ihn über alles liebt, weiß sie, dass dem Feenvolk nicht zu trauen ist …
Die Autorin
Patricia Briggs, Jahrgang 1965, wuchs in Montana auf und interessiert sich seit ihrer Kindheit für Phantastisches. So studierte sie neben Geschichte auch Deutsch, denn ihre große Liebe gilt Burgen und Märchen. Neben erfolgreichen und preisgekrönten Fantasy-Romanen wie Drachenzauber und Rabenzauber widmet sie sich ihrer Mystery-Saga um Mercy Thompson. Nach mehreren Umzügen lebt die Bestsellerautorin mit ihrer Familie in Washington State.
PATRICIA BRIGGS
Seelen-dieb
Ein Mercy-Thompson-Roman
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe: SOUL TAKEN Deutsche Übersetzung von Vanessa Lamatsch
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 03/2023
Redaktion: Anneliese Schmidt
Copyright © 2022 by Hurog, Inc.
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-29487-8V001
www.heyne.de
Für Ann Peters, meine getreue Assistentin, alias Sparky, die mein gesamtes Arbeitsleben besser macht.
Präludium
Er stand in Mercys Schlafzimmer, im Herzen des Heims seiner Feindin.
Auf den Gedanken folgte ein leises Stirnrunzeln. Nein, sie war nicht länger seine Feindin. Dann eben seine Verbündete. Sie hatte um seine Hilfe gebeten – etwas, was selbst seine Herrin selten tat, unzuverlässiger Diener, der er war.
Er hatte Mercy geholfen – vielleicht –, und sie hatte … sie hatte etwas mit ihm angestellt. Er wusste nicht, wie er es nennen sollte – weil es sich angefühlt hatte, als hätte sie ihn gerettet. Bis die Wirkung nachgelassen und er verstanden hatte, dass sie ihn vielleicht stattdessen zerstört hatte. Hoffnung war das tödlichste aller Gefühle.
Er ging nicht davon aus, dass sie seine Feindin war. Aber sicherlich auch nicht seine Freundin.
Vorsichtig hielt er den seidigen Stoff seines Schatzes. Der Gegenstand war jetzt sehr alt, wenn auch nicht so alt wie er selbst, und er holte den Stoff nur selten aus seiner schützenden Kiste, aus Angst vor Schäden. Er hielt seine Kostbarkeit an die Nase und gab vor, immer noch das gehaltvolle Jasmin-Parfüm riechen zu können, das sie getragen hatte, um die Gerüche zu überdecken, die gesunde menschliche Körper eben produzierten, bevor tägliches – oder auch nur wöchentliches – Waschen in Mode kam. Er vermisste diese Gerüche; heutzutage roch alles blass und nichtssagend.
Dieser zerbrechliche Stoff – ein Geschenk an die Person, die er einst gewesen war – war sein Anker. Eine Erinnerung daran, dass er einst intakt gewesen war. Einst hatte er Freude empfunden. Er ging ein Risiko ein, indem er diesen Stoff – diesen letzten Rest seiner Seele – hier hinterließ. Mercy war unberechenbar, und das Chaos folgte ihr.
Beim Gedanken, den bestickten Seidengürtel dem Chaos zu überlassen, drückte er den Stoff enger an den Körper. Aber nur für einen Moment. Denn Mercy, anders als er selbst, fügte Unschuldigen kein Leid zu. Sie würde diesen farbenfrohen, hübschen Gegenstand sicher verwahren. Er empfand Erleichterung, als die Wahrheit dieses Gedankens einsank, und endlich verstand er den Impuls, der ihn dazu getrieben hatte, den Gürtel hierherzubringen.
Er legte den Gürtel auf Mercys Bett, legte den Kopf auf das Kissen ihres Gefährten und drückte sich die seidenen Schnürbänder seines Schatzes an die Wange. Dann schloss er die Augen.
Er war kein Christ. War es nie gewesen. Trotzdem stiegen voller Ironie die Worte eines Kindergedichtes in ihm auf.
Oh Herr, ich bin zum Schlaf bereit
Bitte schütz meine Seele vor jedem Leid
Und sollt’ der Tod meinen Körper lähmen
Fleh ich, meine Seele schützend zu dir zu nehmen
Er lachte lautlos, als Tränen in seine Augen stiegen. Seine Lippen bewegten sich stumm auf dem alten Seidengürtel, formten die Worte »Ardeo. Ardeo. Ardeo.«
Ich brenne.
1
Mercy.«
Adam spähte auf mich herunter. Seine wilden goldenen Augen hielten meinen Blick. In den hellen Tiefen lauerten ein paar dunkle Einschlüsse, wie bittere Schokolade in schmelzender Butter. Eisiger Regen tropfte von seiner Stirn auf mein Gesicht. Ich blinzelte.
Das Gold war besorgniserregend, dachte ich vage und wischte mir ungeschickt mit der Hand über die Wange. Ich sollte dem gefährlichen Gold in seinen Augen Beachtung schenken.
»Hübsch«, sagte ich.
Jemand unterdrückte ein Lachen, aber es war nicht Adam. Sein Stirnrunzeln vertiefte sich.
Ich hatte gerade … nun, ich konnte mich nicht genau erinnern, aber ich hatte definitiv nicht auf dem feuchten Boden gelegen, während eisiger Regen – oder vielleicht auch sehr nasser Schnee – über mein Gesicht glitt und ich in Adams wilde Augen starrte. Ich hob eine Hand, die mir nicht recht gehorchen wollte, und packte den Kragen seines Hemdes.
Auch wenn ich immer noch nicht klar denken konnte, fiel es leicht, eine Verbindung herzustellen zwischen dem epischen Kopfschmerz, der scheinbar von meiner Schläfe ausstrahlte, und meiner Position auf dem Boden. Etwas musste mich hart getroffen haben. Ich vermutete, dass ich – kaltes Wasser tropfte auf meine Wange – schon in einer Minute wieder fit sein dürfte, aber Adams Miene ließ mich vermuten, dass das eine zu lange Zeitspanne war, um eine Explosion zu verhindern.
Das könnte übel werden. Schlimmer, als wenn Adam nur die Kontrolle über seinen Wolf verlor. Seinen gewöhnlichen Wolf. Die kurz aufblitzende Erinnerung an einen David-Cronenberg-inspirierten Film-Werwolf, der sich mit riesigen, blutbesudelten Zähnen an meiner Kehle zu schaffen machte, riss mich effektiver aus meiner Betäubung, als es dem kalten Wasser gelungen war, das vom Himmel fiel.
Ich schnappte nach Luft, als Adrenalin in meine Adern schoss und offenbar die letzten dunklen Reste der Menschlichkeit aus Adams Blick vertrieb, auch wenn der Schock gleichzeitig dafür sorgte, dass ich klarer denken konnte. Weder Adam noch ich wussten, ob das grausame Monster, in das er sich dank eines Fluches der Hexe Elizaveta verwandeln sollte, wirklich verschwunden war … oder nur im Verborgenen den rechten Augenblick abwartete.
Adam hatte das Rudel gewarnt, dass die Möglichkeit bestand, dass er sich in etwas Gefährlicheres verwandeln könnte; ein Monster, das er nicht immer kontrollieren konnte. Doch wie Werwölfe nun einmal waren, schienen sie diesen Umstand als Adams neue Superkraft zu sehen statt als tatsächliche, beängstigende Bedrohung. Sie hatten das Monster noch nicht gesehen.
Adam hatte tiefe Erleichterung empfunden, nachdem der Vollmond gekommen und vorübergegangen war, ohne dass etwas anderes als Adams normale Wolfsform dem Ruf des Mondes gefolgt war. Sein Temperament, immer aufbrausend, war noch unberechenbarer geworden, aber meiner Vermutung nach ließ sich das auf die ungewöhnlichen Belastungen der letzten paar Monate zurückführen. Und doch …
Ich suchte im Gesicht meines Gefährten nach Hinweisen auf das Monster und sah … Adam. Die Erfahrungen des letzten Jahres hatten Spuren hinterlassen. Trotz seines jugendlichen Aussehens, das typisch für Werwölfe war, wirkten seine Augen älter, seine Miene angespannt, infolge der Last von Elizavetas Fluch und der diversen Schrecken der letzten Monate. Er strahlte immer noch das Selbstbewusstsein aus, das so sehr Teil von ihm war. Aber insgesamt wirkte er inzwischen eher wie ein kriegsmüder Soldat.
Ich zerrte ein wenig fester am Kragen seines Hemdes.
Adam blinzelte und ein dunkler Ring bildete sich um seine Iris. Beruhigt packte ich fest genug zu, um ihn zu würgen, und ignorierte dabei den dumpfen Schmerz, der von der Stelle an meinem rechten Arm ausging, an der eine Meuchelmörderin mich getroffen hatte, kurz bevor Adams Monster sie gefressen hatte.
Ich hätte Adam niemals zu mir herunterziehen können, wenn er das nicht gewollt hätte. Er war ein Werwolf, ich nicht. Ich hätte mich hochziehen können, aber diese Mühe blieb mir erspart. Er beugte sich vor und presste seine Lippen sanft auf meine, begleitet vom Heben einer einzelnen Augenbraue, das mir verriet, dass er genau wusste, was ich plante, aber bereit war, mitzuspielen.
Er setzte sich auf den Boden, ohne auf den Matsch zu achten, und zog mich auf seinen Schoß. Es war, als säße ich auf einem Ofen. Mein gesamter Körper schmolz dahin, kuschelte sich an seine Wärme und versank in dem warmen Geruch von Heimat. Für eine halbe Sekunde war da noch eine andere Witterung, ein ranziger Geruch – aber vielleicht hatte ich mir das auch nur eingebildet. Denn als ich erneut einatmete, roch ich nur Adam.
Ich ließ den Kopf gegen seine Schulter sinken, die hart war wie Stein. Und das lag nicht daran, dass er sich vor Zorn verspannt hätte; er war einfach so durchtrainiert. Jede Nachgiebigkeit war verschwunden und nur Muskeln und Knochen zurückgeblieben. Adams Körper war unnachgiebig. Aber falls ich einen weichen Partner wollte, musste ich nach jemandem suchen, der nicht als Alpha einem Werwolfrudel vorstand. Nach jemand anderem als Adam.
Als meine Schläfe auf sein Schlüsselbein sank, stieß ich zischend den Atem aus. Sofort wurden Adams Muskeln steif. Fast hätte ich es vergessen. Das alles hatte angefangen, weil etwas mich gegen die Schläfe getroffen und umgeworfen hatte.
»War es Bonarata?«, fragte ich. Aber das klang falsch. Der Herr der Nacht – vampirischer Herrscher über alles, was er sehen konnte – hielt sich in Italien auf. Und wir hatten alle Hexen getötet, oder nicht? Selbst Elizaveta war tot. Und der fae-artige Rauchdrache war dorthin verschwunden, wohin fae-artige Rauchdrachen eben verschwanden.
Wieder hörte ich unterdrücktes Lachen. Hätten sich Feinde um uns herum aufgehalten, hätte niemand gelacht – und Adam hätte sich nicht auf den Boden gesetzt.
Jemand sagte, leise, aber nicht leise genug: »Verflixt. Sie wird schon wieder ein blaues Auge kriegen.« War das Honey? Aber gewöhnlich war sie zu klug für so was.
Adam schloss die Arme um mich und knurrte. Und das Geräusch war keines, das aus einer rein menschlichen Kehle stammen konnte. Er war nach wie vor sehr unglücklich über die Schäden, die ich als seine Gefährtin davontrug – eine Position, die gewöhnlich von einer menschlichen Frau eingenommen wurde, die wann immer möglich von allem ferngehalten wurde … oder einer Werwölfin, die für sich selbst einstehen konnte. Ich dagegen war nichts davon; ich war eine Kojoten-Gestaltwandlerin und ein eigenständiges Rudelmitglied, mit allen Privilegien und Pflichten, die damit einhergingen. Ich ließ mich nicht von den Werwölfen – oder Adam – verhätscheln. Das wäre nicht gut für uns alle gewesen; egal, wie schwer es Adam auch fiel, diese Tatsache zu akzeptieren.
»Hey, Boss«, erklang Warrens gleichmütige Stimme … die er immer einsetzte, wenn er sich nicht sicher war, ob er wirklich mit einem vernunftbegabten Gegenüber sprach.
Ich drehte den Kopf und entdeckte den hochgewachsenen, schlaksigen Cowboy vielleicht drei Meter entfernt, seine Haltung betont entspannt. Das hätte überzeugender gewirkt, hätte nicht ein Anflug von Gold in seinen Augen geleuchtet. Ein paar Meter hinter ihm drängte sich das Rudel in einem schlammbespritzten, schweigenden Haufen.
Adam hob ebenfalls den Kopf.
Augenblicklich wich das Rudel zurück. Warren drehte den Kopf, bis er nicht mehr in unsere Richtung sah.
Doch seine Stimme blieb ruhig und gleichmäßig, als er sagte: »Bist du dir sicher, dass du sie bewegen solltest? Vielleicht sollte Mary Jo sicherstellen, dass Mercy keine Gehirnerschütterung davongetragen hat.«
Mary Jo war Feuerwehrfrau und ausgebildete Sanitäterin.
Auch dieser Kommentar war für Adam keiner Antwort würdig; die Anspannung wuchs. Was genau der gegenteilige Effekt war, den wir mit unserem Ausflug aufs Kürbisfeld hatten erreichen wollen.
Unser Rudel, das Columbia-Basin-Rudel, war unabhängig von den anderen Werwölfen – das einzige Rudel auf dem gesamtamerikanischen Kontinent, das nicht zu Bran Cornick, dem Marrok, gehörte. Brans oberstes Ziel war das Überleben der Werwölfe. Und dieses Ziel verfolgte er ohne Rücksicht – was der Grund war, warum wir auf uns selbst gestellt waren.
Ein weises Rudel, des Schutzes des Marrok beraubt, musste sich im Hintergrund halten, wenn es überleben wollte. Unglücklicherweise stand uns diese Option nicht zur Verfügung.
Man konnte ohne anzugeben sagen, dass wir das bekannteste Rudel der Welt waren, zumindest, was die menschliche Gesellschaft anging. Adam – unser Alpha, mein Gefährte – wäre an jeder Straßenecke in den gesamten USA erkannt worden. Dieser Umstand hatte seinen Anfang als Versehen genommen, wegen seiner Kontakte beim Militär, unterstützt durch Adams Bereitschaft, mit den Medien zu sprechen, und seinem attraktiven Aussehen, das schon vor seiner Verwandlung in einen Werwolf der Fluch seines Lebens gewesen war.
Aber es war meine Schuld, dass inzwischen unser gesamtes Rudel zusammen mit ihm leiden musste.
Vor ein paar Jahren war das Schlimmste, was den Leuten (und anderen fühlenden Wesen) in den Tri-Cities in Washington State Angst eingejagt hatte, die Vorstellung gewesen, dass einer der Auffangbehälter für nukleare Abfallprodukte in Hanford – gefüllt mit den giftigen Überbleibseln der frühen, experimentellen Jahre der nuklearen Wissenschaft – seinen zähflüssigen Inhalt in den Columbia River ergoss. Oder vielleicht auch explodierte.
Es gab fast zweihundert dieser alternden Tanks, und in einigen davon lagerten fast vier Millionen Liter. In jedem Tank ruhte eine ganze eigene Rezeptur einer üblen, radioaktiven Suppe. Doch damit nicht genug: Dank der geheimniskrämerischen Natur der Atomwissenschaft wusste niemand, was sich genau darin befand.
Es gab dort draußen Dinge, die beängstigender waren als Monster.
Egal.
Doch die Tri-Cities lagen nicht nur direkt neben einem Standort des Superfund-Programms für Altlasten, sondern auch nur ungefähr eine Stunde vom Ronald-Wilson-Reagan-Fae-Reservat entfernt, das die Fae zu einer Machtbasis in ihrem (überwiegend) kalten Krieg mit der US-Regierung ausgebaut hatten.
Da es dem Feenvolk in den Kram passte, und weil ich erklärt hatte, die Tri-Cities ständen unter dem Schutz des Rudels (eine dämliche Erklärung, die ich in der Hitze des Gefechts getätigt hatte), hatten die Fae bekannt gegeben, dass sie das Recht des Columbia-Basin-Rudels anerkannten und respektierten, dass wir unser Territorium schützten … und damit auch die Leute, ob nun Menschen oder Übernatürliche, die innerhalb dieser Grenzen lebten. Wir hatten eine Abmachung mit den Fae unterschrieben, dass wir genau das tun würden – und, wichtiger, dass das Feenvolk denjenigen, die unter unserem Schutz standen, keinen Schaden zufügen würde.
Wir hatten keine andere Wahl gehabt, und ich war mir ziemlich sicher, dass dasselbe auch für das Feenvolk galt. Aber Abmachungen mit den Fae neigten dazu, ein böses Ende zu nehmen, egal, wie gut die Absichten beider Seiten auch sein mochten – und deswegen hatte der Marrok sich von uns losgesagt.
Niemand wollte einen Krieg zwischen dem Feenvolk und den Werwölfen riskieren. Wenn unser Rudel auf sich selbst gestellt war, würden nicht die Werwölfe in ihrer Gesamtheit mit in den Konflikt hineingezogen werden, egal, was auch zwischen uns und dem Feenvolk – oder den Vampiren – geschehen mochte. Die Vernichtung unseres Rudels würde keinen Krieg zwischen der übernatürlichen Welt und den Menschen auslösen – solange wir allein standen.
Oder zumindest hofften das alle.
Seitdem strebten schwächere übernatürliche Wesen an den Ort der (vermeintlichen) Sicherheit und lösten damit – unter anderem – einen Wohnungsmangel aus. Hotels waren ausgebucht und die Kosten für Airbnb-Anmietungen gingen durch die Decke, weil es jetzt einen »sicheren« Ort gab, um Fae zu sehen, die mit normalen Menschen interagierten.
Auch Räuber wanderten ein, wenn auch auf unauffälligere Art. Es waren Kreaturen, die der Meinung waren, sie müssten sich keine Sorgen wegen eines einfachen Werwolfrudels machen, während sie in den reichen Jagdgründen jagten, zu denen die Tri-Cities geworden waren. Allein in der letzten Woche hatten wir zwei dieser Räuber getötet.
Unser Rudel war wild. Adam war Ehrfurcht gebietend und einfach fantastisch. Wir konnten auf die Unterstützung der Fae zählen – auch wenn diese leider genauso gefährlich war wie nützlich. Die örtliche Vampir-Siedhe unterstützte uns aus ganz eigenen Gründen. Unser Rudel, alle sechsundzwanzig Mitglieder, trug die Hauptlast der Aufgabe, das Territorium zu schützen – und da wir nicht mehr mit dem Marrok verbunden waren, würden wir in nächster Zeit auch keine neuen Wölfe ins Rudel aufnehmen.
Adam hatte auf diese neuen Entwicklungen reagiert, indem er uns in eine disziplinierte Kampftruppe verwandelt hatte. Zum einen Teil bedeutete das eine Menge Kampftraining. Zum anderen Teil aber auch, dass der Rudelzusammenhalt gestärkt werden musste.
Und genau deswegen hatte Adam an einem Dienstagabend im Oktober ein riesiges Kürbisfeld mit angeschlossenem Maislabyrinth gemietet, damit unser Rudel Spaß haben konnte.
Wer hätte gedacht, dass ein Kürbisfeld gefährlich werden könnte?
Der Oktober ist ein seltsamer Monat im östlichen Teil des Bundesstaates Washington. An manchen Tagen ist es sonnig bei fünfundzwanzig Grad, an anderen Tagen schwanken die Temperaturen bei Eisregen um den Gefrierpunkt. An unserem Spaßabend waren wir mit der zweiten Wettervariante konfrontiert, noch ergänzt durch heftige Windböen.
Mir war warm in Adams Armen, obwohl meine Kleidung bis auf die Haut durchnässt war. Ich senkte den Kopf, um den Boden zu betrachten und bemerkte eine dünne Eisschicht auf dem flüssiger werdenden Schlamm. Die Besitzer des Kürbisfeldes hatten heute mit uns Kasse gemacht – denn nur wirklich verzweifelte Eltern hätten bei diesem Wetter Geld für einen Besuch bezahlt.
Eine flatternde Fahne hinter Adams Schulter zog nun meine Aufmerksamkeit auf die Plakatwand neben dem Eingang zum Maislabyrinth. Auf einer Hälfte der Wand hatte sich ein Plakat halb aus dem Halt der Reißzwecken oder Heftklammern gelöst und gab den Blick frei auf eine grobe Holzoberfläche, die dringend eine neue Schicht Farbe brauchte.
Auf der anderen Seite prangte hinter Plexiglas ein Poster, auf dem eine düstere Gestalt mit Sense zu sehen war. Darüber zog sich in altmodischer Horrorschrift der Titel Der Schnitter. Ein laminiertes Blatt Papier, das an das Plexiglas geklebt war, verkündete Vorstellungen des Films ab Samstag, mit einem Eröffnungsevent, bei dem auch der in Pasco geborene Drehbuchautor erscheinen sollte.
Während ich die Plakatwand ansah und versuchte, den stechenden Schmerz in meiner Schläfe auszublenden, riss die Kombination aus Wind und Regen den Zeitplan ab. Das laminierte Papier sank zu Boden und landete auf einem kleinen Gegenstand in verdächtig strahlendem Orange, der ungefähr so groß war wie ein Softball. Ich drehte mich, um einen besseren Blick darauf zu erhaschen.
Oh, lieber Gott, dachte ich, als ich den orangefarbenen Verursacher meines aktuellen Verderbens anstarrte. Das werden sie mich nie vergessen lassen.
Soweit ich erkennen konnte, hatten sich alle Rudelmitglieder, die nicht gerade im Labyrinth unterwegs waren, vor dem Ausgang verteilt, um Adam nicht zu nahe kommen zu müssen. Sie bemerkten meine Blickrichtung. Mehrere zuckten zusammen oder zogen die Köpfe ein.
»Sagt mir«, erklärte ich, und meine Stimme klang dabei nicht weinerlich – oder zumindest nicht sehr –, »dass ich nicht gerade von einem Kürbis am Kopf getroffen wurde.«
»Es könnte sein, dass du nicht von einem Kürbis am Kopf getroffen wurdest«, sagte Honey, übertrieben freundlich. Sie wusste, dass sie in echten Schwierigkeiten steckte. »Es war orange, aber auch klein und hart, also sind wir uns ziemlich sicher, dass es streng genommen ein Flaschenkürbis war, kein normaler Kürbis. Wir haben darüber diskutiert, bevor …«
»Wir haben Baseball gespielt, um uns die Zeit zu vertreiben, bis die letzte Gruppe aus dem Labyrinth kommt«, erklärte Carlos, einer der anderen Wölfe, entschuldigend. »Hätten wir Softbälle verwendet, wäre der Schlag nicht mal in deine Nähe gegangen. Aber diese Dinger sind nicht rund. Ihre Flugbahn vorauszuberechnen ist unmöglich.«
»Macht das Spiel interessanter«, meinte Mary Jo nüchtern, wenn auch mit einem Funkeln in den Augen.
Mary Jo war fast so schlammverschmiert wie ich. Ihr kurzes blondes Haar klebte an ihrem Kopf. Sie war die Kleinste in der Gruppe der Werwölfe. Aber nicht viele konnten in einem Kampf gegen Mary Jo bestehen – wie sie bereits bewiesen hatte.
Sie hielt ein Kantholz in Händen, vielleicht einen Meter lang. Vermutlich der improvisierte Schläger. Ich fragte mich, ob wohl dieser Schläger den Kürbis … den Flaschenkürbis … in meine Richtung gejagt hatte. Falls ja, war ich mir ziemlich sicher, dass es keine Absicht gewesen war. Mary Jo und ich waren nicht unbedingt dicke Freundinnen, aber zumindest hasste sie mich nicht mehr.
Jedenfalls vermutete ich das stark.
»Die meisten Flaschenkürbisse zerplatzen einfach, wenn wir sie treffen«, meinte George, tough und selbstbewusst. Er war zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten Polizist gewesen. Momentan arbeitet er für das Pasco Police Department und das schon, seitdem das Rudel in den Tri-Cities residierte. Er gehörte zu den Wölfen, die Adam begleitet hatten, als mein Gefährte sein Rudel von New Mexico hierherverlagert hatte.
In Georges Stimme klang ein Hauch schuldbewusster Erheiterung mit. Er beugte sich vor, um das Geschoss aufzuheben, warf es in die Luft und fing es wieder auf, als wäre es wirklich ein Baseball. »Aber die Harten sind fast so gut wie ein echter Ball.«
Seufzend tätschelte ich Adam. Ich war von einem Flaschenkürbis am Kopf getroffen und bewusstlos geschlagen worden, um dann in eine Schlammpfütze zu fallen. Ziemlicher Schlag für mein Ego, aber für das Zusammengehörigkeitsgefühl des Rudels hätte nichts Besseres passieren können – solange Adam nicht beschloss, dass er mich verteidigen musste.
Schlamm tropfte aus meinen Haaren und glitt über meine Wange. Die Geschichte, wie ich aus Versehen ausgeknockt worden war, würde wieder und wieder erzählt werden, bis sie zu einer Rudellegende wurde. Zumindest war es kein gewöhnlicher Kürbis gewesen.
Ich wette, in den Geschichten wird es bald ein großer Kürbis sein, dachte ich niedergeschlagen. Geschichten veränderten sich, wenn sie oft erzählt wurden; sie wurden aufregender und unglaubwürdiger. Ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie in ferner Zukunft irgendwo ein Rudel um ein Lagerfeuer saß und Geschichten über die dämliche Kojoten-Gestaltwandlerin erzählte, die sich für einen Werwolf gehalten hatte, bis jemand ihr den Schädel mit einem Kürbis eingeschlagen hatte. Oder etwas anderes in dieser Art.
Ich hätte mich vielleicht noch eine Weile in meiner Demütigung gesuhlt, aber das Zucken von Adams Muskeln unter mir erinnerte mich daran, dass zumindest er den Vorfall nicht besonders lustig fand. Sobald ich aufstand, würde Adam sich auf das Baseballteam stürzen. Dann wäre der gesamte Effekt dieses Ausfluges dahin. Aber wenn ich nicht bald aufstand, würde er annehmen, dass ich ernsthaft verletzt war. Und das hätte die Sache auch nicht besser gemacht.
Aber Adam war so warm. Und ich muss zugeben, dass ich ein kleines bisschen pervers bin. Adam ist einfach atemberaubend attraktiv. Das ist es nicht, was ich an ihm am meisten liebe – es ist vielmehr sogar einer der Gründe, warum ich mich so lange von ihm ferngehalten habe. Er spielte definitiv nicht in meiner Liga. Was nicht bedeutete, dass ich sein Aussehen nicht zu schätzen wusste. Welche Frau wäre nicht glücklich darüber? Aber wenn er wütend war … hmmm. Einfach nur sexy.
Im Moment war er stinkwütend. Sehr ablenkend.
Ich drückte meine Wange an seinen Hals, drehte den Kopf, bis meine Lippen sein Ohr berührten und hauchte: »In deiner und meiner Zukunft wartet eine heiße Dusche. Könnte Spaß machen.«
Ich konnte fühlen, wie er erstarrte. Und mir wurde klar, dass ich, wenn auch unabsichtlich, das Beste getan hatte, um sein Augenmerk zu verlagern.
Ein weiteres leises Lachen von den billigen Plätzen erinnerte mich daran, dass wir Publikum hatten. Wir saßen im Matsch – oder zumindest Adam saß im Matsch –, und ich wünschte mir eine heiße Dusche. Und ich hatte vor, das eine Problem zu beheben und das andere anzugehen.
Daher richtete ich mich ein wenig auf und fragte, laut und (diesmal) absichtlich weinerlich: »Musstet ihr mich in den Schlamm werfen?«
»Wenn du beschließt, dich neben der größten Pfütze auf diesem riesigen Grundstück aufzustellen, darfst du dich nicht beschweren, wenn die Dinge ihren Lauf nehmen«, antwortete Warren milde, auch wenn sein wachsamer Blick kurz zu Adam huschte, bevor er den Blick wieder abwandte. »Wir haben es nicht absichtlich getan« – bisher hatten alle darauf geachtet, den wahren Schuldigen nicht zu nennen; Mary Jo war nicht die Einzige, die einen improvisierten Schläger hielt –, »aber wenn du uns so in Versuchung führst …«
Das Team der Wölfe im Labyrinth erzeugte schon eine Weile ziemlich viel Lärm. Manchmal klang es, als trieben sie sich direkt hinter der ersten Reihe Maispflanzen herum, manchmal kamen die Geräusche von weiter entfernt – was zu Wölfen passte, die in einem Labyrinth Fangen spielten. Alle sahen Adam und mich an, während Adam ganz auf mich konzentriert war – daher war ich die Einzige, die sah, wie Zack aus dem Ausgang stürmte.
Er rannte in Höchstgeschwindigkeit, eine Vielzahl von feuchten Bändern in der erhobenen Faust, die bewiesen, dass er die Wegpunkte innerhalb des Labyrinths gefunden hatte. Sein Gesicht war nach hinten gewandt und von der Art von vergnügtem Terror erfüllt, die mir verriet, dass Sherwood (den wir als Monster im Labyrinth erwählt hatten) ihm dicht auf den Fersen war.
Mir blieb nicht mal genug Zeit, um irgendwen zu warnen.
Zack rammte George in Höchstgeschwindigkeit an der Schulter und schleuderte den viel größeren Mann damit in die Gruppe der Wölfe. Zack selbst stolperte über Georges schwankenden Körper und gegen Mary Jo, die umkippte, wenn auch eher vor Überraschung, und nicht, weil Zack sie so hart getroffen hatte.
Kurz bevor Mary Jo auf den Boden knallte, sprang ein riesiger Wolf über die Maispflanzen hinweg – etwas, zu dem nicht jeder Wolf in unserem Rudel fähig gewesen wäre, weil die Wände des Labyrinths nicht nur fast drei Meter hoch, sondern auch mindestens so breit waren –, und diesem Wolf fehlte ein Hinterbein. Von meinem Aussichtspunkt auf Adams Schoß konnte ich den Moment erkennen, in dem Sherwood (der dreibeinige Wolf) die gesamte Szene in sich aufnahm.
Ich zweifelte nicht daran, dass er sicher hätte landen können. Doch stattdessen entschied er sich, mit befriedigtem Gesichtsausdruck einen Bauchklatscher im tiefsten Teil der Pfütze hinzulegen, in die ich bereits gefallen war. Ich spürte eine federleichte Berührung von Magie, dann wurden alle – Adam und ich eingeschlossen – mit kaltem, schlammigem Wasser bespritzt.
Zack erhob sich aus dem unordentlichen Haufen aus Körpern, wischte sich mit dem Unterarm das Gesicht und zeigte Adam und mir seine Faust voller jetzt vollkommen durchnässter Bänder. »Ich habe alle fünfzehn Bänder gefunden. Mein gesamtes Team gewinnt ein Steakessen bei Onkel Mike, richtig?«
Der Rest von Zacks Team tauchte aus dem Labyrinth auf, mit Joel an der Spitze und in normaler Geschwindigkeit. Sie wirkten – wenn das überhaupt möglich war – noch nässer als der Rest von uns. Aber sie lachten wie die Irren. Zacks Team war als Letztes angetreten und das Einzige, das alle Bänder gefunden hatte.
Sherwood stand auf und schüttelte sich mit selbstgefälliger Miene, wobei er die anderen (und Adam und mich) erneut mit Wasser bespritzte.
Adam hatte mich eng an sich gezogen, um mich vor den schlimmsten Auswirkungen zu schützen, also konnte ich den Moment spüren, als er sich entspannte und lachte.
Adam brachte mich nach Hause, während das Rudel aufräumte.
»Das Privileg eines hohen Ranges«, war alles, was Adam sagte, als ich erklärte, wir sollten bei der Säuberungsaktion helfen. Aber ich wusste, dass unser früher Aufbruch in Wirklichkeit dem Umstand geschuldet war, dass er sich immer noch Sorgen um mich machte.
Es ging mir gut. Ich hatte schon eine Menge Gehirnerschütterungen durchgestanden … und das hier war keine. Aber ich diskutierte nicht mit Adam – ich verdrehte nur hinter seinem Rücken die Augen in Mary Jos Richtung.
Sie streckte mir die Zunge heraus und schielte. In letzter Zeit kamen wir besser miteinander klar. Das verdankte ich zum Teil dem unglaublich charmanten Deputy, mit dem sie ausging – was bedeutete, dass Mary Jo nicht mehr nach Adam schmachtete. Ich dachte einen Moment darüber nach und entschied, dass vielleicht alles mit ihrem neuen Freund zusammenhing. Ich freute mich über ihr Glück.
Adam bemerkte Mary Jos Grimasse – sie hatte nicht versucht, ihre Reaktion vor ihm zu verbergen – und drehte sich zu mir um. Aber er war zu spät dran; ich hatte den Blick bereits abgewandt und schaute unschuldig drein.
»Ich habe gehört, wie deine Augäpfel geknirscht haben«, erklärte er mir, eine Formulierung, die er immer gegenüber seiner Tochter Jesse verwendet hatte, die mit dreizehn Jahren die Hohepriesterin des Augenrollens gewesen war.
Ich lachte.
»Wir sehen uns in einer Stunde bei Onkel Mike«, erklärte Adam dem Rudel.
»Das kriegen wir hin, Boss«, sagte Warren.
Ich musste zunächst noch Jesse meine Prellung und den ganzen Schlamm erklären, also lief die Dusche bereits, als ich unser Zimmer betrat. Kaum dass ich die Schlafzimmertür hinter mir geschlossen hatte, begann ich, meine schlammige Kleidung abzuwerfen. Als ich ins Bad ging, war ich bereits nackt – und Adam hatte das Wasser abgestellt und griff nach einem Handtuch.
»Nö«, verkündete ich, zog ihm das Handtuch aus den Händen und ließ es auf den Boden fallen.
Er kniff die Augen zusammen – oder zumindest vermutete ich, dass er das tat. Mein Blick war nicht auf sein Gesicht gerichtet.
»Du bist verletzt.«
»Papperlapapp«, verkündete ich herablassend – ein Ausdruck, den ich von Ben übernommen hatte. Die meisten seiner britischen Wörter waren für den Gebrauch in der Öffentlichkeit nicht geeignet, aber »Papperlapapp« mochte ich. »Es ist eine Prellung. Sie wird verblassen. Und du hast mir Sex in der Dusche versprochen.«
»Ich denke, du hast mir dieses Versprechen gegeben«, antwortete er.
»Du, ich, wen interessiert das?« Ich packte seine Hand und zog ihn zurück in die Dusche. »Stups.«
Es war eine große Dusche, mehr als groß genug für zwei Personen.
»Es ist nicht fair, dass du die Massenvernichtungswaffen einsetzt«, grummelte Adam gespielt schlecht gelaunt. »Stups« war unser Codewort, dem man sich nicht widersetzen, das man aber auch nicht zu oft einsetzen durfte. Aber ich wusste, dass mein Gefährte meine Pläne guthieß, egal, was er auch sagen mochte.
»Wenn man es mit dem großen bösen Wolf zu tun hat, muss man alle zur Verfügung stehenden Waffen nutzen«, erklärte ich, als ich das Wasser aufdrehte.
Ich zuckte nicht zusammen, als der Strahl meine Wange traf. Adam bemerkte trotzdem etwas und hob die Hand, um mein Gesicht zu schützen.
»Mit Freude hatte ich nicht gerechnet«, meinte er, bevor er die empfindliche Haut hinter meinem Ohr küsste.
»Was?«, fragte ich abgelenkt.
Er hob den Kopf und suchte meinen Blick. Die Pupillen in den dunkelbraunen Tiefen waren vor Leidenschaft geweitet. »Du schenkst mir Freude«, sagte er deutlich. »Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich habe es nicht verdient – aber ich beanspruche dich für mich.«
»Ja, sicher«, gab ich zurück. »Ich dachte, das hätten wir bereits erklärt, als ich dich erst zu meinem Gefährten und dann zu meinem Ehemann erklärt habe. Ich bekomme dich. Du bekommst mich. Umtausch ausgeschlossen.«
Er lachte. Küsste mich.
Ich vergrub das Gesicht an seiner Brust und atmete tief ein. Adam schenkte mir ebenfalls Freude. Aber vor allem schenkte er mir diese verlässliche Sicherheit, dass jemand für mich da war.
Als Teenager war mir mit dem Tod meiner Pflegeeltern das Zuhause geraubt worden. Meine Pflegemutter war bei dem Versuch gestorben, zur Werwölfin zu werden. Mein Pflegevater, Bryan, hatte sich danach umgebracht, unfähig, ohne seine Gefährtin weiterzuleben. Ich war mit vierzehn Jahren allein zurückgeblieben. Die nächsten zwei Jahre hatte ich im Rudel des Marrok verbracht, unter seiner Obhut und in gewisser Weise auch seinem Schutz. Mit sechzehn Jahren habe ich dann sogar das verloren.
Doch zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Ich hatte jahrelang ein einsames Leben geführt und geglaubt, ich wäre zufrieden. Und dann war Adam aufgetaucht und hatte meine Welt auf den Kopf gestellt.
Ich schlang die Arme um ihn, nahm die Gegenwart dieses Mannes voller Pflichtgefühl und Stärke in mich auf; dieses Mannes, der mich liebte, obwohl er jede Frau hätte haben können. Ich konnte nicht in Worte fassen, wie sehr ich ihn liebte. Oder zumindest kannte ich die richtigen Worte nicht. Aber ich wusste, wie ich es ihm zeigen konnte.
Und das war für uns beide ein freudiges Vergnügen.
Als er mich schließlich schlaff und tief befriedigt aus der Dusche trug, flüsterte er grollend: »Umtausch ausgeschlossen.«
Onkel Mike’s war ein Pub des Feenvolkes für die übernatürlichen Einwohner der Tri-Cities. Von außen betrachtet, wirkte das Lokal wie eine heruntergekommene Kneipe in einem alten Lagerhaus in einem Industriegebiet von Pasco – nicht gerade die Gegend, in der man einen Pub vermutete.
Es gab einige Bars und Kneipen in den Tri-Cities, in denen Touristen Vertreter des Feenvolkes treffen konnten – Fae, die sorgfältig nach ihrer Fähigkeit ausgewählt worden waren, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Es gab sogar einen Pub, in dem inzwischen eine Low-Budget-Realityshow über die Begegnungen zwischen Touristen und Fae gedreht wurde. Onkel Mike hatte seinen Pub ebenfalls kurzzeitig für die Touristen geöffnet, doch das Bedürfnis nach einer eigenen Kneipe, in der wir einfach wir selbst sein konnten, war einfach zu groß. Auf Bitten seiner gewöhnlichen Gäste – und auch ein paar der eher ungewöhnlicheren – hatte Onkel Mike seine Türen für die allgemeine Öffentlichkeit wieder geschlossen.
Als Adam und ich ankamen, hielt sich der Großteil des Rudels bereits in dem von uns reservierten Nebenzimmer auf – obwohl wir es ihnen überlassen hatten, das Chaos am Maislabyrinth aufzuräumen.
Die Rudelmitglieder begrüßten unser Zuspätkommen mit hemmungsloser Erheiterung – nachdem einige von ihnen meinen Vorschlag einer Dusche mit gewissen Vorteilen belauscht hatten. Ihre Belustigung vermischte sich mit der überschwänglichen Grundstimmung, die das Rudel erfüllte. Das Wissen, dass die Verbindung zwischen Adam und mir stark war, vermittelte den Wölfen ein Gefühl der Sicherheit. Manchmal fühlte ich mich nicht ganz wohl mit dem Interesse des Rudels an meinem … nein, um ehrlich zu sein, an Adams Liebesleben.
Aber ich verstand es. Für Werwölfe gibt es einen Ort der Sicherheit, und in dessen Mitte befindet sich der Alpha. Adams Stärke und Stabilität bildeten das Herz unseres Rudels. Adam hatte gerade ein paar harte Monate hinter sich … und alles, was ihn glücklich machte, war gut fürs Rudel. Unser Liebesspiel war und durfte nicht immer privat sein, dafür war es einfach zu wichtig für das Überleben des Rudels.
Der Abend verging mit genauen Nacherzählungen all der lustigen Vorfälle und Katastrophen des Nachmittags, mit Sherwood als Star der Show. Er hatte es niemandem leicht gemacht, was Zacks Triumph besonders süß machte. Wir hatten es verpasst, aber anscheinend hatte Zacks Team ihn auf dem Parkplatz auf die Schultern gehoben und triumphierend in die Kneipe getragen.
Unser einzelgängerischer, unterwürfiger Wolf scheute meist die Aufmerksamkeit, doch heute Abend wirkte Zack entspannt und glücklich. Ich bemerkte, dass immer wieder Rudelmitglieder an seinem Tisch vorbeigingen, um ihn abzuklatschen, ihm auf die Schulter zu klopfen oder ihm kurz das Haar zu verwuscheln. Wie glückliche Alpha-Wölfe machten auch Unterwürfige das Rudel sicherer. Zacks ruhige Zufriedenheit füllte den Raum wie die Wärme eines Kaminfeuers im Winter. Der Effekt wirkte auf alle bis auf Warren, wie ich mit leichter Sorge bemerkte.
Warren war normalerweise genauso unerschütterlich wie alle dominanten Werwölfe, die ich je gekannt hatte. Aber jetzt wirkte er viel angespannter als im Maislabyrinth. Und ich war nicht die Einzige, der das auffiel. Er saß auf seinem üblichen Platz direkt neben Zack … und alle hielten ein wenig Abstand zu ihm.
Zack lebte mit Warren und seinem menschlichen Gefährten Kyle. Und damit meine ich, dass er ihr Mitbewohner war, nicht ihr Mitbewohner. Das war eigentlich als Übergangslösung gedacht gewesen, aber keiner der drei machte irgendwelche Anstalten, etwas an der Regelung zu ändern. Und ich fühlte mich besser, weil unser verletzlichstes Rudelmitglied (neben mir) unter Warrens Schutz lebte.
Wie Warren – und trotz dieses wunderbaren Zwischenspiels unter der Dusche – war ich unruhiger als gewöhnlich. Nach dem Anziehen hatte Adam mir den wahren Grund verraten, warum er nach dem Maislabyrinth noch eine Party angesetzt hatte. Ich war nicht glücklich darüber, dass er mir gewisse Dinge vorenthalten hatte.
Ich trank mein Limettenwasser und blieb auf meinem Platz sitzen, während Adam durch den Raum wanderte und seinen Teil tat, um die fröhliche Atmosphäre zu erhalten. Was klug war. Denn auch wenn ich ihn liebte: In diesem Moment war ich ziemlich unglücklich, und durch das Zurückhalten von Informationen hatte Adam sich zur Zielscheibe meines Zorns gemacht.
Wie Warren wurden auch mir einige verstohlene Blicke zugeworfen. Doch es war Joel, eines der ebenfalls siegreichen Teammitglieder von Zack, der meine verschlossene Miene ignorierte und auf mich zuging.
Joel zog Adams Stuhl heraus und nahm darauf Platz. Dann musterte er schweigend mein Gesicht. Er war derjenige, der beschlossen hatte, sich zu mir zu setzen; er konnte das Gespräch eröffnen.
Nach ein paar Minuten sagte er: »Du bist wegen irgendetwas wütend.«
»Sehr«, log ich.
Ich hätte niemals versucht, einen der Werwölfe anzulügen. Aber Joel war (neben mir) das einzige Rudelmitglied, das kein Werwolf war. Seine Sinne funktionierten ein wenig anders … und er war ziemlich neu in diesem ganzen übernatürlichen Geschäft.
Ich kannte Joel (die spanische Version des Namens, auch wenn er sich nicht groß daran störte, wenn Leute den Namen falsch aussprachen) als Bekannten schon länger als jeden anderen hier im Raum, obwohl er fast das jüngste Mitglied des Rudels war. Ich arbeitete als VW-Mechanikerin … und er hatte schon an alten Autos herumgeschraubt, bevor ich die Werkstatt übernommen hatte.
Joel hatte sich – aufgrund seiner Abstammung – im Visier eines uralten Gottes wiedergefunden. Der Vorfall hatte ihn besessen vom Geist einer Tibicena zurückgelassen – einem Vulkan-Caniden (»Hund« war einfach nicht das richtige Wort). Oder war eher er im Besitz des Geistes? Das war schwer zu sagen. Es war Joel monatelang nicht gelungen, lange genug in seiner menschlichen Gestalt zu verweilen, um in sein normales Leben zurückzukehren. Glücklicherweise hatte er es geschafft, die glühende Tibicena, zumindest meistens, unter Kontrolle zu halten, sodass er im Körper eines schwarz gestromten Presa Canario feststeckte – einer Bestie, die fast so beängstigend war wie die meisten Werwölfe.
Doch in letzter Zeit kam Joel besser zurecht. Letzte Woche waren er und seine Ehefrau aus dem Hauptquartier des Rudels (Adams und mein Haus) zurück in ihr frisch renoviertes Heim gezogen – und hatten unseren aus dem Land unter dem Feenhügel geretteten Jungen – Aiden – mitgenommen, um die Sicherheit aller zu garantieren. Aiden besaß die Gabe des Feuers und konnte Joel helfen, falls dieser die Kontrolle über die Tibicena verlor.
»Du bist nicht wütend«, sagte Joel mit einem Stirnrunzeln, als wäre ich eine widerspenstige Motoraufhängung – ein Rätsel, das gelöst werden musste. »Das war eine Lüge.«
So viel dazu, dass Joel einfacher zu belügen wäre als einer der Werwölfe.
»Ich bin ein bisschen wütend.«
Er musterte mich genau. »In Ordnung«, meinte er langsam. »Das war keine Lüge. Auf wen bist du wütend?«
Ich antwortete nicht, weil es keine ehrliche Antwort gab, die nicht dafür gesorgt hätte, dass ich klang wie eine Dreizehnjährige. Nur Jugendliche können Dinge wie »das Schicksal« oder »die Welt« sagen und danach nicht zusammenzucken. In meinem Alter sollte man eigentlich verstanden haben, dass das Leben nicht fair war. Und man sollte auch damit aufhören, diese Fairness einzufordern. Wenn ich ehrlich war, war meine Wut auf Adam – an die ich mich geklammert hatte – verpufft, nachdem ich ihn zehn Minuten dabei beobachtet hatte, wie er sich um unser Rudel kümmerte.
Adam würde immer versuchen, die Last der Welt allein auf den Schultern zu tragen. Wenn mir das nicht gefiel, hätte ich mir einen anderen Gefährten aussuchen müssen.
Joel und ich hatten uns leise unterhalten, und im Raum war es laut – Musik, Lachen, Gespräche. Aber jetzt drehte er den Kopf, damit niemand sein Gesicht sehen konnte.
»Ich weiß, wer dich k. o. geschlagen hat«, meinte er.
Ich brauchte einen Moment, um zu verstehen, dass er dachte, ich wäre sauer wegen des Kürbisvorfalls – den ich bereits vollkommen vergessen hatte. »Das ist es nicht«, sagte ich. »Und wenn du nicht davon ausgehst, dass der Treffer Absicht war – denn das würde die Situation vollkommen verändern –, sag es mir nicht.« Ich dachte kurz nach, dann schob ich hinterher: »Tatsächlich solltest du es auch für dich behalten, falls du denkst, es wäre Absicht gewesen. Ich werde irgendwann herausfinden, wer es war. Und dann wird diejenige Person bezahlen.« Und das wäre besser, als Adam herausfinden zu lassen, dass jemand mich vorsätzlich verletzt hatte.
Joel grinste, und ich sah ein rotes Funkeln in seinen Augen. »Ich habe schon von deinen perfekten Racheplänen gehört. Jesse hat Aiden erzählt – der es wiederum mir weitererzählt hat –, dass es einen spektakulären Vorfall mit einem Schokoladenosterhasen gab. Du hast dein Licht bisher unter den Scheffel gestellt.«
Ich misstraute diesem Funkeln in seinen Augen; die Tibicena konnte niederträchtig sein. Wir hielten uns in einem Gebäude auf, das fast vollständig aus Holz erbaut war, und Aiden war nicht hier, um das Feuer aus Joel zu ziehen. Ich zweifelte nicht daran, dass Onkel Mike ein normales Feuer kontrollieren konnte, doch ich wollte lieber nicht herausfinden, ob er der Tibicena gewachsen war.
»Wir sprechen nicht über den Osterhasenvorfall«, verkündete ich ernst. »Es waren nur Osterhasen. Ich kann nichts dafür, dass Abführmittel mit Schokoladengeschmack verkauft werden.«
Ehrlich, meine Gefühle in Bezug auf den Osterhasenvorfall waren zwiespältig. Das Resultat war perfekt und sehr befriedigend gewesen. Doch mein erwachsenes Ich ging davon aus, dass die Osterhasen, die effektiv mehrere Werwölfe außer Gefecht gesetzt hatten, auch jemanden hätten töten können – besonders, falls eines meiner Opfer beschlossen hätte, einen Schokoladenhasen an ein menschliches Kind zu verschenken.
Als Erwachsene bevorzugte ich ein wohlüberlegteres, klügeres Vorgehen – zumindest wohlüberlegt genug, um niemanden umzubringen, den ich nicht umbringen wollte. Aber der Osterhasenvorfall hatte das gesamte Rudel des Marrok dazu gebracht, mich in Ruhe zu lassen. Alle außer Leah, der Gefährtin des Marrok.
Wie erhofft lachte Joel, und der rote Funke in seinen Augen verblasste.
Fantastisch, dachte ich. Es war immer eine gute Idee, nur eine Katastrophe auf einmal abzuhandeln.
»Oh, wie gern hätte ich dabei Mäuschen gespielt«, meinte er, dann rief jemand seinen Namen, bevor er weitersprechen konnte. Er schenkte mir ein bedauerndes Lächeln und zog los.
Das war ebenfalls gut. Weil er mich nicht gefragt hatte, was mich ärgerte, wenn es nicht die Tatsache war, dass ein Kürbis mich ausgeknockt hatte. Ich wollte ihm nicht erzählen, dass ich Angst hatte. Offensichtlich hatte er diese Tatsache auch nicht gewittert – das war der Grund, warum ich mich auf meine Wut konzentrierte, so kindisch sie auch sein mochte. Ich konnte nur hoffen, dass ich damit auch schärfere Sinne als Joels täuschen konnte.
Ich blieb nicht lange allein. Als Nächstes näherte sich Ben, der mit seinem blonden Haar und den blauen Augen trügerisch harmlos wirkte. Er zog einen dritten Stuhl an meinen Zweiertisch, um sich nicht auf Adams Stuhl setzen zu müssen. Ben war bereits lange genug Werwolf, um nicht in Adams Revier einzudringen … selbst wenn es nur um einen Stuhl ging.
Ben war, früher einmal, der gefährlichste von Adams Wölfen gewesen. Nicht weil er am mächtigsten war, sondern weil bei ihm die Wahrscheinlichkeit am größten gewesen war, dass er die Kontrolle verlor und jemanden umbrachte. Er war ins Columbia-Basin-Rudel geschickt worden, um Ärger in Großbritannien aus dem Weg zu gehen. Die schiere Entfernung von seiner ursprünglichen Heimat wies darauf hin, dass das, was Ben getan hatte, wirklich übel gewesen war. Irgendjemand hatte entschieden, dass seine Sünden nicht schlimm genug waren, um eliminiert zu werden … aber die Möglichkeit hatte offenbar im Raum gestanden. In den letzten Jahren hatte Ben sich gebessert. Er war sowohl stabiler als auch glücklicher geworden.
Trotzdem hatte er wie Adam ein paar harte Monate hinter sich. Er hatte eine Weile bei uns gewohnt, um sich von der Besessenheit durch einen Rauchdrachen zu erholen, und war erst vor ein paar Wochen wieder in sein eigenes Haus gezogen. Er wirkte so weit in Ordnung, aber er hatte gute zehn Kilo an Gewicht verloren und bisher nicht zurückgewonnen.
»Du siehst mich am Boden zerstört«, sagte er. Sein aristokratischer, englischer Akzent hatte mit der Zeit nachgelassen, doch wie sehr, war mir erst bewusst geworden, als er nun erneut in Erscheinung trat. »Ich war es.«
»Was warst du?«, fragte ich.
»Ich habe dich mit dem Kürbis getroffen.«
Ich fing seinen Blick ein. Wir starrten uns gute zwanzig Sekunden an, bevor wir nicht mehr an uns halten konnten. Sein Mundwinkel zuckte einmal, dann zweimal. Und das war’s. Ich lachte, bis mein Bauch wehtat und Tränen über meine Wangen liefen.
»So witzig war es gar nicht«, sagte er, aber er lachte ebenfalls. Und wirkte dabei gar nicht so gefährlich.
»Mit einem Flaschenkürbis«, presste ich hervor, wobei ich mich bemühte, seinen Akzent zu imitieren, weil die Aussage damit noch absurder klang.
Ich hatte diesen Lachanfall gebraucht. Und Bens zerknirschte Miene in Kombination mit dem Eingeständnis, der Schuldige im Kürbischaos gewesen zu sein, war einfach unglaublich witzig.
Honey, die gerade mit ein paar Biergläsern in der Hand vorbeiwanderte, schüttelte den Kopf. »Er hat gestanden, hm?«, fragte sie mich.
Sie musste sich ebenfalls zu Hause – oder irgendwo – geduscht und umgezogen haben, weil sie wie üblich elegant und gepflegt aussah, komplett mit Stoffhose und Seidenbluse. Sie gehörte zu den Frauen, die wussten, wie man Make-up so auflegte, dass es die Gesichtszüge betonte, ohne dass man die Schminke wirklich bemerkte.
Ich nickte. »Er hat mich mit einem Kürbis beschossen«, sagte ich, die Augen vor Erstaunen weit aufgerissen, um meine Imitation von Bens englischem Akzent zu betonen.
Honey grinste uns an – was ihr perfektes Gesicht menschlicher wirken ließ. »Wüsste ich es nicht besser«, meinte sie, »würde ich dich fragen, ob du getrunken hast.« Sie sah mich an. »Hast du gehört, dass die Personalabteilung Ben gebeten hat, sich am Telefon anders zu melden?«
»Nein?«, fragte ich in einem Tonfall, der klar erkenntlich mehr Informationen forderte.
»Sie haben mir mitgeteilt, dass ›Was zum Teufel ist dein Problem?‹ unpassend ist«, sagte Ben, ohne den Kopf zu heben.
»Ich habe gehört, es hat gerade mal zwei Wochen gedauert, bis sie ihm erklärt haben, dass er gerne wieder zu seiner ursprünglichen Formulierung zurückkehren könne«, meinte Honey.
»Alle neuen Begrüßungen waren noch schlimmer«, verkündete Carlos am Nebentisch.
»Es hat nur sechs Tage gedauert«, meinte Ben selbstgefällig.
Kurz darauf wurde Ben von ein paar anderen Rudelmitgliedern weggezerrt, und ich blieb erneut allein zurück.
Adam setzte sich wieder auf seinen Stuhl und stellte ein frisches Glas Limettenwasser vor mir ab.
»Ben hat gestanden«, erklärte ich ihm. »Es gab keinen hinterhältigen Plan, dich durch einen fliegenden Kürbis zum Witwer zu machen. Es war ein Unfall.«
»Ich habe gesehen, wie ihr gelacht habt wie die Irren.«
»Er hat mich mit einem Flaschenkürbis getroffen«, gab ich in meinem schlechten englischen Akzent zurück. »Er war am Boden zerstört.«
Adam lachte.
2
George brach als Erster auf.
»Ich wurde gerade angefordert«, erklärte er Adam laut genug, um über die Musik gehört zu werden, und schüttelte meinem Gefährten die Hand. »Irgendein Vorfall in einem Lebensmittelmarkt.«
Adam verspannte sich. »Gewalt?«
George zuckte mit den Achseln. »Für den Moment halten sie sich noch bedeckt – oder sie wissen es noch nicht.«
»Pass auf dich auf«, sagte ich.
»Du musst reden.« Georges Blick huschte über mein verfärbtes Gesicht. »Ich habe schon Leute in die Leichenhalle gebracht, die genau an dieser Stelle getroffen wurden. Ist ein verletzlicher Punkt am Schädel.«
»Ich ebenfalls«, sagte Adam, doch er klang entspannt. In diesem Moment wurde mir klar, dass ihm genau dieser Gedanke durch den Kopf geschossen sein musste, als er mich fallen gesehen hatte. Manchmal macht Wissen alles nur noch schlimmer.
»Ich bin noch nicht tot«, erinnerte ich die beiden. »Vermutlich bin ich einfach zu dickköpfig. Wenn meine Zeit kommt, werde ich gehen … und wahrscheinlich werde ich an etwas Dummem sterben. Aber wenn der Himmel gnädig ist, wird mich kein Kürbis ins Jenseits befördern.«
»In Ordnung«, meinte George mit einem leisen Lächeln. Er tippte sich in einem letzten Salut an die Stirn und ging zum Ausgang.
»Lass uns mit Zack reden«, sagte Adam.
Der Auftakt zur letzten Aufgabe des Abends. Mein Magen verkrampfte sich, doch gleichzeitig erfüllte mich eine seltsame Erleichterung. Warten stank zum Himmel.
»Dafür brauchst du mich nicht«, erinnerte ich ihn.
Er schenkte mir ein kleines Lächeln. »Ich mag es, dich in meiner Nähe zu haben.«
Ich ließ mein volles Glas neben dem leeren stehen und folgte Adam zu Zacks Tisch.
»Du müsstest heute Abend etwas länger bleiben als alle anderen«, murmelte Adam ihm zu. »Ich kann dich nach Hause fahren, wenn wir fertig sind.«
Warren, der immer noch neben Zack saß, stieß ein Brummen aus, hob leicht den Hintern an und zog einen Subaru-Schlüssel heraus, an dem immer noch das Etikett des Autohauses hing. »Ich werde mich von irgendwem mitnehmen lassen. Zack, nimm mein Auto.«
»Du hast ein neues Auto?«, fragte ich. Seitdem ich ihn kannte, fuhr Warren einen alten, heruntergekommenen Truck in den Farben Grundierung und Rost.
»Geschenk von Kyle«, sagte Zack und nahm ohne Widerspruch den Schlüssel von Warren entgegen.
Für einen Moment vergaß ich meine Sorgen. Warren nahm gewöhnlich keine so großen Geschenke von Kyle an.
Statt in Kyles schicker Villa hatten die beiden lange in einer Wohnung in einem Gebäude aus der Nachkriegszeit gelebt, weil Warren sich auf niemand anderen verlassen wollte. Selbst nachdem sie in Kyles Haus gezogen waren, hatte Warren seine Wohnung noch eine Weile behalten. Jetzt ein Geschenk dieser Größenordnung anzunehmen, war ein unglaublicher Vertrauensbeweis.
Kyle hatte Warren auch einen hübschen Ehering gekauft. Ich hatte ihn vor ein paar Monaten bei der Auswahl unterstützt. Er hatte mich zum Juwelier begleitet, weil ich meine Kette mit dem silbernen Lamm-Anhänger reparieren lassen musste, und hatte dabei den perfekten Ring entdeckt.
»Das ist mal was Neues«, meinte ich. »Und ich rede nicht vom Auto.«
»Mein Truck ist zu auffällig«, sagte Warren, den Mund in etwas verzogen, was Verlegenheit hätte sein können. Oder auch nicht.
Ich runzelte die Stirn.
»Kyle lässt mich Leute beschatten«, erklärte Warren zu schnell. Warren arbeitete als Privatdetektiv für Kyles Anwaltskanzlei. »Er hat beschlossen, dass ich etwas brauche, was sich besser einfügt.«
Das klang, als hätte Kyle sich über Warrens Widerspruch hinweggesetzt … was ihm gar nicht ähnlich sah. Und das wiederum erklärte vielleicht die Anspannung, die Warren heute Abend ausstrahlte.
»Wenn Unauffälligkeit das Ziel war, hätte ich mich eher für Honda oder Toyota entschieden«, sagte ich, womit ich es Kyle und Warren überließ, ihre Schwierigkeiten zu lösen. »Aber Subaru produziert auch gute Autos.«
Niemand fragte nach VW. Seit dem Abgasskandal war ich sauer auf Volkswagen.
»Ich würde Mercy ja ein neues Auto kaufen, um das zu ersetzen, das sie benutzt hat, um einen Feind an einem Müllcontainer zu zerquetschen«, meinte Adam, »aber sie würde mir das Fell gerben.«
»Ich bin Automechanikerin«, erklärte ich ihm gespielt cool. »Ich muss ein altes Auto fahren. So lautet die Regel.«
Er lächelte mich an, und die Wärme in seinen Augen raubte mir den Atem. »Okay«, antwortete er. »Wenn die Regel so lautet.«
Ungefähr zwanzig Minuten später brachen die ersten Wölfe auf. Adam stand neben der Tür und berührte jeden, der ging. Manchmal umarmte er jemanden, manchmal strich er einem mit den Fingern über die Wangen oder tätschelte ihm die Schulter. Ein guter Rudelführer wusste, was seine Wölfe brauchten.
Ich zog mich an unseren Tisch zurück und nippte an meinem dritten Glas Limettenwasser. Ich hätte eigentlich neben Adam stehen müssen, aber es wäre mir nicht gelungen, meine Anspannung zu verbergen. Es war wichtig, dass das Rudel heute Abend glücklich war. Ein paar von ihnen sahen zu mir, und ich rieb als Antwort auf die Blicke meine Wange. Mein Kopfweh war eine Tatsache, selbst wenn es nicht wirklich das Problem war.
Adam sagte etwas zu Darryl, seinem Zweiten, was den großen Mann zum Lachen brachte. Auriele, Darryls Gefährtin, schlug ihm leicht auf den Hinterkopf, aber sie lachte ebenfalls. Darryl hatte nicht am Wettbewerb teilgenommen, weil er und Adam die Stationen im Labyrinth aufgebaut hatten. Aber Auriele hatte mitgemacht. Ihr Team hatte das Zeitlimit eingehalten, aber nur zwei der Bänder gefunden.
Sherwood stand auf, um zu gehen. Auf dem Weg zur Tür humpelte er leicht, was verriet, dass er im Labyrinth wirklich alles gegeben hatte. Gewöhnlich bewegte er sich so elegant, dass die meisten Leute seine Beinprothese gar nicht bemerkten.
Statt Adams Gespräch zu stören, wollte Sherwood einfach vorbeigehen. Adam griff nach Sherwoods Arm, ohne sich von den anderen zwei Wölfen abzuwenden, und hielt den Mann fest. Sherwood verspannte sich und wollte sich zurückziehen – aber Adam gab ihn nicht frei.
Und trotz des kurzen, fast besorgten Blickes, den Darryl Sherwood zuwarf, beendete Adam die Verabschiedung nicht übereilt. Auriele runzelte die Stirn, als die beiden schließlich gingen.
Adam sagte etwas zu Sherwood. Nachdem A Little Bit Off von Five Finger Death Punch aus den Lautsprechern schmetterte, konnte niemand anders die Worte verstehen. Der große Mann starrte Adam einen Moment lang mit unfreundlichem Blick an, dann atmete er tief durch. Er bemühte sich bewusst, sich zu entspannen, nickte Adam kurz zu und drehte sich, um in meine Richtung zu schreiten.
Showtime, dachte ich und atmete ebenfalls tief durch. Ich musste Ruhe ausstrahlen.
Sherwoods Humpeln war nicht mehr wahrnehmbar, als er in meine Richtung pirschte. Wölfe zeigen vor ihren Feinden niemals Schwäche. Nicht dass irgendwer, der ihn kannte, je davon ausgegangen wäre, dass Sherwood schwach war, weil ihm ein Bein fehlte.
Ich hatte vorher noch nie von einem Werwolf gehört, dem Gliedmaßen fehlten. Werwölfe sterben entweder an ihren Verletzungen oder sie heilen sie. Wenn ein Bein abgetrennt wird, sollte es eigentlich nachwachsen.
Und für den Fall, dass der Mensch schon vor seiner Verwandlung gelähmt oder amputiert war, gab es Wege, auch solche Verletzungen zu beheben. Das Vorgehen war schrecklich – weil es erforderte, die geschädigten und jetzt verheilten Körperteile erneut zu verletzen. Ich hatte gehört, dass diese Methoden bei Sherwood keinerlei Effekt gezeigt hatten.
Sherwood war in einem Labor einer Gruppe schwarzer Hexen gefunden worden, die vor ein paar Jahren von Werwölfen vernichtet worden waren. Niemand wusste, wie lange er sich schon in Gefangenschaft befunden oder was man ihm angetan hatte, aber ich war selbst einmal für eine Weile an einem solchen Ort festgehalten worden … und litt immer noch an Albträumen.
Seine Retter hatten Sherwood zu Bran gebracht, der ihn gezwungen hatte, erneut seine menschliche Gestalt anzunehmen. Sherwood hatte keinerlei Erinnerung daran, wer oder was er gewesen war – vielleicht, weil er eine zu lange Zeit als Wolf verbracht hatte, vielleicht auch, weil die Hexen ihm irgendetwas angetan hatten.
Bran kannte Sherwoods Identität, doch aus seinen ganz eigenen Gründen hatte er es nicht für angebracht gehalten, Sherwood – oder irgendwen sonst – aufzuklären. Stattdessen hatte Bran die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, dem dreibeinigen Wolf (oder dem einbeinigen Mann) einen Namen gegeben und Sherwood Post zu uns geschickt.
Zu Beginn hatte ich geglaubt, dabei wäre es um Sherwoods Wohlbefinden gegangen. Bran hatte mir erzählt, dass Sherwood sich über die schrecklichen Winter in Montana beschwert und darum gebeten hatte, zu einem Rudel in einer wärmeren Klimazone geschickt zu werden. Die meisten Orte hatten ein angenehmeres Klima als Aspen Creek, Montana.
Nach den letzten Monaten – Monate, in denen Sherwood bewiesen hatte, dass er einige sehr nützliche und ungewöhnliche Fähigkeiten besaß – vermutete ich langsam, dass zusätzliche Gründe Bran dazu bewogen hatten, Sherwood zu uns zu schicken.
Hatte Bran gewusst, was hier geschehen würde? Hatte er geahnt, dass unser Rudel ins Zentrum politischer Manöver des Feenvolkes geraten würde, bevor wir das selbst geahnt hatten? Denn Sherwood war nicht lange vor dem Moment zu uns gestoßen, als ich in den Fernsehnachrichten unser Territorium für uns beansprucht hatte. Aber woher hätte Bran das wissen sollen? Und falls dem so war, wieso hatte er uns nicht davor gewarnt, dass er gezwungen sein würde, uns (mich, murmelte eine kindische Stimme in meinem Kopf) im Regen stehen zu lassen, ohne den Schutz des Marrok und aller Wölfe unter seiner Herrschaft?
Gewöhnlich bekam ich Kopfweh, wann immer ich zu lange über Brans Pläne und Beweggründe nachdachte. Ich wollte meine Kopfschmerzen heute nicht noch verschlimmern, aber ich konnte mich trotzdem nicht vom Grübeln abhalten.
Hatte Bran uns Sherwood Post als Geheimwaffe geschenkt in dem Wissen, dass wir bald schon jeden Vorteil brauchen könnten? Sherwood war nicht einfach irgendein Werwolf. Er trug Hexenblut in sich. Vielleicht. Oder zumindest konnte er geschickt Magie handhaben. Seine Macht roch nicht verdorben und auch nicht wirklich nach Hexenmagie. Und Sherwood besaß eine Menge Magie für jemanden, der nicht den Makel der schwarzen Künste trug.
Ich wusste nicht genau, was er war. Aber ich wusste, dass er jemand war – eine Macht, deren Namen jeder kennen sollte. Jemand, den ein paar der wirklich alten Wölfe wahrscheinlich auf den ersten Blick erkannt hätten. Davon hatten wir nur wenige – Honey und Zack. Alter gehörte zu den Dingen, nach denen man sich einfach nicht erkundigte, für die man aber nach einiger Zeit ein Gefühl entwickelte. Ich wusste, dass Honey keine Ahnung hatte, wer Sherwood war. Aber in Bezug auf Zack war ich mir nicht sicher. Zack konnte Geheimnisse wahren.
Bran mochte uns Sherwood als Waffe geschickt haben, aber Adam ging davon aus, dass uns diese Tatsache bald schon ins Gesicht explodieren würde.
Sherwood zog den Stuhl heran, auf dem Adam gesessen hatte, und setzte sich darauf. Dieses Vorgehen sagte etwas aus, so wie es vorhin etwas ausgesagt hatte, dass Ben den Stuhl nicht benutzt hatte. Damit saß Sherwood mir gegenüber, seine Miene so grimmig wie meine Laune.
Nun ward der Winter unseres Missvergnügens, dachte ich. Ich hatte im College einen Englischkurs belegt, der vom Institut für Theaterwissenschaft angeboten wurde. Überwiegend hatte das bedeutet, dass wir viele der berühmten Shakespeare-Reden auswendig lernen mussten, und hin und wieder stiegen sie aus meinem Gedächtnis auf. Ich ging nicht davon aus, dass Sherwood einen glorreichen Sommer bringen würde, egal, wie sehr alle Beteiligten sich das vielleicht auch wünschten.
Ich mochte Sherwood. So war es seit dem Tag, an dem wir uns an der Spitze eines sehr hohen Krans unterhalten und letztendlich Rücken an Rücken gekämpft hatten. Was passiert war, war nicht seine Schuld, so wie auch Adam keine Schuld trug. Manchmal – ziemlich häufig sogar – stank es einfach zum Himmel, ein Werwolf zu sein.
Ich beschloss, dass ich mich am besten beruhigen konnte, indem ich ein Gespräch führte … uns beide ablenkte. Nicht dass Sherwood selbst an guten Tagen ein toller Gesprächspartner gewesen wäre. Aber mit einer Sache konnte ich seine Aufmerksamkeit sicher gewinnen.
Ich fragte: »Wie geht es Pirat?«
Bei der Erwähnung seiner Katze entspannte sich Sherwood leicht. Wenn Adam recht hatte – und Adam hatte in solchen Dingen immer recht –, dann wusste Sherwood ebenfalls, dass wir in Schwierigkeiten steckten.
»Pirat sendet Grüße«, erklärte Sherwood feierlich, »und möchte sein Bedauern ausdrücken, dass sein bösartiger Mitbewohner ihn heute Abend nicht mitgebracht hat. Er bittet mich, dir zu sagen, dass er sich bemühen wird, dem erwähnten Mitbewohner seinen Irrtum zu verdeutlichen – vermutlich indem er ein Haarknäuel aufs Bett erbricht.«
Er bemerkte meinen überraschten Blick, und Röte stieg in seine Wangen. Er rückte seinen Stuhl zurecht, der warnend knirschte – Sherwood war ein großer Mann.
In der Tat nahm Sherwood Pirat gewöhnlich überallhin mit, wo es möglich war, und Katzen neigten dazu, die Herrscher in ihrem Zuhause zu sein. Hätte er sprechen können, hätte Pirat gut die Nachricht formulieren können, die Sherwood überbracht hatte.
Aber hier ging es um Sherwood. Ich hatte mit einem einfachen »Gut« gerechnet. Vielleicht, wenn ihm besonders redselig zumute war, sogar etwas wie »Wütend, dass er ausgeschlossen wurde.« Diese längere, witzige Botschaft sah dem Sherwood, den ich kannte, nicht ähnlich.
Das Schweigen zwischen Sherwood und mir wurde unangenehm. Noch unangenehmer. Mir lagen unzählige Fragen auf der Zunge, aber ich durfte keine davon stellen, bevor Adam sich uns angeschlossen hatte.
»Oh, schau«, sagte ich dankbar, weil unangenehmes Schweigen dafür sorgte, dass ich die Stille mit Plappern füllen wollte, »da ist einer von Onkel Mikes Lakaien. Willst du etwas trinken, während wir warten?«
Ein Kellner hatte den Raum durch die Küchentür betreten. Er ließ den Blick über die wenigen verbliebenen Gäste gleiten, dann kam er an unseren Tisch, weil wir als Einzige noch saßen.
Bevor Sherwood mir antworten konnte, fing ich den Blick des Wolfes ein, der eventuell heute Nacht meinen Gefährten töten würde, und eine Frage drängte über meine Lippen – für die ich das zuvor in mir aufgestiegene Zitat aus Richard III. verantwortlich machte.
»Bist du Shakespeare?«
Sherwood erstarrte. Dann drehte er unendlich langsam den Kopf in Richtung des näherkommenden Kellners. Ich war mir sicher, dass er damit seine Miene vor mir verbergen wollte.
Denn es gab nur einen Grund, ihm diese Frage zu stellen.
Nach unserem Ausflug in die Dusche heute Abend hatte Adam mir erzählt, dass die Rudelbindungen ihn darüber informiert hatten, dass Sherwoods Gedächtnis zurückgekehrt war. Sherwoods Reaktion verriet mir, dass es stimmte. Adam hatte keine Ahnung, was geschehen war, doch das war im Moment auch nicht wichtig. Wir hatten einen Wolf in unserem Rudel, der plötzlich sehr, sehr dominant war.