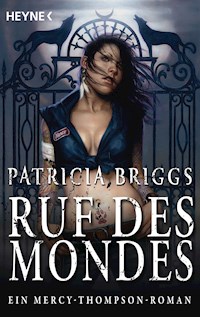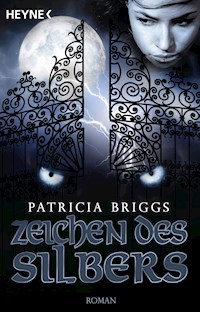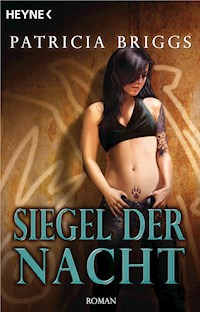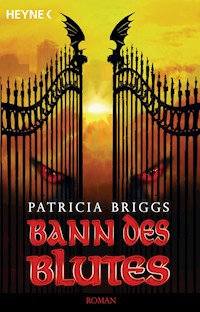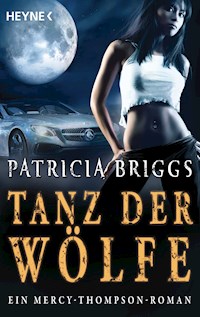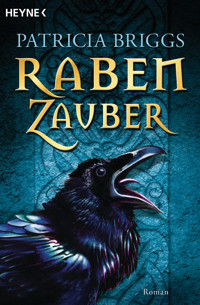9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mercy-Thompson-Reihe
- Sprache: Deutsch
Mercy Thompson ist stolze Besitzerin einer kleinen Autowerkstatt. Und sie ist eine Walkerin – sie kann sich in einen Kojoten verwandeln. Doch Mercys Welt ist dunkel und gefährlich. Für den Tod eines Vampirs, an dem sie nicht ganz unschuldig ist, sinnt die Vampirkönigin Marsilia auf Rache. Da bleibt Mercy kaum noch Zeit für ihre Beziehung mit dem umwerfenden Werwolf Adam …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
»Gestatten, mein Name ist Mercedes Thompson und ich bin kein Werwolf …«
Endlich hat sich die Liebesbeziehung zwischen Mercy und Adam so weit vertieft, dass der Alpha sie offiziell zu einem Mitglied seines Rudels macht. Der temperamentvollen Automechanikerin und Walkerin bleibt jedoch kaum Zeit, sich über ihren neuen Status zu freuen, denn plötzlich eröffnen die Vampire der Tri-Cities die Jagd auf sie. Die Führerin der Vampirgemeinschaft, Marsilia, macht Mercy für den Tod eines ihrer Vampire verantwortlich. Nun will sie sich rächen – und als Mercy eines Nachts mysteriösen Besuch erhält, weiß sie zweierlei: ihr Leben ist definitiv in Gefahr, und wüsste Adam davon, würde er alles tun, um sie zu beschützen. Damit droht jedoch ein Krieg zwischen Werwölfen und Vampiren, den Mercy unbedingt verhindern will. Die Situation gerät außer Kontrolle, als sie ihrer alten Collegefreundin Amber im Kampf gegen einen Hausgeist beisteht und ein fremder, mächtiger Vampir auf die Walkerin aufmerksam wird.
Die MERCY-THOMPSON-Serie Erster Roman: Ruf des Mondes Zweiter Roman: Bann des Blutes Dritter Roman: Spur der Nacht Vierter Roman: Zeit der Jäger
Die ALPHA & OMEGA-Serie Erster Roman: Schatten des Wolfes Zweiter Roman: Spiel der Wölfe
Die Autorin
Patricia Briggs, Jahrgang 1965, wuchs in Montana auf und interessiert sich seit ihrer Kindheit für Phantastisches. So studierte sie neben Geschichte auch Deutsch, denn ihre große Liebe gilt Burgen und Märchen. Neben preisgekrönten Fantasy-Romanen wie »Drachenzauber« und »Rabenzauber« widmet sie sich ihrer New York Times-Bestseller-Serie um Mercy Thompson. Die Autorin lebt gemeinsam mit ihrer Familie in Washington State.
Inhaltsverzeichnis
Für Jordan, den schrulligen, musikalischen Freund aller Tiere, ob nun pelzig, gefiedert oder mit Schuppen.
1
Ich starrte mein Spiegelbild an. Ich war nicht hübsch, aber ich hatte dickes Haar, das mir bis auf die Schultern fiel. Meine Haut war an den Armen und im Gesicht dunkler gebräunt als am Rest meines Körpers, aber zumindest – der Blackfoot-Abstammung meines Vaters sei Dank – würde ich nie wirklich blass sein.
Da waren die zwei Stiche, mit denen Samuel den Schnitt an meinem Kinn genäht hatte, und die Prellung an meiner Schulter (kein übermäßiger Schaden, wenn man bedachte, dass ich gegen etwas gekämpft hatte, das gerne Kinder fraß und einen Werwolf bewusstlos geschlagen hatte). Die dunklen Fäden in der Wunde wirkten aus einem bestimmten Winkel wie die Beine einer großen schwarzen Spinne. Abgesehen von diesen leichten Schäden war mit meinem Körper alles in Ordnung. Karate und meine Arbeit als Mechanikerin hielten mich gut in Form.
Meine Seele war um einiges mitgenommener als mein Körper, aber das konnte ich im Spiegel nicht sehen. Hoffentlich konnte es auch niemand anders erkennen. Dieser unsichtbare Schaden war es, der die Angst davor hervorrief, das Badezimmer zu verlassen und mich Adam zu stellen, der in meinem Schlafzimmer wartete. Obwohl ich mit absoluter Sicherheit wusste, dass Adam nichts tun würde, was ich nicht wollte – und was ich nicht schon lange von ihm gewollt hatte.
Ich konnte ihn bitten zu gehen. Mir mehr Zeit zu lassen. Wieder starrte ich die Frau im Spiegel an, aber sie starrte nur zurück.
Ich hatte den Mann umgebracht, der mich vergewaltigt hatte. Würde ich zulassen, dass er den letzten Sieg davontrug? Zulassen, dass er mich zerstörte, wie es seine Absicht gewesen war?
»Mercy?« Adam musste nicht laut werden. Er wusste, dass ich ihn hören konnte.
»Vorsicht«, sagte ich, als ich mich vom Spiegel abwandte, um saubere Unterwäsche und ein altes T-Shirt anzuziehen. »Ich habe einen antiken Wanderstab, und ich weiß, wie man ihn benutzt.«
»Der Wanderstab liegt auf deinem Bett«, antwortete er.
Als ich aus dem Bad kam, lag Adam ebenfalls auf meinem Bett.
Er war nicht groß, aber er brauchte auch keine körperliche Größe, um seine Ausstrahlung zu verstärken. Hohe Wangenknochen und ein voller, breiter Mund über einem markanten Kinn vereinten sich zu fast filmstarartiger Schönheit. Wenn seine Augen offen waren, zeigten sie ein dunkles Schokoladenbraun, das nur ein wenig heller war als bei mir. Sein Körper war fast so attraktiv wie sein Gesicht – obwohl ich wusste, dass er so nicht über sich selbst dachte. Er hielt sich in Form, weil er der Alpha war und sein Körper das Werkzeug, das er einsetzte, um seinem Rudel Sicherheit zu geben. Bevor er verwandelt wurde, war er Soldat, und sein militärisches Training war immer noch an der Art zu erkennen, wie er sich bewegte und wie er das Kommando übernahm.
»Wenn Samuel aus dem Krankenhaus kommt, wird er den Rest der Nacht in meinem Haus verbringen«, erklärte Adam, ohne dabei die Augen zu öffnen. Samuel war mein Mitbewohner, ein Arzt, und ein einsamer Wolf. Adams Haus lag hinter meinem, mit ungefähr zehn Morgen Land dazwischen – drei gehörten mir und die restlichen Adam. »Wir haben also Zeit, uns zu unterhalten.«
»Du siehst schrecklich aus«, meinte ich, nicht ganz ehrlich. Er sah müde aus, mit dunklen Ringen unter den Augen, aber nichts, vielleicht mal abgesehen von Verstümmelung, könnte ihn je schrecklich aussehen lassen. »Haben sie in D. C. keine Betten?«
Er hatte das letzte Wochenende in Washington verbringen müssen (die Hauptstadt – wir befanden uns im Staat), um eine Sache zu regeln, die irgendwie mein Fehler gewesen war. Natürlich, wenn er Tims Leiche nicht vor laufender Kamera in winzige Stücke zerrissen hätte und die daraus resultierende DVD nicht auf dem Schreibtisch eines Senators gelandet wäre, hätte es gar kein Problem gegeben. Also war es zum Teil auch sein Fehler.
Größtenteils war es aber Tims Fehler, und der Fehler desjenigen, der die DVD kopiert und eine Kopie davon verschickt hatte. Ich hatte mich um Tim gekümmert. Bran, der Boss aller anderen Werwolf-Bosse, kümmerte sich offenbar um diese andere Person. Letztes Jahr hätte ich noch erwartet, bald von einer Beerdigung zu hören. Dieses Jahr, wo die Werwölfe gerade erst der Welt gegenüber ihre Existenz eingestanden hatten, würde Bran wahrscheinlich umsichtiger vorgehen. Was auch immer das hieß.
Adam öffnete die Augen und schaute mich an. In dem dämmrigen Raum (er hatte nur das kleine Licht auf meinem Nachttisch angeschaltet) wirkten seine Augen schwarz. In seinem Gesicht lag eine Trostlosigkeit, die vorher nicht da gewesen war, und ich wusste, dass sie etwas mit mir zu tun hatte. Weil er nicht fähig gewesen war, mich zu schützen – und Leute wie Adam nehmen das ziemlich schwer.
Ich persönlich war der Meinung, dass es meine Aufgabe war, mich zu schützen. Manchmal hieß das vielleicht, Freunde um Hilfe zu bitten, aber das war meine Verantwortung. Er aber sah es trotzdem als Versagen.
»Du hast dich also entschieden?«, fragte er. Er meinte damit, ob ich ihn als meinen Gefährten akzeptieren würde. Die Frage hing schon zu lange in der Luft, und sie beeinträchtigte seine Fähigkeit, das Rudel unter Kontrolle zu halten. Ironischerweise hatte das, was mit Tim passiert war, das Problem gelöst, das mich seit Monaten davon abgehalten hatte, Adam anzunehmen. Wenn ich gegen den Feentrank kämpfen konnte, den Tim mir eingeflößt hatte, dann würde mich ein wenig Alpha-Macht auch nicht in eine fügsame Sklavin verwandeln.
Vielleicht hätte ich ihm danken sollen, bevor ich ihn mit dem Stemmeisen erschlug.
Adam ist nicht Tim, sagte ich mir selbst. Ich dachte an Adams Wut, als er die Tür zu meiner Garage aufgebrochen hatte, an seine Verzweiflung, als er mich davon überzeugte, nochmal aus dem verdammten Feenvolk-Kelch zu trinken. Zusätzlich zu der Macht, mir den freien Willen zu rauben, hatte dieser Kelch auch die Kraft der Heilung – und zu diesem Zeitpunkt hatte ich eine Menge Heilung gebraucht. Es hatte funktioniert, aber Adam hatte sich gefühlt, als würde er mich betrügen, und geglaubt, dass ich ihn dafür hassen würde. Aber er hatte es trotzdem getan. Ich ging davon aus, dass es etwas damit zu tun hatte, dass er nicht gelogen hatte, als er erklärt hatte, dass er mich liebte. Als ich mich vor Scham versteckt hatte – das lastete ich dem Feenvolk-Trank an, weil ich wusste … ich wusste, dass ich keinen Grund hatte mich zu schämen –, hatte er mein Kojoten-Ich unter seinem Bett hervorgezogen, mich als Strafe für Torheit in die Nase gebissen und mich dann die ganze Nacht gehalten. Dann hatte er mich mit seinem Rudel und Sicherheit umgeben, egal, ob ich es brauchte oder nicht.
Tim war tot. Und er war immer schon ein Loser gewesen. Ich würde nicht das Opfer eines Losers sein – oder von irgendjemand anderem.
»Mercy?« Adam blieb auf dem Rücken auf meinem Bett liegen, in einer Position, die Verletzlichkeit zeigte.
Anstelle einer Antwort zog ich mir das T-Shirt über den Kopf und ließ es auf den Boden fallen.
Adam bewegte sich schneller, als ich es je gesehen hatte, und brachte die Decke mit. Bevor ich auch nur blinzeln konnte, hatte er sie um mich geschlungen … und dann drückte er mich fest an sich, meine Brüste an seinem Brustkasten. Er hatte den Kopf schief gelegt, sodass mein Gesicht an seine Wange gedrückt wurde.
»Ich wollte die Decke zwischen uns bringen«, erklärte er angespannt. Sein Herz raste und die steinharten Muskeln an seinen Armen zitterten. »Ich meinte nicht, dass du jetzt sofort mit mir schlafen musst – ein einfaches ›Ja‹ hätte gereicht.«
Ich wusste, dass er erregt war – selbst ein normaler Mensch ohne den Geruchssinn eines Kojoten hätte das bemerkt. Ich ließ meine Hände von seinen Hüften über seinen harten Bauch und zu seinen Rippen gleiten und lauschte auf seinen Herzschlag, der immer schneller wurde, während gleichzeitig seine Haut unter meiner leichten Liebkosung anfing zu schwitzen. Ich konnte fühlen, wie sich die Muskeln in seiner Wange bewegten, als er die Zähne zusammenbiss, und auch die Hitze, die seine Haut ausstrahlte. Ich pustete in sein Ohr und er sprang von mir weg, als hätte ich ihn mit einem Viehtreiber attackiert.
Bernsteinfarbene Streifen erleuchteten seine Augen und seine Lippen erschienen mir voller, röter. Ich ließ die Decke auf mein T-Shirt fallen.
»Verdammt nochmal, Mercy.« Er fluchte nicht gerne vor Frauen. Ich empfand es immer als persönlichen Triumph wenn ich ihn dazu bringen konnte. »Deine Vergewaltigung ist nicht mal eine Woche her. Ich werde nicht mit dir schlafen, bevor du mit jemandem geredet hast, einem Psychologen vielleicht.«
»Mir geht es gut«, sagte ich, obwohl mir in Wirklichkeit, jetzt, wo seine körperliche Nähe mir auch die Sicherheit geraubt hatte, die er brachte, ein wenig übel wurde.
Adam drehte sich um, so dass er zum Fenster schaute und nicht mehr zu mir. »Das stimmt nicht. Denk dran, du kannst einen Wolf nicht belügen, Liebling.« Er stieß den Atem aus, zu heftig, als dass es ein Seufzer sein konnte. Dann fuhr er sich schnell durch die Haare, um seine überschüssige Energie loszuwerden. Pflichtgemäß stand es jetzt in den kleinen Locken vom Kopf ab, die er normalerweise zu kurz hielt, als dass sie anders aussehen könnten als ordentlich und gut gepflegt. »Über wen rede ich hier?«, fragte er, aber ich ging nicht davon aus, dass die Frage an mich gerichtet war. »Das hier ist Mercy. Selbst im besten Fall ist der Versuch, dich dazu zu bringen, über Persönliches zu reden, ungefähr wie Zähne ziehen. Dich dazu zu bringen, mit einem Fremden zu reden …«
Ich hatte mich nie für besonders verstockt gehalten. Eigentlich war ich sogar immer wieder beschuldigt worden, eine große Klappe zu haben. Samuel hatte mir mehr als einmal mitgeteilt, dass ich wahrscheinlich länger leben würde, wenn ich endlich mal lernen würde, das Maul zu halten.
Also wartete ich schweigend darauf, dass Adam sich entschied, was er tun wollte.
Der Raum war nicht kalt, aber ich zitterte trotzdem ein wenig – musste Nervosität sein. Wenn Adam sich allerdings nicht beeilte und bald etwas tat, dann würde ich mich im Bad übergeben müssen. Und seitdem Tim mir eine Überdosis Feen-Trank eingeflößt hatte, hatte ich zu viel Zeit damit verbracht, die Porzellanschüssel anzubeten, um dieser Vorstellung unvoreingenommen gegenüberzustehen.
Adam beobachtete mich nicht, aber das musste er auch nicht. Gefühle haben einen Geruch. Er drehte sich mit gerunzelter Stirn zu mir um und musterte meinen Zustand mit einem allumfassenden Blick.
Er fluchte, stiefelte zu mir zurück und schlang seine Arme um mich. Dann zog er mich eng an sich, gab dabei beruhigende, tief aus der Kehle kommende Laute von sich und wiegte mich sanft.
Ich atmete tief die Luft ein, die mit Adams Geruch geschwängert war, und bemühte mich, nachzudenken. Normalerweise würde mir das nicht schwerfallen. Aber normalerweise hing ich auch nicht fast nackt in den Armen des heißesten Mannes, den ich kannte.
Ich hatte missverstanden, was er gewollt hatte.
Um mich noch einmal zu versichern, räusperte ich mich. »Als du gesagt hast, dass du heute eine Antwort auf deinen Antrag brauchst – da hast du nicht Sex gemeint?«
Sein Körper zuckte ein wenig, als er lachte, und er rieb seine Wange über mein Gesicht. »Also hältst du mich für die Art von Mann, die so etwas tun würde? Nach dem, was vor gerade mal einer Woche passiert ist?«
»Ich dachte, das sei notwendig«, murmelte ich und fühlte, wie Blut in meine Wangen stieg.
»Wie lang genau warst du im Rudel des Marrok?«
Er wusste, wie lang. Er wollte nur, dass ich mich dumm fühlte. »Verpaarung war nichts, worüber jeder mit mir geredet hätte«, erklärte ich ihm verteidigend. »Nur Samuel …«
Adam lachte wieder. Eine Hand lag auf meiner Schulter, die andere bewegte sich in einer leichten Liebkosung über meinen Po. Das hätte kitzeln sollen, tat es aber nicht. »Und ich wette, dass er dir zu diesem Zeitpunkt nur die Wahrheit, die absolute Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hat.«
Ich klammerte mich fester an ihn – irgendwie waren meine Hände in seinem Kreuz gelandet. »Wahrscheinlich nicht. Also brauchtest du nur meine Zustimmung?«
Er grunzte. »Das wird mit dem Rudel nicht helfen, nicht, bis es wirklich ist. Aber nachdem Samuel aus dem Weg ist, dachte ich, du wärst fähig zu entscheiden, ob du interessiert bist oder nicht. Wenn du nicht interessiert wärst, könnte ich anfangen, darüber hinwegzukommen. Wenn du hingegen zustimmst, die Meine zu werden, dann kann ich auf dich warten, bis die Hölle zufriert.«
Seine Worte klangen vernünftig, aber sein Geruch sagte mir etwas anderes. Er verriet mir, dass mein vernünftiger Tonfall seine Sorgen beruhigt hatte und er jetzt an etwas anderes dachte als an unsere Diskussion.
Na gut. So nah an seinem Körper konnte ich fühlen, wie sein Herz raste, weil er mich wollte … jemand hatte mir einmal gesagt, dass die Begierde eines anderen das beste Aphrodisiakum sei. Für mich stimmte das auf jeden Fall.
»Natürlich«, sagte er, immer noch mit dieser seltsam ruhigen Stimme, »ist warten in der Theorie viel einfacher als in der Realität. Ich möchte, dass du mir sagst, dass ich mich zurückziehen soll, okay?«
»Mmmm«, meinte ich. Er brachte eine Sauberkeit mit sich, die das Gefühl von Tim viel besser von meiner Haut wusch als die Dusche – aber nur, wenn er mich berührte.
»Mercy.«
Ich senkte die Hände, ließ sie in den Bund seiner Jeans gleiten und grub sanft meine Nägel in seine Haut.
Er knurrte noch etwas, aber keiner von uns hörte zu. Er drehte den Kopf und legte ihn schief. Ich erwartete ›heftig‹ und bekam ›spielerisch‹, als er mich sanft in die Unterlippe biss. Die Härte seiner Zähne jagte ein Kribbeln bis in meine Fingerspitzen und schoss auch an den Knien vorbei bis in meine Zehen. Mächtige Dinger, Adams Zähne.
Ich zog meine plötzlich zitternden Hände nach vorne, um am Knopf seiner Jeans herumzuspielen. Adam riss den Kopf hoch und legte eine Hand auf meine.
Dann hörte ich es auch.
»Deutsches Auto«, sagte er.
Ich seufzte und ließ mich gegen ihn sinken. »Schwedisch«, verbesserte ich ihn. »Vier Jahre alter Volvo-Kombi. Grau.«
Er schaute mich überrascht an, aber dann breitete sich Verstehen auf seinem Gesicht aus. »Du kennst das Auto.«
Ich stöhnte und versuchte, mich an seiner Schulter zu verstecken. »Verdammt, verdammt. Es stand in der Zeitung.«
»Wer ist es, Mercy?«
Kies knirschte und die Scheinwerfer erhellten kurz mein Fenster, als das Auto in meine Einfahrt fuhr. »Meine Mom. Ihr Timing ist furchtbar. Ich hätte daran denken sollen, dass sie von der … davon lesen würde.« Ich wollte das, was mir passiert war, das, was ich mit Tim gemacht hatte, nicht beim Namen nennen. Zumindest nicht, während ich quasi nackt in Adams Armen stand.
»Du hast sie nicht angerufen.«
Ich schüttelte den Kopf. Ich wusste, dass ich es hätte tun sollen. Aber das war so eine Sache gewesen, der ich mich einfach nicht stellen wollte.
Adam lächelte jetzt. »Zieh du dich an. Ich gehe und halte sie auf, bis du bereit bist, rauszukommen.«
»Dazu werde ich niemals bereit sein«, erklärte ich ihm.
Er wurde ernst und lehnte seine Stirn an meine. »Mercy. Es kommt in Ordnung.«
Dann ging er und schloss die Schlafzimmertür hinter sich, als es zum ersten Mal an der Haustür klingelte. Es klingelte noch zweimal, bis er sie öffnete, und das nicht, weil er langsam war.
Ich schnappte mir Klamotten und dachte fieberhaft darüber nach, ob wir die Teller vom Abendessen abgewaschen hatten. Wenn Samuel dran gewesen wäre, hätte ich mir keine Sorgen machen müssen. Ich wusste, dass ihr die Teller völlig egal sein würden – aber dieser Gedanke lenkte mich von der wachsenden Panik ab.
Ich hatte nicht einmal darüber nachgedacht, sie anzurufen. Ich würde mich vielleicht in zehn Jahren dafür bereit fühlen.
Ich zog meine Hosen an und blieb barfuß, während ich verzweifelt nach einem BH suchte.
»Sie weiß, dass Sie hier sind«, erklärte Adam auf der anderen Seite der Tür – als ob er daran lehnen würde. »Sie kommt in einer Minute.«
»Ich weiß nicht, für wen Sie sich halten« – die Stimme meiner Mutter war tief und hatte einen gefährlichen Unterton –, »aber wenn Sie mir nicht sofort aus dem Weg gehen, ist es auch völlig egal.«
Adam war der Alpha-Werwolf an der Spitze des ansässigen Wolfrudels. Er war zäh. Er konnte richtig gemein sein, wenn er musste – und er hätte nicht den Hauch einer Chance gegen meine Mom.
»BH, BH, BH«, sang ich, als ich einen aus dem Wäscheeimer zog und ihn vorne schloss. Dann drehte ich das Ding so schnell, dass es mich nicht gewundert hätte, wenn ich mir selbst eine Verbrennung verpasst hätte. »Hemd, Hemd.« Ich durchwühlte meine Schubladen und entdeckte und verwarf zwei T-Shirts. »Sauberes Hemd, sauberes Hemd.«
»Mercy?«, rief Adam ein wenig verzweifelt – wie gut ich dieses Gefühl doch kannte.
»Mom, lass ihn in Ruhe!«, schrie ich. »Ich komme gleich.«
Frustriert starrte ich mein Zimmer an. Ich musste irgendwo ein sauberes Oberteil haben. Ich hatte gerade noch eines angehabt – aber das war bei der Suche nach einem BH verschwunden. Schließlich zog ich ein T-Shirt an, auf dessen Rücken 1984: Regierung für Dummies stand. Es war sauber, oder zumindest stank es nicht zu schlimm. Der Ölfleck auf der Schulter wirkte permanent.
Ich holte tief Luft und öffnete die Tür. Ich musste mich an Adam vorbeischieben, der im Türrahmen lehnte.
»Hey, Mom«, sagte ich fröhlich. »Ich sehe, du hast meinen –« Was? Gefährten? Ich ging nicht davon aus, dass das etwas war, was meine Mutter hören musste. »Ich sehe, du hast Adam schon kennengelernt.«
»Mercedes Athena Thompson«, blaffte meine Mutter. »Erklär mir, warum ich das, was geschehen ist, aus der Zeitung erfahren musste.«
Ich hatte es vermieden, ihrem Blick zu begegnen, aber nachdem sie mich mit meinen vollen drei Namen angesprochen hatte, blieb mir keine Wahl mehr.
Meine Mutter ist gerade mal einen Meter fünfzig groß. Sie ist nur siebzehn Jahre älter als ich, was heißt, dass sie noch nicht mal fünfzig ist und aussieht wie dreißig. Sie kann die Gürtelschnallen, die sie beim Barrel Race Riding getragen hat, heute noch mit den ursprünglichen Gürteln tragen. Sie ist grundsätzlich blond – ich bin mir ziemlich sicher, dass das ihre eigentliche Haarfarbe ist –, aber die Schattierungen variieren von Jahr zu Jahr. Dieses Jahr war es blond mit einem leichten Rotstich. Ihre Augen sind groß und blau und sehen unschuldig aus, ihre Nasenspitze zeigt leicht nach oben und ihr Mund ist voll und rund.
Bei Fremden spielt sie manchmal die dumme Blondine, klimpert mit den Wimpern und spricht mit einer hauchigen Stimme, die jeder, der alte Filme mag, aus Manche mögen’s heiß oder Bus Stop kennt. Meine Mutter hat meines Wissens nach niemals selbst einen platten Reifen gewechselt.
Hätte der scharfe Ton ihrer Stimme nicht nur dazu gedient, den Schmerz in ihren Augen zu vertuschen, hätte ich genauso geantwortet. Stattdessen zuckte ich mit den Schultern.
»Ich weiß nicht, Mom. Nachdem es passiert ist … Ich bin ein paar Tage Kojote geblieben.« Ich hatte eine halbhysterische Vision, wie ich sie anrief und sagte: »Übrigens, Mom, rate mal, was heute passiert ist …«
Sie schaute mir in die Augen und ich hatte das Gefühl, dass sie mehr sah, als ich wollte. »Bist du in Ordnung?«
Ich setzte an, ja zu sagen, aber dass ich mein Leben unter Kreaturen verbracht hatte, die man nicht anlügen konnte, hatte mir die Ehrlichkeit tief eingeimpft. »Überwiegend«, erklärte ich schließlich als Kompromiss. »Es hilft, dass er tot ist.« Es war demütigend, dass mir die Brust eng wurde. Ich hatte mich lange genug selbst bemitleidet.
Mom konnte ihre Kinder genauso verhätscheln wie die besten Eltern, aber ich hätte ihr mehr zutrauen sollen. Sie wusste alles darüber, wie wichtig es war, auf eigenen Beinen zu stehen. Sie hatte die rechte Hand zur Faust geballt, sodass die Fingerknöchel weiß hervortraten, aber als sie sprach, war ihre Stimme forsch.
»In Ordnung«, erklärte sie, als hätten wir damit alles geklärt, was sie wissen wollte. Ich wusste es besser, aber ich wusste auch, dass es später und weniger öffentlich stattfinden würde.
Sie richtete ihre engelsblauen Augen auf Adam. »Wer sind Sie, und was tun Sie um elf Uhr nachts im Haus meiner Tochter?«
»Ich bin nicht mehr sechzehn«, sagte ich, und sogar ich konnte den schmollenden Ton in meiner Stimme hören. »Ich kann sogar einen Mann übernachten lassen, wenn ich will.«
Mom und Adam ignorierten mich.
Adam war einfach in seiner Position am Türrahmen geblieben, seine Körperhaltung etwas lässiger als üblicherweise. Mir kam es so vor, als wollte er meiner Mom das Gefühl vermitteln, dass er hier zu Hause war: jemand, der die Befugnis hatte, sie aus meinem Zimmer zu halten. Er hob eine Augenbraue und zeigte nicht mal einen Anflug der Panik, die ich vorhin in seiner Stimme gehört hatte. »Ich bin Adam Hauptman. Ich lebe auf der anderen Seite ihres hinteren Zauns.«
Sie schaute ihn finster an. »Der Alpha? Der geschiedene Mann mit der Teenager-Tochter?«
Er schenkte ihr eines seiner überraschenden Lächeln, und ich wusste, dass meine Mom mal wieder eine Eroberung gemacht hatte: Sie ist ziemlich süß, wenn sie böse guckt, und Adam kannte nicht besonders viele Leute, die den Mut hatten, ihn so anzuschauen. Plötzlich hatte ich eine Offenbarung. Ich hatte in den letzten Jahren einen taktischen Fehler begangen; hätte ich wirklich gewollt, dass er aufhörte, mit mir zu flirten, hätte ich lächeln sollen und grinsen und mit den Wimpern klimpern. Offensichtlich genoss er es, wenn eine Frau ihn böse anschaute. Aber momentan genoss er zu sehr die finstere Miene meiner Mom, um meine zu bemerken.
»Das stimmt, Ma’am.« Adam löste sich vom Türrahmen und trat ein paar Schritte in den Raum. »Schön, Sie endlich kennenzulernen, Margi. Mercy spricht oft von Ihnen.«
Ich wusste nicht, was meine Mutter darauf gesagt hätte, ohne Zweifel irgendetwas Höfliches. Aber mit dem Geräusch von Eis, das auf Zementboden zerspringt, erschien etwas zwischen Mom und Adam, ungefähr dreißig Zentimeter über dem Boden. Es war ein menschenförmiges Etwas, schwarz und verbrannt. Es fiel auf den Boden und stank nach Kohle, altem Blut und verwesenden Leichen.
Ich starrte es viel zu lange an, weil meine Augen nichts fanden, was mit dem übereinstimmte, was meine Nase mir sagte. Selbst das Wissen, dass nur wenige Dinge in meinem Wohnzimmer erscheinen konnten, ohne die Tür zu benutzen, ließ mich nicht anerkennen, was es war. Schließlich war es das grüne T-Shirt, zerrissen und befleckt, auf dem noch der hintere Teil einer wohlbekannten Dogge zu erkennen war, das mich dazu zwang, zuzugeben, dass dieses schwarze, eingefallene Etwas Stefan war.
Ich ließ mich neben ihm auf die Knie fallen und streckte die Hand aus, nur um sie zurückzureißen, weil ich Angst hatte, ihm noch mehr Schaden zuzufügen. Er war offensichtlich tot, aber nachdem er ein Vampir war, war das keine so hoffnungslose Sache.
»Stefan?«, fragte ich.
Ich war nicht die Einzige, die zusammenzuckte, als er plötzlich mein Handgelenk umklammerte. Die Haut an seiner Hand war trocken und knisterte beunruhigend.
Stefan war mein Freund seit dem ersten Tag nach meinem Umzug hierher in die Tri-Cities. Er ist charmant, witzig und großzügig – wenn er auch zu Fehleinschätzungen darüber neigt, wie verzeihend ich in Bezug auf unschuldige Menschen sein kann, die er zu meinem Schutz getötet hat.
Ich konnte mich gerade noch davon abhalten, ihm meinen Arm zu entreißen und das Gefühl seiner brüchigen Haut abzureiben. Bäh. Bäh. Bäh. Und ich hatte das schreckliche Gefühl, dass es ihm wehtat, mich festzuhalten, dass jeden Moment seine Haut brechen und einfach abfallen würde.
Er öffnete seine Augen einen Spalt weit, und seine Regenbogenhaut war scharlachrot statt braun. Sein Mund öffnete und schloss sich zweimal, ohne dass ein Ton herauskam. Seine Hand griff mich fester, bis ich mich nicht mal hätte befreien können, wenn ich es gewollt hätte. Er sog Luft in seine Lungen, um sprechen zu können, aber es gelang ihm nicht richtig. Ich hörte, wie Luft aus den Seiten seiner Rippen entkam, wo sie definitiv nicht austreten sollte.
»Sie weiß.« Die Stimme klang überhaupt nicht wie seine. Sie war rau und trocken. Als er langsam meine Hand zu seinem Gesicht zog, sagte er eindringlich mit der letzten Luft seines Atemzuges: »Flieh.« Und mit diesen Worten verschwand die Person, mit der ich befreundet war, unter dem wilden Hunger in seinem Gesicht.
Ich schaute in seine wahnsinnigen Augen und dachte, dass sein Rat es wert war, ihn anzunehmen – zu dumm, dass ich mich nicht würde befreien können, um ihm zu folgen. Er war langsam, aber er hatte mich, und ich war kein Werwolf oder Vampir mit übernatürlicher Stärke, um mir aus der Klemme zu helfen.
Ich hörte das charakteristische Klicken einer Pistole, die geladen wird, und ein schneller Blick zeigte mir meine Mutter mit einer bösartig aussehenden Glock in der Hand, die auf Stefan gerichtet war. Die Waffe war rosa und schwarz – es war klar, dass meine Mutter eine Barbie-Pistole haben würde: süß, aber tödlich.
»Es ist okay«, erklärte ich ihr schnell – meine Mutter würde nicht zögern, zu schießen, falls sie der Meinung sein sollte, dass er mich verletzen wollte. Normalerweise würde ich mir keine Sorgen darum machen, ob jemand auf Stefan schoss, weil Vampire Waffen gegenüber nicht besonders verletzlich waren, aber er war in übler Verfassung. »Er steht auf unserer Seite.« Es war ein wenig schwierig, überzeugend zu klingen, während er mich zu sich zog, aber ich tat mein Bestes.
Adam schnappte sich Stefans Handgelenk und hielt es fest, sodass Stefan jetzt nicht mehr mich zu ihm zog, sondern langsam seinen eigenen Kopf vom Boden hob. Als er sich meinem Arm näherte, öffnete er den Mund und Hautfetzen fielen auf meinen hellbraunen Teppich. Seine Reißzähne waren weiß und sahen tödlich aus, und sie waren auch ein ganzes Stück größer, als ich sie in Erinnerung hatte.
Ich atmete schneller, zuckte aber nicht zurück und wimmerte, »Lass los! Lass los!« – volle Punktzahl für mich. Stattdessen lehnte ich mich über Stefan und legte meinen Kopf an Adams Schulter. Damit machte ich meinen Hals verletzlich, aber der Geruch von Werwolf und Adam half dabei, den Gestank dessen zu überdecken, was man Stefan angetan hatte. Wenn Stefan Blut brauchte, um zu überleben, dann würde ich es ihm spenden.
»Es ist okay, Adam«, sagte ich. »Lass ihn los.«
»Stecken Sie Ihre Waffe nicht weg«, wies Adam meine Mutter an. »Mercy, wenn das hier nicht funktioniert, ruf in meinem Haus an, sag Darryl, dass er einsammeln soll, wer immer da ist, und sie hier rüberbringen.«
Und mit einem Mut, der absolut zu seinem Charakter passte, hielt Adam sein Handgelenk vor Stefans Gesicht. Der Vampir schien es nicht zu bemerken, sondern zog sich immer noch mit seinem Griff an meinem Arm nach oben. Er atmete nicht, also konnte er Adam nicht wittern, und ich nahm nicht an, dass sein Blick besonders klar war.
Ich hätte versuchen sollen, Adam aufzuhalten – ich hatte Stefan schon vorher genährt, ohne irgendwelche negativen Auswirkungen zu bemerken, und ich war mir ziemlich sicher, dass es Stefan wichtig war, ob ich lebte oder starb. Ich war mir nicht so sicher, wie er Adam gegenüberstand. Aber ich erinnerte mich daran, dass Stefan gesagt hatte, es »sollte« keine Probleme geben, weil es nur einmal passiert war, und ich hatte ein paar Leute aus Stefans Schafsherde getroffen – die Leute, die sein Frühstück, Mittag-und Abendessen waren. Sie waren ihm alle absolut ergeben. Nicht falsch verstehen, für einen Vampir ist er ein toller Kerl – aber irgendwie bezweifelte ich, dass diese Leute, überwiegend Frauen, so friedlich und einem Mann ergeben zusammenwohnen könnten, wenn da nicht eine Art Vampir-Hypnose am Werk war. Und ich hatte für dieses Jahr genug von magischen Zwängen.
Und außerdem wäre jeder Einwand gegenüber Adam sowieso eine vergebliche Anstrengung. Er fühlte sich in diesem Moment mir gegenüber besonders beschützend – es würde mir nur gelingen, das Blut in Wallung zu bringen: seines, meines und das meiner Mutter.
Adam drückte sein Handgelenk gegen Stefans Mund und der Vampir stoppte die langsame Annäherung seiner Reißzähne an meinen Arm. Für einen Moment schien er verwirrt – und dann zog er Luft durch die Nase ein.
Stefans Zähne versanken in Adams Handgelenk, seine freie Hand schoss nach oben, um Adams Arm zu umklammern, und er schloss die Augen – alles so schnell, dass es aussah wie die Bilderfolge in einem billig gezeichneten Cartoon.
Adam keuchte kurz auf, aber ich konnte nicht sagen, ob aus Schmerz, oder weil es sich gut anfühlte. Als Stefan sich von mir genährt hatte, war ich in ziemlich schlechter Verfassung gewesen. Ich erinnerte mich an kaum etwas.
Es war seltsam intim, wie Stefan mich hielt, während er sich aus Adams Handgelenk nährte, und wie Adam sich fester an mich lehnte, während Stefan trank. Intim, aber mit Publikum. Ich drehte den Kopf und sah, dass meine Mutter ihre Waffe immer noch fest in beiden Händen hielt und sie auf Stefans Kopf gerichtet hatte. Ihr Gesicht war ruhig, als sähe sie ständig verbrannte Körper aus dem Nichts erscheinen, die dann von den Toten auferstanden, um ihre Reißer in jeden zu hauen, der gerade nahe genug war. Ich wusste, dass das nicht wahr war. Ich war mir nicht mal sicher, ob sie jemals auch nur einen Werwolf in seiner Wolfsform gesehen hatte.
»Mom«, sagte ich, »der Vampir ist Stefan. Er ist ein Freund von mir.«
»Soll ich die Waffe wegstecken? Bist du dir sicher? Er sieht nicht aus wie ein Freund.«
Ich schaute Stefan an, der schon besser aussah, auch wenn ich ihn ohne meine Nase immer noch nicht erkannt hätte. »Ganz bestimmt, und ich bin mir sowieso nicht sicher, ob es etwas helfen würde. Kugeln, selbst wenn sie aus Silber sind, funktionieren vielleicht bei Werwölfen, aber ich glaube nicht, dass es Kugeln gibt, die Vampiren viel antun.«
Sie steckte die Glock – wie heiß – in das Holster, das sie in ihrem Hosenbund am Kreuz trug. »Was tut man dann mit Vampiren?«
Jemand klopfte an die Tür. Ich hatte niemanden vorfahren gehört, aber ich war auch ein wenig abgelenkt gewesen.
»In erster Linie nicht ins Haus lassen«, schlug Adam vor.
Mom, die auf dem Weg zur Tür gewesen war, blieb stehen. »Ist es wahrscheinlich, dass das ein Vampir ist?«
»Lass lieber mich gehen«, sagte ich. Ich wand meinen Arm, und Stefan ließ mich los, um sich dann fester an Adam zu klammern. »Ist bei dir alles in Ordnung, Adam?«
»Er ist zu schwach, um schnell zu trinken«, erklärte Adam. »Für eine Weile bin ich noch in Ordnung. Wenn du mein Telefon für mich rausholen und die Kurzwahltaste drücken würdest, rufe ich allerdings noch nach mehr Wölfen. Ich bezweifle, dass eine Nährung ausreichen wird.«
Weil Mom zusah, benahm ich mich, als ich das Telefon aus der Tasche an seinem Gürtel zog. Statt mir die Mühe zu machen, sein Telefonbuch zu durchsuchen, wählte ich einfach seine Nummer und gab ihm das Telefon. Wer auch immer vor der Tür stand, wurde langsam ungeduldig.
Ich zog mein T-Shirt zurecht und schaute kurz an mir herunter, um sicherzustellen, dass ich nichts an mir hatte, was verkündete: »Hey, ich habe einen Vampir in meinem Haus.«
Ich würde einen blauen Fleck auf dem Unterarm bekommen, aber noch war er nicht besonders deutlich. Ich glitt an Mom vorbei und öffnete die Tür ungefähr fünfzehn Zentimeter weit.
Die Frau, die auf meiner Veranda stand, kam mir nicht bekannt vor. Sie hatte ungefähr meine Größe und auch mein Alter. Ihr dunkles Haar hatte helle Strähnen (oder ihr hellbraunes Haar hatte dunkle Strähnen). Sie trug so viel Makeup, dass ich es über das Parfüm hinweg riechen konnte, das vielleicht für eine menschliche Nase leicht und attraktiv roch. Ihre Aufmachung war makellos, wie ein reinrassiger Hund hergerichtet für die Rasseshow – oder eine Edelnutte.
Nicht der Typ, den man nachts auf der Veranda eines Wohnwagens in der Washingtoner Provinz erwartet.
»Mercy?«
Wenn sie nichts gesagt hätte, hätte ich sie niemals erkannt, weil meine Nase voller Parfüm war und sie in keinster Weise aussah wie das Mädchen, mit dem ich auf dem College gewesen war. »Amber?«
Amber war die beste Freundin meiner Mitbewohnerin auf dem College gewesen, Charla. Sie wollte Tierärztin werden, aber ich hatte mitbekommen, dass sie im ersten Jahr des Studiums aufgegeben hatte. Seit unserem Abschluss hatte ich nichts mehr von ihr gehört.
Als ich Amber das letzte Mal gesehen hatte, trug sie einen Irokesenschnitt, hatte einen Ring in der Nase (die damals größer gewesen war) und das Tattoo eines Kolibris im Augenwinkel. Sie und Charla waren seit der Highschool beste Freundinnen gewesen. Obwohl es Charla gewesen war, die beschlossen hatte, dass sie nicht zusammenwohnen sollten, hatte Amber immer mir die Schuld dafür gegeben. Wir waren eher Bekannte als Freunde gewesen.
Amber lachte, zweifellos wegen meines verwirrten Gesichtsausdrucks. Es klang irgendwie zerbrechlich. Nicht dass ich in der Position gewesen wäre, pingelig zu sein. Ich war auch steifer als normalerweise. Hinter mir nährte sich ein Vampir von einem Werwolf; ich fragte mich, was sie wohl versteckte.
»Es ist lange her«, sagte sie nach einem kurzen, ungemütlichen Schweigen.
Ich trat zu ihr auf die Veranda und schloss die Tür hinter mir. Ich bemühte mich, nicht so zu wirken, als wolle ich sie aussperren. »Was führt dich her?«
Sie verschränkte die Arme vor der Brust und schaute über das unordentliche Feld hinter meinem Haus, wo ein rostiger VW-Golf auf drei Reifen stand. Von unserem Standpunkt aus konnte man weder das Graffiti noch die fehlende Tür oder die gesprungene Windschutzscheibe sehen, aber es wirkte trotzdem wie Gerümpel. Die alte Blechkiste war eine Sache zwischen Adam und mir, und ich würde mich nicht dafür entschuldigen.
»Ich habe in der Zeitung etwas über dich gelesen«, sagte sie.
»Du lebst in den Tri-Cities?«
Sie schüttelte den Kopf. »Spokane. Es wurde auch auf CNN gebracht, wusstest du das nicht? Das Feenvolk, Werwölfe, Tod … wie sollten sie dem widerstehen?« Für einen Moment hörte ich Humor in ihrer Stimme, auch wenn ihr Gesicht beunruhigend reglos blieb.
Wunderbar. Die ganze Welt wusste, dass ich vergewaltigt worden war. Genau, das hätte ich vielleicht auch witzig gefunden – wenn ich Lucrezia Borgia gewesen wäre. Es gab eine Menge Gründe, warum ich keinen Kontakt zu Amber gehalten hatte.
Sie war auch sicher nicht aus Spokane angefahren gekommen, um mich zu suchen, nur um mir dann zu erzählen, dass sie von dem Angriff gelesen hatte. »Also hast du über mich gelesen und entschieden, dass es vielleicht lustig wäre, mir zu erzählen, dass die Geschichte davon, wie ich meinen Vergewaltiger getötet habe, im ganzen Land bekannt ist? Dafür bist du hundertfünfzig Meilen gefahren?«
»Offensichtlich nicht.« Sie drehte sich wieder zu mir, und die peinlich berührte Fremde hatte sich in einen polierten Profi verwandelt, der mir noch fremder war. »Schau. Erinnerst du dich, als wir zusammen nach Portland gefahren sind, um uns dieses Theaterstück anzuschauen? Danach sind wir in eine Bar gegangen und du hast uns von dem Geist in der Damentoilette erzählt.«
»Ich war betrunken«, erklärte ich – was absolut stimmte. »Ich glaube, ich habe euch auch erzählt, ich wäre von Werwölfen aufgezogen worden.«
»Ja«, antwortete sie mit plötzlichem Eifer. »Ich dachte, du erzählst nur Geschichten, aber jetzt wissen wir alle, dass es wirklich Werwölfe gibt, genauso wie das Feenvolk. Und du gehst mit einem aus.«
Das stammte wohl auch aus dem Zeitungsartikel. Hipp, hipp, hurra. Es gab mal eine Zeit, als ich versuchte, aus dem Rampenlicht zu bleiben, weil es so sicherer war. Es war immer noch sicherer, aber im letzten Jahr war ich nicht so gut gewesen, was Unauffälligkeit anging.
Unbeeinflusst von meinem inneren Dialog sprach Amber weiter: »Also dachte ich, wenn du jetzt mit einem ausgehst, hast du vielleicht auch damals die Wahrheit gesagt. Und wenn du die Wahrheit über die Werwölfe gesagt hast, dann war vielleicht auch wahr, dass du uns erzählt hast, du könntest Geister sehen.«
Jeder andere hätte das vergessen, aber Amber hatte ein Gedächtnis wie eine Schlagfalle. Sie erinnerte sich an alles. Genau nach diesem Ausflug hatte ich aufgehört, Alkohol zu trinken. Leute, die die Geheimnisse von anderen hüten, können es sich nicht leisten, etwas zu tun, was ihre Fähigkeit beeinträchtigt, ihren Mund unter Kontrolle zu halten.
»In meinem Haus spukt es«, sagte sie.
Im Augenwinkel sah ich, wie sich etwas bewegte. Ich trat einen Schritt auf Amber zu und drehte mich ein wenig. Ich konnte da draußen immer noch nichts sehen, aber mit Amber in meinem Windschatten ruinierte ihr Parfüm nicht meinen Geruchssinn und ich konnte etwas riechen: Vampir.
»Und du willst, dass ich etwas dagegen unternehme?«, fragte ich. »Du solltest einen Pfarrer rufen.« Amber war katholisch.
»Keiner glaubt mir«, erklärte sie offen. »Mein Ehemann hält mich für verrückt.« Das Licht auf der Veranda fiel in ihre Augen, nur für einen Moment, und ich konnte sehen, dass ihre Pupillen erweitert waren. Ich fragte mich, ob das nur an der Dunkelheit der Nacht lag, oder ob sie auf irgendwelchen Drogen war.
Sie beunruhigte mich, aber ich war mir ziemlich sicher, dass es nur daran lag, dass hier Amber vor mir stand, die Königin des Außergewöhnlichen, und aussah wie die Mätresse eines reichen Mannes. Sie hatte jetzt etwas Sanftes und Hilfloses an sich, was mich an Beute denken ließ, während die Amber, die ich gekannt hatte, jeden, der sie nervte, mit einem Baseballschläger verdroschen hätte. Sie hätte keine Angst vor einem Geist gehabt.
Natürlich konnte meine Beunruhigung auch daher kommen, dass ein Vampir in den Schatten um mein Haus lauerte, oder dass einer gerade in meinem Haus war.
»Schau«, sagte ich. Stefan und was ihm angetan worden war waren mir wichtiger, als was auch immer Amber passiert war, oder was sie von mir wollte. »Ich kann jetzt nicht weg – ich habe Besuch. Warum gibst du mir nicht deine Telefonnummer und ich rufe dich an, sobald die Dinge sich beruhigt haben.«
Sie fummelte an ihrer Tasche herum, um sie zu öffnen, und gab mir dann eine Karte. Sie war auf teures Baumwollpapier gedruckt, aber es standen nur ihr Vorname und eine Telefonnummer darauf.
»Danke.« Sie klang erleichtert und die Anspannung verließ ihre Schultern. Sie lächelte mich kurz an. »Es tut mir leid, dass du angegriffen wurdest – aber ich war nicht überrascht, dass du dich revanchiert hast. Darin warst du immer ziemlich gut.« Ohne auf meine Antwort zu warten ging sie die Stufen hinunter und stieg in ihr Auto, einen neueren Miata-Cabrio mit geöffnetem Faltverdeck. Sie setzte rückwärts aus der Einfahrt, ohne mich nochmal anzuschauen, und raste in die Nacht davon.
Ich wünschte mir, sie hätte kein Parfüm getragen. Sie war wegen irgendetwas durcheinander gewesen – sie war schon immer ein hoffnungsloser Lügner gewesen. Aber das Timing war einfach zu passend: Stefan taucht auf, sagt mir, ich solle fliehen, und Amber erscheint und bietet mir einen Ort, an den ich fliehen kann.
Ich wusste, vor wem ich weglaufen sollte, und es war nicht Stefan. »Sie weiß«, hatte er gesagt.
»Sie« war Marsilia, die Herrin der Vampire der Tri-Cities. Sie hatte mich ausgeschickt, einen Vampir zu jagen, der auf einem Amoklauf war, der die Siedhe gefährdete. Sie war davon ausgegangen, dass ich ihre beste Chance war, ihn zu finden, weil ich Geister fühlen kann, die andere nicht sehen, und weil die Verstecke von Vampiren dazu neigen, Geister anzuziehen.
Sie hatte nicht gedacht, dass ich wirklich fähig sein würde, ihn zu töten. Als ich es getan hatte, hatte ich sie damit sehr unglücklich gemacht. Der Vamp, den ich getötet hatte, war etwas Besonderes gewesen, mächtiger als andere, weil er von einem Dämon besessen war. Dass der Dämon ihn verrückt gemacht hatte und er ständig Menschen tötete, störte Marsilia nicht, außer vielleicht, weil das die Aufmerksamkeit der Menschenwelt auf die Vampire hätte lenken können. Er war außer Kontrolle geraten, als er mächtiger geworden war als sein Schöpfer, aber Marsilia glaubte, dass sie das in Ordnung und ihn unter Kontrolle hätte bringen können. Sie hatte mich benutzt, um ihn zu finden – sie war sich sicher gewesen, dass er mich töten würde.
Und sie hätte Recht behalten, hätte ich keine Freunde gehabt.
Nachdem sie mich hinter ihm hergeschickt hatte, konnte sie keine Rache üben, ohne zu riskieren, die Kontrolle über die Siedhe zu verlieren. Vampire nehmen solche Dinge sehr ernst.
Ich wäre in Sicherheit gewesen, hätte es da nicht noch den zweiten Vampir gegeben.
Andre war Marsilias linke Hand gewesen, wo Stefan ihre rechte war. Er war auch der Verantwortliche für die Erschaffung des dämonenbesessenen Vampirs, der mehr Leute umgebracht hatte, als ich an beiden Händen abzählen konnte. Und Andre und Marsilia hatten vorgehabt, noch mehr davon zu schaffen. Einer war in meinen Augen mehr als genug gewesen. Also hatte ich Andre getötet, in dem Wissen, dass es meinen Tod bedeuten würde.
Aber Stefan hatte meine Tat vertuscht. Vertuscht durch den Tod zweier unschuldiger Menschen, deren einziges Verbrechen es gewesen war, dass sie Andres Opfer waren. Er hatte mich gerettet, aber der Preis war zu hoch gewesen. Ihr Tod hatte mir zwei weitere Monate erkauft.
Marsilia wusste es. Sie hätte Stefan niemals wegen etwas anderem so übel zugerichtet.
Sie hatte ihn gefoltert und ausgehungert und ihn dann freigelassen, damit er zu mir kommen konnte. Ich schaute auf die roten Male, die Stefan an meinem Arm hinterlassen hatte – wenn er mich umgebracht hätte, hätte niemand ihr dafür die Schuld gegeben.
Ich hörte ein Geräusch und schaute auf. Darryl und Peter gingen gerade an dem ramponiertem Rumpf des Golf vorbei.
Darryl war groß, athletisch und Adams Stellvertreter. Er hatte die dunkle Haut seines afrikanischen Vaters und die Augen seiner chinesischen Mutter. Sein perfektes Aussehen entsprang einer fröhlichen Mischung der absolut verschiedenen Gene, aber die Grazie seiner Bewegungen entstand aus dem Unfall, der ihn in einen Werwolf verwandelt hatte. Er mochte elegante Kleidung, und das frische weiße Hemd, das er trug, hatte wahrscheinlich mehr gekostet, als ich in der Woche verdiente.
Ich wusste nicht, wie alt er war, aber ich war mir ziemlich sicher, dass er nicht viel älter war, als er aussah. Es gab etwas an den älteren Wölfen – ein Auftreten, als kämen sie nicht wirklich aus diesem Zeitalter der Autos, Handys und Fernseher –, das Darryl nicht hatte.
Peter war alt genug, um in der Kavallerie gewesen zu sein, aber im Hier und Jetzt arbeitete er als Klempner. Er war gut in seinem Job und hatte ein halbes Dutzend Leute (Menschen) auf seiner Gehaltsliste. Aber er ging rechts und ein wenig hinter Darryl, weil Darryl sehr dominant war und Peter einer der wenigen unterwürfigen Wölfe in Adams Rudel.
Darryl blieb kurz vor der Veranda stehen. Er mochte mich meistens nicht besonders. Ich hatte schließlich entschieden, dass es Snobismus war – er war ein Wolf und ich ein Kojote. Er war ein Doktor, der in einer hochwertigen Denkfabrik arbeitete, und ich war eine Mechanikerin mit Dreck unter den Fingernägeln.
Und am schlimmsten für ihn war: Wenn ich Adams Gefährtin war, musste er meinen Befehlen folgen. Manchmal funktioniert der Chauvinismus, der sich durch die Regeln zieht, nach denen Werwölfe funktionieren, auch in die umgekehrte Richtung. Völlig egal, wie unterwürfig die Gefährtin des Alpha ist, ihre Befehle werden nur von seinen getoppt.
Als er nichts sagte, öffnete ich einfach die Tür und ließ Adams Wölfe in mein Heim.
2
Stefan war dem Vorschlag, Blutspender zu wechseln, nicht wirklich zugänglich, also knieten sich Peter und Darryl je auf eine Seite von ihm und begannen, seine Finger aufzubiegen. Als ich näher kam, um auch zu helfen, knurrte Adam mich an.
Wenn er nicht geknurrt hätte, hätte ich wahrscheinlich zugelassen, dass die Wölfe sich darum kümmern. Schließlich hatten sie diese fantastische Wolfs-Superkraft. Aber wenn Adam und ich eine Beziehung haben wollten – etwas, was mir jetzt schon Schmetterlinge im Bauch verursachte –, dann würde es eine gleichberechtigte sein. Ich konnte es mir nicht leisten, zurückzuweichen, wenn Adam knurrte.
Außerdem verabscheute ich den feigen Teil von mir, der vor seiner Wut zurückwich. Selbst wenn ich mir ziemlich sicher war, dass das der kluge Teil war.
Peter und Darryl arbeiteten an Stefans Händen, also ging ich zu seinem Kopf. Ich ließ meine Finger in eine Seite seines Mundes gleiten, in der Hoffnung, dass Vampire genauso auf Druckpunkte reagierten wie wir alle. Aber ich musste nicht mal Nervenzentren finden, denn sobald meine Finger seinen Mund berührten, erschauderte er und löste sich von Adam. In dem Moment, in dem seine Reißzähne Adams Arm verließen, wurden auch seine Arme schlaff.
»Werde nicht«, sagte Stefan, als ich meine Finger wieder aus seinem Mund zog. »Werde nicht.« Es war nur ein Flüstern und verklang unheimlich, als ihm der Atem ausging.
Sein Kopf bewegte sich, bis er mit geschlossenen Augen an meiner Schulter lehnte. Sein Gesicht wirkte jetzt fast wie sein eigenes, aufgefüllt und in Heilung begriffen. Die aufgeplatzten Stellen auf seiner Haut, seinen Händen und Lippen sahen jetzt aus wie Wunden. Es sagte etwas darüber aus, wie schlimm er ausgesehen hatte, dass nässende Wunden tatsächlich eine Verbesserung darstellten.
Wenn sein Körper nicht gezittert hätte wie in einem epileptischen Anfall, wäre ich glücklicher gewesen.
»Weißt du, was mit ihm nicht stimmt?«, fragte ich Adam hilflos.
»Ich weiß es«, erklärte Peter. Beiläufig zog er ein riesiges Taschenmesser aus einer Gürtelscheide und schnitt sich leicht ins Handgelenk.
Peter schob mich unter Stefan heraus und bewegte ihn, bis der Vampir mit seinem Kopf auf Peters Schoß lag, gehalten von der unverletzten Hand des Werwolfs. Peter hielt sein blutiges Handgelenk vor Stefans Mund, der die Lippen zupresste und den Kopf abwandte.
Adam, der sein eigenes Handgelenk umklammerte, um die Blutung zu stillen, lehnte sich nach vorne. »Stefan. Es ist in Ordnung. Es ist nicht Mercy. Es ist nicht Mercy.«
Rote Augen öffneten sich und der Vampir gab ein Geräusch von sich, das ich noch niemals vorher gehört hatte – und ich wünschte mir, ich könnte das immer noch sagen. Es stellte mir jedes Haar im Nacken auf, hochfrequent und dünn wie eine Hundepfeife, aber irgendwie rauer. Er schlug zu und Peter zuckte, biss die Zähne zusammen und stieß zischend Luft aus.
Ich bemerkte nicht, wie meine Mutter wegging, aber irgendwann musste sie es getan haben, weil sie Samuels großen Erste-Hilfe-Kasten aus dem Bad aufgeklappt auf der Couch stehen hatte. Sie kniete sich neben Adam, aber er sprang auf die Beine.
Alpha-Werwölfe gestehen in der Öffentlichkeit niemals ein, dass sie Schmerzen haben, und auch im Privaten nur selten. Sein Handgelenk mochte aussehen, als hätte jemand es zerfetzt, aber er würde meine Mutter deswegen niemals etwas unternehmen lassen. Ich stand ebenfalls auf.
»Hier«, sagte ich, bevor er etwas sagen konnte, das sie beleidigte oder umgekehrt. »Lass mich mal sehen.«
Ich zog und schob, bis ich die Wunden sehen konnte. »Er kommt in Ordnung«, erklärte ich Mom befriedigt. »Es hat schon Krusten gebildet. In einer halben Stunde sind es nur noch rote Male.«
Das war gut.
Meine Mutter zog eine Augenbraue hoch und murmelte: »Wenn ich dran denke, dass ich mir immer Sorgen gemacht habe, weil du keine Freunde hattest. Ich hätte für das dankbar sein sollen, was ich hatte.«
Ich warf ihr einen scharfen Blick zu und sie lächelte, trotz der Sorge in ihren Augen. »Vampire, Mercy? Ich dachte, die wären erfunden.«
Sie war immer gut darin gewesen, mir Schuldgefühle einzuimpfen, was mehr war, als Bran je geschafft hatte. »Ich konnte es dir nicht erzählen«, sagte ich. »Sie mögen es nicht, wenn Menschen von ihnen wissen. Es hätte dich in Gefahr gebracht.« Sie kniff die Augen zusammen. »Außerdem, Mom, habe ich in Portland nie welche gesehen.« Ich hatte darauf geachtet, nicht hinzuschauen, wenn ich sie gerochen hatte. Vampire mögen Portland – viele regnerische Tage.
»Können sie alle einfach so auftauchen, wann immer sie wollen?«
Ich schüttelte den Kopf, dann dachte ich nochmal nach. »Ich weiß nur von zweien, und Stefan ist einer davon.«
Adam beobachtete, wie Stefan sich nährte; er wirkte besorgt. Mir war nicht klar gewesen, dass er und Stefan mehr waren als flüchtige Bekannte.
»Wird er in Ordnung kommen?«, fragte Mom.
Adam war bleich, aber er heilte prima. Andere Wölfe hätten länger gebraucht, aber Adam war ein Alpha und sein Rudel gab ihm mehr Macht, als andere Wölfe hatten. Aber wenn Stefan so an Peter herumkaute, wie er es bei Adam getan hatte, dann würde Peter eine Weile brauchen, um zu heilen.
Sie schaute mich an und plötzlich zeigten sich ihre Grübchen. »Ich sprach über den Vampir. Dich hat es übel erwischt, oder?«
Ich hatte mich bemüht, nicht zu viel über Stefans Zustand nachzudenken, und warum er so schlimm war – und inwieweit das alles mein Fehler war. »Ich weiß es nicht, Mom.« Ich lehnte mich an sie, nur ein wenig, bevor ich mich wieder aufrichtete, um allein zu stehen. »So viel weiß ich nicht über Vampire. Sie sind schwer zu töten, aber ich habe noch nie einen gesehen, der so übel dran war und überlebt hat.« Daniel, Stefans … was? Freund war nicht ganz das richtige Wort. Vielleicht einfach nur Stefans. Daniel hatte einmal aufgehört, sich zu nähren, weil er dachte, er wäre ausgetickt und hätte eine ganze Sippschaft getötet. Er hatte schlimm ausgesehen, aber nicht so schlimm wie Stefan.
»Er bedeutet dir auch etwas.«
Sie klang nicht überrascht, aber das wäre sie gewesen, wenn sie so viel über Vampire gewusst hätte wie ich.
Ich wusste, dass Stefan eine Gruppe Menschen quasi als Gefangene hielt, um sich von ihnen zu nähren – auch wenn es keinem von ihnen etwas auszumachen schien. Die rosarote Brille war mir endgültig von der Nase gerissen worden, als er zwei hilflose Leute umbrachte, Leute, die ich gerettet hatte, um mich zu beschützen. Es war vielleicht der mysteriöse Vampir Wulfe gewesen, der ihnen die Hälse umgedreht hatte, aber Stefan hatte diese makabre kleine Verschwörung organisiert.
Aber es tat trotzdem weh, ihn so zu sehen.
»Ja«, antwortete ich Mom.
»Du kannst ihn jetzt loslassen«, meinte Adam zu Darryl. »Er nährt sich.«
Darryl ließ Stefans Arm fallen und trat zurück, als fürchte er sich vor Verseuchung. Es gab nicht mehr viel Platz in meinem Wohnzimmer, aber er schob seinen Rücken gegen den Tresen, der den größeren Raum von der Küche trennte, und verzog die Lippen. Adam warf ihm einen nachdenklichen Blick zu, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder auf den anderen Wolf richtete.
»Geht es dir gut, Peter?«, fragte Adam.
Ich schaute den Werwolf an und sah, dass sich Schweiß auf seiner Stirn sammelte. Er hatte die Augen geschlossen und von dem Vampir abgewandt, der über seinem Schoß lag und an seinem Arm hing. Nach dem Unterschied zwischen seiner Reaktion und der Adams zu schließen, wäre es vielleicht besser gewesen, einen dominanteren Wolf zu finden, um Stefan zu nähren.
Peter antwortete nicht und Adam trat hinter ihn, so dass er eine Hand auf die Haut an seinem Nacken legen konnte. Fast sofort konnte ich die Reaktion auf die Berührung sehen, als Peter sich mit einem erleichterten Seufzen entspannte und an seinen Alpha lehnte.
»Es tut mir leid«, sagte Adam. »Wenn jemand anders da gewesen wäre … Ben sollte bald hier sein.«
Da gab es noch Darryl, der auf seine Schuhe starrte. Adams Bemerkung war nicht scharf gewesen, aber Darryl sah aus, als hätte ihn jemand geschlagen.
Peter schüttelte den Kopf. »Kein Problem. Für eine Minute war es allerdings ziemlich schlimm. Ich dachte, es wäre ein Mythos, dass Vampire den Geist gefangen halten können.«
Das war eines der Probleme mit den Vamps. Wie beim Feenvolk gab es so viele falsche Informationen da draußen, dass es schwer war, die Wahrheit herauszufinden.
»Er ist nicht er selbst«, hörte ich mich sagen. »Er würde es nicht absichtlich tun.« Ich war mir nicht ganz sicher, ob das die Wahrheit war, aber es klang gut. Er hatte mich einmal übernommen. Da hatte alles wunderbar funktioniert, aber mir wäre es lieber, wenn es niemals wieder passieren würde.
Meine Mutter sah mich an. »Hast du Orangensaft oder etwas anderes mit Zucker für die Blutspender da?«
Daran hätte ich selbst denken sollen. Ich hüpfte über Stefans Beine, um in die Küche gehen zu können und zu suchen. Nachdem mein Mitbewohner mich als absolut einfallslos in der Wahl meiner Lebensmittel bezeichnet hatte, hatte er das Einkaufen an sich gerissen. Ich hatte keine Ahnung, was er alles in den Kühlschrank gestopft hatte.
Ich fand eine halbe Flasche Orangensaft und füllte zwei Gläser. Das erste gab ich Adam und das zweite hielt ich vor Peter.
»Brauchst du Hilfe?«
Peter warf mir ein halbes Lächeln zu, schüttelte den Kopf und nahm das Glas. Er leerte es in einem Zug und gab es mir zurück.
»Mehr?«
»Jetzt nicht«, meinte er. »Vielleicht, wenn es vorbei ist.«
Mom und ich setzten uns auf die Couch, Adam nahm sich einen Stuhl und Darryl blieb, wo er war, und schaute betont nicht auf den Vampir.
An der Tür erklang ein scharfes Klopfen und Darryl sagte: »Ben.«
Er machte keine Anstalten, die Tür zu öffnen, aber sie ging trotzdem auf und Ben streckte seinen Kopf in den Raum. Sein blondes Haar wirkte im Licht der Verandalampe fast weiß. Er warf einen kurzen Blick auf Stefan und erklärte in seinem eleganten britischen Akzent: »Verdammte Scheiße. Er sieht übel aus.«
Aber seine Aufmerksamkeit war völlig auf meine Mutter konzentriert.
»Sie ist verheiratet«, warnte ich ihn. »Und wenn du sie beleidigst, dann wird sie dich mit ihrer hübschen rosa Knarre erschießen und ich werde auf dein Grab spucken.«
Er schaute einen Moment zu mir und öffnete dann den Mund.
Adam sagte: »Ben, darf ich dir Mercys Mutter Margi vorstellen?«
Ben wurde blass, schloss den Mund und öffnete ihn dann wieder. Aber kein Laut kam hervor. Ich ging nicht davon aus, dass Ben es gewöhnt war, Müttern vorgestellt zu werden.
»Ich weiß.« Ich seufzte. »Sie sieht aus wie meine jüngere, hübschere Schwester. Mom, das ist Ben. Ben ist ein Werwolf aus England und er hat ein ziemlich übles Mundwerk, wenn Adam nicht in der Gegend ist, um auf ihn aufzupassen. Er hat mir ein paarmal das Leben gerettet. An der Wand steht Darryl, Werwolf, Genie mit Doktortitel, und Adams Stellvertreter. Peter, auch ein Werwolf, ist der nette Mann, der gerade Stefan nährt.«
Und danach breitete sich unangenehme Stille aus. Darryl sprach kein Wort. Ben, nach einem weiteren verwirrten Blick zu Mom, hielt den Kopf gesenkt und den Mund geschlossen. Peter war offensichtlich durch den saugenden Vampir abgelenkt. Adam starrte mit einem besorgten Stirnrunzeln Stefan an.
Er wusste auch, was Stefan mit seinen ersten Worten gemeint hatte. Aber er konnte vor meiner Mom nicht mit mir darüber reden, außer, ich fing an. Und ich würde sie nicht wissen lassen, dass Marsilia und ihre Vampire hinter mir her waren. Nicht wenn es nicht sein musste.
Mom wollte mir Fragen über … über den Vorfall letzte Woche stellen. Über Tim und wie er gestorben war. Aber sie würde mich nichts fragen, bevor nicht alle anderen gegangen waren.
Und ich? Ich hätte am liebsten über nichts davon geredet. Ich fragte mich, wie lange ich alle hierhalten konnte, weil ich die Unbehaglichkeit immer noch besser fand als die Übelkeit erregende Panik, die durch die Gespräche mit Adam oder meiner Mutter ausgelöst werden würde.
»Ich bin kaputt«, erklärte Peter.
Stefan war auch diesmal kein bisschen glücklicher darüber, Blutspender zu wechseln. Aber der zusätzliche Wolf erfüllte seinen Zweck und er nährte sich, mit nur minimalem Schaden an meinem Tisch, bald von Ben. Aber nur ein paar Minuten später wurde Stefan schlaff und sein Mund öffnete sich.
»Ist er tot?«, fragte Peter und nippte an seinem zweiten Glas Orangensaft.
»Der?«, fragte Ben und zog sein Handgelenk zurück. »Der ist schon seit Jahren tot.«
Peter grunzte. »Du weißt, was ich meine.«
Tatsächlich war es schwer zu sagen. Er atmete nicht, aber Vampire taten das sowieso nicht, außer sie mussten reden oder sich als Menschen ausgeben. Sein Herz schlug nicht, aber auch das bedeutete nicht viel.
»Wir werden ihn in mein Haus bringen«, erklärte Adam. »Der …« Er warf einen Blick zu Mom. »Mein Keller hat einen Raum ohne Fenster, wo er sicherer ist.« Er meinte den Käfig, in den Werwölfe gesperrt wurden, die ein Kontrollproblem hatten. Dann runzelte er die Stirn. »Nicht dass das denjenigen aufhalten wird, der ihn in der Mitte deines Wohnzimmers abgesetzt hat, Mercy.« Er wusste genau, wer ›derjenige‹ war.
Marsilia, dachte ich, aber vielleicht war es auch Stefan selbst. Oder vielleicht irgendein anderer Vampir. Es war Andre gewesen, der mir erklärt hatte, dass Marsilia und Stefan die Einzigen waren, die sich so teleportieren konnten, der, den ich hatte töten müssen. Es war schwer, seinen Informationen großartig zu trauen.
»Ich werde vorsichtig sein«, erklärte ich Adam. »Aber