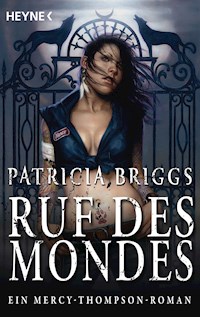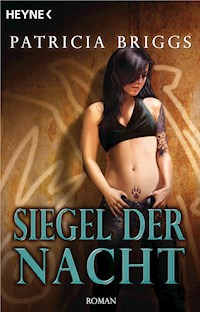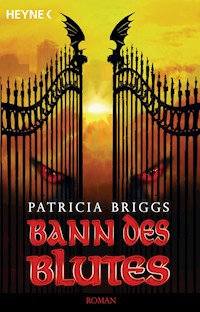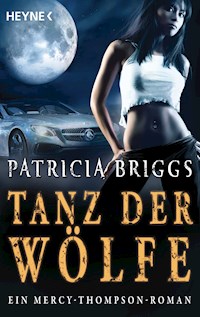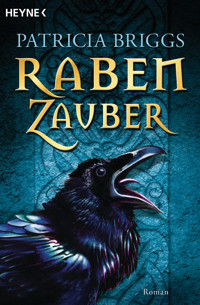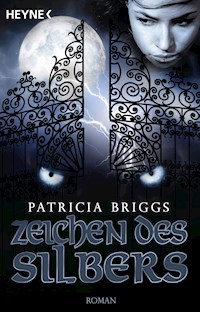
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mercy-Thompson-Reihe
- Sprache: Deutsch
Platz 1 der New York Times- Bestsellerliste
Mercy Thompson, stolze Besitzerin einer kleinen Autowerkstatt und Walkerin, ist längst nicht allen übernatürlichen Geschöpfen ihrer gefährlichen Welt gewachsen. Das bekommt sie schmerzhaft zu spüren, als sie ein mächtiges Buch, eine Leihgabe des Feenvolks, zu spät zurückgibt. Denn das Buch enthält geheimes Wissen, das die Feen um jeden Preis schützen wollen. Selbst wenn es Mercys Leben kostet …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
»Gestatten, mein Name ist Mercedes Thompson, und ich bin kein Werwolf …«
Automechanikerin Mercy Thompson hat mehr als ein Problem zu bewältigen: Sie ist immer noch damit beschäftigt, ihre Beziehung mit Adam zu vertiefen und einen Platz in seinem Werwolfrudel zu finden. Was sich als schier unmöglich herausstellt – zumindest wenn man, wie Mercy, ein Kojote ist. Zudem muss sie sich um ihren Kumpel Sam kümmern, der Selbstmordabsichten hegt, was nicht nur für ihn und seinen Wolf, sondern für die gesamten Tri-Cities katastrophale Folgen hätte! Richtig kompliziert wird es, als Mercy versäumt, ein mächtiges Buch, die Leihgabe des Feenvolks, rechtzeitig zurückzugeben. Denn das Buch enthält uralte Geheimnisse und darf unter keinen Umständen in die falschen Hände geraten. Da das Feenvolk bereit ist, jeden Preis zu bezahlen, um das Buch zurückzubekommen, ist es gut möglich, dass dieser Preis Mercys Leben ist …
Die Autorin
Patricia Briggs, Jahrgang 1965, wuchs in Montana auf und interessiert sich seit ihrer Kindheit für Phantastisches. So studierte sie neben Geschichte auch Deutsch, denn ihre große Liebe gilt Burgen und Märchen. Neben erfolgreichen und preisgekrönten Fantasy-Romanen wie Drachenzauber und Rabenzauber widmet sie sich ihrer New York Times-Bestseller-Serie um Mercy Thompson. Nach mehreren Umzügen lebt die Bestsellerautorin heute gemeinsam mit ihrer Familie in Washington State.
Inhaltsverzeichnis
Für lang-leidende Lektoren, die niemals aus der Ruhe kommen, Ehemänner, die Pferde füttern, Kinder, die sich selbst zur Schule bringen und sich ihr Essen kochen, Tierärzte, die zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten panische Telefonanrufe entgegennehmen und alle anderen, die ihre Zeit, Talente und Energie einsetzen, um anderen zu helfen und da zu sein, wenn man sie braucht.
Vielen Dank.
Der Anlasser beschwerte sich lautstark, als er versuchte, den schweren Motor des alten Buick zu starten. Ich hatte ziemliches Mitleid mit ihm, denn ich wusste genau, wie es ist, außerhalb der eigenen Liga zu spielen. Ich bin eine Kojoten-Gestaltwandlerin in einer Welt von Werwölfen und Vampiren – zu behaupten, ich wäre unterlegen, war noch eine Untertreibung.
»Noch einmal«, wies ich Gabriel an, meinen siebzehnjährigen Bürochef, der auf dem Fahrersitz des Buicks seiner Mutter saß. Ich schnüffelte und wischte mir die Nase an der Schulter meines Arbeitsanzuges ab. Eine Triefnase gehörte im Winter einfach zur Arbeit dazu.
Ich liebe es, Mechaniker zu sein, trotz Triefnase, öliger Hände und allem anderen.
Es ist ein Leben voller Frustration und aufgeschürfter Knöchel, gefolgt von kurzen triumphierenden Momenten, welche die gesamte Mühe wert sind. Hier finde ich die Ruhe vor dem Chaos, zu dem mein Leben sich in letzter Zeit entwickelt hat: Es ist höchst unwahrscheinlich, dass jemand stirbt, wenn ich dieses Auto nicht reparieren kann.
Nicht mal, wenn es das Auto von Gabriels Mutter ist. Es war ein kurzer Schultag, und Gabriel hatte seine Freizeit dazu verwendet, zu versuchen, das Auto seiner Mutter zu reparieren. Er hatte es geschafft, dass es nicht mehr nur schlecht, sondern gar nicht mehr lief. Dann hatte er einen Freund dazu gebracht, es zu mir zu schleppen, um zu sehen, ob ich es reparieren konnte.
Der Buick gab noch ein paar ungesunde Geräusche von sich. Ich trat von der offenen Motorhaube zurück. Benzin, Feuer und Luft bringen einen Motor zum Laufen – vorausgesetzt, der Motor war nicht tot.
»Er springt nicht an, Mercy«, sagte Gabriel, als hätte ich das nicht schon selbst bemerkt.
Seine eleganten, aber von der Arbeit rauen Hände umklammerten das Lenkrad. Auf seiner Wange war ein Schmierölfleck, und ein Auge war rot, weil er keine Schutzbrille angezogen hatte, als er unter das Auto gekrochen war. Als Belohnung dafür war ihm ein dicker Batzen Dreck – eine Mischung aus rostigem Metall und Öl – ins Auge gefallen.
Obwohl zwei große Standöfen ein wenig gegen die Kälte anbliesen, trugen wir beide Jacken. Man kann eine Werkstatt nicht wirklich warm halten, wenn man den ganzen Tag das Garagentor öffnet und schließt.
»Mercy, meine mamá muss in einer Stunde in der Arbeit sein.«
»Die gute Nachricht ist, dass ich nicht glaube, dass es an etwas liegt, was du getan hast.« Ich trat vom Motorraum zurück und suchte seinen panischen Blick. »Die schlechte Nachricht ist, dass der Wagen auch in einer Stunde nicht laufen wird. Die Geschworenen beraten noch, ob er jemals wieder auf die Straße kann.«
Er glitt aus dem Auto und lehnte sich unter die Motorhaube, als könnte er die kleine Lokomotive damit wie durch ein Wunder wieder zum Laufen bringen. Ich überließ ihn seinen Grübeleien und ging durch den kurzen Flur in mein Büro.
Hinter dem Tresen hing ein dreckiges, ehemals weißes Brett, an dem die Schlüssel der Autos hingen, an denen ich gerade arbeitete – und noch ein halbes Dutzend geheimnisvoller Schlüssel, die schon vor meiner Arbeit in der Werkstatt existiert hatten. Ich nahm mir einen Schlüsselbund, an dem ein quietschbuntes Peace-Zeichen hing, und trottete zurück in die Garage. Gabriel saß wieder hinter dem Lenkrad des Buicks und wirkte, als wäre ihm übel. Ich gab ihm durch das offene Fenster die Schlüssel.
»Nimm den Käfer«, sagte ich. »Sag deiner Mom, dass die Blinker nicht funktionieren und sie Handzeichen geben muss. Und erklär ihr auch, dass sie nicht zu fest am Lenkrad ziehen darf, weil es sonst abgeht.«
Seine Miene wurde störrisch.
»Schau«, sagte ich, bevor er ablehnen konnte, »es ist ja nicht so, als würde mich das irgendwas kosten. Es werden nicht alle Kinder reinpassen« – nicht, dass das beim Buick der Fall wäre; es waren wirklich viele Kinder –, »und die Heizung funktioniert auch nicht richtig. Aber er fährt, und ich benutze ihn nicht. Wir werden nach Feierabend am Buick arbeiten, bis er fertig ist, und diese Stunden kannst du dann bei mir abarbeiten.«
Ich war mir ziemlich sicher, dass der Motor schon auf dem Weg auf den großen Schrottplatz im Himmel war – und ich wusste, dass Sylvia, Gabriels Mutter, sich keinen neuen Motor leisten konnte, genauso wenig wie ein neues Auto. Also würde ich mich an Zee wenden, meinen alten Mentor, damit er seine Magie wirkte. Echte Magie – an Zee war wenig Metaphorisches. Er war vom Feenvolk – ein Gremlin, dessen natürliches Element Metall war.
»Der Käfer ist dein Autoprojekt, Mercy.« Gabriels Protest war schwach.
Mein letztes Projektauto, ein Karmann Ghia, war verkauft. Mit meinem Anteil am Gewinn, den ich mir mit einem fantastischen Lackierer und einem Polsterer geteilt hatte, hatte ich einen Käfer von 1971 und einen VW-Bus Jahrgang 1965 gekauft. Ein bisschen war noch übrig geblieben. Der Bus war wunderschön und lief nicht; der Käfer hatte genau das gegenteilige Problem.
»Ich arbeite sowieso zuerst am Bus. Nimm die Schlüssel.«
Sein Gesicht wirkte plötzlich älter, als es hätte sein sollen. »Nur, wenn du erlaubst, dass die Mädchen jeden Samstag vorbeikommen und putzen, bis wir dir den Käfer zurückgeben.«
Ich bin nicht dämlich. Seine kleinen Schwestern wussten, wie man arbeitet – ich kam bei dieser Abmachung besser weg. »Geh und bring Sylvia das Auto, bevor sie zu spät kommt.«
»Ich komme danach zurück.«
»Es ist spät. Ich gehe nach Hause. Komm einfach morgen zur üblichen Zeit.«
Morgen war Samstag. Offiziell hatte die Werkstatt an den Wochenenden geschlossen, aber ein paar unvermeidliche Ausflüge, um Vampire zu jagen, hatten mein Konto belastet. Also hatte ich in letzter Zeit länger offen gehabt und auch am Wochenende gearbeitet, um ein bisschen zusätzliches Geld zu verdienen.
Der Kampf gegen das Böse macht nicht reich: Meiner Erfahrung nach war sogar das Gegenteil der Fall. Ich hoffte, dass ich mit Vampiren fertig war – der letzte Vorfall hatte mich fast umgebracht und langsam musste meine Glückssträhne mal enden; eine Frau, deren größtes Talent es war, dass sie sich in einen Kojoten verwandeln konnte, sollte nicht in der Oberliga mitspielen.
Ich schickte Gabriel auf den Weg und machte mich daran, die Werkstatt zu schließen. Garagentore zu, Heizung auf sechzehn Grad, Lichter aus. Kassenschublade in den Safe, meine Tasche auf die Schulter. Gerade, als ich die Hand nach dem letzten Lichtschalter ausstreckte, klingelte mein Handy.
»Mercy?« Es war Zees Sohn Tad, der mit einem vollen Stipendium auf eine Eliteuniversität im Osten ging. Das Feenvolk wurde als Minderheitengruppe angesehen, also hatten ihn seine Noten und sein offizieller Status als Halb-Feenvolk dorthin gebracht. Aber er hielt sich dort, weil er hart arbeitete.
»Hey, Tad. Was ist los?«
»Ich hatte gestern eine seltsame Nachricht auf meiner Mailbox. Hat Phin dir etwas gegeben?«
»Phin?«
»Phineas Brewster, der Kerl, zu dem ich dich geschickt habe, als die Polizei meinen Dad wegen Mordverdachts im Knast hatte und du Informationen über das Feenvolk brauchtest, um herauszufinden, wer den Mann wirklich umgebracht hatte.«
Ich brauchte eine Sekunde. »Der Kerl aus dem Buchladen? Er hat mir ein Buch geliehen.« Ich hatte schon länger vor, es ihm zurückzubringen. Nur … wie oft bekam man schon die Chance, ein Buch über das mysteriöse Feenvolk zu lesen, geschrieben von einem Angehörigen des Feenvolks selbst? Es war handgeschrieben, schwer zu entziffern, und ich kam nur langsam voran – und Phin hatte nicht so gewirkt, als wollte er es so schnell wie möglich zurückhaben. »Sag ihm, es tut mir leid, und ich werde es ihm heute Abend zurückbringen. Ich habe später noch ein Date, aber davor kann ich es noch vorbeibringen.«
Es folgte ein kurzes Schweigen. »Eigentlich hat er sich nicht gerade klar ausgedrückt, ob er es nun zurückhaben will oder nicht. Er hat nur gesagt: ›Sag Mercy, sie soll gut auf dieses Ding aufpassen, das ich ihr gegeben habe.‹ Und jetzt kann ich ihn nicht mehr erreichen; sein Handy ist ausgeschaltet. Deswegen habe ich stattdessen dich angerufen.« Er gab ein angewidertes Geräusch von sich. »Die Sache ist die, Mercy: Er schaltet dieses verdammte Telefon nie aus. Er will immer sicher sein, dass seine Großmutter ihn erreichen kann.«
Großmutter? Vielleicht war Phin jünger, als ich gedacht hatte.
»Du machst dir Sorgen«, meinte ich.
Jetzt klang das Geräusch, das er erzeugte, eher peinlich berührt. »Ich weiß, ich weiß. Ich bin paranoid.«
»Kein Problem«, sagte ich. »Ich sollte es ihm sowieso zurückbringen. Aber wenn er nicht länger geöffnet hat als üblich, wird er auf keinen Fall mehr im Laden sein, wenn ich da ankomme. Hast du eine Privatadresse von ihm?«
Hatte er. Ich schrieb sie mir auf und beendete das Gespräch mit Beschwichtigungen. Als ich die Tür abschloss und die Alarmanlage aktivierte, schaute ich zu der versteckten Kamera hoch. Adam würde wahrscheinlich nicht zuschauen – wenn niemand einen Alarm auslöste, filmten die Kameras ziemlich selbsttätig und schickten die Bilder zur Aufzeichnung weiter. Trotzdem … als ich auf mein Auto zuging, küsste ich meine Handfläche und blies einen Kuss in Richtung der winzigen Linse, die jede meiner Bewegungen beobachtete, und formte mit den Lippen noch ein »Bis heute Abend«.
Mein Liebhaber machte sich auch Sorgen darum, wie gut ein Kojote mit den Wölfen spielen konnte. Dass er ein Alpha-Werwolf war, sorgte dafür, dass er in seiner Sorge ein wenig zu sensibel war – und da er der Chef einer großen Sicherheitsfirma war, die für verschiedene Regierungsbehörden arbeitete, hatte er Zugang zu einer Menge Werkzeug, um seine beschützerischen Instinkte auszuleben. Ich war wütend über die Kameras gewesen, nachdem er sie frisch installiert hatte, aber inzwischen fand ich sie beruhigend. Eine Kojotin passt sich an; so überlebt sie.
Phineas Brewster lebte im zweiten Stock eines neuen Wohnhauses mit Eigentumswohnungen in West Pasco. Es wirkte nicht wie der passende Wohnort für einen Sammler alter Bücher, aber vielleicht hatte er nach einem Arbeitstag genug von Staub, Schimmel und Moder und brauchte das zu Hause nicht auch noch.
Ich war schon auf halbem Weg zu dem Gebäude, bevor mir aufging, dass ich das Buch nicht mitgenommen hatte, als ich ausgestiegen war. Ich zögerte, entschied dann aber, es liegen zu lassen, wo es war – in ein Handtuch eingewickelt auf dem Rücksitz meines Golf. Das Handtuch sollte das Buch schützen – für den Fall, dass ich nicht alles Öl von meinen Händen abbekommen hatte –, aber es war auch eine gute Tarnung gegen Möchtegern-Diebe, auch wenn das hier nicht besonders wahrscheinlich war.
Ich ging also in den zweiten Stock und klopfte an die Tür mit der Nummer 3 B. Nachdem ich bis zehn gezählt hatte, klingelte ich. Nichts. Ich klingelte noch einmal, und die Tür von 3 A öffnete sich.
»Er ist nicht da«, meinte eine schroffe Stimme.
Ich drehte mich um und entdeckte einen dürren alten Mann. Er trug neue Jeans, ein Western-Hemd, alte Stiefel und eine Cowboy-Krawatte. Etwas – ich glaube, es waren die Stiefel – roch entfernt nach Pferden. Und dem Feenvolk.
»Ist er nicht?«
Offiziell sind alle Angehörige des Feenvolks geoutet, und das schon seit langer Zeit. Aber in Wahrheit haben die Grauen Lords sehr genau ausgesucht, von wem die Öffentlichkeit etwas erfahren hat und wer den Menschen vielleicht Angst einjagen würde – oder einfach nützlicher war, solange er sich noch als Mensch ausgab. Es gibt – zum Beispiel – ein paar Senatoren, die nicht geoutete Angehörige des Feenvolks sind. Nichts in der Verfassung erklärt es für illegal, dass jemand vom Feenvolk Senator ist, und die Grauen Lords wollen, dass es auch so bleibt.
Dieser Mann bemühte sich wirklich sehr, als Mensch durchzugehen; er würde es nicht zu schätzen wissen, wenn ich ihm klarmachte, dass ich ihn durchschaut hatte. Also behielt ich meine Entdeckung für mich.
Seine blassen Augen glitzerten, als er den Kopf schüttelte. »Nö, war den ganzen Tag nicht zu Hause.«
»Wissen Sie vielleicht, wo er ist?«
»Phin?« Der alte Mann lachte und zeigte dabei Zähne, die so weiß und gleichmäßig waren, dass sie falsch aussahen. Vielleicht waren sie es auch. »Also, nun. Er verbringt die meiste Zeit in seinem Laden. Manchmal auch die Nächte.«
»War er letzte Nacht hier?«, fragte ich.
Er schaute zu mir auf und grinste. »Nö. Der doch nicht. Vielleicht hat er irgendeine Bibliothek aufgekauft und bleibt so lange im Laden, bis er alles katalogisiert hat. Das tut er manchmal.« Phins Nachbar starrte in den Himmel, um die Zeit abzuschätzen. »Er geht dann nicht mehr an die Tür. Verkriecht sich in seinem Keller und kann nichts mehr hören. Am besten warten Sie und schauen morgen früh mal im Laden vorbei.«
Ich schaute auf die Uhr. Ich musste nach Hause und mich für mein Date mit Adam fertig machen.
»Wenn Sie etwas für ihn haben«, sagte der alte Mann, und seine Augen waren klar wie der Himmel, »können Sie es gerne bei mir lassen.«
Das Feenvolk lügt nicht. Ich hatte gedacht, dass sie nicht lügen können, aber das Buch, das ich mir geliehen hatte, machte ziemlich deutlich, dass dabei andere Faktoren eine Rolle spielen. Phins Nachbar hatte nicht gesagt, dass Phin im Laden arbeitete. Er hatte gesagt, dass es vielleicht so war. Meine Instinkte schrien ziemlich laut, und ich musste mich anstrengen, um weiter ungezwungen zu wirken.
»Ich wollte nur mal nach ihm schauen«, sagte ich, und das war auch die Wahrheit. »Sein Telefon ist ausgeschaltet, und ich habe mir Sorgen um ihn gemacht.« Dann wagte ich etwas. »Er hat bis jetzt keinen Nachbarn erwähnt – sind Sie neu eingezogen?«
Er sagte: »Vor nicht allzu langer Zeit«, dann wechselte er das Thema. »Vielleicht hat er sein Ladegerät vergessen. Haben Sie es schon im Laden versucht?«
»Ich habe nur eine Nummer von ihm«, erklärte ich dem Mann. »Ich glaube, das war sein Handy.«
»Wenn Sie Ihren Namen hinterlassen, dann erzähle ich ihm, dass Sie vorbeigeschaut haben.«
Ich ließ mein freundliches Lächeln noch breiter werden. »Kein Problem. Ich finde ihn schon selbst. Gut zu wissen, dass er Nachbarn hat, die auf ihn aufpassen.« Ich dankte ihm nicht – einem vom Feenvolk zu danken, hieß, dass sie das Gefühl hatten, man stünde in ihrer Schuld. Und in der Schuld des Feenvolks zu stehen ist ziemlich übel. Stattdessen winkte ich ihm nur vom Fuß der Treppe aus freundlich zu.
Er versuchte nicht, mich aufzuhalten, aber er beobachtete mich den gesamten Weg bis zu meinem Auto. Ich fuhr außer Sichtweite, dann hielt ich am Straßenrand an und rief Tad an.
»Hallo«, sagte seine Stimme. »Das ist mein Anrufbeantworter. Vielleicht lerne ich gerade; vielleicht habe ich aber auch nur Spaß. Hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Nummer, und ich rufe Sie vielleicht zurück.«
»Hey«, erklärte ich Tads Anrufbeantworter. »Hier ist Mercy. Phin war nicht zu Hause.« Ich zögerte. In der Sicherheit meines Autos hatte ich das Gefühl, dass ich in Bezug auf den Nachbarn vielleicht ein wenig überreagiert hatte. Je besser man das Feenvolk kennenlernt, umso angsteinflößender wird es. Aber wahrscheinlich war er harmlos. Oder war wirklich gefährlich – hatte aber nichts mit Phin zu tun.
Also sagte ich: »Habe Phins Nachbarn getroffen – der zum Feenvolk gehört. Er hat mir vorgeschlagen, im Laden anzurufen. Hast du die Nummer des Ladens? Hast du schon versucht, ihn dort zu erreichen? Ich werde weiter nach ihm Ausschau halten.«
Ich legte auf, legte den Gang ein und fuhr mit der festen Absicht los, nach Hause zu fahren. Aber irgendwie fand ich mich dann auf der Schnellstraße in Richtung Richland wieder statt Richtung Finley.
Phins mysteriöser Anruf bei Tad und der Verdacht, den ich in Bezug auf Phins Nachbarn hatte, machten mich nervös. Ich sagte mir selbst, dass es bis zu Phins Buchladen nicht weit war. Es würde nicht schaden, kurz vorbeizufahren. Tad hing auf der andere Seite des Landes fest, und er machte sich Sorgen.
Das Uptown ist ein Einkaufszentrum und Richlands älteste Shoppingmeile. Anders als die neueren, schickeren Nachfolger wirkte Uptown, als hätte jemand ein paar Dutzend Läden verschiedenster Art und Größe genommen, sie alle zusammengestopft und dann einen Parkplatz drum herum gebaut.
Hier findet man die Art von Läden, die in den größeren Einkaufzentren in Kennewick nicht florieren würden: Restaurants, die nicht zu einer Kette gehören, mehrere Antiquitätenläden (mit viel Müll im Angebot), ein paar Secondhandshops für Kleidung, einen Musikladen, einen Doughnut-Bäcker, eine oder zwei Bars und mehrere Läden, die man am besten mit dem Wort »ausgefallen« beschrieb.
Phins Buchladen lag am Südende vom Uptown. Die großen Fenster waren getönt, um die Bücher vor der Sonneneinstrahlung zu schützen. Goldene Lettern auf dem größten Fenster erklärten: Brewsters Bibliothek, gebrauchte Bücher und Sammlerstücke.
Ich konnte kein Licht hinter den Scheiben sehen, und die Tür war verschlossen. Ich legte mein Ohr ans Glas und lauschte.
In meiner menschlichen Form habe ich immer noch ein herausragendes Hörvermögen, nicht ganz so gut wie als Kojote, aber immer noch scharf genug, um festzustellen, dass sich im Laden nichts bewegte. Ich klopfte, aber niemand antwortete.
Rechts neben der Tür hing ein Schild mit den Öffnungszeiten im Fenster: Dienstag bis Samstag zehn Uhr bis sechs Uhr. Sonntag und Montag nur nach Vereinbarung. Die Telefonnummer darunter war die, die ich schon hatte. Sechs Uhr war schon vorbei.
Ich klopfte noch ein letztes Mal an die Tür, dann schaute ich wieder auf die Uhr. Wenn ich etwas zu schnell fuhr, dann hätte ich vielleicht noch zehn Minuten, bevor der Wolf vor meiner Tür stand.
Das Auto meines Mitbewohners stand in der Einfahrt und schien sich neben dem großen Wohnwagen von 1978, in dem ich lebte, richtig wohlzufühlen. Sehr teure Autos beeinflussen, wie echte Kunstwerke, die Umgebung um sich herum und formen sie. Einfach, in dem es da war, sorgte sein Auto dafür, dass mein Heim vornehm wirkte – egal, wie das Haus selbst aussah.
Samuel hatte dieselbe Gabe, nie fehl am Platz zu wirken, sich immer anzupassen, während er gleichzeitig das Gefühl vermittelte, er wäre jemand Besonderes, jemand Wichtiges. Instinktiv mochten ihn die Leute und vertrauten ihm. Das half ihm in seinem Beruf als Arzt, aber ich neigte zu der Ansicht, dass es ihm als Mann ein wenig zu sehr half. Er war zu sehr daran gewöhnt, das zu bekommen, was er wollte. Und wenn sein Charme es nicht rausriss, dann setzte er sein taktisches Denken ein, das selbst Rommel Ehre gemacht hätte.
Daher auch sein Leben als mein Mitbewohner.
Ich hatte eine Weile gebraucht, um mir darüber klarzuwerden, warum er wirklich bei mir eingezogen war: Samuel brauchte ein Rudel. Werwölfe schlugen sich allein nicht besonders gut, besonders nicht alte Wölfe. Und Samuel war ein sehr alter Wolf. Alt und dominant. In jedem Rudel außer dem seines Vaters wäre er der Alpha. Sein Vater war Bran, der Marrok, der größte Überwolf von allen.
Samuel war Arzt, und das war mehr als genug Verantwortung für ihn. Er wollte nicht Alpha sein; er wollte aber auch nicht im Rudel seines Vaters bleiben.
So lebte er als einsamer Wolf mit mir zusammen im Territorium des Columbia Basin Rudels, ohne Teil davon zu sein. Ich war kein Werwolf, aber ich war auch kein hilfloser Mensch. Ich war im Rudel seines Vaters aufgewachsen, und damit gehörte ich schon fast zur Familie. Bis jetzt hatten er und Adam, der Alpha des örtlichen Rudels – und mein Partner –, sich nicht gegenseitig umgebracht. Ich hoffte inständig, dass das auch weiterhin nicht passieren würde.
»Samuel?«, rief ich, als ich ins Haus eilte. »Samuel?«
Er antwortete nicht, aber ich konnte ihn riechen. Der charakteristische Geruch von Werwolf war zu stark, um nur ein Nachhall zu sein. Ich joggte den schmalen Flur entlang zu seinem Zimmer und klopfte leise an die geschlossene Tür.
Es sah ihm nicht ähnlich, mich nicht zu begrüßen, wenn ich nach Hause kam.
Ich machte mir so große Sorgen um Samuel, dass ich mir langsam schon paranoid vorkam. Etwas stimmte nicht mit ihm. Er war beschädigt, funktionierte aber noch – so sah ich es zumindest. Darunter lag eine Depression, die mit den Monaten weder besser noch schlimmer zu werden schien. Sein Vater vermutete schon, dass etwas nicht stimmte, und ich war mir ziemlich sicher, dass Samuel bei mir und nicht in seinem eigenen Haus in Montana lebte, weil er nicht wollte, dass sein Vater erfuhr, wie schlecht es ihm wirklich ging.
Samuel öffnete die Tür und sah aus wie immer, groß und langgliedrig: attraktiv, wie die meisten Werwölfe es sind, egal, welchen Knochenbau sie haben. Perfekte Gesundheit, dauerhafte Jugend und viele Muskeln sind so ziemlich die Patentformel für gutes Aussehen.
»Sie haben geläutet?«, fragte er in einer ausdruckslosen Imitation von Lurch, wobei seine Stimme tiefer war, als ich es je zuvor gehört hatte. Wir hatten uns gestern Abend im Fernsehen einen Addams-Family-Marathon angeschaut. Wenn er Witze machte, dann war alles in Ordnung. Selbst wenn er mir nicht direkt in die Augen sah, so als würde er sich Sorgen machen, was ich darin lesen könnte.
Eine schnurrende Medea lag auf einer seiner Schultern ausgestreckt. Meine kleine Manx-Katze schenkte mir aus halb zugekniffenen Augen einen glücklichen Blick, während er sie streichelte. Als seine Hand über ihren Rücken glitt, bohrte sie ihm die hinteren Krallen in die Schulter und streckte ihren schwanzlosen Hintern in die Luft.
»Au«, sagte er und versuchte, sie von sich zu lösen, aber sie hatte ihre Krallen durch sein altes Flanellhemd gegraben und hing fester an ihm als ein Klettverschluss – und wahrscheinlich um einiges schmerzhafter.
»Ähm«, meinte ich und bemühte mich, nicht zu lachen. »Adam und ich gehen heute Abend aus. Du musst also allein zu Abend essen. Ich habe es nicht in den Supermarkt geschafft, also ist nicht wirklich viel da.«
Er hatte mir den Rücken zugewandt und lehnte sich über das Bett, damit die Katze, wenn er sie denn lösen konnte, nicht so weit fallen würde.
»Okay«, sagte er. »Aua, Katze. Weißt du nicht, dass ich dich mit einem Bissen verschlingen könnte? Und bei dir würde mir nicht mal – aua – ein Schwanz aus dem Maul hängen.«
Ich überließ die beiden sich selbst und eilte in mein Zimmer. Mein Handy klingelte, noch bevor ich die Tür erreicht hatte.
»Mercy, er ist auf dem Weg, und ich habe Informationen für dich«, erklang die Stimme von Adams Teenager-Tochter an meinem Ohr.
»Hey, Jesse. Wo geht’s heute Abend hin?«
Als ich an Adam dachte, konnte ich seine Erwartung spüren, und auch das glatte Leder unter seiner Hand – weil Adam nicht nur mein Geliebter war; er war mein Gefährte.
In der Welt der Werwölfe bedeutete das für jedes verbundene Paar etwas anderes. Wir waren nicht nur durch Liebe aneinandergebunden, sondern auch durch Magie. Ich habe erfahren, dass manche gebundenen Paare kaum einen Unterschied merken … und andere fast an der Hüfte zusammenwachsen. Bah. Glücklicherweise waren Adam und ich irgendwo in der Mitte. Zumindest meistens.
Wir hatten die magische Schaltung zwischen uns überladen, als wir unsere Bindung zum ersten Mal besiegelt hatten. Seitdem war das Band zwischen uns eher launisch – für ein paar Stunden flackerte es, mal an, mal aus, dann verschwand es für Tage fast vollkommen. Beunruhigend. Ich ging davon aus, dass ich mich bereits an die Verbindung zu Adam gewöhnt hätte, wenn sie dauerhaft wäre. Adam hatte mir versichert, dass es so eigentlich sein sollte. So wie es war, hatte es die Tendenz, mich zu überrumpeln.
Ich fühlte, wie das Lenkrad unter Adams Händen vibrierte, als er den Wagen startete, dann war er verschwunden. Ich blieb in meiner Mechaniker-Kleidung zurück, mit seiner Tochter am Telefon.
»Bowling«, sagte sie.
»Danke, Mädel«, meinte ich. »Ich werde dir ein Eis mitbringen. Muss jetzt duschen.«
»Du schuldest mir fünf Dollar, aber ein Eis kann nicht schaden«, erklärte sie mir mit einer söldnerartigen Bestimmtheit, die ich respektieren konnte. »Und du solltest besser schnell duschen.«
Adam und ich hatten ein Spiel entwickelt. Für mich fühlte es sich an, als würde sein Wolf mit mir spielen: Ein einfaches Spiel ohne Verlierer war ein Wolfsspiel, etwas, das sie mit denen taten, die sie liebten. Es passierte nicht oft mit dem gesamten Rudel, aber in kleineren Gruppen schon.
Mein Gefährte sagte mir nicht, wo wir hingehen würden – so dass es an mir war, mit allen möglichen Mitteln seine Pläne auszuspionieren. Es war ein deutliches Zeichen seines Respekts, dass er davon ausging, dass ich Erfolg haben würde.
Heute Nacht hatte ich seine Tochter bestochen, mich anzurufen und mir alles zu erzählen, was sie wusste … Selbst wenn es nur eine Beschreibung seiner Kleidung beim Verlassen des Hauses war. Dann wäre ich passend angezogen – obwohl ich überrascht tun würde, dass wir so gut zueinanderpassten, wenn ich doch keine Ahnung hatte, wohin er gehen wollte.
Ein Flirt-Spiel, aber auch ein Spiel, das uns beide von den Gründen ablenkte, warum wir uns immer noch zu Verabredungen trafen statt als Gefährten zusammenzuleben. Seinem Rudel gefiel es nicht, dass seine Gefährtin eine Kojoten-Gestaltwandlerin war. Werwölfe sind noch schlechter als ihre normalen Wolfsverwandten, wenn es darum geht, ein Territorium mit anderen Raubtieren zu teilen. Aber sie hatten lange Zeit gehabt, um sich an den Gedanken zu gewöhnen, und überwiegend hatten sie sich damit abgefunden – bis Adam mich auch noch ins Rudel geholt hatte. Es hätte nicht möglich sein sollen. Ich hatte noch nie von einem Nicht-Werwolf gehört, der Teil des Rudels geworden war.
Ich legte Kleidung heraus und sprang unter die Dusche. Der Duschkopf hing niedrig, also war es kein größeres Problem, meine Zöpfe aus dem Wasserstrahl zu halten, während ich mir mit einem Bimsstein und Seife die Hände abrieb. Ich hatte sie schon gewaschen, aber jedes bisschen half. Eine Menge Dreck war schon eingezogen, und meine Hände würden niemals aussehen wie die eines Models.
Als ich in ein Handtuch gewickelt aus dem Bad kam, konnte ich Stimmen im Wohnzimmer hören. Samuel und Adam sprachen absichtlich so leise, dass ich ihre Worte nicht verstehen konnte, aber es klang nicht so, als gäbe es Spannungen. Sie mochten sich eigentlich ganz gern, aber Adam war der Alpha und Samuel ein einsamer Wolf, der dominanter war als er. Manchmal gab es Schwierigkeiten, wenn sie zusammen in einem Raum waren, aber anscheinend nicht heute Abend.
Ich streckte die Hand nach der Jeans aus, die ich aufs Bett gelegt hatte.
Bowling.
Ich zögerte. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Nicht den Bowling-Teil – ich war mir sicher, dass Adam gerne bowlte. Eine schwere Kugel auf eine Ansammlung hilfloser Kegel zu werfen und dann das folgende Chaos zu betrachten gehört zu der Art von Dingen, die Werwölfe mögen.
Was ich mir nicht vorstellen konnte, war, wie Adam Jesse verriet, dass er mich zum Bowling ausführen wollte. Wo er doch versuchte, es vor mir zu verstecken. Das letzte Mal hatte sie mir lediglich sagen können, welche Art von Kleidung er trug.
Vielleicht litt ich ja nur an Verfolgungswahn. Ich öffnete meinen Schrank und musterte die wenigen Kleidungsstücke darin. Ich hatte mehr Kleider als noch vor einem Jahr. Drei mehr.
Jesse hätte es bemerkt, wenn er sich rausgeputzt hätte.
Ich schaute aufs Bett zu meiner neuen Jeans und dem dunkelblauen T-Shirt, die nach mir riefen, weil sie so bequem waren. Bestechung funktioniert in zwei Richtungen – und Jesse hätte ihren Spaß daran, die Doppelagentin zu spielen.
Also zog ich ein fahlgraues Kleid hervor, schick genug, dass ich es zu den formellsten Anlässen tragen konnte, aber nicht so überkandidelt, dass es in einem Restaurant oder Kino übermäßig auffallen würde. Falls wir wirklich Bowlen gehen sollten, konnte ich auch in dem Kleid spielen. Ich zog es mir über den Kopf, löste schnell mein Zöpfe und kämmte mir die Haare.
»Mercy, bist du bald fertig?«, fragte Samuel, und in seiner Stimme klang ein Hauch Belustigung mit. »Hast du nicht was von einer heißen Verabredung gemunkelt?«
Ich öffnete die Tür und stellte fest, dass ich es nicht ganz richtig hinbekommen hatte. Adam trug einen Smoking.
Adam ist kleiner als Samuel, mit dem Körperbau eines Ringers und dem Gesicht eines … Ich weiß nicht. Es ist Adams Gesicht, und es ist schön genug, um die Leute von der Macht abzulenken, die er ausstrahlt. Sein Haar ist dunkel, und er trägt es kurz. Er hat mir einmal gesagt, es wäre deswegen, weil die Armeeangehörigen, mit denen er wegen seiner Security-Firma immer wieder zu tun hat, sich so eher mit ihm wohlfühlen. Aber nachdem ich ihn in den letzten paar Monaten besser kennengelernt hatte, glaubte ich inzwischen, dass sein Gesicht ihm peinlich war. Das kurze Haar sorgt dafür, dass er nicht eitel wirkt, sondern ausstrahlt: »Hier bin ich. Lassen Sie uns übers Geschäft reden.«
Ich würde ihn auch lieben, wenn er drei Augen und nur zwei Zähne hätte, aber manchmal trifft mich seine Schönheit einfach bis ins Mark. Ich blinzelte einmal, holte tief Luft und drängte das Verlangen zurück, ihn als mein zu beanspruchen, so dass ich wieder in den interaktiven Modus schalten konnte.
»Ah«, sagte ich und schnippte mit den Fingern. »Ich wusste doch, dass ich etwas vergessen habe.« Ich lief zu meinem Schrank zurück und schnappte mir ein glitzerndes silbernes Schultertuch, das mein graues Kleid angemessen aufwertete.
Ich kam gerade rechtzeitig zurück, um zu sehen, wie Samuel Adam einen Fünf-Dollar-Schein gab.
»Ich habe dir doch gesagt, dass sie dahinterkommt.«
»Gut«, erklärte ich ihm. »Damit kannst du Jesse bezahlen. Sie hat mir gesagt, wir würden bowlen gehen. Ich muss einen besseren Spion finden.«
Er grinste, und ich musste mich wirklich anstrengen, um weiter genervt zu schauen. Seltsamerweise war es nicht die Schönheit von Adam-mit-einem-Lächeln, die mich entzückte, wenn er grinste – obwohl es wirklich fantastisch aussah. Es war das Wissen, dass ich ihn zum Lächeln gebracht hatte. Adam neigt nicht zu … Verspieltheit, außer mit mir.
»Hey, Mercy«, sagte Samuel, als Adam die Eingangstür öffnete.
Ich drehte mich zu ihm um, und er küsste mich auf die Stirn.
»Sei glücklich.« Die seltsame Formulierung erregte meine Aufmerksamkeit, aber der Rest seiner Worte war nicht außergewöhnlich. »Ich habe die Rotaugen-Schicht. Wahrscheinlich werde ich dich nicht mehr sehen, wenn du zurückkommst.« Er schaute zu Adam und sah ihn so herausfordernd an, dass Adam die Augen zusammenkniff. »Kümmere dich um sie.« Dann schob er uns aus dem Haus und schloss die Tür, bevor Adam auf seinen Befehl beleidigt reagieren konnte.
Nach einem längeren Schweigen lachte Adam und schüttelte den Kopf. »Mach dir keine Sorgen«, sagte er, weil er wusste, dass der andere Wolf ihn auch durch die Tür hören konnte. »Mercy kümmert sich um sich selbst; ich muss nur hinterher das Chaos aufräumen.« Hätte ich ihn nicht beobachtet, wäre mir entgangen, dass er den Mund verzog. Als würde ihm das, was er gerade sagte, nicht besonders gut gefallen.
Plötzlich fühlte ich mich befangen. Ich mag, wer ich bin – aber es gibt viele Männer, die das anders sehen. Ich bin eine Automechanikerin. Adams erste Frau hatte nur aus sanften Kurven bestanden, bei mir waren es überwiegend Muskeln. Nicht besonders weiblich, das hatte zumindest meine Mutter oft beklagt. Und dann waren da noch die Eigenheiten, die als Nachwirkungen meiner Vergewaltigung auftraten.
Adam hielt mir die Hand entgegen, und ich legte meine hinein. Er war sehr gut darin geworden, mir Berührungen zu entlocken. Darin, mich nicht als Erster zu berühren.
Ich schaute auf unsere verschlungenen Hände, als wir die Terrassenstufen nach unten gingen. Ich hatte gedacht, dass ich besser wurde. Dass das unfreiwillige Zucken, die Angst, langsam nachließ. Mir ging auf, dass es vielleicht nur daran lag, dass er besser darin wurde, meine Ängste zu umgehen.
»Was ist los?«, fragte er, als wir neben seinem Truck anhielten.
Er war so neu, dass immer noch ein Aufkleber des Herstellers auf der Heckscheibe klebte. Er hatte seinen SUV ausgetauscht, nachdem einer seiner Wölfe den Kotflügel zerbeult hatte, während er mich verteidigt hatte – gefolgt von einem anderen Vorfall, als ein Schnee-Elf (echt riesiges Feenvolk-Wesen) bei der Jagd nach mir die Vorderhälfte eines Gebäudes daraufgeworfen hatte.
»Mercy …« Er starrte mich mit gerunzelter Stirn an. »Du schuldest mir nichts für den verdammten Truck.«
Er hielt immer noch meine Hand, und ich hatte noch Zeit, zu verstehen, dass unsere launenhafte Gefährtenverbindung ihm einen Einblick in meine Gedanken erlaubt hatte, bevor eine Vision mich in die Knie zwang.
Es war dunkel, und Adam saß in seinem Arbeitszimmer zu Hause an seinem Computer. Seine Augen brannten, seine Hände taten weh, und sein Rücken war steif, weil er so lange gearbeitet hatte.
Das Haus war still. Zu still. Keine Ehefrau, um einen vor der Welt zu beschützen. Es war lange her, dass er sie geliebt hatte – es ist gefährlich, jemanden zu lieben, der das Gefühl nicht erwidert. Er war zu lange Soldat gewesen, um sich absichtlich ohne guten Grund in Gefahr zu begeben. Sie liebte seinen Status, sein Geld und seine Macht. Sie hätte es noch mehr geliebt, wenn all das jemandem gehört hätte, der tat, was sie ihm sagte.
Er liebte sie nicht, aber er liebte es, sich um sie zu kümmern. Liebte es, ihr kleine Geschenke zu kaufen. Liebte die Vorstellung von ihr.
Sie zu verlieren war schlimm gewesen; seine Tochter zu verlieren war viel, viel schlimmer. Jesse verbreitete Fröhlichkeit und Lärm um sich herum, wo auch immer sie war – und ihre Abwesenheit war … schwierig. Sein Wolf war ruhelos. Eine Kreatur des Moments, sein Wolf. Er ließ sich nicht mit dem Wissen beruhigen, dass er Jesse im Sommer wiederhaben würde. Nicht, dass er daraus viel Trost ziehen konnte. Also versuchte er, sich in seiner Arbeit zu verlieren.
Jemand klopfte an die Hintertür.
Er schob den Stuhl zurück und musste kurz innehalten. Sein Wolf war wütend, dass jemand in seinen Zufluchtsort eindrang. Nicht einmal sein eigenes Rudel war in diesen Tagen mutig genug, um zu seinem Haus zu kommen.
Als er schließlich in die Küche stiefelte, hatte er sich mehr oder weniger unter Kontrolle. Er riss die Hintertür auf und erwartete, einen seiner Wölfe zu sehen. Aber es war Mercy.
Sie wirkte nicht fröhlich – aber das tat sie selten, wenn sie rüberkommen und mit ihm reden musste. Sie war taff und unabhängig und überhaupt nicht glücklich darüber, wenn er ihre Unabhängigkeit beeinträchtigte. Es war schon lange her, dass ihn jemand so herumkommandiert hatte wie sie es tat – und es gefiel ihm. Mehr als es einem Wolf gefallen sollte, der schon seit zwanzig Jahren Alpha war.
Sie roch nach verbranntem Motoröl, dem Jasminshampoo, das sie in diesem Monat verwendete, und nach Schokolade. Oder vielleicht kam dieser letzte Geruch auch von den Cookies auf dem Teller, den sie ihm entgegenhielt.
»Hier«, sagte sie steif. Und ihm ging auf, dass ihr Mund aus Schüchternheit so verkniffen wirkte. »Schokolade hilft mir gewöhnlich dabei, mein Gleichgewicht wiederzufinden, wenn das Leben mir in die Fresse getreten hat.«
Sie wartete nicht auf eine Antwort, sondern drehte sich einfach um und ging zu ihrem Haus zurück.
Er nahm die Cookies mit ins Arbeitszimmer. Nach ein paar Minuten aß er einen davon. Schokolade, dick und dunkel, breitete sich auf seiner Zunge aus, ihre Bitterkeit entschärft durch ein sündiges Maß an braunem Zucker und Vanille. Er hatte vergessen zu essen, und er hatte es nicht einmal bemerkt.
Aber es waren nicht die Schokolade oder das Essen, das dafür sorgte, dass er sich besser fühlte. Es war Mercys Freundlichkeit gegenüber jemandem, den sie als ihren Feind sah. Und in genau diesem Moment begriff er etwas. Sie würde ihn nie dafür lieben, was er für sie tun konnte.
Er aß noch einen Keks, bevor er aufstand, um sich Abendessen zu machen.
Adam schloss die Verbindung zwischen uns, bis sie nicht dicker war als ein Bindfaden.
»Es tut mir leid«, murmelte er an meinem Ohr. »Es tut mir so leid. Sch…« Er schluckte das Schimpfwort, bevor es ihm über die Lippen kam. Dann zog er mich näher an sich, und mir ging auf, dass wir im Kies der Einfahrt saßen, an den Truck gelehnt. Und der Kies war an nackter Haut wirklich kalt.
»Bist du in Ordnung?«, fragte er.
»Weißt du, was du mir gezeigt hast?«, fragte ich. Meine Stimme war rau.
»Ich dachte, es wäre ein Flashback«, antwortete er. Er war schon früher dabei gewesen, wenn ich unter Flashbacks gelitten hatte.
»Keiner von meinen«, erklärte ich ihm. »Einer von deinen.«
Er erstarrte. »War es schlimm?«
Er war in Vietnam gewesen; er war schon seit der Zeit vor meiner Geburt ein Werwolf – er hatte wahrscheinlich jede Menge schlimme Dinge gesehen.
»Es schien ein privater Moment zu sein, den zu sehen ich eigentlich kein Recht habe«, erklärte ich ihm ehrlich. »Aber es war nicht schlimm.«
Ich hatte ihn in dem Moment gesehen, in dem ich mehr geworden war als nur eine Aufgabe, die der Marrok ihm übertragen hatte.
Ich erinnerte mich daran, wie dumm ich mich gefühlt hatte, als ich da mit dem Teller Cookies auf der Veranda stand und sie einem Mann geben wollte, dessen Leben gerade in einer scheußlichen Scheidung in Flammen aufgegangen war. Er hatte nichts gesagt, als er die Tür geöffnet hatte – also war ich davon ausgegangen, dass er es ebenfalls dumm gefunden hatte. Ich war so schnell nach Hause zurückgegangen, wie es mir möglich war, ohne zu rennen.
Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass es geholfen hatte. Und auch nicht, dass er mich für taff hielt. Witzig, ich hatte immer gedacht, dass ich im Vergleich zu den Werwölfen schwach wirkte.
Also, was machte es schon, wenn ich immer noch zusammenzuckte, wenn er es mal vergaß und mir die Hand auf die Schulter legte? Mit der Zeit würde das nachlassen. Mir ging es bereits um einiges besser: Tägliche Flashbacks wegen der Vergewaltigung gehörten der Vergangenheit an. Wir würden das schon hinkriegen. Adam war bereit, gewisse Zugeständnisse für mich zu machen. Und unsere Verbindung machte diese Gummiband-Masche, die sie ab und zu abzog, und war plötzlich wieder voll da, so dass er Zugang zu meinen Gedanken hatte, als wäre mein Kopf aus Glas.
»Was auch immer du brauchst«, sagte er, während sein Körper plötzlich erstarrte. »Was auch immer ich tun kann.«
Ich entspannte meine Schultern und vergrub meine Nase an seinem Schlüsselbein, und nach einer Sekunde war die Entspannung auch real. »Ich liebe dich«, erklärte ich ihm. »Und wir müssen darüber reden, wie ich diesen Truck bezahlen soll.«
»Ich werde nicht …«
Ich schnitt ihm das Wort ab. Eigentlich wollte ich ihm einen Finger auf die Lippen legen oder etwas ähnlich Zärtliches. Aber als ich den Kopf als Reaktion auf seinen Widerspruch nach oben riss, rammte ich ihm meine Stirn gegen das Kinn. Wodurch ich ihn etwas effektiver zum Schweigen brachte als geplant, weil er sich in die Zunge biss.
Er lachte, während Blut über sein Hemd tropfte und ich mich brabbelnd tausendmal entschuldigte. Dann lehnte er mit einem Bums den Kopf gegen den Wagen.
»Lass gut sein, Mercy. Es wird bald von alleine aufhören.«
Ich zog mich zurück, bis ich neben ihm saß – und musste selbst schmunzeln, weil er Recht damit hatte, dass seine Verletzung in ein paar Minuten heilen würde, auch wenn es wahrscheinlich ziemlich wehgetan hatte. Es war nur eine kleine Verletzung, und er war ein Werwolf.
»Du wirst aufhören zu versuchen, den SUV zu bezahlen«, erklärte er mir.
»Der SUV war mein Fehler«, informierte ich ihn.
»Du hast keine Wand draufgeworfen«, sagte er. »Ich hätte dich vielleicht für die Dulle zahlen lassen …«
»Wag es nicht, mich anzulügen. Niemals«, schnaubte ich empört, und er lachte wieder.
»Okay. Hätte ich nicht. Aber es ist sowieso eine überflüssige Diskussion, weil nach der Wand gar nicht mehr zur Debatte stand, ob der Kotflügel gerichtet wird. Und für den Kontrollverlust des Schnee-Elfen waren hundertprozentig die Vampire verantwortlich …«
Ich hätte weiter mit ihm diskutieren können – normalerweise diskutiere ich gerne mit Adam. Aber es gibt Dinge, die ich noch lieber tue. Ich lehnte mich vor und küsste ihn.
Er schmeckte nach Blut und Adam – und er schien kein Problem damit zu haben, dem Stimmungswechsel von mildem Gezanke zu Leidenschaft zu folgen. Nach einer Weile – ich weiß nicht, wie lang – schaute Adam auf sein blutbeflecktes Hemd und lachte wieder. »Ich nehme an, jetzt können wir genauso gut bowlen gehen«, sagte er und zog mich auf die Beine.
Zuerst hielten wir aber an einem Steak-Haus und aßen zu Abend.
Er hatte das blutige Jackett und das Hemd im Wagen gelassen und sich ein einfaches blaues T-Shirt aus einer Tüte mit diversen Klamotten vom Rücksitz geschnappt. Dann hatte er mich gefragt, ob es seltsam aussah, dass er ein T-Shirt zu Anzughosen trug. Er konnte nicht sehen, wie das T-Shirt sich an die Muskeln seiner Schultern und des Rückens schmiegte. Ich versicherte ihm ehrlich – und ohne eine Miene zu verziehen –, dass es niemanden kümmern würde.
Es war Freitagabend, und das Restaurant war voll. Glücklicherweise wurden wir trotzdem schnell bedient.
Nachdem die Kellnerin unsere Bestellung aufgenommen hatte, sagte Adam ein wenig zu beiläufig: »Also, was hast du in deiner Vision gesehen?«
»Nichts Peinliches«, erklärte ich ihm. »Nur dieses eine Mal, als ich dir die Cookies gebracht habe.«
Seine Augen leuchteten auf. »Ach so«, sagte er, und seine Schultern entspannten sich, auch wenn er ein wenig rot wurde. »Daran hatte ich gerade gedacht.«
»Alles okay?«, fragte ich ihn. »Es tut mir leid, dass ich eingedrungen bin.«
Er schüttelte den Kopf. »Du musst dich nicht entschuldigen. Was auch immer du empfängst, du darfst es sehen.«
»Also«, meinte ich beiläufig, »du hattest dein erstes Mal unter einer Tribüne, hm?«
Er riss den Kopf hoch.
»Erwischt. Warren hat es mir erzählt.«
Er lächelte. »Kalt und nass und unbequem.«
Die Kellnerin klatschte unser Essen vor uns auf den Tisch und eilte wieder davon. Adam fütterte mich mit Stücken von seinem fast rohen Filet Mignon und ich gab ihm ein wenig von meinem Lachs. Das Essen war gut, die Gesellschaft noch besser, und wäre ich eine Katze gewesen, hätte ich geschnurrt.
»Du wirkst glücklich.« Er nippte an seiner Kaffeetasse und streckte ein Bein aus, so dass sein Fuß an meinem ruhte.
»Du machst mich glücklich«, erklärte ich ihm.
»Du könntest immer glücklich sein«, sagte er und aß den letzten Bissen seiner Ofenkartoffel, »und bei mir einziehen.«
Jeden Morgen neben ihm aufzuwachen … aber … »Nein. Ich habe dir schon genug Schwierigkeiten gemacht«, erklärte ich. »Das Rudel und ich müssen erst einen … Waffenstillstand ausarbeiten, bevor ich bei dir einziehe. Dein Haus ist die Höhle, das Herz des Rudels. Sie brauchen einen Ort, an dem sie sich sicher fühlen.«
»Sie können sich anpassen.«
»Sie passen sich so schnell an, wie es ihnen möglich ist«, hielt ich dagegen. »Erst kam Warren – hast du übrigens gehört, dass, nachdem du ihn aufgenommen hast, mehrere andere Rudel auch schwulen Wölfen den Beitritt erlaubt haben? Und jetzt ich. Ein Kojote in einem Werwolfrudel – du musst zugeben, dass das eine ziemliche Veränderung ist, mit der das Rudel umgehen muss.«
»Bevor du dich versiehst«, sagte er, »werden Frauen wählen dürfen und ein Schwarzer wird Präsident.« Er wirkte ernst, aber in seiner Stimme klang Humor mit.
»Siehst du?« Ich zeigte mit der Gabel auf ihn. »Sie hängen alle noch im neunzehnten Jahrhundert fest, und du erwartest, dass sie sich verändern. Samuel sagt gerne, dass Werwölfe mit ihrer ersten Verwandlung in den Wolf schon alle Veränderung haben, die sie ertragen können. Andere Arten von Veränderung kann man ihnen nur schwer aufzwingen.«
»Peter und Warren sind die Einzigen, die das neunzehnte Jahrhundert erlebt haben«, erklärte Adam mir. »Die meisten sind jünger als ich.«
Die Kellnerin kam vorbei und blinzelte ein wenig überrascht, als Adam drei Nachspeisen bestellte – Werwölfe brauchen eine Menge Nahrung, um bei Kräften zu bleiben. Ich schüttelte den Kopf, als sie mich ansah.
Als sie gegangen war, nahm ich das Gespräch wieder auf. »Es wird uns nicht wehtun, wenn wir noch ein paar Monate warten, bis alles sich ein wenig beruhigt hat.«
Wäre er nicht grundsätzlich meiner Meinung gewesen, würde ich bereits in seinem Haus schlafen, statt mich noch mit ihm zu verabreden. Er verstand genauso gut wie ich, dass es eine Menge Feindseligkeit ausgelöst hatte, dass er mich ins Rudel geholt hatte. Vielleicht wären die Dinge nicht so schlimm geworden, wenn es vorher ein gesundes, ausgeglichenes Rudel gewesen wäre.
Vor ein paar Jahren hatten ein paar aus dem Rudel angefangen, mich zu belästigen – einen Kojoten, der in ihrem Revier lebte. Werwölfe sind sehr territorial, wie ihre tierischen Verwandten in der Wildnis, und sie teilen ihre Jagdgründe nicht leichtfertig mit anderen Raubtieren. Also hatte Adam mich zu seiner Gefährtin gemacht, um das zu stoppen. Ich hatte zu dieser Zeit nicht gewusst, warum die Belästigungen so plötzlich aufhörten – und Adam hatte es auch nicht eilig gehabt, es mir zu erzählen. Aber die Rudelmagie verlangte, dass eine solche Erklärung eine Antwort erhielt, und Adam trug die Kosten, als das nicht geschah. Es ließ ihn schwächer und mürrischer zurück – weniger fähig seinem Rudel dabei zu helfen, ruhig, kühl und gesammelt zu bleiben. Dann hatte er mich fast gleichzeitig zu einem Mitglied des Rudels gemacht, während unsere Gefährtenbindung gebildet wurde – so dass sein Rudel keine Chance hatte, sicheren Boden unter die Füße zu bekommen, bevor es wieder in Treibsand stand
»Noch ein Monat«, sagte er schließlich. »Und dann werden sie – und auch Samuel – sich einfach dran gewöhnen müssen.« Der Ausdruck in seinen Augen war ernst, als er sich vorlehnte. »Und du wirst mich heiraten.«
Ich lächelte, so dass er meine Zähne sah. »Meinst du nicht: ›Willst du mich heiraten?‹«
Ich hatte es eigentlich als Witz gemeint, aber seine Augen wurden heller, bis goldene Flecken in der Dunkelheit schwammen. »Du hattest deine Chance, wegzulaufen, Kojote. Jetzt ist es zu spät.« Er lächelte. »Deine Mutter wird glücklich sein, dass sie ein wenig von dem Hochzeitszeug deiner Schwester verbrauchen kann, nachdem diese Feier nicht stattgefunden hat.«
Panik erfüllte mein Herz. »Du hast nicht mit ihr darüber geredet, oder?« Ich hatte Visionen von einer vollen Kirche, in der überall weißer Satin hing. Und Tauben. Meine Mutter hatte Tauben bei ihrer Hochzeit gehabt. Meine Schwester war durchgebrannt, um ihr zu entkommen. Meine Mutter ist wie eine Dampfwalze, und sie kann nicht besonders gut zuhören … niemandem.
Der Wolf verschwand aus seinen Augen, und er grinste. »Du hast kein Problem damit, einen Werwolf mit einer Tochter im Teenageralter und einem Rudel, das gerade in seine Einzelteile zerfällt, zu heiraten – aber beim Gedanken an deine Mutter bekommst du Panik?«
»Du kennst meine Mutter«, meinte ich. »Du solltest genauso Panik bekommen.«
Er lachte.
»Du warst ihr einfach noch nicht lang genug ausgesetzt.« Ihn zu warnen war nur fair.
Wir hatten Glück und bekamen einen Zähltisch für uns alleine, weil die Frauen, die auf der Bahn links neben uns gespielt hatten, gerade zusammenpackten, als wir unsere Kugeln aussuchten. Meine war leuchtend grün mit goldenen Streifen. Adams war schwarz.
»Du hast keine Fantasie«, sagte ich selbstgefällig. »Es hätte dir überhaupt nicht wehgetan, wenn du dir eine pinke Kugel ausgesucht hättest.«
»Alle pinken Kugeln hatten Löcher für Kinderfinger«, erklärte er mir. »Die schwarzen Kugeln sind die schwersten.«
Ich öffnete den Mund, aber er brachte mich mit einem Kuss zum Schweigen. »Nicht hier«, sagte er. »Schau neben uns.«
Wir wurden beobachtet – von einem ungefähr fünfjährigen Jungen und einem Kleinkind in einem rosafarbenen Kleid mit Rüschen.
Ich streckte die Nase hoch in die Luft. »Als würde ich Witze über deine Bälle machen. Wie kindisch.«
Er grinste mich an. »Ich habe mir schon gedacht, dass du so denken würdest.«
Ich setzte mich und spielte mit der Einstellung für die Spielernamen, bis ich zufrieden war.
»Fiel Ohne Rücksicht Durch«, sagte er trocken, als er mir über die Schulter schaute.
»Ich dachte, ich nehme unsere Automarken. Du fährst jetzt einen FORD. F-O-R-D.«
»Viel Waldmeister?«
»Wenige coole Worte fangen mit V oder W an«, gab ich zu.
Er lehnte sich über meine Schulter und änderte es in Vintage Wolf, dann flüsterte er mir ins Ohr: »Vorwitzig wunderbar. Meins.«
»Damit kann ich leben.« Und sein warmer Atem an meinem Ohr sorgte dafür, dass ich mich sogar sehr vorwitzig fühlte.
Bis Adam kam, hatte ich mich immer gefühlt wie seine schwarze Bowlingkugel – langweilig, aber nützlich. Ich bin nicht besonders gut aussehend, wenn man mal über die etwas exotische Hautfarbe hinwegsieht, die mir mein Blackfoot-Vater vererbt hat. Und Adam … die Leute drehen sich um, wenn Adam vorbeigeht. Selbst hier in der Bowlinganlage erregte er Aufsehen.
Titel der amerikanischen Originalausgabe SILVER BOURNE Deutsche Übersetzung von Vanessa Lamatsch
Deutsche Erstausgabe 02/2011 Redaktion: Charlotte Lungstrass
Copyright © 2010 by Hurog, Inc. Copyright © 2011 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld Karte: Andreas Hancock Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-641-10463-4
www.heyne-magische-bestseller.de
www.randomhouse.de
Leseprobe