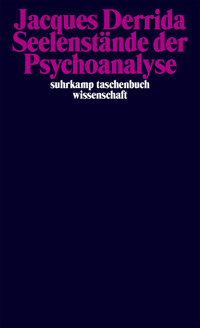
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In einer Lektüre Freud'scher Texte, die sich um den Begriff der »Grausamkeit« ranken, erkundet Derrida mögliche Antworten auf die Frage, worin die Krise der Psychoanalyse heute besteht. Ausgehend von der These, dass die Psychoanalyse der Name dessen sein könnte, was sich ohne jegliches Alibi dem Eigensten der psychischen Grausamkeit zuwendet, versucht Derrida die Möglichkeit zu denken, wie jenseits der Logik des Todestriebes Recht, Politik und vielleicht sogar eine Ethik begründet werden könnten, die der psychoanalytischen Revolution wie auch den Ereignissen Rechnung tragen, die einen grausamen Wandel der Grausamkeit darstellen – den technischen, wissenschaftlichen, juridischen, ökonomischen, ethischen und politischen Veränderungen unserer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
3Jacques Derrida
Seelenstände der Psychoanalyse
Das Unmögliche jenseits einer souveränen Grausamkeit
Vortrag vor denÉtats généraux de la Psychanalyseam 10. Juli 2000 im Grand Amphithéâtre der Sorbonne in Paris
Aus dem Französischen von Hans-Dieter Gondek
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel États d'âme de la psychanalyse bei Éditions Galilée, Paris
eBook Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2459
© der deutschsprachigen Ausgabe: 2002, Suhrkamp Verlag AG, BerlinDeutsche Erstausgabe: Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2002© der Originalausgabe: © Jacques Derrida Estate, vertreten durch Éditions du Seuil
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-78192-0
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Seelenstände der Psychoanalyse
Postskriptum
Ohne Alibi
Fußnoten
Informationen zum Buch
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
48
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
89
90
91
92
93
95
96
97
98
Seelenstände der Psychoanalyse
5
Seelenstände der Psychoanalyse
7
Eine erste Abschweifung, vertraulicher Art. Wenn ich in diesem Augenblick in Ihre Richtung, doch ohne identifizierbaren Empfänger sage: »Ja, ich leide grausam«, oder auch: »Man macht Sie oder man lässt Sie grausam leiden«, oder gar noch: »Sie machen sie oder lassen ihn grausam leiden«, ja sogar: »Ich mache mich oder lasse mich grausam leiden«, nun, dann lassen diese grammatikalischen oder semantischen Variationen, diese Differenzen zwischen leiden machen, leiden lassen, lassen … machen [laisser … faire] etc., diese Wechsel in der Person – es könnte davon noch weitere geben, im Singular oder im Plural, im Maskulinum oder im Femininum, »man«, »wir«, »ihr/Sie«, »er/sie«, »sie/sie« –, diese Übergänge zu reflexiveren Formen (»ich mache mich oder lasse mich grausam leiden«, »du machst dich oder lässt dich grausam leiden« etc.), diese sämtlichen möglichen Modifikationen ein Adverb unberührt, eine Invariante, die ein für alle Mal bezeichnend zu sein scheint für ein Leiden, nämlich die Grausamkeit: »grausam«.
Im Verlauf dieser Sätze und all dieser Adressen verändert sich »grausam«, unerschütterlich, nicht. Als ob wir den Sinn dieses Wortes verstünden. Uns auf dieses »als ob« verlassend, tun wir so, als ob wir uns darüber verständigen würden, was »grausam« heißt. Ob man das Wort cruauté nun an seine lateinische Heraufkunft verweist, das heißt an eine so notwendige Geschichte des vergossenen Blutes (cruor, crudus, crudelitas), der Bluttat und der Blutsbande, oder ob man es mit anderen Sprachen und anderen Se8mantiken (Grausamkeit[1] zum Beispiel ist das Freud’sche Wort) zusammenschließt, und zwar dieses Mal ohne Verbindung zum Blutvergießen, sondern vielmehr, um nun den Wunsch zu benennen, leiden zu machen oder sich leiden zu machen, um zu leiden, ja sogar zu quälen oder zu töten, sich damit zu töten oder zu quälen, dass man quält oder tötet, um dem Bösen um des Bösen willen [au mal pour le mal] eine psychische Lust abzugewinnen, ja um das radikale Böse zu genießen – in allen diesen Fällen wäre die Grausamkeit nur schwer zu bestimmen oder abzugrenzen. Nietzsche beispielsweise erkennt darin das hinterlistige Wesen des Lebens: Die Grausamkeit wäre ohne Ende [terme] und ohne ein Ende, das man ihr entgegensetzen könnte, sie wäre folglich ohne Zweck und ohne Gegenteil. Für Freud aber, der Nietzsche, wie immer, doch so nahe ist, wäre die Grausamkeit vielleicht ohne Ende, aber nicht ohne ein Ende, das man ihr entgegensetzen könnte, das heißt, sie wäre ohne Zweck, aber nicht ohne Gegenteil – und dies wird eine unserer Fragen sein. Man kann die blutige Grausamkeit (cruor, crudus, crudelitas) zum Versiegen bringen, man kann dem Mord mit blanker Waffe, mit der Guillotine, mit den klassischen oder modernen Theatern des blutigen Krieges ein Ende bereiten, doch nach Nietzsche oder Freud wird sich an deren Stelle stets eine psychische Grausamkeit setzen und neue Hilfsmittel dafür erfinden. Eine psychische Grausamkeit wäre gewiss immer noch eine Grausamkeit der psyche, ein Seelenzustand, also ein Zustand noch des 9Lebendigen, als Grausamkeit aber wäre sie nicht blutig. Könnte eine solche Grausamkeit, wenn es sie denn gibt, und sie eine im eigentlichen Sinne psychische wäre, einer der der Psychoanalyse eigensten Horizonte sein? Ja, könnte er, dieser Horizont, nicht sogar der Psychoanalyse vorbehalten sein, als die bodenlose Tiefe dessen, was sie allein zu behandeln sich vorgegeben hätte, der letzte Grund, von dem sie sich eines Tages als Figur abhob? Diese Reflexion über die psychische, das heißt blutlose oder nicht notwendig blutige Grausamkeit, über die in der Seele am Bösen gewonnene verschärfte Lust werde ich nicht dazu missbrauchen, um an eine jüdische Geschichte zu erinnern: an den Psychoanalytiker, der seine Wahl dieser therapeutischen Disziplin damit erklären würde, dass er den Anblick von Blut nicht ertragen könnte. Ich werde das nicht tun, und auch nicht, um die nunmehr kanonisch gewordene Auseinandersetzung um eine Verbindung zwischen der potentiellen Universalität der Psychoanalyse und der Geschichte der Judenheit oder des Judentums aufs Neue zu eröffnen. Stellen wir uns allein die Frage, ob, ja oder nein, das, was sich die Psychoanalyse nennt, nicht den einzigen Weg eröffnen würde, der, wenn nicht zu wissen, wenn noch nicht einmal zu denken, so doch zumindest zu befragen gäbe, was dieses fremde und vertraute Wort »Grausamkeit«, was die schlimmste Grausamkeit, das Leiden um des Leidens willen, das Leiden-machen, das Sich-leiden-machen oder -lassen um, wenn man das so noch sagen kann, der Lust am Leiden willen bedeuten könnte. Und auch wenn die Psychoanalyse allein es uns noch nicht zu wissen, zu denken und zu behandeln gäbe, und ich neige dazu, das 10zu glauben, so könnte man doch zumindest nicht mehr beabsichtigen, es ohne sie zu tun. Hypothese über eine Hypothese: Wenn es denn etwas Irreduzibles gibt im Leben des lebendigen Seins, in der Seele, in der Psyche (denn ich begrenze das, was ich sage, nicht auf dieses lebendige Sein, das man den Menschen nennt, und lasse folglich die ungeheure und furchtbare, in meinen Augen offene Frage nach dem Tiersein im Allgemeinen sowie die Frage, ob die Psychoanalyse durch und durch eine Anthropologie ist oder nicht, in der Schwebe), und wenn diese irreduzible Sache im Leben des beseelten Seins eben die Möglichkeit der Grausamkeit ist (der Trieb, wenn Sie so wollen, zu einem Bösen um des Bösen willen, zu einem Leiden, das sein Spiel damit treiben würde, das Leiden eines Leidenmachens oder eines Sich-leiden-machens um der Lust willen zu genießen), dann könnte kein anderer – theologischer, metaphysischer, genetischer, physikalistischer, kognitivistischer etc. – Diskurs sich dieser Hypothese öffnen. Sie wären alle dazu geschaffen, sie zu reduzieren, sie auszuschließen, ihr jeglichen Sinn zu nehmen. Der einzige Diskurs, der heute auf die Sache der psychischen Grausamkeit als seine eigene Angelegenheit Anspruch erheben könnte, wäre genau dieses, was sich seit ungefähr einem Jahrhundert die Psychoanalyse nennt. Die Psychoanalyse wäre vielleicht nicht die einzige mögliche Sprache noch gar die einzige mögliche Behandlung, was diese Grausamkeit angeht, die kein Ende in einem Gegenteil oder kein Ende schlechthin hätte. Jedoch wäre »Psychoanalyse« der Name für das, was sich ohne ein theologisches oder ein anderes Alibi dem zuwenden würde, was der psychischen Grausamkeit ihr 11Eigenstes wäre. Die Psychoanalyse wäre für mich, wenn Sie mir diese weitere Vertraulichkeit gestatten, der andere Name für »ohne Alibi«. Das Geständnis eines »ohne Alibi«. Wenn es denn möglich wäre. Ohne dieses jedenfalls könnte man so etwas wie eine psychische Grausamkeit, also etwas spezifisch Psychisches, und so etwas wie den bloßen Selbstbezug dieser Grausamkeit vor jedem Wissen, vor jeder Theorie und jeder Praxis und selbst vor jeder Therapeutik nicht mehr ernsthaft ins Auge fassen. Überall, wo eine Frage des Leidens um des Leidens willen, des Bösens um des Bösen willen Tuns oder Tunlassens, alles in allem überall, wo die Frage des radikalen Bösen oder eines Bösen schlimmer als das radikale Böse nicht mehr der Religion oder der Metaphysik überlassen wäre, dürfte kein anderes Wissen bereit sein, sich für so etwas wie die Grausamkeit zu interessieren – außer diesem, das sich die Psychoanalyse nennt, deren von nun an mit dem Bösen assoziierter Name seinerseits umso mehr unentzifferbarer würde denn je, als allein eine psychoanalytische Revolution bereits in ihrem Vorhaben imstande wäre, der Syntax, den Konjugationen, den Reflexionen und den grammatikalischen Personen gerecht zu werden, die ich entfaltete, um anzufangen: es zu genießen, leiden zu machen oder leiden zu lassen, sich leiden zu machen oder sich leiden zu lassen, sich selbst, den Anderen als Anderen, den Anderen und die Anderen an sich, mich, dich, ihn, sie, euch, uns, sie, Männer oder Frauen etc. Sie gestatten mir, dass ich, was diese Grausamkeit betrifft, auf Beispiele verzichte, denn dies wären in unseren Zeiten die unerhörtesten und erfindungsreichsten, die unerträglichsten und unverzeihlichsten.
12Nach dieser gedanklichen Abschweifung werde ich das letzte Wort einer letzten Frage noch in der Schwebe lassen.
Diese Frage wird nicht sein: Gibt es den Todestrieb, das heißt, und Freud verknüpft sie regelmäßig, einen grausamen Destruktions- oder Vernichtungstrieb? Oder noch anders: Gibt es außerdem eine jenseits oder diesseits der Prinzipien – zum Beispiel der Prinzipien von Lust oder Realität – mit dem Bemächtigungstrieb [pulsion de pouvoir ou de maîtrise souveraine] untrennbar verbundene Grausamkeit? Meine Frage wird vielmehr und später sein: Gibt es für das Denken, für das künftige psychoanalytische Denken ein anderes Jenseits, wenn ich das so sagen kann, ein Jenseits, das sich jenseits dieser Möglichen hält, welche noch immer sowohl die Prinzipien von Lust und Realität als auch die Triebe von Tod oder Bemächtigung sind, die scheinbar überall da zur Ausübung kommen, wo Grausamkeit offen an den Tag tritt? Mit anderen, ganz anderen Worten: Lässt sich diese augenscheinlich unmögliche, aber anders unmögliche Sache denken, ein Jenseits nämlich des Todes- oder Bemächtigungstriebes, das Jenseits also einer Grausamkeit, ein Jenseits, das weder mit den Trieben noch mit den Prinzipien etwas zu tun hätte? Also weder etwas mit dem ganzen Rest des Freud’schen Diskurses, der sich mit seiner Ökonomie, seiner Topik, seiner Metapsychologie und vor allem mit dem danach richtet, was Freud, wir werden es hören, auch als seine »Mythologie« der Triebe bezeichnet? Im Übrigen kommt er, wenn er von seiner »Mythologie« der Triebe spricht, sofort auf die Hypothese einer ebenfalls »mythologischen« Beschaffenheit des härtesten, positivsten wis13senschaftlichen Wissens, der Einstein’schen theoretischen Physik zum Beispiel, zu sprechen. Ist für dieses Jenseits des Jenseits eine entscheidbare Antwort möglich? Was ich die Seelenstände der Psychoanalyse heute nennen werde, genau das zeugt vielleicht in dieser Hinsicht letztlich von einer gewissen Erfahrung des Unentscheidbaren. Von einem Gottesurteil des Unentscheidbaren.
Eben indem ich das Jenseits des Jenseits des Lustprinzips, das Jenseits des Todestriebes, das Jenseits des Bemächtigungstriebes, also das auf andere Weise Unmögliche, das unmögliche Andere oder das andere Unmögliche [l’autre impossible] benenne, möchte ich die États généraux de la Psychanalyse, die Generalstände der Psychoanalyse, grüßen.
Um was für einen Gruß kann es sich für den, der die Generalstände der Psychoanalyse würdig begrüßen möchte, dabei handeln? Gibt es einen Gruß[2] für die Psychoanalyse?
Wozu soll man den Generalständen der Psychoanalyse Dank sagen? Und wie dankt man den Freunden Psychoanalytikern, die allem Anschein nach die historische Initiative dazu hatten?
Ich werde später versuchen, die meinen Gruß betreffenden Überlegungen darzulegen. Doch bevor ich beginne, einmal vorausgesetzt, ich beginne je, muss ich schließlich und im Hinblick auf die gerade in der Schwebe gelassene Angelegenheit des Unmöglichen zwei Gattungsnamen auswählen. Sie haben gerade schon an die Tür gepocht oder einfach nur gepocht, wir antworten 14





























