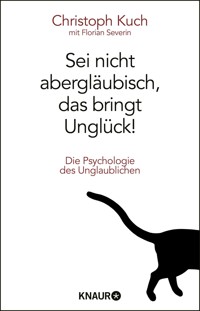
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wieso spielen Millionen vernunftbegabter Menschen Lotto? Warum lesen wir Horoskope, auch wenn wir nicht daran glauben? Christoph Kuchs magische Tricks beruhen auf psychologischen Erkenntnissen. Seit Jahren beschäftigt er sich damit, warum wir so oft irrationalen Denkmustern erliegen oder Dinge tun, die eigentlich unlogisch sind. Christoph Kuch entführt uns auf eine Reise durch die Welt der Alltagspsychologie – mit verblüffenden Einsichten. Er ist regelmäßig in Talkshows zu Gast und die Presse schreibt begeistert über ihn.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Christoph Kuch / Florian Severin
Sei nicht abergläubisch, das bringt Unglück
Die Psychologie des Unglaublichen
Knaur e-books
Über dieses Buch
Wieso spielen Millionen vernunftbegabter Menschen Lotto? Warum lesen wir Horoskope, auch wenn wir nicht dran glauben? Spielerisch zeigt Christoph Kuch, Weltmeister in Mentalmagie, auf, wie sehr unser Denken von Magie geprägt wird. Unterhaltsam und witzig erklärt er die Psychologie des menschlichen Geistes und sein Bedürfnis nach dem Unerklärlichen. Und natürlich verrät der »beste Mentalmagier der Welt« (Welt am Sonntag) auch, ob er Ihre Lottozahlen voraussagen kann.
Inhaltsübersicht
Vorwort
»I can read your mind.«
The Alan Parsons Project – Eye in the Sky
Tiefe Verbeugung, der Vorhang schließt sich. Ich stehe dahinter, atme durch, genieße den Moment, verlasse die Bühne und begebe mich in meine Garderobe.
Die Gäste meines Abends beginnen zu murmeln, Gläser werden mit zunehmender Frequenz zum Mund geführt, Stühle knarzend bewegt, Autos gestartet, während sich an diesem verschneiten Novembertag die ersten Zuschauer auf den Weg nach Hause machen, um ihre Babysitter abzulösen. Andere, so wird mir häufig berichtet, werden sich schlaflos in ihrem Bett wälzen, über das Geschehene grübeln und sich fragen, wo die Grenze zwischen Psychologie und Zauberei verläuft und ob Gedankenlesen eventuell doch möglich sei.
Und plötzlich, Stille.
Ich trete aus meiner Garderobe vor die Bühne. Hier, wo gerade noch Menschen gelacht und gestaunt haben, herrscht nun gähnende Leere. Ich verstaue meine Requisiten in meinem Auto. Genau in diesem Moment freue ich mich immer, Gedankenleser zu sein und nicht als Großillusionist mit einem Truck voll sperriger Kisten und schwebender Jungfrauen durch die Lande reisen zu müssen. Ich setze mich ins Auto, starte den Motor. Es beginnt zu schneien. Es ist schon eine eigenartige Welt, eine Scheinwelt, mein Beruf, meine Leidenschaft … und morgen darf ich den neuen Schreibtisch für meine Tochter aufbauen. La vita è bella.
Die »Welt am Sonntag« schrieb einmal über mich: »Dabei wirkt der hochgewachsene Kuch mit seinem vollen braunen Haarschopf und dem treuen Hundeblick wahrlich nicht wie ein mystischer Merlin.«[1]
Nun, das ist nicht nur eine Wirkung, das ist die Realität.
Ja, ich bin ein ganz normaler Typ, verheiratet, Vater von zwei Kindern. Einzig das, was ich vorwiegend auf großen Bühnen präsentiere, ist nicht alltäglich.
Schon in meiner frühesten Kindheit hat mich das Zaubervirus befallen. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, als Fünfjähriger »Stars in der Manege« gesehen zu haben. Es war 1980, und Rainer Werner Fassbinder ließ Hanna Schygulla schweben. Ich musste wissen, wie das funktionierte. Leider hatte ich bisher nie wieder die Möglichkeit, ein Video dieses Auftritts zu sehen, so dass ich heute nicht einmal mehr weiß, was genau mich an dieser Nummer so faszinierte. Zu Weihnachten bekam ich dann »Hardys Zauberkasten« geschenkt, und von da an wurde geübt. Zumindest so lange, bis alle Familienmitglieder samt Dackel herausgefunden hatten, wie die Tricks funktionierten.
Ich brauchte neues Material, mit dem ich alle verblüffen konnte und bei dem selbst mein kritischer großer Bruder Matthias keine Ahnung hatte, wie der kleine Christoph diese Wunder vollbrachte.
Glücklicherweise entdeckte ich Mitte der achtziger Jahre den »Nürnberger Zauberladen«, ein Kleinod voller Masken, Kostüme, Scherzartikel und Zaubertricks am Burgberg in der Altstadt. Häufig fuhr ich direkt nach der Schule hin und ließ mir mit großen Augen und offenem Mund die neuesten Kunststücke zeigen. Wenn der Herr hinter der Theke mich täuschen konnte, dann würde mir das mit Freunden und Familie auch gelingen. So trug ich mein gesamtes Taschengeld dorthin und kaufte viele unnütze Dinge. Eines davon ist mir erst kürzlich wieder in die Hand gefallen: ein Verschwindenetz für Tauben, das ich für immerhin einhundertneununddreißig Mark erstand. Dabei wollte ich nie, wirklich nie, nie, niemals in meinem Leben mit Tauben zaubern. Hinzu kommt, dass das Netz lila war. Absolut hässlich und unnatürlich. Was mich dazu bewegte, dieses, für meine damaligen Verhältnisse, Vermögen auszugeben, bleibt mir bis heute unklar.
So versetze ich mich immer noch gelegentlich selbst in Erstaunen, was für einen Zauberkünstler eine Seltenheit ist. Beschäftigt man sich intensiv mit der Zauberei und liest Bücher, sieht Videos (damals waren kleine silberne Scheiben noch ausschließlich zum Hören von Musik gedacht), geht der wundervollste Teil der Illusion, die Verblüffung, verloren. So bedaure ich sehr, dass ich dieses faszinierende Gefühl, keine Ahnung zu haben, wie ein Trick funktioniert, nur noch sehr selten verspüre. Dafür habe ich die Freude gewonnen, Menschen bei meinen Auftritten zu erstaunen und sie verblüfft oder gar fassungslos zu sehen. Deshalb mein von Herzen kommender Tipp: Versuchen Sie nicht, hinter die Magie zu kommen. Natürlich ist es menschlich, die Geheimnisse eines Zauberkunststücks erfahren zu wollen. Machen Sie sich aber bewusst, dass Sie sich mit jedem erworbenen Wissen, wie etwas funktioniert, ein Stück der Illusion, des kindlichen Denkens berauben.
Stellen Sie sich vor, an Ihrem Fenster flöge soeben ein Elefant vorbei. Was würden Sie denken? Ein Kind würde sagen: »Ui, schau mal, toll, da schwebt ein Elefant vorbei!« Ein Erwachsener hingegen: »Ui, wodurch kann denn dieser Elefant fliegen?«
Je älter wir werden, umso mehr verschwindet die Fähigkeit, Dinge einfach geschehen zu lassen und diese zu genießen.
Bevor ich mich das erste Mal auf die Bühne traute, gingen noch einige Jahre ins Land. Erst dann begriff ich, dass es auch andere Menschen faszinieren würde, was ich mache.
»Wenn ich erwachsen bin, möchte ich gerne Zauberkünstler werden.«
»Mein Sohn, beides zusammen geht nicht.«
Ich beruhigte meine Eltern und ließ sie in dem Glauben, dass ich meine Leidenschaft nie zum Beruf machen würde. Sorry, Mama, zu spät.
Im Alter von sechzehn Jahren lernte ich meinen »Zaubermeister« Werner Fleischer kennen. Er war damals Dozent an der Volkshochschule in Nürnberg und referierte über Zauberkunst. Als er sah, wie ich eine Münze aus der Hand verschwinden ließ, meinte er, ich hätte Talent und dass er mich gerne fördern würde. Danach hatte ich drei Jahre lang Privatunterricht bei ihm. Er war es, der mir vermittelte, dass für uns Zauberkünstler die Tricks nur Mittel zum Zweck sein dürften. Was wirklich zähle, sei, Menschen zu unterhalten. Die »Präsentation« sei wichtig. Zauberei lebe von der Leidenschaft. Gut könne man nur werden, wenn man etwas liebe, lebe, denke und fühle.
Die meisten Menschen haben einen Zauberer noch nie live gesehen. Die wenigsten gar einen Mentalisten. Ganz nah dran zu sein oder Teil eines Gedankenexperimentes zu werden fasziniert den Zuschauer. Ein schönes Kompliment bekam ich bei meinem Auftritt im Sat.1-Frühstücksfernsehen von der Moderatorin Karen Heinrichs, die mir backstage sagte, sie fände meine Kunst absolut faszinierend, da dies »Zauberei für Erwachsene« sei.[2]
Denke ich an meine ersten Auftritte zurück, so waren diese von extremem Lampenfieber und versehentlich zu Boden fallenden Requisiten geprägt. Jedoch ließ ich mich nicht entmutigen, blieb auf der Bühne und finanzierte mir damit sogar mein Studium. Betriebswirtschaftslehre. Oh, ja. Der ausgefallene Studiengang mit den aufregenden und abwechslungsreichen beruflichen Möglichkeiten.
Spätestens mit Beginn des Studiums verstärkte sich auch mein Interesse am menschlichen Geist. Weniger jedoch, um die Studienkollegen zu verstehen, die bereits die Vorlesungen des ersten Semesters im Anzug besuchten, als vielmehr aufgrund eines meiner Schwerpunktfächer: Wirtschaftspsychologie. Faszinierend fand ich dabei insbesondere die sozialen Teilbereiche wie Arbeits- und Führungspsychologie.
Immer häufiger ertappte ich mich, den Transfer zu vollziehen, wie ich mir das erworbene Wissen während einer Zaubershow zunutze machen könnte. Warum agieren Menschen so, wie sie es tun? Warum handeln sie immer nach gleichen Mustern? Ist es möglich, Menschen zu manipulieren, sie dazu zu bewegen, Dinge zu tun, von denen sie selbst nicht einmal vermuteten, dass sie sie tun würden? Ich verbrachte viel Zeit in der Bibliothek, las Bücher und Essays und fand eine weitere Leidenschaft – verrückte Experimente:
Warum Kinder, die ihre Schokolade nicht sofort essen, später Erfolg im Beruf haben.
Warum Menschen bereit sind, viel Geld auszugeben, wenn sie vorher eine wertlose CD geschenkt bekommen haben.
Wie man mit Gedanken töten kann.
Warum Tauben abergläubisch sind.
Warum das Tragen einer Uniform auch Deppen zu Macht verhilft.
Immer häufiger baute ich Themen der Psychologie in meine Zaubershows ein. Letztendlich entschied ich mich, meinen Auftritten einen komplett mentalmagischen Rahmen zu geben. Ich liebe die Zauberei, ich liebe gute magische Präsentationen, und ich liebe Karten, Münzen, Kisten. Aber ich will sie nicht länger vorführen. Mich begeistert die Psychologie. Diese Faszination überträgt sich auf mein Publikum. Das, was ich mache, kommt aus meinem Innersten, das bin ich, und das spüren die Zuschauer. Denn meiner Meinung nach schafft man Glaubwürdigkeit nur durch Authentizität.
Die nächsten Jahre feilte ich an meiner Show, an meinen Präsentationen und Texten, experimentierte mit neuen Ideen und Tricktechniken. Im Jahr 2012 erfüllte ich mir einen Kindheitstraum und trat bei der Weltmeisterschaft der Zauberkunst an, der Olympiade für Magier. Mit der punkthöchsten Darbietung gewann ich in der Sparte Mentalmagie.
Meine Begeisterung für Psychologie hatte sich ausgezahlt.
In diesem Buch finden Sie meine Lieblingsexperimente und die unglaublichen Erkenntnisse, die sich daraus für uns Menschen ergeben. Ein faszinierender Einblick in den menschlichen Verstand.
Nach meinen Shows kommen immer wieder Zuschauer auf mich zu und stellen mir Fragen.
Auf den folgenden Seiten beantworte ich die interessantesten.
Kapitel 1
»Können Sie die Lottozahlen vorhersagen?«
»Oh, oh, people of the earth,
Listen to the warning, the seer he said.«
Queen – The Prophet’s Song
Nach meinem Auftritt kommt der Veranstalter, der mich gebucht hat, zu mir und nimmt mich zur Seite. Er blickt schnell nach links und rechts, um sicherzugehen, dass uns keiner belauscht. Dann flüstert er mir zu, ob ich ihm die Lottozahlen von nächster Woche verraten könne.
Möchte er mir damit durch die Blume sagen, dass meine Gagenforderung zu hoch ist?
Nein, er hofft einfach, dass ich ihm zu schnellem Reichtum verhelfe. Wo sind nur die alten Tugenden hin? Zählen denn harte Arbeit, Sparsamkeit und reiche Eltern nichts mehr? Am Blick des Mannes erkenne ich, dass er nicht lockerlassen wird. Deshalb schreibe ich sie ihm auf: 4–19–26–28–33–40. Und als Zusatzzahl die 9.
Das sind sie.
»Allerdings«, gebe ich zu bedenken, »weiß ich nicht genau, in welcher Woche die Zahlen gezogen werden. Aber ich weiß, dass sie gezogen werden.«
Mit dieser Aussage befinde ich mich in guter Gesellschaft. Wer als Prophet etwas taugen will, muss seine Aussagen vage halten. Nostradamus, die Galionsfigur aller Weissager, hat es vorgemacht.
Michel de Nostredame, wie sein vollständiger Name lautet, lebte im 16. Jahrhundert in Frankreich. Das finstere Mittelalter war zwar schon vorbei, aber viel los war trotzdem nicht. Die Französische Revolution sollte noch über zweihundert Jahre auf sich warten lassen, so dass sich Michel nicht einmal mit einer gepflegten Enthauptung die Zeit vertreiben konnte. Deshalb fing er an, Jahrbücher zu schreiben. Aber nicht irgendwelche Jahrbücher, sondern solche, in denen er die Zukunft beschrieb. Sozusagen die »Gala« von übermorgen. Er war dabei ungeheuer fleißig. Seine Weissagungswälzer enthalten insgesamt über sechstausend Vorhersagen und decken die Zeit bis zum Jahr 3797 ab[3] – womit er lässig und ganz nebenbei gewusst hat, dass der Maya-Kalender mit dem Verfallsdatum der Menschheit danebenliegt.
Anno Domini 3797 übrigens deshalb, weil sein Buddy Richard Roussat aus Lyon kurze Zeit vorher dieses Jahr als das Ende der Welt festgelegt hatte.[4] Unter Propheten fällt man sich gegenseitig nicht in den Rücken. Außer natürlich diesen Kalender-Indianern aus Mexiko, aber vermutlich sind denen einfach nur die Steintafeln für die weiteren Jahre ausgegangen.
Eine der ersten Prophezeiungen, mit denen Nostradamus ins Schwarze traf, war die Beschreibung, wie König Heinrich II. von Frankreich zu Tode kommen sollte. Wie für Nostradamus üblich, ist sie als fescher Vierzeiler gehalten:
»Der junge Löwe wird über den alten siegen.
In einem einzigen Duell auf dem Schlachtfeld,
Wird er seine Augen stechen im goldenen Käfig.
Zwei Dinge werden eins, dann stirbt er den grausamen Tod.«
Heinrich II. starb im Jahre 1559 bei einem Turnier. Die Lanze seines Gegners, des Grafen Gabriel de Lorges von Montgomery, durchbrach das Visier des Königs, und ein Splitter verwundete diesen derart, dass er zehn Tage später seinen Verletzungen erlag.
Die Vorhersage scheint recht behalten zu haben: Beide Reiter führten als Wappen einen Löwen. Der Graf war jünger als der König. Heinrich trug einen goldenen Helm – den goldenen Käfig –, und der Splitter der Lanze durchbohrte sein Auge.
Volltreffer! (Ich hoffe, Sie vergeben mir den Ausdruck in diesem Zusammenhang.)
Ähnliche Treffsicherheit bewies Neil Marshall, Student der Brock University in Kanada. Mit drei Jahren Vorsprung sagte er den Anschlag vom 11. September 2001 vorher:
»In der City of God wird ein großer Donner herrschen.
Zwei Brüder werden von Chaos auseinandergerissen.
Während die Festung Leid erträgt,
Wird ein großer Führer unterliegen.«
Die »zwei von Chaos auseinandergerissenen Brüder« sind natürlich die Twin Towers des World Trade Centers. Und in der von Gott geliebten Stadt, die der rechtschaffenen Bürger, also New York City, herrschte an dem Tag ein Lärm, der sogar lauter war als aller Donner zusammen. In dem Vierzeiler ist sogar der Angriff auf das Pentagon als »leidtragende Festung« erwähnt.
Doch wer ist der große Führer, der unterliegt?
Da spalten sich die Meinungen. Die einen sagen, dass es Amerika sei, das den Anschlag nicht verhindern konnte. Die anderen sehen es eher so, dass damit die Ergreifung von Osama bin Laden vorweggenommen werde.
Das klingt etwas ungenau. Was denn jetzt? Soll der Angegriffene oder der Angreifer gemeint sein?
Hätte Marshall seine Vorhersage nicht etwas präziser formulieren können?
Nein, denn so funktionieren klassische Vorhersagen. Sie sind möglichst schwammig gehalten, so dass sie früher oder später auf irgendein Ereignis zutreffen. Auch Nostradamus’ Weissagungen bestehen aus zahlreichen Metaphern, verfasst in einem sprachlichen Mischmasch aus Französisch, Latein und Spanisch,[5] die jede Menge Raum für wilde Spekulationen lassen.
Genau das wollte Neil Marshall mit seiner »Prophezeiung« belegen. In dem Essay, in dem er diese vier Zeilen »vorhersagt«, führt er direkt im Anschluss verschiedene Interpretationsmöglichkeiten an,[6] um zu zeigen, wie beliebig jede Weissagung ausgelegt werden könne. Er schreibt, dass der Donner nicht nur ein Gewitter, sondern auch ein Erdbeben sein könne. Für die »City of God« gibt er als Beispiel direkt fünf zutreffende Städte an: Mekka, Medina, Rom, Jerusalem oder Salt Lake City.
Auf diese Weise ließen sich seine vier Zeilen leicht auf eine Vielzahl von Ereignissen zurechtbiegen. »Zurechtbiegen« ist sehr zutreffend, denn wenn mal etwas nicht passt, dann wird es halt passend gemacht. New York als die Stadt Gottes zu bezeichnen wird wohl kaum jemandem in den Sinn kommen, der schon einmal zwei Stunden im Regen auf ein Yellow Cab warten musste. Zum Glück sind Metaphern jedoch sehr geduldig und beschweren sich auch nicht über abwegige Interpretationen.
Damit scheint sich der Zusammenhang von Vorhersage und Ereignis umzukehren. Offensichtlich sagt nicht der Prophet das Geschehen im Vorfeld voraus, sondern andere Menschen suchen nach einer Begebenheit die passende Vorhersage. Korrekter wäre also die Bezeichnung »Nachhersage«. Und das ist keine üble Nachrede.
In der Psychologie nennt man dieses (unbewusste) Vorgehen »illusorische Korrelation«. Dabei handelt es sich um die menschliche Eigenart, zwei separate Vorgänge in kausale Verbindung zu setzen.
Das macht die illusorische Korrelation zu einem dicken Kumpel und Wegbereiter des Aberglaubens. Stellen Sie sich einen Mann vor. Diesem geschieht ein Unglück. Zum Beispiel vergisst er im Bus seine Aktentasche. Während er abends seiner Frau davon erzählt, fällt ihm plötzlich ein, dass ihm am Morgen eine schwarze Katze über den Weg gelaufen ist. Seine Gattin erinnert sich, dass auch sie schon einmal Pech hatte, nachdem sie zuvor eine Katze gesehen hatte. Daraufhin vermuten beide einen Zusammenhang, und schon haben wir den Nährboden für den felinen Unglücksboten geschaffen.[7]
Wir sind für solche »Schlussfolgerungen« sehr anfällig. Im Verlauf von sechs Jahren, nachdem der Gruselfilm »Poltergeist«[8] und seine Fortsetzungen gedreht wurden, starben vier der Schauspieler. Zufall, oder liegt auf dem Film etwa ein Fluch? Verwunderlich wäre es nicht, denn angeblich wurden für die berühmte Swimmingpool-Szene am Ende des ersten Teils echte Skelette verwendet. Hat das die Geister der Verstorbenen verärgert? Oder fanden sie den Film einfach schlecht und wollten sich deshalb an den Darstellern rächen? Ich weiß noch genau, dass ich diesen Aspekt damals gruseliger als den eigentlichen Film fand. Und wie verträgt sich der Fluch mit dem Glück von Richard Lawson, der die Rolle des Ryan in »Poltergeist« übernahm? Er scheint vor dem Fluch geschützt zu sein, denn er ist in seinem Leben bereits mehrfach einem Unglück entkommen. Zuletzt sogar einem Flugzeugabsturz, bei dem er kurz vor Abflug einen anderen Sitzplatz zugewiesen bekam und so überlebte. – Ziemlich unheimlich!
Gerade Verschwörungsfreunde sind wahre Meister im Aufspüren von abwegigen Verbindungen. Da werden Übereinstimmungen aus dem Hut gezaubert und überall die geheime Zahl 23, die Glückszahl der Verschwörungen,[9] hineingedichtet. Zum Beispiel scheint es einen seltsamen Einklang zwischen dem Attentat auf John F. Kennedy und dem auf Abraham Lincoln zu geben. Die Nachnamen beider Präsidenten haben sieben Buchstaben. Der politische Nachfolger von beiden hieß Johnson. Der Nachfolger Lincolns wurde 1808 geboren und der von Kennedy 1908. Genau hundert Jahre liegen auch zwischen der Wahl in den Kongress (1846 und 1946) und zum Präsidenten (1860 und 1960). Während auf Lincoln im Ford-Theater geschossen wurde, fuhr Kennedy in einem Ford – und zwar im Modell Lincoln. Als Beleg, wie willkürlich diese Übereinstimmungen gewählt werden, veranstaltete das »Skeptical Inquirer«-Magazin einen Wettbewerb, wer die meisten Gemeinsamkeiten zwischen zwei weiteren beliebigen Präsidenten findet.[10] Es trafen über einundzwanzig Listen ein, die teilweise sogar sechzehn Übereinstimmungen zwischen den Politikern aufwiesen.
Wer lange genug sucht, der wird auch fündig. Aber warum suchen wir überhaupt danach und meist sogar unbewusst wie im Fall des Pech bringenden Mäusefängers? Dass wir Menschen solch weit hergeholte Verkettung anstellen, liegt an unserem Gehirn. Das hat Schuld. Es steht nämlich auf »ganze Sachen« und ist permanent im Autovervollständigen-Modus. Evolutionstechnisch hat sich das einst als eine super Sache erwiesen. Diese Eigenschaft ist ein Grund, warum wir nicht so oft aufgefressen wurden.
Wenn damals ein Tyrannosaurus[11] hinter einem Baum hervorlinste, haben unsere Vorfahren nicht begeistert gerufen: »Ach guck, ein halber Dino. Da muss ich nicht weglaufen. Der hat ja nur ein Bein!« Sie haben sich vielmehr schnell aus dem Staub gemacht. Sie mussten nicht den ganzen Carnivoren sehen, sondern es reichte eine Hälfte aus, um ihn als Gefahr zu erkennen. (Siehe Abbildungen 1 und 2)
Abbildung 1: Auf dieser Zeichnung erkennen Sie direkt auf den ersten Blick den Liebling aller Kinder, den guten, alten Tyrannosaurus Rex – und das, obwohl keine Linie durchgezogen ist. Trotzdem ergänzt Ihr Gehirn, der alte Puzzlefreund, sofort die fehlenden Teile, und Sie »sehen« den Dinosaurier.
Illustration: Gisela Rüger, München
Abbildung 2: Noch deutlicher wird das Verlangen unseres Gehirns, Dinge als das »Große Ganze« zu sehen, bei den sechs Kreisen. Denn die lässt uns unser Gehirn nur ungern als Kreise mit seltsamen Einkerbungen wahrnehmen, sondern wir sehen als Erstes das Haus vom Nikolaus.
Illustration: Gisela Rüger, München
Besonders faszinierend ist, dass sich nicht nur Menschen als Zusammenhangsarchitekten versuchen, sondern auch Geflügel, wie der folgende Versuch von Burrhus Skinner zeigt:
Er sperrte Tauben in einen Käfig. Mittels einer Maschine wurde dem Federvieh regelmäßig und völlig automatisch Futter zugeführt – das All-inclusive-Bändchen in Silber haben Brieftauben ja ohnehin immer am Fuß. Die Tiere hatten natürlich keine Ahnung, dass die Nahrung von ganz alleine alle zwanzig Sekunden in den Käfig fiel. Stattdessen schienen sie anzunehmen, dass einzig ihr Verhalten für den Körnernachschub verantwortlich sei. Sie vollführten verschiedene Bewegungen, um herauszufinden, bei welcher Aktion Futter in den Käfig fiel. Im Laufe der Zeit wiederholten alle Tauben die exakt gleichen Bewegungen. Eine Tauben-Choreo, ganz ohne Tanzlehrer. Detlef D! Soost wäre begeistert. Diesen Versuch hat Skinner als »Aberglauben bei Tauben« bezeichnet.[12]
Weil das Gehirn also voll drauf abfährt, Dinge in einen größeren Zusammenhang zu setzen, verfallen wir der Verführung der »Synchronizität«. So glauben wir, dass zwischen zwei unabhängigen Ereignissen (schwarze Katze und liegen gelassene Tasche) eine Verbindung besteht. Darum liegt es auch nahe, an das Zutreffen von Vorhersagen zu glauben. Seien es die eines französischen Apothekers oder die eines amerikanischen Studenten.
Den beiden Propheten steht aber nicht nur unser leicht »zwängliches« Gehirn, sozusagen ein Strukturjunkie erster Güte, zur Seite, sondern auch die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Bei sechstausend schwammigen Aussagen muss früher oder später einfach eine zutreffen. Außerdem war Nostradamus so schlau und hat hauptsächlich Ereignisse vorausgesagt, die ohnehin ihren festen Platz als Sidekick in der Geschichte der Menschheit haben: Hungersnöte, Kriege und Naturkatastrophen. Da musste man auch im 16. Jahrhundert kein Hellseher sein, um zu wissen, dass davon in absehbarer Zeit noch einige geschehen werden.
Sogar seltenere und konkretere Sachverhalte werden mit genügend Geduld eintreffen. Machen Sie einen Selbstversuch. Schnappen Sie sich einen Stuhl und dieses Buch (damit Sie etwas zum Lesen haben, während Sie warten). Gehen Sie raus auf die Straße und setzen Sie sich in die Fußgängerzone. Achtung, hier kommt meine Prophezeiung: Ich sage voraus, dass bald ein Mann mit einem schwarzen Filzhut vorbeikommen wird.
Das wird vielleicht nicht heute sein, vielleicht auch nicht morgen. Aber irgendwann kommt einer vorbei. Irgendwann werden Hüte wieder modern sein. Oder es wird irgendwann bei Ihnen in der Fußgängerzone ein historischer Film gedreht und einer der Darsteller trägt einen schwarzen Filzhut. Unwahrscheinlich? Vielleicht. Aber nicht unmöglich.
Das gibt Hoffnung; eines Tages könnte sogar einmal ein Zug der Deutschen Bahn pünktlich sein. Mathematisch auf den Punkt gebracht: Ist die Zeitachse nur lang genug, wird jede Behauptung einmal wahr.
Das entspricht dem alten Spruch, nach dem man tausend Affen den ganzen Tag auf Schreibmaschinen rumhämmern lässt, um irgendwann die Werke von Shakespeare in der Hand zu halten.
Wenn Sie wollen und entsprechend aufnahmefähig sind, geht es noch mathematischer. Die Zahl Pi ist unendlich und nicht periodisch. Sie wiederholt sich also niemals, sondern es kommen immer neue Kombinationen der Ziffern Null bis Neun. Damit müssen Sie folglich an irgendeiner Stelle hinter dem Komma auch Ihre aktuelle Telefonnummer finden. Und sogar Ihre nächste Telefonnummer, von der Sie jetzt noch gar nicht wissen, wie sie einmal lauten wird. Man kann es sogar noch weiter auf die Spitze treiben und die Stücke von Shakespeare Buchstabe für Buchstabe in Zahlen umwandeln. Also A ist 1, B bekommt die 2, C entspricht 3 und so weiter … Und diese Zahlenfolge lässt sich ebenfalls irgendwo in der Zahl Pi finden. Sie ist nämlich unendlich. Damit brauchen Sie also keine schreibmaschinenaffinen Affen mehr, sondern nur einen Taschenrechner.
Das ist, zugegebenermaßen, sehr abstrakt und theoretisch.
Zusammengefasst heißt die Devise: »Wer warten kann, gewinnt.« Und da hat Nostradamus einen gewaltigen Vorteil gegenüber den ganzen Nachwuchspropheten. Mit sechstausend Weissagungen hat er nicht nur eine Menge möglicher Treffer angehäuft, sondern auch zeitlich einen Riesenvorsprung von vierhundertsechzig Jahren. Bei der Anzahl und der vergangenen Zeit muss natürlich irgendwann etwas eintreffen.
Als Mentalmagier kann ich mir diese Einstellungen allerdings nicht leisten. Meine Show kann nicht vierhundertsechzig Jahre dauern, damit würde sie die Blase vieler Zuschauer über das Maß des Erträglichen strapazieren. Deshalb muss ich Mittel und Wege finden, um meine Vorhersagen wahr werden zu lassen, ohne endlos warten und Däumchen drehen zu müssen.
Dazu bediene ich mich gerne einer relativ unbekannten Erkenntnis aus der Linguistik. Es handelt sich um entfernte Verwandte der Statistik, die sogenannten »semantischen Prototypen«.
Ich werde Ihnen jetzt drei Fragen stellen, und ich möchte, dass Sie diese umgehend beantworten.
Umgehend bedeutet, sofort und ohne groß nachzudenken. Glauben Sie mir, das Ergebnis wird erstaunlicher sein, wenn Sie das Erste sagen, was Ihnen in den Kopf kommt. Sie müssen die Antworten nicht laut aussprechen – je nachdem, wo Sie das Buch lesen, wollen Sie vielleicht nicht unnötig Aufmerksamkeit auf sich ziehen –, es reicht völlig, wenn Sie sich in Gedanken auf eine Antwort festlegen.
Machen Sie mit, es tut nicht weh. Versprochen. Und hinterher können wir dann vergleichen, ob ich mit meiner »Vorhersage« richtiglag.
Also, los geht’s.
Denken Sie an eine Farbe.
Jetzt.
Denken Sie an ein Werkzeug.
Jetzt.
Denken Sie an ein Musikinstrument.
Jetzt.
Und zum Abschluss denken Sie noch an ein Möbelstück.
Jetzt.
Sie haben also eine Farbe, ein Werkzeug, ein Musikinstrument und ein Möbelstück im Kopf.
Hier kommt meine Vorhersage. Im Herbst 2013, als ich diese Zeilen geschrieben habe, wusste ich bereits, dass Sie sich heute für ROT, HAMMER, GEIGE und STUHL entscheiden werden.
Wie konnte ich das wissen?
Hatte ich eine Vision?
Nein, ich habe lediglich die Abhandlung von Eleanor Rosch über Prototypensemantik gelesen.[13] In den frühen siebziger Jahren hat sich die Doktorin der Harvard University mit der Kategorisierung von Objekten beschäftigt. Es ging ihr um die Frage, nach welchen Kriterien wir Menschen Dinge unterteilen. Woran erkennen wir, dass wir einen Baum vor uns haben und nicht etwa einen Laternenpfahl?
Dafür hat sie unzählige Studenten befragt, was beispielsweise einen Fisch ausmache. Die Antwort war: Er müsse im Wasser leben, Flossen und einen dicken Bauch haben. Bei einer anderen Befragung sollten die Teilnehmer des Tests verschiedene Fischarten danach beurteilen, wie »fischig« sie sind. Das Ergebnis war keine große Überraschung, je mehr Ähnlichkeit zu dem »Fisch-Prototyp« bestand, umso eher und von umso mehr Personen wurde das Tier als Fisch erkannt. Sie können es selbst einmal versuchen. (Siehe Abbildung 3: Wer ist hier der Fisch?)
Abbildung 3
Illustration: Gisela Rüger, München
Als typischen Fisch stufen wir eher den Wal (der sportliche, schwarz-weiße Wellenreiter auf dem oberen Bild) als den Aal (das schlauchförmige Dings mit dem hinterhältigen Grinsen) ein. Dabei ist der Wal gar kein Fisch, sondern ein Säugetier, das nur keine Beine hat und deshalb lieber im Meer abhängt. Verständlich, an Land würden ihn die Japaner und Norweger nur noch schneller erwischen und ihm ein ähnliches Schicksal wie Heinrich II. bescheren. Mitten ins Auge …!
Der Aal schneidet beim Fisch-Contest traditionell schlecht ab. Biologiestudenten und andere Streber identifizieren den Aal bei einer Gegenüberstellung zwar korrekt als aquatisches, kiemenatmendes Wirbeltier, aber wenn uns normalen Menschen ein Aal in einem Einkaufszentrum begegnete, würden wir ihn für eine Schlange halten. Und wenn uns ein Wal die Handtasche klaut, geben wir bei der Personenbeschreibung zu Protokoll, dass es ein fieser Fisch war, der uns überfallen hat.
Anscheinend hat unser Gehirn für bestimmte Begriffe ein besonderes Vorzeigeexemplar, einen Prototyp, gespeichert. Und wenn ein neues Objekt dem ähnelt, können wir es in Sekundenschnelle entsprechend zuordnen. Für die Evolution der Menschheit war das eine grandiose Einrichtung. Dadurch wusste der Urmensch, ob es sich bei dem langen Etwas vor ihm um einen Ast handelte oder doch um eine gefährliche Schlange. Und zwar, bevor sie ihn gebissen hat.
Darauf sind diese Prototypen angelegt. Auf Geschwindigkeit. Ihr Zweck ist es, in kurzer Zeit eine Zuordnung zu ermöglichen. Mit Ruhe und Überlegung kommen wir natürlich zum gleichen Schluss wie der besser wissende Biologiestudent und stufen den Wal korrekt als leicht überdimensionierten Säuger ein.
Deshalb funktioniert das Frage-und-Antwort-Spiel von vorhin auch nur, wenn Sie sofort und ohne nachzudenken antworten. Wenn Sie direkt das Erste sagen, was Ihnen zu »Möbelstück« einfällt, sagen Sie ziemlich sicher »Stuhl«. Wenn Sie sich Zeit lassen, warten Sie stattdessen vielleicht mit »Paravent« oder »Wanduhr« auf.
Rosch hat ihre Prototypenforschung in zwei Richtungen geführt. Nicht nur, welche Kriterien ein Objekt erfüllen muss, um in eine Kategorie zu passen, sondern auch, welcher Gegenstand eine Kategorie am ehesten repräsentiert. Es gibt sozusagen eine Best-of-Liste der Farben, der Werkzeuge und der Musikinstrumente. Die Poleposition belegen Rot, Hammer und Geige.
Meine angebliche Vorhersage ist also gar keine Vorhersage. In Wirklichkeit schlachte ich die statistische Häufigkeit von semantischen Prototypen aus. Das wiederum ist natürlich nur eine hochtrabende Umschreibung dafür, dass ich geschummelt habe.
Das ist aber nicht schlimm. Wenn es um Prophezeiungen geht, ist jedes Mittel recht. Was macht man also, wenn weder Warten noch illusorische Korrelation oder fantasievolles Interpretieren helfen? Was ist die letzte Rettung, wenn sich partout keine Vorhersage findet, die auf ein bestimmtes Ereignis zutrifft?
Dann bleibt nur rohe Gewalt!
Das Gehirn ist schon ein Ordnungsfreak, aber manche Menschen laufen den grauen Zellen echt den Rang ab. Weil sie so gerne an das Eintreffen der Vorhersagen glauben wollen, mogeln sie und verändern die historischen Fakten. So lassen sich zum Beispiel keine wirklichen Belege dafür finden, dass Heinrich II. oder der Graf von Montgomery beim tödlichen Turnier den Löwen als Wappen gehabt hätten. Das erscheint sogar eher als unwahrscheinlich, da die Corporate Identity des Hauses Valois, zu dem Heinrich II. gehörte, im Logo einen rothaarigen Delfin vorsieht – und davon ist in Nostradamus’ Vierzeiler nun wirklich keine Rede. In einigen historischen Berichten von damals verfehlt der Lanzensplitter das königliche Auge sogar und dringt stattdessen durch die Stirn ein. Sogar den goldenen Helm scheint es nie gegeben zu haben.
So viel also zu dem jungen Löwen, den ausgestochenen Augen und dem goldenen Helm.
Trotzdem hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Nostradamus den Tod des Königs vorhersagte. Dabei hat sich Nostradamus selbst nie als Prophet bezeichnet. Ganz im Gegenteil. In mehreren Briefen an seinen Sohn sowie an König Heinrich II. und Kardinal René de Birague weist er diesen Titel von sich: »Ich bin kein Narr, ich würde mich niemals als Prophet bezeichnen.«[14]
Bekommen Sie bitte keinen falschen Eindruck von mir. Ich bin kein Miesepeter, der nur darauf aus ist, die Weissagungen anderer Leute schlechtzumachen. Gerne hätte ich Ihnen hier die eine oder andere Vorhersage präsentiert. Leider ist es mir trotz intensiver Suche nicht gelungen, auch nur eine Prophezeiung zu finden, die tatsächlich eingetroffen ist.
Dabei hatte ich sehr große Hoffnungen auf die Arbeit von Valerie J. Hewitt gesetzt. Diese hat nämlich eine Möglichkeit entwickelt, die metaphorischen Vorhersagen von Nostradamus in konkrete (!) Aussagen mit Datum (!!) umzurechnen.[15] Ihrer Meinung nach hatte Nostradamus bereits alles exakt vorausgesagt, dann aber schnell verschlüsselt, damit erst spätere Generationen seine Prophezeiungen lesen würden. Die Technik selbst ist ziemlich komplex, Buchstaben werden dabei nach einer bestimmten Regel durchgestrichen, andere durcheinandergewürfelt und wieder andere gegen Zahlen ausgetauscht – das deutsche Steuerrecht ist leichter zu durchschauen. Zum Glück muss es niemand verstehen, denn Hewitt hat alles schon ausgerechnet und zusammengefasst.
Das Beste an der Sache ist, dass sie die »entschlüsselten« Weissagungen Anfang der neunziger Jahre aufgeschrieben hat und diese bis zum Jahr 2010 reichen. Das bedeutet, wir haben hier endlich einmal Prophezeiungen vorliegen, die wir im Nachhinein auf ihre Aussagekraft überprüfen können.
Leider sind bei ihren konkreten Vorhersagen keine Treffer dabei. Weder wurden am 11. Mai 1995 Charles und Diana zu König und Königin gekrönt noch können wir uns seit dem 3. April 2007 mit Delfinen in ihrer eigenen Sprache unterhalten, und genauso wenig haben wir am 1. August 2005 den Planeten Venus zu unserem neuen Urlaubsdomizil erklärt.
Eine komplette Fehlanzeige.
Sollte es etwa gar keine verlässlichen Prophezeiungen geben?
Das Einzige, was ich finden konnte, ist das folgende System, um etwas über die Zukunft eines Menschen herauszufinden. Damit sind Sie in der Lage, innerhalb von zwanzig Minuten mit hoher Sicherheit sagen zu können, ob ein Kind später einmal Erfolg im Beruf haben oder bereits im Kindergarten sein durch Drogenverkäufe aufgebessertes Taschengeld beim Glücksspiel mit den Erziehern verlieren wird.
Entdeckt hat das System Walter Mischel. Ende der sechziger Jahre wollte er Vorschulkinder auf ihre Fähigkeit zur Selbstkontrolle testen. Zu dem Zeitpunkt hatte er keine Ahnung, dass er damit eine verlässliche Prophezeiungstechnik entdecken würde.
Fundstelle dieser Methode, die mit ihrer Trefferquote jeden Berufswahltest der Agentur für Arbeit an die Wand spielt, war der Kindergarten[16] der Stanford University. Dort holte er Vier- bis Sechsjährige einzeln in einen Raum, der bis auf einen Stuhl und einen Tisch vollkommen leer war. Mischel zeigte den Kindern ein Marshmallow, diesen weißen aufgeschäumten Zuckerhappen, den wir zu Hause immer liebevoll Mäusespeck genannt haben. Doch der gebürtige Österreicher ließ die Kinder die Süßigkeit nicht einfach essen. Stattdessen teilte er ihnen mit, dass er mal kurz den Raum verlassen müsse. Sie könnten das Marshmallow essen, aber wenn sie warten würden, bis er zurückkäme, würde er ihnen noch ein zweites geben.
Mit diesen Worten legte er die Süßigkeit auf den Tisch und verließ die hilflosen Kleinen, die sich nun in einem Dilemma befanden. Mit großen Augen saß jedes einzelne vor der verlockenden Nascherei und fragte sich: direkt essen – oder warten und zwei bekommen?
Wie viele Kinder wären bereit, auf das kurzfristige Vergnügen zu verzichten und das Warten bewusst in Kauf zu nehmen, um dann später belohnt zu werden?
Sofort verputzt haben die wenigsten den Mäusespeck. Den Großteil hat die Aussicht auf eine Verdopplung der Süßigkeit zur Zurückhaltung verleitet. Doch mit jeder Minute wurde das Verlangen größer. Mit jeder Minute hofften die Kinder, dass Mischel endlich zurückkäme. Aber Mischel ließ sich Zeit. Viel Zeit. Bis zu zwanzig Minuten ließ er sie vor dem Marshmallow schmoren. – Ziemlich gemein, da Amerikaner normalerweise Marshmallows auf offenem Feuer schmoren und nicht umgekehrt.
Vom Nebenraum aus beobachtete Walter Mischel heimlich die Kinder bei ihrem Versuch, standhaft zu bleiben, während er selbst vermutlich Unmengen an Marshmallows vertilgte.
Unterschiedliche Strategien wurden von den Kindern angewendet. Einige kehrten der Verlockung gemäß dem Motto »Aus den Augen, aus dem Sinn« den Rücken zu oder hielten sich ihre Hände vors Gesicht. Allerdings nur, um sich regelmäßig wieder umzudrehen. Andere versuchten, der Versuchung zu widerstehen, indem sie sich selbst an den Haaren zogen oder im Raum umherrannten. Wieder andere wurden rabiat und traten erbost gegen den Tisch, von dem aus der Schaumzucker sie lockte. Einige bauten so ein starkes Verlangen auf, dass sie anfingen, die Süßigkeit zu streicheln.
Letztlich entsagte etwa ein Drittel der Versuchung, hielt bis zum Ende stand und wurde mit einem zweiten Zuckerbatzen belohnt.
Was hatte sich Walter Mischel dabei gedacht, außer dass er sich an der Qual der Kinder laben wollte? Inspiriert zu seiner Versuchsreihe wurde er von einem Experiment, das einige Jahre zuvor in Trinidad durchgeführt worden war. Dabei sollte untersucht werden, welche Kinder die meiste Selbstbeherrschung aufwiesen. Unter anderem stellte sich heraus, dass Kinder aus intakten Familien eher bereit waren, auf die sofortige Marshmallow-Vertilgung zu verzichten, um später die doppelte Ration zu erhalten.[17]
Bei seinem erneuten Versuch in den Vereinigten Staaten wollte Mischel zusammen mit seinen Forscherkollegen Antonette Raskoff Zeiss und Ebbe B. Ebbesen feststellen, mit welchen Tricks sie den Kindern helfen konnten, länger zu warten. Zum Beispiel vervielfachte sich die Wartezeit immens, wenn die Kinder währenddessen an etwas dachten, das ihnen Spaß machte.[18]
So schön diese Erkenntnisse auch sein mögen, letztlich ist das nur Wissenschaftlerkram, der auf unserer Suche nach der perfekten Prophezeiung rein gar nichts bringt. Die wirklich interessanten Ergebnisse kamen erst Jahre später ans Licht, als Mischel seine Versuchsobjekte erneut besuchte, um sich deren Werdegang anzusehen. Die Kinder, die damals auf Mischels Rückkehr gewartet hatten, waren auch die »erfolgreichen« Kinder. Sie hatten alle durchweg gute Schulnoten und verstanden sich mit ihren Lehrern gut. Von ihren Eltern wurden sie als sehr erwachsen und vernünftig beschrieben. Diejenigen, die den Süßkram sofort aufgegessen hatten, hatten schlechtere Zeugnisse und waren auch schon mal sitzengeblieben. Fasziniert von dieser Entwicklung, stattete er ihnen einige Jahre später erneut einen Besuch ab. Von den wartewilligen Kindern hatten sogar alle besser beim Aufnahmetest für die Universität abgeschnitten als die, die das Marshmallow[19] gegessen hatten.
Damit hat Walter Mischel also tatsächlich eine Methode gefunden, um eine perfekte Prognose über das Leben eines Menschen zu treffen. Wer das Marshmallow nicht isst, wird es weit bringen. Zum einen kann er seine Handlungen überdenken, und zum anderen versteht er, dass Erfolg manchmal auf sich warten lässt. Es zeigt sich, dass unsere frühere Erkenntnis auch hier Gültigkeit hat: Wer warten kann, gewinnt!
Es dürfte klar sein, was Ihr nächster Schritt ist, wenn Sie Kinder haben: Sie setzen Ihrem Sprössling einen Schokopudding vor und sagen ihm, dass Sie mal kurz wegmüssten. Wenn er in der Zwischenzeit die Finger von dem Süßkram ließe, gäbe es hinterher noch ein Eis obendrauf. Dann gehen Sie nach nebenan und lesen dieses Buch zu Ende. Hat Ihr Nachwuchs in der Zeit den Pudding nicht angerührt, können Sie beruhigt sein. Er hat das Potenzial, der neue Herrscher dieser Welt zu werden. Sollte der Nachtisch bei Ihrer Rückkehr längst aufgegessen sein, setzen Sie Ihr Kind vor die Tür oder einfach auf eBay.[20]
Mischel ist also der Berufskunde-Nostradamus unserer Zeit.
Wenn Sie ihm gleichtun wollen, dann finden Sie im Internet zahllose Mitschnitte von Wiederholungen des Experimentes. Wer Spaß an den Videos aus der TV-Sendung »Upps! Die Pannenshow« hat, in der Kinder beim Trampolinspringen im Nachbargarten landen, wird auch an diesen Aufnahmen seine helle Freude haben.
Ein ganzes Kapitel, und es gibt nur eine verlässliche Vorhersage? Damit steht es im Finalspiel »Propheten gegen Vernunft« eins zu zwölf Millionen. Das ist ein denkbar schlechtes Ergebnis, was die Verlässlichkeit von Wahrsagungen angeht. Somit sollten Sie es sich besser zweimal überlegen, ob Sie wirklich Geld auf meine Lottozahlen setzen wollen!
Vorhersage
Als Mentalmagier braucht man eine ganze Menge Glück. Denn was ist, wenn einen die Wahrscheinlichkeit im Stich lässt und der Zuschauer eben nicht »Hammer«, »Geige« und »Rot« sagt, sondern eben doch »Paravent«? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, sein Glück aufzubessern? Wäre ich als Moderator der Sendung »Pimp My Luck« geeignet? Zum Glück folgt gleich das nächste Kapitel, und darin werden wir genau das unter die Lupe nehmen.
Kapitel 2
»Können Sie das Glück beeinflussen?«
»So how can you tell me you’re lonely,
And say for you that the sun don’t shine?
Let me take you by the hand
And lead you through the streets of London
I’ll show you something
To make you change your mind.«
Ralph McTell – Streets of London
Er hält mir einen Geldschein vor die Nase. Instinktiv will ich schon danach greifen, da fallen mir im letzten Moment meine guten Manieren wieder ein. Ich kann einem Kind doch nicht seinen Gewinn abnehmen! Wo kämen wir denn da hin?
»Nein, das ist dein Geldschein«, sage ich, »den hast du doch in meiner Show gewonnen.«
»Ehrlich?«
»Klar. Du hast dir den Umschlag ausgesucht, in dem der Zehner steckte, und damit darfst du ihn auch behalten.«
Der vierzehnjährige Tim blickt mich sprachlos an. Dann zieht er den Zehneuroschein blitzschnell zurück und steckt ihn in die Tasche seiner Jeans.
»Super! Ich hab zehn Euro gewonnen!«
Mit diesen Worten und um zehn Euro reicher läuft der Junge zu seiner Mutter, die bereits auf ihn wartet. Begeistert erzählt er ihr, dass er das gewonnene Geld behalten dürfe.
Das ist genau die richtige Einstellung, die Tim an den Tag legt. Damit wird er es weit bringen. Für ihn zählt nur, dass in dem Umschlag, den er sich ausgesucht hat, zehn Euro waren. Die anderen sind ihm egal.
Eine spannende Stelle in meinem Bühnenprogramm ist das »Gewinnspiel«. Dabei gebe ich einem Zuschauer vier Umschläge zur Auswahl. Er darf sich völlig frei für einen entscheiden. Was in dem Umschlag steckt, darf er behalten – die anderen bekomme ich zurück. In einem befindet sich ein Zehneuroschein, in den anderen angeblich Trostpreise. Ich werde ihn mit meinen magischen Fähigkeiten als Mentalist so beeinflussen, dass ich das Geld behalten werde. Der Zuschauer wählt nach diesen Ankündigungen einen Umschlag aus und öffnet ihn. Überraschenderweise ist darin der Schein.
Das Publikum nimmt natürlich an, dass das Experiment gehörig schiefgelaufen ist. Das soll es auch denken. Denn wie bei einem guten Film oder Roman ist das ein dramaturgischer Kniff. In dem Moment, in dem die Zuschauer sich an meinem Missgeschick laben, kommt der Twist.
Langsam öffne ich die übrigen Umschläge und zeige, was die vermeintlichen Trostpreise gewesen wären: ein Fünfziger, ein Zweihunderteuro- und im letzten Umschlag sogar ein Fünfhunderteuroschein.
Die Überraschung ist groß – offensichtlich hatte ich es von Beginn an so geplant.
Doch Timmi grämt sich nicht darüber, dass er »nur« den Zehner erhalten hat und nicht die großen Scheine. Nein, er freut sich, dass er zehn Euro gewonnen hat. Schließlich ist es ein großes Glück, dass ich gerade ihn aus den zweihundert anwesenden Zuschauern ausgewählt habe. Hätte ich eine andere Person aus dem Publikum genommen, wäre Tim ganz leer ausgegangen.
Wenn ich diese Geschichte anderen Menschen erzähle, höre ich oft, dass Tim sich die Sache einfach nur schönreden würde. Er würde die Welt durch eine rosarote Brille sehen und damit noch ziemlich oft enttäuscht werden, sobald er älter wäre.





























