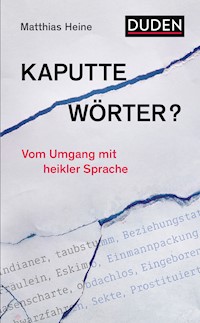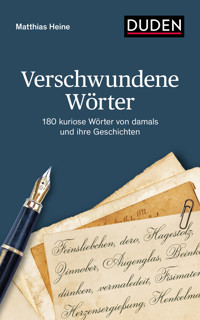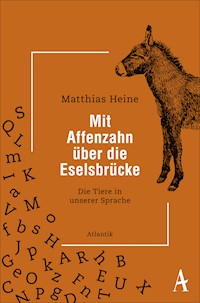12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Wörter werden geboren, sie sterben, sie wandern ein, sie wandern aus, und ihre Bedeutung wandelt sich. Wörter machen Geschichte. Aber wer macht eigentlich die Wörter? Da wäre zum Beispiel der Hiwi, der sich nach kalten Zeiten an der Ostfront heute in deutschen Universitätsstuben wärmen darf. Der Hipster, der die Hautfarbe wechselte. Und der Rocker, der im Deutschen eine unerwartete Karriere als krimineller Motorradfahrer gemacht hat. Matthias Heine fahndet seit Jahren für "Die Welt" nach den schillerndsten deutschen Begriffen. Die besten Wort-Steckbriefe versammelt dieser Band und gibt außerdem Antwort auf die Fragen: Was ist das schwierigste Wort der deutschen Sprache? Warum haben wir seit Luther auf den Ausdruck Shitstorm gewartet? Ist Plattenbau ein westdeutscher Kampfbegriff? Und warum müssen wir uns für das global erfolgreichste deutsche Wort ewig schämen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Matthias Heine
Seit wann hat geil nichts mehr mit Sex zu tun?
100 deutsche Wörter und ihre erstaunlichen Karrieren
Hoffmann und Campe
Einleitung
Von Geburt und Tod der Wörter: Seid umschlungen, Millionen
Im Februar des Jahres 2013 wurde in Berlin das bestgehütete Geheimnis der deutschen Sprache gelüftet.
200 Jahre lang hatten Gelehrte und Laien gerätselt, wie viele deutsche Wörter es wohl gebe. Den frühesten Versuch, sie zu zählen, unternahm Johann Christoph Adelung Ende des 18. Jahrhunderts. Er schrieb das erste wirklich umfassende Wörterbuch der deutschen Sprache. An ihm orientierten sich auch Goethe und Schiller. 58500 Einträge hatte Adelungs Grammatisch-kritisches Wörterbuch in der letzten Auflage, die 1811 nach dem Tod dieses Pioniers erschien.
Als die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm 27 Jahre später mit der Niederschrift ihres Deutschen Wörterbuchs begannen, ahnten sie nicht, dass das Werk erst 1961, 98 Jahre nach Wilhelms und 102 Jahre nach Jacobs Tod, vollendet würde – und dann ca. 320000 Stichwörter umfassen würde. Für den Wortschatz der Gegenwart ist das aber keine verlässliche Zahl, weil viele im Grimm verzeichnete Ausdrücke längst außer Betrieb sind. Manche gebrauchte schon niemand mehr, als sie ins Wörterbuch aufgenommen wurden. Sie verdanken ihre Aufnahme nur Luther oder den Klassikern, die sie einmal benutzt haben. Andere fehlen, weil die Grimms und ihre Nachfolger Fremdwörter nur sehr spärlich zuließen und weil unzählige Wörter erst im 19. und 20. Jahrhundert in Gebrauch kamen, nachdem die entsprechenden alphabetischen Bände längst abgeschlossen waren.
In der 2013 erschienenen 26. Auflage des Rechtschreibduden stehen dagegen nur 140000 Wörter, obwohl sie gegenüber der Vorgängerversion von 2009 um 5000 neue Einträge erweitert wurde – darunter auch solche wie Arabellion oder Flashmob, von denen man jetzt schon ahnt, dass sie in späteren Ausgaben wieder gestrichen werden.
Im zehnbändigen Großen Wörterbuch der deutschen Sprache aus dem Duden-Verlag sind sogar 200000 Lexeme verzeichnet. Die Duden-Redaktion ist sich – im Gegensatz zu vielen Wörterbuchbenutzern – aber darüber im Klaren, dass damit keineswegs alle deutschen Wörter erfasst sind. Nichts ist dümmer als das oft gehörte Argument: »Das Wort gibt es nicht. Es steht nicht im Duden.« Wörterbuchmacher gingen zuletzt davon aus, dass es etwa 300000 bis 500000 deutsche Wörter gibt. Auf etwa 70000 wird der sogenannte Standardwortschatz geschätzt, der Rest gehört eher Fachsprachen, Jargons und regionalen Dialekten an.
Seitdem nun zu Beginn des Jahres 2013 im Gebäude der ehrwürdigen Akademie der Wissenschaften am Berliner Gendarmenmarkt der Erste Bericht zur Lage der deutschen Sprache vorgelegt wurde, weiß man: Es sind in Wirklichkeit viel mehr. Etwa 5,3 Millionen deutsche Wörter hat ein Team um Wolfgang Klein, den Leiter des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache, ermittelt. Zum Vergleich: Das Oxford English Dictionary, das den gesamten Wortschatz der englischen Sprache in ihrer historischen Tiefe und ihren regionalen Varianten zu beschreiben versucht, weist derzeit etwa 620000 Einträge auf. Der für die französische Sprache maßgebliche Grand Robert erklärt 100000 Stichwörter.
Der gewaltige Unterschied zu den früheren Annahmen für das Deutsche und den Zahlen für andere Sprachen, die ja keinesfalls wortarme Bauerndialekte sind, legt schon den Verdacht nahe, dass hier unterschiedliche Zählweisen und statistische Verfahren angewandt wurden.
Mitgezählt wurden von den Wissenschaftlern der Berliner Akademie erstmals auch Zusammensetzungen oder Ableitungen, die nur selten Eingang in Wörterbücher finden. Jedes Wort, das nach den Wortbildungsregeln der deutschen Sprache gebildet wird, ist ein deutsches Wort – auch dann, wenn es ein einziger Mensch nur ein einziges Mal benutzt. »Gelegenheitsbildungen« oder »Augenblicksbildungen« nennen Fachleute solche Schöpfungen. Von ihnen lebt die dichterische Sprache, noch viel mehr die Sprache der Medien und der Sachbücher. Der auf der Pressekonferenz anwesende Germanist Peter Eisenberg gab selbst ein schönes Beispiel für diese Art von Wörtern, die niemand im Lexikon registriert, die aber jeder Muttersprachler versteht: Eisenberg redete von der »Sprachloyalität«, die bei Deutschen weniger ausgeprägt sei als in anderen Nationen. Gemeint war der unbedingte Glaube, dass die eigene Sprache die schönste und beste sei. Stattdessen ist das Reden über Sprache, genau wie der Blick auf die Umwelt, die Wirtschaft und die Politik, von german angst geprägt, um einen besonders schönen und populären Anglizismus zu gebrauchen, der in vielen Zeitungstexten benutzt wird, aber bisher in keinem Wörterbuch steht.
Ständig erfindet Deutschlands sprachlich kreative Klasse oder auch nur jeder halbwegs einfallsreiche Sprecher neue Wörter. Zwei Beispiele, die es nie in den Duden geschafft haben, sind aus Namen von Politikern abgeleitete Verben: In den Neunzigerjahren sprach man von gaucken, wenn anhand der Aktenlage in der Stasi-Unterlagenbehörde überprüft wurde, ob eine Person für das Staatsicherheitsministerium der DDR tätig war. Das Wort wurde von jedem verstanden, solange der spätere Bundespräsident die Behörde leitete. Und 2012 machte das Wort guttenbergen eine kurze Karriere. Schüler und Lehrer benutzten es als Synonym für abschreiben, nachdem der gewesene Verteidigungsminister sich in seiner Doktorarbeit großzügig bei anderen Autoren bedient hatte, ohne extra darauf hinzuweisen.
Der Berliner Computerlinguist Lothar Lemnitzer fischt mit einem speziellen Algorithmus in ausgewählten Onlinemedien nach solchen Neuwörtern und verzeichnet sie auf seiner Internetseite Wortwarte. In ertragreichen Monaten kann er dort fast jeden Tag fünf bis zehn Funde in der Art von Plusize-Frau, Pegidaversteher oder Vernunftsmobil präsentieren.
Ich selbst habe mal das Wort Kotzbrockenauffangbecken für eine Sportexpertenrunde im Fernsehen, an der Paul Breitner teilnahm, geprägt und es seitdem mehrmals bei Postings in sozialen Netzwerken benutzt. Und in einer Filmkritik zu Lars von Triers Weltuntergangsfilm Melancholia nannte ich die Mutter der Braut einen Selbstverwirklichungsdrachen. Beide Wörter sind nie in den Duden gelangt; die überwältigende Mehrheit der deutschen Muttersprachler hat sie nie gehört oder gelesen. Dennoch kann sie jeder auf Anhieb verstehen.
In der Literatur gibt es solche Gelegenheitsbildungen massenhaft. Während ich dies schreibe, lese ich Heinrich Heines Ideen. Das Buch Le Grand und Bertolt Brechts erstes Theaterstück Baal. In beiden Texten stoße ich auf jeder Seite auf Wörter, die nicht im Duden stehen.
Auf der ganz willkürlich aufgeschlagenen Seite 63 der Großen Frankfurter und Berliner Ausgabe der Werke von Bertolt Brecht finde ich beispielsweise die Ausdrücke fruchttragende Ährenmeere, weißstaubige Straßen, maitoller Bursche. Weder Ährenmeer noch weißstaubig noch maitoll stehen im Duden. Die letztgenannten finden sich noch nicht einmal im Grimm, während sich Ährenmeer dort immerhin bis zum Dichter Barthold Heinrich Brockes zurückverfolgen lässt, dessen Wirken mal dem Spätbarock und mal der Frühaufklärung zuzurechnen ist.
Bei Heinrich Heine finde ich auf der ebenfalls ganz zufällig aufgeschlagenen Seite 72 des Reclamhefts lotosgeblümte Pantalons und ein Paar Nankinghosen. Während der Duden mich überrascht, weil dort Pantalon verzeichnet und erklärt ist – »lange Männerhose mit röhrenförmigen Beinen« –, kennt er lotosgeblümt natürlich so wenig wie die Nankinghose. Aber da er immerhin Nanking (»ein Baumwollgewebe«) und Lotos (»eine Seerose«) erklärt, kann ich mir beide Zusammensetzungen erschließen. Solche Wörter sind es, aus denen sich die Millionen-Legionen des deutschen Wortschatzes zusammensetzen.
Die zweite Erklärung für die überraschend hohe Zahl deutscher Wörter, die Professor Klein und seine Kollegen ermittelt haben, ist das Bemühen der Berliner Wissenschaftler um eine größtmögliche Datenbasis. Sie schätzten nicht, indem sie – wie bisher meist geschehen – nach der Methode Pi mal Daumen die Stichwortzahlen der umfangreichsten Wörterbücher hochrechneten. Sondern sie wollten von Computern anhand einer repräsentativen digitalen Textsammlung – eines sogenannten Korpus – mit verlässlichen statistischen Methoden ausrechnen lassen, wie viele Wörter es im Deutschen tatsächlich gibt.
Kleins Korpus bestand aus einer über das ganze 20. Jahrhundert gleichmäßig gestreuten sorgfältigen Auswahl repräsentativer Texte aus folgenden Bereichen: Belletristik (also Romane, Erzählungen und andere fiktionale Literatur), Zeitungen, Gebrauchstexte (wie Ratgeber, Kochbücher und Rechtstexte) und wissenschaftliche Texte aus verschiedenen Gebieten.
Nachdem potenzielle Fehlerquellen einigermaßen ausgeschlossen bzw. mit statistischen Methoden herausgerechnet waren, ergab sich: »In einem Textkorpus der deutschen Gegenwartssprache, das eine Milliarde Textwörter lang ist, kommen etwa 5,3 Millionen lexikalische Einheiten – also Wörter, so wie sie im Wörterbuch stehen – vor.«
Die Gegenwart, von der Klein an jenem denkwürdigen Tag 2013 in Berlin sprach, war allerdings nicht mehr ganz taufrisch: Gemeint waren die Jahre 1994 bis 2004. Das war die dritte »Zeitscheibe«, aus der die Linguisten Texte untersucht hatten, um vergleichen zu können, wie sich der deutsche Wortschatz zahlenmäßig im Laufe der vergangenen knapp 120 Jahre entwickelt hat. Für die erste »Zeitscheibe« wurden Texte des frühen 20. Jahrhunderts bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs analysiert, für die zweite hat man die Nachkriegszeit genauer betrachtet.
5328000 deutsche Wörter – das ist der Stand für die »Zeitscheibe« von 1994 bis 2004. In den Texten aus der Zeit 1948 bis 1957 wurden 5045000 Wörter gezählt, für die Zeit von 1905 bis 1914 waren es 3715000.
Klein fasst zusammen: »Der deutsche Wortschatz hat im Verlauf des 20. Jahrhunderts um etwa ein Drittel zugenommen. Dabei ist der Anstieg in der ersten Jahrhunderthälfte deutlicher als in der zweiten.« Der Zuwachs besteht nur zum geringen Teil aus eigenständigen neuen einfachen Wörtern wie rödeln oder mosern. Auch die Zahl der Fremdwörter wird überschätzt. Die weitaus meisten neuen Wörter sind Ableitungen, wie der Ausdruck Aktivist von aktiv, oder Zusammensetzungen, wie Gutmensch, Unrechtsstaat, Plattenbau oder Lügenpresse. Dazu kommen eingebürgerte Fremdwörter – meist aus dem Englischen –, wie neuerdings Nerd oder Hipster. Aber auch aus dem Tschechischen und dem Türkischen, wie Roboter (das mittlerweile jeder kennt) oder Kek (dessen Gebrauch noch auf Hiphopper und ihre Fans beschränkt ist). Von einer »Verarmung« des Deutschen, wie sie Sprachpessimisten immer wieder beklagen, könne also keine Rede sein, resümierte Klein, der auch Direktor des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik ist: »Die heutige deutsche Sprache verfügt über einen überaus reichen Wortschatz, der weit jenseits dessen liegt, was je in einem Wörterbuch beschrieben worden ist.«
Bevor die Computer und die Linguisten mit der Zählerei beginnen konnten, musste allerdings geklärt werden, was ein Wort überhaupt ist. Als Beispiel nennt Klein Absatz, bei dem beispielsweise zwischen dem »Absatz in einem Text« und dem »Absatz von Produkten auf dem Markt« unterschieden werden muss. Sind das dann zwei verschiedene Wörter oder zwei Bedeutungen desselben Wortes? Wie bringt man einem Computer bei, sie zu unterscheiden? Ähnliche Probleme ergeben sich beispielsweise bei Schloss und Strauß – das sogar drei Bedeutungen haben kann: »Blumengebinde«, »großer Laufvogel« und »heftiger Auftritt, Gefecht, Wortwechsel«. Letztere Bedeutung findet man allerdings nicht mehr im Duden, sondern nur noch im Grimm. Gelegentlich stößt man in der Sprache der Klassiker noch auf sie.
Diese Probleme lassen sich mit etwas semantischer Ordnungsliebe relativ leicht lösen. Der Duden setzt für alle Bedeutungen von Absatz, Schloss und Strauß eigene Lemmata an – so lautet der wissenschaftliche Terminus für Einträge im Wörterbuch.
Wissenschaftler nutzen gern solche Termini, weil zwar jeder Laie glaubt, die Frage »Was ist ein Wort?« spontan beantworten zu können, Linguisten und Philosophen aber zäh um die Definition dieses scheinbar so einfachen Begriffes ringen. Hadumod Bußmann erläutert in ihrem Lexikon der Sprachwissenschaft die Bedeutung von Wort auf unübertrefflich schöne Weise – wie ich finde – gar nicht wirklich: »Intuitiv vorgegebener und umgangssprachlich verwendeter Begriff für sprachliche Grundeinheiten, dessen zahlreiche sprachwissenschaftliche Definitionsversuche uneinheitlich und kontrovers sind.«
Die Frage »Was ist ein Wort?« beantwortet der nachdenkliche Linguist also am besten zunächst mit: »Es kommt darauf an …« Phonetisch sind Wörter kleinste Lautsegmente, die durch Grenzsignale wie Pausen oder Knacklaute isolierbar sind. Syntaktisch werden als Wörter die kleinsten verschiebbaren Einheiten innerhalb des Satzes definiert. Orthografisch ist ein Wort eine Buchstabengruppe zwischen zwei Trennzeichen – aber da fangen die Schwierigkeiten schon an, denn nicht alle Sprachen kennen solche Trennzeichen, und auch in Europa wurden sie erst im Mittelalter eingeführt. Nach der morphologischen Definition ist ein Wort eine kleine sprachliche Einheit, die eine Bedeutung trägt, frei vorkommen und grammatisch gebeugt werden kann und durch die Regeln der Wortbildung zu beschreiben ist. Unter dem Gesichtspunkt der Semantik sind Wörter kleinste selbstständige Bedeutungsträger, die in Wörterbüchern verzeichnet sind. Die wissenschaftliche Bezeichnung für diese Bedeutungsträger ist Lexem. Lexeme können auch aus mehreren Wörtern bestehen, beispielsweise gefallenes Mädchen oder Graf Koks.
Bezeichnungen wie Lexem und Lemma habe ich in diesem Buch sparsam benutzt. Als Synonyme für Wort gebrauche ich lieber Ausdruck, Bezeichnung, Vokabel, Terminus und Begriff, wobei mir klar ist, dass Begriff im strengen philosophischen Sinne eher den mit einem Wort verbundenen Vorstellungsinhalt bezeichnet als das Wort selbst. Aber immerhin hat sogar Goethe Begriff im Sinne von »Wort« verwendet, vor allem, wenn es um fachsprachliches Vokabular ging.
Mit den 5,3 Millionen deutschen Wörtern, Ausdrücken, Bezeichnungen, Vokabeln, Termini und Begriffen vermögen wir aber keineswegs nur 5,3 Millionen Dinge, Eigenschaften, Tätigkeiten, Menschen, Institutionen etc. zu benennen, sondern noch viel mehr. Denn ein Wort kann viele ganz unterschiedliche Bedeutungen haben, wie es in diesem Buch exemplarisch an Organ beschrieben wird. Die ursprüngliche Bedeutung kann in Vergessenheit geraten – so geschehen bei Feminismus, geil, Weltmeister und Islamismus. Sie kann aber auch neben einer neuen weiterexistieren, ohne dass es irgendeinen Muttersprachler des Deutschen verwirrt: Wir wissen immer ziemlich sicher, ob mit einem Spinner gerade ein Textilarbeiter oder ein Verrückter gemeint ist, und wir verstehen, dass Nazis nicht von Insekten reden, wenn sie über Zecken lästern – ganz ohne den Jargon der rechten Szene im Detail zu kennen.
An 100 Beispielen wird in diesem Buch geschildert, wie, wann und warum Wörter erfunden werden, wie sie zu ihren Bedeutungen kommen und wieso wir sie benutzen. Im Mittelpunkt steht dabei der gesellschaftlich und politisch relevante Wortschatz, also Begriffe, anhand derer sich deutsche Geschichte (und nicht nur die) erzählen lässt und die oft genug Freund und Feind trennen. Manche von diesen brisanten Wörtern haben Weltkarriere gemacht, sind ins Englische und in andere Sprachen ausgewandert – wie Nazi. Aber auch ein unscheinbares Wort wie häh verdient mehr Aufmerksamkeit, als man zunächst annehmen würde.
100 gegen 5,3 Millionen – damit ist klar, dass die Auswahl subjektiv und eigenmächtig sein muss. Dass sie dennoch keineswegs zufällig und willkürlich ist, wird sich hoffentlich jedem Leser erschließen.
Aktivist
Vom Bagger auf die Barrikade
Überall, wo heute Geschichte gemacht wird, ist er dabei. Er stand am Majdan in Kiew mit rauchgeschwärztem Gesicht und hat hinter seinem selbstgebastelten Schild weitergemacht, als seine Kameraden von Scharfschützen dezimiert wurden. Am Gezi-Park schützte er sich mit feuchten Tüchern vor dem Tränengas. Er ging in Caracas auf die Straße, um gegen Inflation, Korruption und Kriminalität zu demonstrieren. Er wird in Russland für drei Jahre ins Straflager gesteckt, weil er gegen Umweltverschmutzung protestiert hat. Die Rede ist vom Aktivisten, dem Universal Soldier des globalen Protestes.
Das Wort Aktivist hat eine erstaunliche Karriere gemacht. Es ist, als hätten die Nachrichtenhändler sehnsüchtig auf einen Begriff gewartet, den jeder zu verstehen glaubt und der dennoch unklar genug ist, um alle gleichermaßen zu umfassen: Regierungsgegner und Unterstützer des Präsidenten Maduro in Venezuela, rechte Populisten von Pro NRW und linke Tierrechtler in Deutschland, französische Gegner der Homo-Ehe und amerikanische Transsexuelle, die sich endlich ordnungsgemäß bei Facebook registrieren wollen. In der Mediensprache gelten Pussy Riot genauso als Aktivisten wie der Journalist Glenn Greenwald, dem die Welt die Snowden-Enthüllungen verdankt.
Manchmal hat ein Wort von Beginn an mehrere Bedeutungen, doch eine dieser Bedeutungen schiebt sich immer weiter in den Vordergrund, sodass sie irgendwann die einzig akzeptable zu sein scheint. Wenn diese Bedeutung verblasst, weil der gesellschaftliche und politische Rahmen, in dem sie Karriere gemacht hat, wegfällt, wird das Wort wieder frei und eine andere Bedeutung blüht plötzlich. So war es bei Aktivist.
Das Wort war Anfang des 20. Jahrhunderts zunächst für die Vertreter einer philosophischen Richtung erfunden worden, die sich Aktivismus nannte. Bereits 1912 ist es im Philosophen-Lexikon von Rudolf Eisler belegt, es muss da also schon eine Weile existiert haben.
Ins Politische gewendet hat es dann der expressionistische Schriftsteller Kurt Hiller. Auf der Homepage der Hiller-Gesellschaft heißt es: »Kurt Hiller und seine Schriftstellerkollegen Rudolf Kayser und Alfred Wolfenstein ersannen dieses Schlagwort im Herbst 1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Hiller selbst definierte den Unterschied dergestalt, dass er den Expressionismus als eine Ausdrucksart empfand, den Aktivismus hingegen als eine Gesinnung, wobei beides in einer Person zusammenfallen konnte. Schockiert durch die Geschehnisse während des Kriegs, schlossen sich viele Schriftsteller der Gesinnung des Weltänderungswillens an. Nach Ende 1918 wurde eine Reihe mehr oder weniger aktivistischer Literaturzeitschriften aus der Taufe gehoben, und es erschienen viele Bücher, denen der Wille zum Aktivismus gemeinsam war.«
Der polemische Giftpilz Karl Kraus macht sich 1920 in seiner Zeitschrift Die Fackel genau über diese Dichter lustig: »Sie verwandeln sich in ›Aktivisten‹ und wenden sich, da in ihnen ja doch keine andere Flamme als die des Ehrgeizes brennt, den Geschäften der Völkerbefreiung zu und behaupten, dadurch dass sie dem alten Pathos nicht gewachsen sind, zu einem neuen gekommen zu sein.«
Auch Klabund begegnet den Künstler-Politikern 1922 in seinem Kunterbuntergang des Abendlandes nur noch mit (mildem) Hohn: »Ein kubistischer Maler namens Täubchen beschloss, nachdem er viele Bilder kubischer Art gemalt, nunmehr als rechter Aktivist auch ›so‹: nämlich kubisch zu leben.«
Zeitungsbelege aus den Zwanzigerjahren beziehen Aktivist aber vor allem auf Vertreter der nach dem Ersten Weltkrieg aufblühenden Nationalismen in Europa. Im Berliner Tageblatt wird im März 1918 Graf Ronikier »Führer der polnischen Aktivisten« genannt. In der gleichen Zeitung ist mehrfach von »flämischen Aktivisten« die Rede.
Lion Feuchtwanger schreibt 1930 rückblickend in seinem Roman Erfolg über den »Ruhrkampf« von 1923: »Gepriesen wurde der Terror, durch den dort deutsche Aktivisten die fremde Besatzung bekämpften. Verherrlicht insbesondere in riesigen Totenfeiern wurde ein Mann, der einen Zug zur Entgleisung gebracht hatte und dafür von den Franzosen erschossen worden war.« Gemeint ist der später von den Nationalsozialisten zum heldenhaften Ahnen hochstilisierte Freikorps-Kämpfer Albert Leo Schlageter.
Ambivalent ist der Gebrauch von Aktivist in der Nazisprache. Einerseits hat das Wort einen positiven Klang: 1936 nennt der Völkische Beobachter die ultra-nationalistischen putschenden Soldaten, die am 26. Februar in Tokio mehrere Minister getötet hatten, »Aktivisten«. Immer wieder werden auch Vertreter der sudetendeutschen Minderheit in der Tschechoslowakei so bezeichnet.
Andererseits wird das Wort während des Russlandfeldzugs geradezu zum Synonym für die politischen Kommissare der Roten Armee, die die »Einsatzgruppen« der SS sofort erschossen. Die Protokolle der Nürnberger Prozesse nach 1945 sind voll von Beispielen für solche Fälle, wo Aktivist ein Todesurteil bedeutete.
Deshalb darf es als besondere Ironie der Geschichte gelten, dass Aktivist in den Entnazifizierungsverfahren der Nachkriegszeit ein juristischer Fachbegriff der Nazi-Verfolger wurde. Damals teilten die Besatzungsbehörden alle, die ihr Verhalten im Dritten Reich vor einer Kammer verantworten mussten, in fünf Gruppen ein. Die zweitschlimmste Kategorie nach den »Hauptschuldigen« umfasste »Belastete«, und sie wurde noch unterteilt in »Aktivisten, Militaristen und Nutznießer«.
Bald darauf bekam Aktivist aber eine völlig neue Bedeutung, die rasch alle anderen für Jahrzehnte marginalisierte: »Seit 1948 wurde das Wort im östlichen Deutschland auch als verliehener Titel gebraucht«, schreibt der Berliner Linguist Wolfgang Pfeifer in seinem Etymologischen Wörterbuch.
Im elektronischen Archiv des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim findet sich dazu ein wunderschöner Beleg aus dem Neuen Deutschland von 1954. Unter der Überschrift »Bagger 90 fördert wieder« wird in hymnischer Prosa der Mann besungen, der den genannten Bagger repariert hat: »Kurt Gottschalch weiß: Die Grube braucht ihn. Nie ließ er sie im Stich. Viele tausend Tonnen Kohle hat er unserem Volk mehr gegeben, weil er geschickt und schnell arbeitet. Darum ist er Verdienter Aktivist geworden. In seiner Freizeit lernte Kurt Gottschalch. Der Meistertitel war sein Lohn. Er ist heute verantwortlich für die Reparatur aller Bagger auf Grube Greifenhain. An diesem 9. und 10. Februar bleibt er länger am Bagger, aber er denkt nicht daran, sich um die Kälte zu scheren oder nach dem Verdienst zu fragen. Er tut es, weil das Land Kohle braucht wie der Mensch seine fünf Liter Blut.«
Vorbild für Baggerführer Gottschalchs Ehrentitel war das russische Wort aktivist für einen Angehörigen eines Aktivs – das, ebenfalls nach sowjetischem Vorbild, geschaffene DDR-Wort für eine Arbeitsgruppe. Birgit Wolf definiert es in ihrem Wörterbuch Sprache in der DDR so: »Eine kleine Gruppe von Personen, die freiwillig und ehrenamtlich innerhalb von Parteien und Massenorganisationen, in der Wirtschaft und im Kultur- und Bildungsbereich an der Lösung bestimmter Aufgaben mitwirkte.«
Aktivist fungierte auch häufig als Name von volkseigenen Betrieben und Sportvereinen. Die Ehrenurkunde für Verdiente Aktivisten wurde 1950 eingeführt, allerdings in der Spätphase der DDR so inflationär verliehen, dass die goldgeprägte Mappe, in der man sie überreicht bekam, heute auf jedem ostdeutschen Flohmarkt verramscht wird.
Mit dem Ende des Kommunismus wurde Aktivist wieder frei für den Gebrauch im alten Sinne, den heute auch der Duden als erste Bedeutung nennt: »besonders politisch aktiver Mensch«. In den Statistiken des Instituts für Deutsche Sprache kann man nachvollziehen, wie die Frequenz des Wortes in den Medien zunimmt – mit einem ersten Höhepunkt in der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre.
Die drei Belege aus dem Jahre 1990 beziehen sich noch alle auf DDR-Verhältnisse, in den 127 Belegen des Jahres 1999 kämpfen Aktivisten gegen den Walfang, gegen die Partei in China, für die kurdische PKK, für Amnesty International, für die Unabhängigkeit Schottlands und für die Mainzer Aidshilfe – aber auch für die britischen Tories und die verbotene österreichische Nazipartei NDP.
In den Jahren 2010 und 2011 explodierte der Gebrauch von Aktivist dann geradezu. Allein für diese beiden Jahre sind 3027 Belege verzeichnet. Das sind fast zwei Drittel der 4820 Belege seit 1954.
Zum Teil hat das damit zu tun, dass in dem genannten Korpus jetzt auch Wikipedia-Artikel ausgewertet werden, in denen jemand als Aktivist bezeichnet wird oder in denen steht, dass Sportler in DDR-Mannschaften mit Namen wie Aktivist Tröbnitz (der Serienmeister im Badminton) aktiv waren. Doch natürlich hat der Anstieg in den beiden genannten Jahren vor allem mit dem »Arabischen Frühling« zu tun.
Früher hätte man die Kämpfer in Ägypten, Libyen oder später in der Ukraine als Revolutionäre bezeichnet. Doch Revolutionäre sind nach unserem Verständnis eher Linke, und das Wort hat mittlerweile einen eindeutig positiven Klang.
Aktivist war gerade in seiner Schwammigkeit offenbar geeignet, die zwiespältigen Gefühle auszudrücken, mit denen man im Westen die Mischung aus Islamisten und Demokraten in den arabischen Ländern oder die düstere Melange aus Europa-Sehnsüchtigen und antisemitischen Nationalisten in der Ukraine betrachtet.
Wenn jetzt die ukrainischen Streiter als Aktivisten bezeichnet werden, hat das aber auch eine besonders schöne Pointe: Denn aus der Sowjetunion, zu der die Ukraine einst gehörte, ist das DDR-Wort ja gekommen. Nun kehrt es wieder dorthin zurück. Ein Aktivist war einmal jemand, der seinen Stolz in der Übererfüllung der kommunistischen Sklavenarbeit fand – wie Baggerführer Gottschalch. Nun ist es einer, der die letzten postsowjetischen Ketten abschütteln will.
Alleinerziehend
Wie man Probleme mit einem Wort nicht aus der Welt schafft
Es gibt keine gefallenen Mädchen mehr. Schon in meiner Kindheit, als ich um 1970 mit dem Bücherlesen anfing, hatte ich zunächst Schwierigkeiten, mir unter diesem Begriff überhaupt etwas vorzustellen. Dabei war meine eigene Mutter eine Vertreterin dieser Spezies. Allerdings nannte man Frauen wie sie in den Sechzigerjahren bereits ledige Mütter – vom religiös angehauchten Ausdruck gefallene Mädchen hatte man sich da zumindest im wissenschaftlichen und politischen Sprachgebrauch verabschiedet.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde dieses Zwei-Wort-Lexem noch ganz unbefangen verwendet. Ein besonders aussagekräftiges Beispiel für die medizinischen und moralischen Vorstellungen, die dem damaligen Sprachgebrauch zugrunde lagen, findet sich in Reinhold Gerlings Das große Aufklärungswerk für Braut- und Eheleute, das zuerst 1901 erschien. Dort heißt es: »Die Erstbefruchtung kann Einfluss auf jede spätere Empfängnis haben, somit darf die Erstlingsblüte der Liebe nur einem geistig und körperlich hochstehenden Manne dargebracht werden. Der leichtsinnige Verführer, der Lüstling schädigt auch die Kinder des Mannes, der dem gefallenen Mädchen seinen Namen gibt. Der Mann aber pflücke die Blume der Keuschheit mit Andacht!«
Obwohl noch bis in die Achtzigerjahre hinein ältere Journalisten ganz unbefangen von gefallenen Mädchen redeten, verlangte doch der Zeitgeist nach der gesellschaftlichen Epochenwende von 1968 und der Sexuellen Revolution einen neuen, neutraleren Ausdruck. Selbst ledige Mutter schien allzu sehr den Mangel – nämlich die Abwesenheit eines Vaters und Ehemannes – zu betonen, statt die Autonomie der Mutter hervorzuheben. Seit den späten Siebzigerjahren tauchen deshalb zunächst in feministischen Publikationen wie Emma und Courage das Adjektiv alleinerziehend und das Substantiv Alleinerziehende auf, letzteres meist im Plural.
Um 1980 ist das Wort schon im offiziösen Wortschatz etabliert. In einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfamilienministerium werden Alleinerziehende als Synonym für ledige Mütter eingeführt.
Der Vorteil des neuen Begriffs ist seine Neutralität in Geschlechterfragen: Alleinerziehende können Männer genauso gut sein wie Frauen. Möglicherweise ist er nach dem Vorbild von single parent geprägt worden, das sich im Englischen seit 1969 nachweisen lässt. Allerdings ist es in der Realität noch wie zu Zeiten von Goethes Gretchen meist so, dass die Frau vom Mann mit dem Kind allein gelassen wird. Dennoch illustrierten fast alle Online-Medien, als ich im Juni 2015 das Wort Alleinziehende als Suchbegriff bei Google News eingab, ihre Artikel mit Bildern von Vätern (!) und Kindern. Wie so oft will man bloß dem Vorurteil entkommen und endet bei der Manipulation der gesellschaftlichen Realität.
Aluhut
Darunter steckt nicht immer ein wirrer Kopf
Der Meinungskampf rund um die ukrainische Majdan-Revolution von 2013/14 und den anschließenden Krieg mit Russland hat der deutschen Sprache auch ein paar neue Wörter beschert oder solche, die vorher ein ausgesprochenes Nischendasein führten, in den Hauptstrom der Sprache geschwemmt. Das bekannteste Beispiel ist der Putin-Versteher. Erfunden hat es möglicherweise mein Welt-Kollege Peter Dausend (heute bei der Zeit), der schon 2006 den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder so nannte.
Und wer Putin-Versteher sagt, der sagt auch Aluhut. Mit diesem Schmähwort wurden in den sozialen Netzwerken Verschwörungstheoretiker bezeichnet, die sich 2014 in Berlin und anderswo auf den »Montagsdemos« gegen den drohenden russisch-ukrainischen Krieg versammelten. In jüngster Zeit nennt man auch den Sänger Xavier Naidoo, der vielen Verschwörungstheorien anhängt, Aluhut. Mittlerweile ist das Wort so populär, dass es auch in der Media-Markt-Werbung verwendet wird.
Der Ausdruck Aluhut ist so schön, weil er sich eben nicht gleich von selbst erklärt. Die Autorin der Berliner Morgenpost Christina Brüning musste nachhaken, als der neu gewählte Chef der Berliner Piratenpartei, Hartmut Semken, im März 2012 auf die Frage, was denn die größte Gefahr für die junge Partei sei, antwortete: »Sich zwischen den Polen der Aluhüte und der Spackeria zu zerfleischen.« Semken erklärte: ›Aluhüte‹ heißen die Leute, die den Fokus auf Datenschutz legen und dabei bis zum Extrem gehen. Und die Leute, die post-privacy leben und alles im Internet öffentlich machen, wurden mal ›Spackos‹ genannt und haben sich dann selbst ›Spackeria‹ genannt.«
Aluhut ist eine Anspielung auf die 1927 von Julian Huxley in der Kurzgeschichte The Tissue-Culture King vorgestellte Wahnidee, eine Kappe aus Metallfolie könne telepathische Einflüsse auf das Gehirn blockieren. Seit den frühen Achtzigerjahren ist im Englischen das Wort tinfoil hat mit der Bedeutung einer solchen Kappe belegt (vorher existierte es schon für eine Partykopfbedeckung für Kinder).
Relativ bald erlangte tinfoil hat dann die Bedeutung »paranoide Person, die eine solche Kappe trägt, um sich vor Telepathie und Strahlen zu schützen«. In der Rhetorik nennt man so eine Sprachfigur, in der ein Teil des Benannten zur Bezeichnung des Ganzen wird, Synekdoche. Ähnlich entstanden etwa Ausdrücke wie Braunhemden (für Nazis) oder Hasskappen (für Autonome, weil sie sich gerne mit Motorradhauben verhüllen).
Das dem tinfoil hat entsprechende deutsche Wort Aluhut existiert spätestens seit dem Jahr 2000, als es der Theaterkritiker Andreas Schäfer in der Berliner Zeitung verwendete – damals noch für den Hut selbst. Als Synonym für Verschwörungstheoretiker wird es spätestens seit 2011 gebraucht. Im Mai jenes Jahres bezeichneten sich die Datenschutz-Dogmatiker der Piratenpartei in einem neu geschaffenen (und bald wieder eingeschlafenen) Blog selbstironisch so. Was dafür spricht, dass nicht unter jedem Aluhut ein total wirrer Kopf steckt.
Aluhut ist übrigens ein wundervolles Beispiel dafür, dass unsere Sprache keineswegs die Kraft verloren hat, englische Wörter zu verdeutschen. Es beweist vielmehr, dass gerade kreative Verdeutschungen Erfolg haben können. Denn die hyperkorrekte Übersetzung »Blechfolienhut« wäre sicher niemals in den Alltagssprachgebrauch eingegangen.
Baron
Adel vernichtet: Von Drogenbaronen, Warlords und Graf Koks
In Billy Wilders Film Ein, zwei, drei, kurz vor dem Mauerbau in Deutschland gedreht, gibt es eine Szene, in der der Coca-Cola-Boss von West-Deutschland (gespielt von James Cagney) seinen kommunistischen Schwiegersohn (Horst Buchholz) durch einen verarmten Adeligen adoptieren lässt, auf dass der Nichtsnutz wenigstens ein bisschen im alteuropäischen Glanz scheine. Der adelige Adoptivvater muss aus einer Toilette geholt werden, wo er sein Geld als Wärter verdient, und klagt über die Einnahmeausfälle, die ihm die Zeremonie beschert. Dieser Graf Waldemar zu Droste-Schattenburg, dem die Schwulenikone Hubert von Meyerinck Glamour verleiht, ist eine schillernde Parodie auf den Typus des heruntergekommenen Adeligen.
Dass Grafen nicht (mehr) zu trauen ist, wusste der Volksmund schon, als er den schönen Ausdruck Graf Koks für eine hochnäsig auftretende Person ohne besondere Verdienste prägte. Der früheste Beleg dafür, den das Digitale Wörterbuch der Deutschen Sprache (DWDS) liefert, schlägt eine schöne Brücke zu Graf Droste-Schattenburg: »Graf Koks ist das Verhältnis seiner Nichte zu dem Onkel der Klosettfrau unsympathisch.« 1920 ahnte Graf Koks noch nicht, dass manche Grafen einen Weltkrieg später selbst als Klosettmänner würden arbeiten müssen.
Die ersten vier Beispiele für Graf Koks aus dem DWDS-Korpus stammen alle aus der Zeitschrift Die Weltbühne der Jahre 1920–1924, deren prominentester Mitarbeiter Kurt Tucholsky war. Es ist nicht klar erkennbar, ob Tucholsky Autor der zitierten Geschichten ist, doch ist bekannt, dass er die Figur des Graf Koks in einer Erzählung namens Der Floh verwendet hat, die er 1932 unter dem Pseudonym Peter Panter schrieb.
Graf Koks ist aber mit Sicherheit keine Erfindung Tucholskys. Allgemein wird die Entstehung des Ausdrucks auf das späte 19. Jahrhundert datiert, als zu Reichtum gekommene Industrielle einen neuen Geldadel bildeten. Bei deren Aufstieg spielte Koks als Heizmaterial für die Hochöfen der Stahlindustrie oft eine Rolle. Koks wurde aber auch industriell zur Erzeugung von Haushaltsgas genutzt, was den heutzutage undurchsichtig gewordenen Spottnamen Graf Koks von der Gasanstalt erklärt – dessen Adel ist so flüchtig wie das Kokereigas, das seit den Sechzigerjahren vom Erdgas mit seinem höheren Brennwert verdrängt wurde.
In jene ferne Welt neureicher Gründerzeitindustrieller gehören auch der Schlotbaron, der Eisenbahnbaron und der Stahlbaron. 1899 heißt es in der Novelle Die Freunde, die Karl Emil Franzos in der Zeitschrift Die Jugend veröffentlichte: »Mein Schwiegervater ist so’n Schlotbaron drüben bei Dortmund.« Doch der älteste auffindbare Beleg ist ein satirisches Gedicht von Arno Holz aus dem Jahre 1892: »Ihr wisst, ich bin kein ›Von‹-Verehrer, ich bin des Zeitgeists Straßenkehrer; doch protzigere Kerle sah ich noch nie, als die Schlotbarone der Plutokratie!« Sicher ist aber auch Holz nicht der Erfinder des Wortes. Dafür spricht, dass Bildungen mit -baron schon 1894 in einer Sitzung des Preußischen Landtags als allgemeines Sprachgut vorausgesetzt wurden. Da hält es ein Vertreter der ostelbischen Großgrundbesitzer in einer industriepolitischen Debatte für nötig, zu betonen: »Ich bemerke übrigens, dass ich weder Kohlenbaron noch Schlotbaron, noch Schnapsbaron, noch sonst irgendein Baron bin.« Die Schlotbarone waren die Vertreter des modernen Kapitalismus, die Großgrundbesitzer standen für traditionellere Formen der Ausbeutung. Antidemokratisch waren beide Gruppen eingestellt, weshalb der jüdische Religionsphilosoph Franz Rosenzweig 1917 resümiert: »Das Schwergewicht der neuen Rechten liegt nicht mehr in Ostelbien; nicht mehr der ›Krautjunker‹, sondern der ›Schlotbaron‹ ist ihr Träger.«
Als in den Siebzigerjahren der entsprechende Band des Wörterbuchs der Deutschen Gegenwartssprache in der DDR erschien, war das Wort Schlotbaron im Westen schon fast ausgestorben. Seit den Sechzigerjahren wurde es nur noch historisierend gebraucht, um längst vergangene Zeiten zu beschreiben. Die Wissenschaftler in Ost-Berlin und ihre ideologischen Aufpasser befanden das Wort trotzdem der Aufnahme für würdig. Vermutlich vor allem, weil es in der Agitation der frühen Arbeiterbewegung eine so große Rolle gespielt hatte. Noch Ernst Thälmann, der Kommunistenführer der Zwanzigerjahre, benutzte es, um die deutsche Klassengesellschaft zu beschreiben: »Auf der einen Seite die Arbeiterklasse und Millionen verelendeter Kleinbürger und Kleinbauern, auf der anderen Seite die ganze Bourgeoisie, von den rheinischen Schlotbaronen und den ostelbischen Junkern bis zu den liberalen Händlern.«
Noch früher hatte sich der Eisenbahnbaron aus dem deutschen Sprachschatz verabschiedet. Erstmals taucht das Wort 1869 im Lustspiel Die Touristen von Johann Jakob Forrer auf. Mit der Verstaatlichung des Schienennetzes wurde dieser Typus des Privatunternehmers, der durch spekulative Geschäfte mit dem Eisenbahnbau reich geworden war, zu einer legendären Figur.
Ein richtiges Comeback hat dagegen der erst seit 1943 belegte Stahlbaron erlebt. Zwar kann man in Deutschland schon lange kein Vermögen mehr mit Stahl begründen, aber seit in den Nullerjahren das indische Stahlunternehmen Mittal zum Global Player geworden ist, haben die Journalisten das schöne alte Wort eigens für dessen Gründer Lakshmi Mittal ausgegraben. Manchmal wird es für den Italiener Emilio Riva, Gründer des größten italienischen und viertgrößten europäischen Stahlkonzerns Ilva, benutzt. Und als im Sommer 2013 Berthold Beitz starb, wurde auch der ehemalige Krupp-Manager in manchen Nachrufen zum Stahlbaron geadelt.
Die im 19. Jahrhundert aufgekommene Sprachmode, Industrielle abwertend als Barone ihrer Branche zu bezeichnen, ist möglicherweise aus dem Englischen ins Deutsche herübergeschwappt. Denn Barone hat es eigentlich nur außerhalb Deutschlands gegeben, hierzulande war die korrekte Anrede stets Freiherr. Ein solcher war in Wirklichkeit auch Manfred von Richthofen. Den Titel Baron verliehen ihm erst die Engländer, als sie den Adelstitel des legendären Jagdfliegers übersetzten. Von dort ist der Spitzname Roter Baron dann nach Deutschland gewandert.
Auch der robber baron, der möglicherweise das Vorbild für unseren Schlotbaron war, ist ein Wanderer zwischen deutsch-englischen Sprachwelten. In den USA hatte man erstmals 1878 Figuren wie Andrew Carnegie und Cornelius Vanderbilt als robber barons bezeichnet. Das heißt wörtlich »Räuberbaron«. Aber eigentlich war es eine aus der historischen Literatur stammende Übersetzung des guten alten deutschen Wortes Raubritter, bevor es in polemischer Absicht auf Großkapitalisten gemünzt wurde.
Man könnte annehmen, dass der Lügenbaron der Vater aller mit -baron konstruierten Schimpfwörter ist. Denn die fiktiven Lebenserinnerungen des Hieronymus Carl Friedrich Freiherrn von Münchhausen erschienen ja bereits 1786. Das Wort Lügenbaron taucht dann erstmals 1841 in Karl Eduard Poelnitz’ Buch Militärische Briefe eines Verstorbenen an seine noch lebenden Freunde auf. Gemeint ist dort natürlich – wie in fast allen Belegen – Münchhausen.
Mit dem Aussterben der Schwerindustriemagnaten in Deutschland wurde das Wort Baron frei für andere Branchen. Berüchtigt war der vielfach wegen Tierquälerei angeklagte Hühnerbaron Arnold Pohlmann. Der Bordellbetreiber Bert Wollersheim ist gelegentlich als Puffbaron oder Rotlicht-Baron bezeichnet worden.
Von allen unechten Adeligen hat aber der Drogenbaron zuletzt eine besonders beeindruckende Karriere hingelegt. Das Wort kam in Gebrauch, als in den Achtziger- und Neunzigerjahren erstmals Zeitungsartikel über die Kokainkartelle von Medellin und Cali veröffentlicht wurden. In den 95 Belegen, die das DWDS versammelt, taucht es 21-mal in der Kombination »kolumbianischer Drogenbaron« auf.
Sehr häufig ist der Drogenbaron übrigens auch ein Warlord, weil Terroristen oder Rebellen ihre militärischen Aktionen gerne durch Rauschgifthandel und -anbau finanzieren. Die größten Schurken werden so sprachlich gleich doppelt geadelt. Das Wort warlord existiert im Englischen seit 1856, es wurde zunächst fast ausschließlich für militärische Führer gebraucht, die in den endlosen Wirren der chinesischen Kriege und Bürgerkriege des frühen 20. Jahrhunderts auf eigene Rechnung operierten – ähnlich wie die Condottieri der italienischen Renaissance. Im Deutschen ist Warlord seit 1915 belegt. Da klagt ein Autor im Jahrbuch der Deutschamerikaner darüber, dass Kaiser Wilhelm von der englischen Presse mit diesem Titel verunglimpft würde. Ansonsten wird es fast immer auf das umkämpfte Asien bezogen, so etwa in einem Buch mit dem vielsagenden Titel Die gelbe Front. Reise eines Kriegsberichterstatters in China von 1940. In dem Maße, in dem China sich nach dem Sieg Maos stabilisierte (von da an mordete nur noch einer, dafür umso gründlicher), kam das Wort für chinesische Verhältnisse außer Gebrauch und wurde frei für eine weiter gefasste Verwendung. Mittlerweile werden auch Militärunternehmer in Afghanistan oder Afrika so genannt.
Der berühmteste Drogenbaron der Gegenwart ist im Hauptberuf aber kein Warlord, sondern Chemielehrer. Der dunkle Glamour Walter Whites hat mittlerweile die Erinnerung an Typen wie Pablo Escobar verblassen lassen. Die meisten Menschen denken heute, wenn sie das Wort Drogenbaron hören, an den Protagonisten der amerikanischen Fernsehserie Breaking Bad, der sich vom Lehrer zum erfolgreichen Drogenhändler – nun, ja – hocharbeitet.
Mit dem Hühnerbaron und dem Drogenbaron haben die Wortbildungen mit -baron den Bereich der klassischen Schwerindustrie verlassen, der die frühen Prägungen Schlotbaron, Stahlbaron und Eisenbahnbaron ja alle angehörten. Heute kann es Barone in jeder Branche geben, sogar einen Internetbaron findet man beim Googeln, und in englischen Quellen wurde der zwielichtige deutsche Netzunternehmer Kim »Dotcom« Schmitz bei seiner Verhaftung als web baron bezeichnet. Interessant wird es, wenn der Lügenbaron der Bruder eines Holzbarons ist und beide obendrein echt adelige Freiherrn sind – wie im Fall von Ex-Minister Karl Theodor zu Guttenberg und seinem Bruder Philipp, dem Vorsitzenden des deutschen Waldbesitzerverbandes.
Bausünde
Heiliger Schinkel, vergib uns!
Alles ist in den letzten 200 Jahren säkularisiert worden. Sogar der Titel Gott, der ganz profanen Helden von Eric Clapton bis Steve Jobs verliehen wurde. Und während sich kein Mensch mehr um den traditionellen Sündenkatalog der katholischen Kirche schert, haben wir es mit neuen Vergehen zu tun, über die sich der Moralist von heute oft mehr erregt als über Klassiker wie Völlerei, Unzucht oder Geiz. Die Moderne hat uns den Ausdruck Verkehrssünder beschert, dessen Wortgeschichte sich bis in die Zwanzigerjahre zurückverfolgen lässt, der aber erst in der Nazizeit richtig zu florieren begann, und auch den Steuersünder, über den schon 1911 im österreichischen Reichsrat geredet wurde. Anfang der Siebzigerjahre kam der Umweltsünder dazu. Deutlicher seltener sind die Wörter Verkehrssünde, Steuersünde und Umweltsünde. Wir haben es hier mit dem Paradoxon von Sündern ohne Sünde zu tun. Genau andersrum verhält es sich mit Bausünde. Diese ist allgegenwärtig – sprachlich wie physisch. Vom Bausünder hört man dagegen fast nie. Vielleicht erklärt es die ganze brutale Hässlichkeit moderner Architektur, dass man hier offenbar sündigen kann, ohne Sünder gescholten zu werden.
Das Wort Bausünde ist deutlich älter als die anderen genannten, und es entstammt einem Milieu, in dem die Baukunst tatsächlich noch einen sakralen Anspruch hatte: dem Kreis um Karl Friedrich Schinkel, den romantischen Baumeister und vielleicht größten Gesamtkünstler, den Deutschland je hervorgebracht hat. Schinkels Schüler Carl August Menzel benutzt es 1845 in seinem Traktat Grundzüge zur Vorschule einer allgemeinen Bauformenlehre, wo er über die Kirchenbaukunst der Jahrhunderte vor der französischen Revolution spottet: »Der sogenannte romantische Styl war in der Anwendung verschwunden, und der sogenannte klassische Styl begann zu herrschen, und wenn ein Baumeister seinen Vignola gehörig auswendig wusste, was man ihm in allen Bau- und Kunstakademien in kurzer Zeit für ein billiges Geld beibrachte, bedurfte er nichts weiter zu lernen, denn alles, was er brauchte, war bis auf die kleinsten Maaße genau vorgeschrieben, und jede Abweichung von der Regel wurde als Bausünde betrachtet.«
Mit Vignola gemeint war der italienische Barockarchitekt Jacob Barozzi von Vignola, der mit Michelangelo gearbeitet hatte. In seinem theoretischen Hauptwerk Regola delle cinque ordini d’architettura (Regeln der fünf Ordnungen der Architektur) versuchte er 1562 architektonische Gliederungselemente in einer festen Wechselbeziehung von Zahlen zu normieren. Das Buch wurde 1720 von dem sächsischen Architekten Johann Rudolph Fäsch bearbeitet und als Grund-Regeln über Die Fünff Säulen verdeutscht. Es prägte mit zahlreichen Neuauflagen die deutsche Baukunst für lange Zeit. Noch 100 Jahre später war ein Der kleine Vignola genanntes Lehrbuch Bestandteil der Architektenausbildung.
Am Anfang war die Bausünde ein schlichter Regelverstoß. Aber schon im 19. Jahrhundert nimmt sie die heutige Bedeutung an, die der dreibändige Duden so erläutert: »nicht in das Orts- und Landschaftsbild passendes, hässliches, unsachgemäß errichtetes oder renoviertes Bauwerk«. Um eine derartige Definition hatte bereits 1865 der Verein zur Förderung baulicher Interessen in Frankfurt am Main gerungen, dessen Mitglieder nach einem Bericht des Intelligenz-Blatt der freien Stadt Frankfurt beschlossen, auf die Tagesordnung zu setzen, »was man denn unter einer Bausünde verstehe«. Zuvor hatte der Buchhändler Friedrich August Ravenstein eine neue Bausünde auf dem Westendplatz zur Sprache gebracht.
Bei Theodor Fontane, der das Wort 1899 in seinem Roman Der Stechlin verwendet, ist die Bausünde dagegen kein Gebäude sondern ein Geschmacksverstoß innerhalb eines Hauses. Über einen »ziemlich pittoresken Portikus« heißt es dort, von ihm habe ein hauptstädtischer Architekt mal gesagt, »sämtliche Bausünden von Schloss Stechlin würden durch diesen verdrehten, aber malerischen Einfall wieder gut gemacht«.
Richtig Karriere machte Bausünde erst in den Zwanziger- und Dreißigerjahren. Die Bauten der Moderne weckten offenbar das Bedürfnis nach einem Verdammungswort, mit dem man sein Befremden über die neue Architektur zum Ausdruck bringen konnte. In der zweiten Hälfte der Vierzigerjahre kommt sein Gebrauch dann wahrhaftig zum Erliegen. Offenbar gab es in den deutschen Trümmerwüsten der Nachkriegszeit keine Häuser mehr, die man als Bausünden empfand. Man war froh über jedes, das noch stand.
Zu florieren beginnt Bausünde wieder in den Siebzigerjahren, als man sich allmählich nicht mehr über jeden neuen Betonklotz freute, sondern sich gegen die Zumutungen der brutalistischen Architektur zu wehren begann. Die Bausünden der Nachkriegszeit werden zu einer populären Redewendung. Nach der Wende macht dieser Genitivattributkomposition allenfalls noch die Phrase von den Bausünden des Sozialismus Konkurrenz.
In einem Land mit schrumpfender Bevölkerung, wo Häuser im Überfluss vorhanden sind, ist die Bausünde nicht lässlich, sondern todeswürdig. Und in Berlin erhofft man sich eine Reinigung von den Bausünden, die die DDR in der Mitte der Stadt hinterlassen hat. Gesammelt werden auch Spenden für den Wiederaufbau von Karl Friedrich Schinkels Bauakademie – gleich neben dem Schlossneubau und nahe der Museumsinsel. Es ist, als wäre Schinkel, in dessen Umfeld die Bausündenlehre erstmals architekturtheologisch formuliert wurde, der Heilige, von dem man sich nun Absolution für die Verirrungen und Versäumnisse der Gegenwart erhofft.
Denglisch
Wenn das Wording bullshit ist