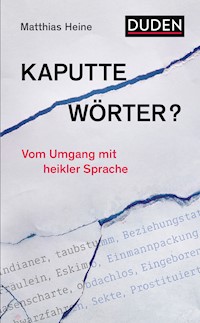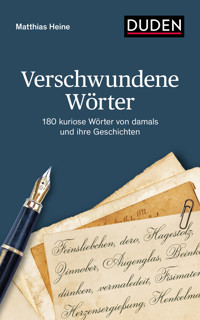Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliographisches Institut
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Duden - Sachbuch
- Sprache: Deutsch
Matthias Heine ermöglicht einen einfachen Zugang zu gebildeter und gehobener Sprache und nimmt uns mit auf eine Kulturgeschichte der Bildungssprache. Wörter wie "Ambiguität", "Chimäre", "eruieren" und "genuin" werden erklärt in ihrer Geschichte, ihren aktuellen Verwendungsweisen und den damit verbundenen Fallen. Was ist problematisch an "Narrativ" und an "Taxonomie" und wann sind "redundant" oder "latent" passend einzusetzen? Dieser Ritt durch die interessantesten Wörter der deutschen Bildungssprache ermöglicht es die eigene Sprache aufzubessern und Spannendes über sie zu erfahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Heine
Kluge Wörter
Wie wir den Bildungswortschatz nutzen können — und wo seine Tücken liegen
Inhalt
Schwere Wörter – mots savants – inkpot words
ab ovo
abundant
Adept
affirmativ
Ägide
Agonie
Ambiguität
Anathema
-ant
Antagonist
Aperçu
Aplomb
apodiktisch
Apologet
-är
arbiträr
Archetyp
Astralleib
aufoktroyieren
avant la lettre
avisieren
bigott
brachial
bramarbasieren
Büchse der Pandora
Canossagang
Charisma
Chimäre
Chuzpe
Couleur
Dekade
Desiderat
desolat
determinieren
dezidiert
Diadochenkämpfe
Dichotomie
dis-
diskreditieren
Diskurs
Disruption
Dissens
Distinktion
divergieren
dysfunktional
Dystopie
echauffieren
eklatant
elaboriert
enigmatisch
ephemer
Epigone
Epitheton
eruieren
Ethos
evozieren
exorbitant
Foliant
frappierend
Friktion
frugal
fulminant
Furor
genuin
gerieren
Gran
Habitus
Hekatombe
heterogen
holistisch
Hybris
Hydra
idiosynkratisch
-ieren
impertinent
inhärent
inkommensurabel
Insignien
Invektive
Kairos
Kanon
katexochen
Kohärenz
Koinzidenz
kongenial
kongruent
konzedieren
konzis
Koryphäe
Kotau
kulminieren
Lackmustest
lakonisch
latent
-lateral
luzid
mäandern
Makulatur
maliziös
Menetekel
misogyn
Monolith
morbid
mutieren
Narrativ
obsolet
Odium
Orkus
Paladin
Paradigma
Parforceritt
par ordre du mufti
Pendant
peripher
Petitesse
Philippika
Placet
postulieren
prädestinieren
Prämisse
profan
Prokrustesbett
Pyrrhussieg
qua
Quintessenz
Rabulistik
Ratio
realisieren
redundant
Refugium
renitent
Replik
respektive
Rudiment
sakrosankt
sardonisch
servil
sibyllinisch
sic!
sophistisch
stoisch
stupend
Suada
sublim
Sujet
sybaritisch
tangieren
Taxonomie
Tirade
Topos
ubiquitär
usurpieren
utilitaristisch
va banque
Verve
virulent
volatil
Volte
Xenophobie
Zäsur
Zerberus
Leseempfehlungen
Schwere Wörter – mots savants – inkpot words
Wer im englischen Sprachraum anzeigen will, dass er gebildet ist, der gebraucht das Wort Bildungsroman. Denn dieses Literaturgenre, das Goethe 1795 mit »Wilhelm Meisters Lehrjahre« prototypisch prägte, ist so deutsch, dass sich seine Bezeichnung offenbar nicht übersetzen lässt. Ganz offensichtlich ist in jener Zusammensetzung nicht der zweite Wortbestandteil das, was dem Übersetzer Probleme bereitet, denn Roman lässt sich einigermaßen verlustfrei mit novel ins Englische bringen. Sondern es ist der schillernde Begriff Bildung, der seit Wilhelm von Humboldt und den Weimarer Klassikern so sehr philosophisch und patriotisch aufgeladen ist, dass er gewissermaßen zu einem Baustein deutschen Nationalbewusstseins wurde. Als deutsche Intellektuelle im 19. Jahrhundert die französische Formel vom »Volk der Dichter und Denker« übernahmen, da taten sie das in der stolzen Überzeugung, dass hier die Bildung wahrhaft zu Hause sei.
Wer von der Bildungssprache und dem Bildungswortschatz berichten will, muss also zunächst klären, was überhaupt mit Bildung gemeint ist. Offensichtlich ist das Wort in den beiden genannten Zusammensetzungen nicht hundertprozentig bedeutungsgleich mit dem Gebrauch in Wörtern wie Bildungsministerin, Bundesministerium für Bildung und Forschung oder Bildungspolitik. Denn in diesen Bezeichnungen ist mit Bildung jede Art von schulischer, fachhochschulischer sowie universitärer Lehre und Ausbildung meist jüngerer Menschen gemeint. Doch nicht alle, die einen Schulabschluss, ein Fachhochschuldiplom oder einen universitären Grad unterhalb des Doktoren- oder Professorentitels haben, werden deshalb automatisch von ihren Mitmenschen als gebildet angesehen.
Bildung
Die Begriffsgeschichte des Wortes Bildung kann hier nicht ansatzweise nacherzählt werden. Das entsprechende, von dem Historiker Rudolf Vierhaus verfasste Kapitel im Standardwerk »Geschichtliche Grundbegriffe« umfasst 43 Seiten. Für uns genügt es, den Bildungsbegriff Wilhelm von Humboldts kurz zusammenzufassen. Denn was wir als Bildung ansehen und welche Menschen wir gebildet nennen, ist immer noch bestimmt von den Ansichten des Sprachwissenschaftlers, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts das preußische Bildungssystem reformierte und für lange Zeit prägte. Auch für den hohen Stellenwert, den Bildung bis heute im deutschsprachigen Raum besitzt, ist Humboldt mitverantwortlich. Bildung war für ihn nicht die bloße Aneignung von nützlichem Wissen, sondern ein Prozess, in dem man die eigene Individualität und den eigenen Charakter ausbildet. Humboldt erklärt:
Der wahre Zwek des Menschen – nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt – ist die höchste und proportionirlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen.
Diese Selbstbildung diente keinem äußeren Ziel und konnte somit nicht einfach als beendet betrachtet werden, wenn man sich ein bestimmtes Maß an brauchbarem Wissen angeeignet hatte. Sie war, wie alles, was ganzheitlich ist, im Prinzip endlos. Dieses niemals als beendet zu betrachtende Streben erinnert nicht zufällig an das niemals abgeschlossene Ringen religiöser Menschen um die Erkenntnis von Gottes Willen und den eigenen Stand der Gnade. Das säkulare Bildungsideal trat an die Seite der religiösen Vervollkommnung, und mehr und mehr trat es auch an deren Stelle.
Doch so wie Humboldts Bildungsideal eine säkulare Religiosität war, wurde Bildung allmählich weiter säkularisiert, und der quasireligiöse Anspruch, mit dem der Begriff aufgeladen war, verdunstete mehr und mehr. Unterhalb der idealischen Sphäre Humboldts betrachtete man Bildung, die an den von Humboldt und seinen Schülern reformierten Gymnasien und Universitäten vermittelt wurde, nicht nur als eine Summe von Wissen und Fähigkeiten, sondern ebenso als einen Habitus, an dem sich die Absolventen solcher Einrichtungen erkannten.
Bildungssprache
Zu diesem Habitus gehört die Bildungssprache. Der Soziologie Pierre Bourdieu, der den Ausdruck Habitus in den Bildungswortschatz einschleuste, zählt sie in seinem epochalen Werk »Die feinen Unterschiede« zum »symbolischen Kapital«; in diesem Sinne dient sie nicht zuletzt als Signal von Prestige und Distinktion. Aus einer anderen Perspektive beschreibt der Linguist Gerhard Augst die Bildungssprache als
Sprache des öffentlichen Diskurses, in dem akademisch gebildete Laien sich zur eigenen Lebensbewältigung mit den Problemen in der Welt auseinandersetzten. Sie übernehmen dabei auch, wo nötig, Fachsprache und lehnen sich in der Erkenntnisgewinnung und Argumentation an die Wissenschaftssprache an.
Bis um 1900 war die Bildungssprache geprägt durch Syntax und Semantik der klassischen Literatur wie der idealistischen Philosophie. Ihre Begriffe wurden häufig durch die »traditionsfortbildenden Geisteswissenschaften«, so der Philosoph Jürgen Habermas, und die Geschichtsschreibung vermittelt. Nach 1900 gelangte allmählich der Wortschatz eines neuen Wissens in die Bildungssprache, das die alten Traditionen zum Teil radikal infrage stellte, Beispiele hierfür sind Darwins Evolutionstheorie (Selektion) und die Psychoanalyse (ödipal). Neue Wortschübe kommen seit den 1950er-Jahren aus der Lernpsychologie (elaboriert) und der Verhaltensforschung (Konditionierung) sowie in starkem Maße aus den Sozialwissenschaften (Habitus, Distinktion) und der Linguistik (redundant).
Daneben wird der Bildungswortschatz seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch Wörter aus Naturwissenschaften und Technik in übertragener Verwendung verstärkt wie Quantensprung, Big Bang, Epizentrum, Lackmustest oder Transmissionsriemen. Zudem werden manchmal dem Englischen entlehnte Wörter wie Essentials oder Appeal dem modernen Bildungswortschatz zugerechnet; deren Status ist aber noch ungesichert. Bezeichnenderweise nimmt Gerhard Augst in seine erklärende Wortliste fast nur Ausdrücke aus dem klassischen Bildungswortschatz auf. So beschränke auch ich mich auf Wörter aus diesem Bereich.
Bildungssprache ist nicht ausschließlich durch die Verwendung bestimmter Wörter gekennzeichnet. Sie ist genauso geprägt von komplexer Satzstruktur, Nominalphrasen, Verbalabstrakta, verstärktem Gebrauch des Passivs und korrekter Beherrschung der Konjunktivformen zur bewussten Markierung von Sprachebenen. Das Wesen der Bildungssprache ist Schriftnähe; selbst mündliche Vorträge sind erkennbar oft schriftlich ausgearbeitet.
Bildungswortschatz
Das markanteste Kennzeichen der Bildungssprache ist die Verwendung eines bestimmten Vokabulars. Gemeinsam ist den Wörtern des klassischen Bildungswortschatzes, dass sie sehr häufig dem sogenannten Eurolatein angehören – einem in vielen europäischen Sprachen ähnlich gearteten Repertoire lateinischer Wörter und lateinischer Wortbildungselemente. Darunter sind wiederum viele ursprünglich altgriechische Wörter, die aber in ihrer lateinischen Form und in lateinischer Schreibweise gebraucht werden.
Gerade bei diesen Graecolatinismen handelt sich sehr häufig um Lehnwörter, die zunächst in wissenschaftlichen Fachsprachen aufgenommen wurden (Apologet), oder um neue Fremdwörter, die dort mit entlehnten Elementen gebildet wurden, aber keinerlei Entsprechung in den Ausgangssprachen Latein oder Griechisch hatten (heterogen). In die Allgemeinsprache gelangten sie schließlich mit einer erweiterten, oft metaphorischen Bedeutung. Der Politikwissenschaftler Kurt Sontheimer spricht dem beschriebenen Aneignungsprozess einen tatsächlich im besten Sinne bildenden Effekt zu. In dem folgenden Zitat geht es zwar um das Eindringen des vor allem sozialwissenschaftlich und linguistisch geprägten Wortschatzes der 68er-Generation in die Allgemeinsprache, aber was Sontheimer sagt, gilt genauso für den älteren Bildungswortschatz und seine Quellen:
Aus dem neueren Theoriebewusstsein dringen die von ihm geprägten Wörter in die tägliche Sprechweise ein, verunsichern oft die hergebrachten Bedeutungsgehalte und verweisen, wenn sie einmal etabliert sind, auf das umfassende theoretische Gebäude, dem sie entlehnt sind.
Verwendung und Bewertung
Das Verb verunsichern im Zitat verweist darauf, dass die Verwendung solcher Wörter keineswegs immer positiv gesehen wird. Sie kann auch als Herrschaftsgeste einer Reflexionselite empfunden werden oder schlicht als angeberisches und ausschließendes Sprecherverhalten. Der Sprachphilosoph Friedrich Kambartel, für den Pragmatismus, Exaktheit sowie die Ablehnung von Formalismus bestimmend waren, urteilte hier besonders harsch. Seiner Meinung nach dienten die klugen Wörter weniger der Verständigung, sondern sollten vor allem »gruppen- bzw. schulbezogene Zustimmungs- oder Ablehnungsdispositionen signalisieren«:
Sich im System der […] bildungssprachlichen Formeln hinreichend gewandt bewegen zu können, bringt in der Öffentlichkeit ebenso wie im Bereich von Wissenschaft und Bildung Anerkennung und gehobene Positionen.
Selbst Wissenschaftler, die dieses Maximalurteil nicht teilen, sind sich einig, dass bildungssprachliche Wörter aus Prestigegründen oder in ideologischer Absicht zu bestimmten Zwecken missbraucht werden. Beispiele hierfür sind Imponiergehabe, Anzeigen des sozialen Aufstiegs sowie das Streben, Einstellungen des Gegenübers durch sprachliche Überrumpelung und Verschleierung zu beeinflussen.
Dieses Misstrauen gegenüber der Bildungssprache und gegenüber jedem, der kluge Wörter allzu häufig gebraucht, rührt von ihrer Exklusivität her. Denn Bildungssprache ist keineswegs jedem vertraut, der irgendeinen Bildungsgang abschließt, für den die Bildungspolitik und die Bildungsministerien zuständig sind. Gerhard Augst berichtet, der Anlass für sein Buch über Bildungssprache sei gewesen, dass sich Studenten über die Verwendung ihnen zunächst unverständlicher Wörter, die nicht im eigentlichen Sinne zur Fachsprache ihres Studiengebietes gehören, beschwert hätten. Einige hätten sogar Glossare mit solchen Ausdrücken angelegt, um ihre akademischen Lehrer zu verstehen. Selbst der Abschluss eines Studiums lässt dem Akademiker die Bildungssprache und den Bildungswortschatz nicht in gleichem Maße geläufig werden.
Wie Augst auszählt, werden Wörter aus dem Bildungswortschatz besonders häufig in den Feuilletons der drei von ihm untersuchten Intelligenzblätter »Spiegel«, »Zeit« und »Frankfurter Allgemeine« verwendet. Spitzenreiter ist hier – wenig überraschend – die oft als »Lehrerblatt« bezeichnete »Zeit«, gefolgt von »FAZ« und »Spiegel«. Die Häufung im Feuilleton weise darauf hin, dass Bildungswortschatz vor allem bei geistes-, kultur- und sozialwissenschaftlichen Themen gebraucht werde. Augsts Beobachtungen werden durch Recherchen für das vorliegende Buch bestätigt. Allerdings stellt er auch in der sich an Ingenieure richtenden Zeitschrift »VDI-Nachrichten« einen Anteil an Bildungswortschatz fest, der auf dem Niveau von »FAZ« und »Zeit« liegt und deutlich über dem des »Spiegels«. Noch einmal mehr als doppelt so viele bildungssprachliche Wörter findet Augst erwartungsgemäß auf den Seiten der »Mitteilungen des deutschen Germanistenverbands«.
Die enge Verbindung zwischen den Geisteswissenschaften und der Bildungssprache wird nicht zuletzt dadurch bestätigt, dass sich im Individualstil von Geistesriesen jener Fachgebiete einschlägige Ausdrücke auffällig häufen. So hätte ich Gebrauchsbeispiele für dieses Buch nahezu ausschließlich mit Belegen aus den Werken von Max Weber, Ernst Troeltsch, Arnold Gehlen, Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas und Niklas Luhmann bestreiten können. Sie bestätigen damit Augsts Definition, beim Bildungswortschatz handele es sich um »sprachliche Ausdrücke für die systematische kognitive Auseinandersetzung mit sich und der Welt«.
Genau dafür wird die Bildungssprache von Jürgen Habermas in einem wegweisenden Vortrag von 1977 geradezu als Transportmittel der Aufklärung gefeiert:
Wissensfortschritte setzen sich im alltäglichen Bewusstsein dadurch fest, daß Termini […] aus einer Wissenschaftssprache in den mündlichen Sprachgebrauch übernommen werden.
Dem sozialwissenschaftlichen und linguistischen Vokabular, das damals in die Bildungssprache eingeführt wurde, traut der Philosoph sogar bewusstseinsverändernde Wirkung zu: »Eine Theoretisierung der Bildungssprache untergräbt das Bewußstein praktischer Gewißheiten.«
In eine ähnliche Richtung weist der kanadische Pädagoge Jim Cummins, für den Bildungssprache – neben Wissenschaftssprache und Schulsprache – zum Komplex der »Cognitive Academic Language Proficiency« – kurz CALP – gehört. Die deutschen Forscher Peter Koch und Wulf Oesterreicher nennen diese Register »Sprache der Distanz«. »Distanz« ist hier jedoch nicht im Sinne von Distinktion gemeint, sondern als Mittel der Objektivierung. Dabei tritt man sprachlich einige Schritte zurück, um Abstand zur alltäglichen Erfahrungswelt, zur Gewohnheit und zum gesunden Menschenverstand zu gewinnen, damit sich die Dinge kälter und klarer sehen lassen.
Bildungssprachen im Wandel
Nicht jedes bildungssprachliche Wort funktioniert so und nicht alle gelangten nach dem oben beschriebenen Schema in die deutsche Bildungssprache. Vor allem die französischen Wörter, die nach den Graecolatinismen die größte Gruppe des klassischen deutschen Bildungswortschatzes bilden, nahmen nicht immer den Weg über Wissenschafts- und Fachsprachen, sondern wurden direkt aus der Bildungssprache des Nachbarlandes in unsere übernommen.
Dieser Prozess setzte ein, als Französisch das für mehr als 1000 Jahre führende Latein als Bildungssprache westeuropäischer Eliten bedrängte und teilweise sogar ablöste. Das Wort Bildungssprache bezeichnet nämlich keineswegs immer nur eine bestimmte Stilebene, Gruppensprache oder Varietät im Rahmen der inneren Mehrsprachigkeit, etwa des Deutschen. Vielmehr kann die Bildungssprache eines Landes oder eines Kulturkreises tatsächlich auch eine ganz andere Fremdsprache sein, die nur Eliten zur Kommunikation nutzen. So war Griechisch in der Antike die Bildungssprache der gesamten hellenistischen Welt. Dann diente Latein spätestens ab der sogenannten karolingischen Renaissance bis zur frühen Neuzeit als Bildungssprache Westeuropas. Und vom 17. bis zum 19. Jahrhundert war Französisch die Bildungssprache ganz Europas – man denke nur an die französischen Dialoge russischer Adeliger auf den ersten Seiten von Lew Tolstois »Krieg und Frieden«.
Ob dieser Status in der Gegenwart durch das Englische eingenommen wird, scheint mir zweifelhaft. Englisch zu können, ist heute eine ubiquitäre (ubiquitär) Fähigkeit wie Lesen und Schreiben, kein besonderes Bildungssignal. Es ist eine Lingua Franca, keine Bildungssprache. Anglizismen werden trotz des Status, den Englisch als internationale Wissenschaftssprache einnimmt, von vielen sprachbewussten Menschen nicht als gebildet empfunden, sondern oft als lächerlich, wichtigtuerisch oder verschleiernd und geradezu dümmlich – vor allem, wenn sie sich unverhältnismäßig häufen wie in der Sprache der Werbung oder im Businessjargon. Anglizismen gelten nur dann als unbestreitbar »bildungssprachlich«, wenn sie – wie redundant, Narrativ oder dysfunktional – neu gebildete Fremdwörter auf Basis der klassischen Bildungssprachen Griechisch und Latein sind.
gehoben versus bildungssprachlich
Die Erinnerung an jene Bedeutung von Bildungssprache – »Fremdsprache, in der die gebildeten Eliten eines Landes kommunizieren« – hilft bei der Differenzierung zwischen einerseits Bildungswortschatz und andererseits Vokabular, das dem »gehobenen« Sprachgebrauch angehört. In der Zuordnung sind sich nämlich die verschiedenen Wörterbücher wie das DWDS, der Duden und der leider nicht mehr fortgeführte »Wahrig« nicht immer einig. »Gehoben« nennt das Duden-Synonymwörterbuch »Wörter, die bei feierlichen Anlässen und gelegentlich in der Literatur verwendet werden (z. B. Brodem für Dunst, anheimgeben für überlassen)«. Als »bildungssprachlich« werden dort definiert: »Wörter (meist Fremdwörter), die eine hohe Allgemeinbildung voraussetzen (z. B. Koryphäe für Experte/Expertin, äquivalent für gleichwertig)«. Mir scheint der Hinweis auf die Fremdwörter entscheidend. »Gehobene« Wörter gehören überwiegend zum deutschen Stammwortschatz, während »bildungssprachliche« Wörter zumeist auf die älteren Bildungssprachen Griechisch, Latein und Französisch zurückgehen.
Auswahl in diesem Buch
Von diesem Prinzip lasse ich mich auch bei der Auswahl der Wörter in diesem Buch leiten. Außerdem bevorzuge ich erklärungsbedürftige Wörter gegenüber solchen, die allgemein bekannt sind. Ein Kriterium für die Aufnahme ist zudem, wenn sich anhand des jeweiligen Wortes ein besonderes Stück Kulturgeschichte nacherzählen lässt. Oder wenn es stellvertretend für einen Einfluss, eine Quelle oder eine Epoche der deutschen Bildungssprache steht. Auf diese Weise ergibt sich zwar kein vollständiges Register – der aktuell noch im Duden-Universalwörterbuch verzeichnete einschlägige Wortschatz umfasst mehrere Tausend Wörter –, aber doch eine beispielhafte Auswahl interessanter Ausdrücke und Wendungen des deutschen Bildungswortschatzes, die seine Geschichte, Gebrauchsweisen, Tendenzen und Tücken anschaulich machen sollen.
Für alle im Folgenden aufgeführten schweren Wörter – so der Titel eines Werks von Gisela Zifonun und Gerhard Strauß über die Semantik solcher Wörter –, die man auf Französisch mots savants (›kluge/weise Wörter‹ – davon leitet sich auch der Titel dieses Buchs ab) oder auf Englisch inkpot words (›Tintenfasswörter‹) nennt, ist jedoch immer wohlwollend zu bedenken, dass sie in erster Linie dazu dienen, sich der Welt auf eine besondere Weise zu vergewissern.
ab ovo
Wer Lateinkenntnisse hat, könnte auf die Idee kommen, dieser Ausdruck, der wörtlich ›vom Ei an‹ bedeutet, verweise auf den ewigen Streit, ob erst das Huhn oder erst das Ei da war. Die Fakten sind aber komplizierter – und interessanter. Eine Erklärung verweist zum Beispiel auf die ausgedehnten römischen Gastmähler, die mit Eiern begannen und mit einem Früchtegang endeten, also ab ovo usque ad mala dauerten – ›vom Ei bis zu den Äpfeln‹. Ein anderer möglicher Ursprung ist eine Stelle in der literaturtheoretischen Schrift »Ars Poetica« des römischen Dichters Horaz. Dort gilt als guter Autor, wer sofort in medias res (›mitten ins Geschehen‹) geht und seine Geschichte nicht ab ovo erzählt. Horaz bezieht sich dabei auf das Vorbild Homers, der in seiner »Ilias« die Geschichte des Trojanischen Krieges im neunten Jahr beginnt. Erst viel später erfährt der Leser, wie die kriegsauslösende schöne Helena und ihr Zwillingsbruder aus Eiern schlüpften, die ihre Mutter Leda geboren hatte, nachdem Zeus sie in der Gestalt eines Schwans geschwängert hatte.
In der Bedeutung ›von Anfang an‹ gelangte die Wendung ab ovo zu Beginn des 17. Jahrhunderts ins Deutsche. In der Übersetzung einer Sammlung von »Diebs-Historien« über »Beutelschneider« und ihre Spießgesellen des Franzosen François de Calvi steht 1627 der Satz: »Last uns anfangen ab ovo, vom Ey / wie die Latiner zu reden pflegen / und last uns die Historien von jhrem anfang recht erzehlen.«
Die Phrase ab ovo drückt jedoch nicht nur Gründlichkeit und Systematik aus, sondern kann – wie schon beim Dichter Ovid – ebenso allzu große Umständlichkeit beschreiben. In Gerhart Hauptmanns Drama »Die Ratten« etwa gehört sie zu den vielen lateinischen Wendungen, mit denen Harro Hassenreuter seine Rede würzt: Damit möchte der verkrachte Theaterdirektor seine Bildung herausstreichen, verrät sich aber unbeabsichtigt als verknöcherter Pedant.
In diesem Buch bildet ab ovo nicht nur alphabetisch den Auftakt. Die Redensart steht zugleich stellvertretend für all die lateinischen Wendungen und Mehrwortlexeme, die uns die Antike, das mittelalterliche Kirchenlatein und die Renaissance bescherten: Es sind so viele, dass sie dieses Buch leicht auf den doppelten Umfang aufblasen könnten. Sub specie aeternitatis wäre vielleicht wünschenswert, doch quod licet jovi, non licet bovi. Ich muss nolens volens auf sie verzichten, gewiss nicht sine ira et studio, aber es gilt nun mal auch hier: Habent sua fata libelli.
abundant
Das Adjektiv, das sich mit ›häufig (vorkommend), reichlich‹ umschreiben lässt, ist das noch gebildetere Gegenstück zu redundant, mit dem es allerdings auch Bedeutungsüberschneidungen aufweist. Beide werden unter anderem genutzt, um bildungssprachlich auszudrücken, dass etwas überflüssig sei. Abundant ist jedoch älter: Seit dem späten 17. Jahrhundert taucht das Wort, das aus lateinisch abundans (›überflutend, übermäßig‹) abgeleitet ist, in deutschsprachigen Texten auf. So informiert 1715 das »Frauenzimmer-Lexicon« von Gottlieb Siegmund Corvinus zum Thema Carfiol (›Blumenkohl‹): »Bey Manns-Personen stimuliret er Venerem, und vermehret derer Frauens-Personen fluorem album, weil er allzu abundant nutriret.« Übersetzt heißt das so viel wie: ›Bei Männern regt das Gemüse die Potenz an, und bei Frauen führt er zu vermehrtem Vaginalausfluss, weil es allzu nahrhaft ist.‹ Dieser wichtige Ernährungshinweis ist natürlich keineswegs abundant.
Adept
Heute wird das Wort vorwiegend in der Bedeutung ›Jünger, Schüler, Bewunderer‹ gebraucht, manchmal auch analog zu ›Nachahmer‹. Doch ursprünglich bezeichnete Adept eine Person, die – im Gegensatz zu Anfängern oder Außenstehenden – in einen Kult, eine Kunst oder eine Wissenschaft eingeweiht war. Dies entspricht dem Sinn der aufklärerischen Maxime, die Christoph Martin Wieland in seinem Buch »Sympathien« mit dem englischen Untertitel »As soul approaches soul« aus dem Jahr 1756 zusammenfasst: »Verbreite die Wahrheit, welche kein Geheimnis unter etlichen wenigen Adepten seyn soll, über alle Arten von Ständen und Menschen.« Auch in Goethes »Faust« sind nicht etwa Schüler gemeint, wenn der Doktor über seinen Vater berichtet:
Mein Vater war ein dunkler Ehrenmann,
Der über die Natur und ihre heilgen Kreise,
In Redlichkeit, jedoch auf seine Weise,
Mit grillenhafter Mühe sann.
Der, in Gesellschaft von Adepten,
Sich in die schwarze Küche schloss,
Und, nach unendlichen Rezepten,
Das Widrige zusammengoss.
Das Wort kam um 1700 in der Form Adeptus aus dem Lateinischen ins Deutsche. Nach 1800 herrscht dann ausschließlich die eingedeutschte, verkürzte Form Adept vor. Adeptus ist die substantivierte Form des Partizip Präteritum adeptus, das zum lateinischen Verb adipisci (›erringen, geistig erfassen‹) gehört.
Zu den Adepten, die das Wort im 20. Jahrhundert noch gebrauchten, zählten Elias Canetti und Thomas Mann, der 1930 seine Autobiografie »Lebensabriß« wie folgt beginnt:
Ich bin geboren am Sonntag, den 6. Juni 1875, mittags zwölf Uhr. Der Planetenstand war günstig, wie Adepten der Astrologie mir später oft versicherten, indem sie mir auf Grund meines Horoskops ein langes und glückliches Leben verhießen.
Hier ist das Wort eindeutig noch im älteren Sinne von ›Spezialist‹ gemeint, von dem das Duden-Universalwörterbuch heute sagt, er sei »früher« üblich gewesen.
affirmativ
Das Wort, das ›bejahend, bestätigend‹ bedeutet, ist – als Gegenbegriff zu kritisch – ein zentraler Ausdruck des Jargons jener Linken, die man gemeinhin etwas unscharf als die »68er« bezeichnet. Verantwortlich dafür waren möglicherweise Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, die in ihrer erstmals 1944 veröffentlichten »Dialektik der Aufklärung«, einem Hausbuch der kritischen Theorie, über die christlichen Kirchen und ihre Heilsversprechen urteilen: »Darin liegt ihre Unwahrheit: in der trügerisch affirmativen Sinngebung des Selbstvergessens.«
In den Jahren, die auf die Neuauflage der »Dialektik« 1969 folgten, etablierte sich affirmativ dann als Terminus der Kultur- und Gesellschaftskritik. Bei damals viel gelesenen marxistischen Denkern wie dem Kunsthistoriker Otto Karl Werckmeister oder dem Soziologen Claus Offe galt es schlimmster Vorwurf, affirmativ gegenüber den bestehenden Verhältnissen zu sein. In Texten wie Werckmeisters »Von der Ästhetik zur Ideologiekritik« oder Offes »Strukturprobleme des kapitalistischen Staates« wird das Verdammungsurteil freigiebig über die nicht marxistische Kultur, Kunst und Philosophie gefällt – von Kant bis Hollywood. Niklas Luhmann beschreibt diese Etablierung des Wortes Jahrzehnte später in »Die Theorie der Gesellschaft«:
In der Nachfolge des Ideologiestreites des 19. Jahrhunderts, den man eigentlich vermeiden wollte, wurde die Paradoxie der Kommunikation über Gesellschaft in der Gesellschaft in Theoriekontroversen aufgelöst mit Formeln wie strukturalistisch/prozessualistisch, Herrschaft/Konflikt, affirmativ/kritisch oder gar konservativ/progressiv.
Seit den 1960er-Jahren steigt die Gebrauchshäufigkeit von affirmativ nachweisbar an; heute gehört es zum allgemeinen Bildungswortschatz. Vorher, ab dem 16. Jahrhundert, war affirmativ, das von lateinisch affirmativus abgeleitet ist, ein neutraler Begriff im Spezialistenwortschatz von Philosophie, Staatstheorie und Rechtssprache, der dort wie positiv als Gegenwort zu negativ eingesetzt werden konnte und in Linguistik und Logik auch noch so eingesetzt wird. Es gab dazu sogar ein heute obsolet gewordenes feminines Substantiv Affirmative (›Bestätigung‹), das noch Otto von Bismarck verwendete.
Ägide
In einer rein veganen Sprache käme das Wort nicht vor, denn es ist aus Leder hergestellt. Ägide geht zurück auf den bei den Griechen aigis genannten ledernen Schild, den Athene und Zeus am linken Arm trugen, um mit der Rechten Feinde bekämpfen oder Blitze schleudern zu können. Einer Theorie zufolge stellte man sich den Schild entweder aus Ziegenleder angefertigt oder mit Ziegenfell bespannt vor; in diesen Fällen wäre das Wort mit dem griechischen Substantiv aix (›Ziege‹) verwandt. Schon die Griechen vermuteten einen solchen etymologischen Zusammenhang, und einer Sage zufolge war der aigis des Zeus unter anderem aus dem Fell der Ziege gefertigt, die den Göttervater als Kleinkind genährt hatte. Als die Römer das Wort übernahmen, wurde es zu aegis (›Schirm, Schutz, Schild‹), und von dessen Genitivform aegidis ist unser Wort abgeleitet.
In den frühen deutschen Belegen hat das Wort häufig noch dieselbe Bedeutung wie schon bei den alten Griechen. In seinem »Physiognomischen Tagebuch« von 1778 rät der aufgeklärte Schriftsteller Johann Karl August Musäus allen Tugendhaften:
Kein sorgsamer Gedanke, eines deiner Tugend auflauernden Hinterhaltes schrecke dich auf aus deinem Schlummer; sie dekt dich selbst mit ihrer Aegide, und schützt dich sicherer vor den Pfeilen der Versuchung, als ein eisernes Gitterbett nebst Schloß und Riegel.
Doch wie in den alten Sprachen wird das Wort im Deutschen von Anfang an auch übertragen im Sinne von ›(Ober-)Herrschaft, Führung, Leitung, Schirmherrschaft‹ verwendet. So lässt der Dichter Klabund in seinem Theaterstück »Der Kreidekreis«, das viel unbekannter ist als das ähnlich benannte, von Klabund angeregte Drama Bertolt Brechts, einen Soldaten sagen: »Der Weg nach Peking, wo der neue Kaiser in eigner himmlischer Person den ersten Hinrichtungen seiner Ägide beizuwohnen geruhen wird, ist noch weit.« Früher konnte Ägide auch ›Schein, Vorwand, Deckmantel‹ bedeuten. In diesem Sinne gebrauchten es noch Christoph Martin Wieland und Annette von Droste-Hülshoff.
Agonie
In einem Buch über schwierige Wörter, deren Bedeutung nicht jedermann geläufig ist, die aber von Unberufenen gerne gebraucht werden, um sich den Anschein von Bildung und Weltläufigkeit zu geben, darf Karoline Stöhr nicht fehlen. In Thomas Manns Roman »Der Zauberberg« ist die Musikergattin aus Cannstatt über viele Jahre eine Tischgenossin von Hans Castorp im Sanatorium Berghof. Der junge Mann und sein Cousin Joachim sind allerdings abgrundtief erschüttert von ihrer Banalität und Dummheit:
Karoline Stöhr war entsetzlich. Wenn irgend etwas den jungen Hans Castorp in seinen redlich gemeinten geistigen Bemühungen störte, so war es das Sein und Wesen dieser Frau. Ihre beständigen Bildungsschnitzer hätten genügt. Sie sagte »Agonje« statt Todeskampf; »insolvent«, wenn sie jemandem Frechheit zum Vorwurf machte.
Vorbild für Karoline Stöhr war eine Frau namens Emma Stöhr aus dem heute zu Stuttgart gehörenden Cannstatt, die Katia Mann 1912 während eines durch Bronchienschwäche erzwungenen Kuraufenthalts in Davos kennengelernt hatte und auf die sie ihren Mann während eines Besuchs aufmerksam machte. Gelegenheit, »Agonje« zu sagen, gab es im Berghof und ähnlichen Einrichtungen reichlich: Einer Statistik zufolge starben 70 Prozent der Patienten in den Davoser Kliniken innerhalb von zehn Jahren nach Beginn ihres ersten Aufenthalts.
Das Wort Agonie taucht in der lateinischen Form Agonia mit der Bedeutung ›äußerste Angst, Todeskampf‹ seit dem 16. Jahrhundert in deutschen Texten auf. Das lateinische Wort geht zurück auf das griechische Wort agonia (›Kampf, Anstrengung‹), von dem auch das bildungssprachliche deutsche Adjektiv agonal (›wettkampforientiert‹) hergeleitet ist. Die heutige Schreibweise Agonie setzte sich im 18. Jahrhundert unter dem Einfluss des französischen agonie gegen die ältere Form durch. Rilke zum Beispiel erzählt in den »Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge« vom unterbrochenen Todeskampf des »heiligen Jean de Dieu, der in seinem Sterben aufsprang und gerade noch zurechtkam, im Garten den eben Erhängten abzuschneiden, von dem auf wunderbare Art Kunde in die verschlossene Spannung seiner Agonie gedrungen war«.
In einem weitaus weniger wunderbaren und tröstenden Sinn steht das Wort 1942 bei Victor Klemperer in seinen Tagebüchern aus der NS-Zeit, deren Endphase er mit seiner Frau in einem sogenannten Judenhaus auf die Deportation wartend verbringen musste. Hier hat es die Bedeutung ›Todesangst‹: »Noch eine Woche dieser Agonie, dann kommt das zweite Judenhaus an die Reihe.« Am häufigsten liest man aber die Wendung in Agonie liegen, die in Medien gern auf verfallende Imperien, im Niedergang befindliche Parteien, erfolglose Wirtschaftsunternehmen und Ähnliches bezogen wird.
Ambiguität
Jesus Christus war ein Freund klarer Worte: »Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel«, schärfte er seinen Zuhörern in der Bergpredigt ein. Kein Wunder also, dass Doppeldeutigkeit den Kirchen als verdächtig galt. Als dafür im 16. Jahrhundert das aus dem Genitiv ambiguitatis zu lateinisch ambiguitas entlehnte Wort in das gelehrte Deutsch gelangte, nutzten es vor allem Theologen, die ihren Gegnern Zweideutigkeit unterstellen wollten.
Auch in der Sprache des Rechts war Eindeutigkeit ein äußerst erstrebenswertes Ziel, und daher war die zweite Spezialistengruppe, bei der man Ambiguität im 16. und 17. Jahrhundert häufiger lesen konnte, die der Juristen. So berichtet 1688 der Staatsrechtler Samuel von Pufendorf, dass die schwedische Gesandtschaft bezeugt habe, wie eine Stelle im Westfälischen Friedensvertrag von 1648 auszulegen sei, um »ins künftige alle Gelegenheit zu Ambiguität und Streite zu vermeiden«. Im 18. Jahrhundert findet man das Wort dann seltener, bevor es im 19. Jahrhundert unter dem Einfluss von französisch ambiguité in der Philologie wieder häufiger gebraucht wurde, um sprachliche Doppeldeutigkeit auszudrücken.
In diesem Sinn verwendet den Terminus auch die moderne Linguistik, und von dort ausgehend wurde die Ambiguität seit den 1970er-Jahren nachgerade zum Modewort. Wer sich noch abheben will, muss das Verb ambigieren (›schwanken, unsicher sein‹) oder das fast ebenso seltene Adjektiv ambig (›doppeldeutig‹) ins Spiel bringen. Oder man benutzt das vermutlich von englisch ambiguous beeinflusste Adjektiv ambiguos, das nahezu ausschließlich bei Thomas Mann belegt ist, von ihm aber offenbar besonders geschätzt wurde. Im »Doktor Faustus« lässt er Adrian Leverkühn postulieren: »Wahre Leidenschaft gibt es nur im Ambiguosen und als Ironie.« Und über den »Zauberberg« schreibt Mann 1953 ironisch an den Germanisten Eberhard Hielscher: »Es geht ›ambiguos‹ dabei zu, daran ist kein Zweifel – ähnlich, mit Verlaub, wie bei Goethe. Der war auch immer ambiguos.« Das Wort Ambiguitätstoleranz wurde übrigens 2023 in das digitale Wörterbuch Duden online aufgenommen.
Anathema
Auch dieses aus dem Lateinischen entlehnte Substantiv mit dem Genus Neutrum hat, wie so viele Wörter des Bildungswortschatzes, einen griechischen Ursprung. In beiden antiken Sprachen meinte anathema ›Weihegeschenk, etwas, das den Göttern vorbehalten ist, Opfergabe‹. Im späteren Kirchenlatein nahm es die Bedeutung ›Kirchenbann‹ an und kann zudem einen mit dem Kirchenbann belegten Verurteilten bezeichnen.
Seit dem frühen 16. Jahrhundert steht das Wort auch in deutschen Texten. So veröffentlicht 1509 ein Augsburger Drucker den ins Deutsche übersetzten Wortlaut einer Bulle des machtbewussten Renaissancepapstes Julius II., der sich mit der Republik Venedig im Krieg befand und den Martin Luther später in seiner Schrift »An den christlichen Adel deutscher Nation« als »Blutsäufer« bezeichnet. Der Titel des Druckes lautet: »Die päpstlich Bull / Proceß / Bann / unnd Anathema so unnser allerhailigister vatter Pabst Julius / wider das groß Commun der Venediger yetzo neulichen hat lassen außgeen«. Später, 1520, wettert Andreas Karlstadt, ein Mitstreiter Luthers, dass Julius’ Nachfolger Leo X. ein Ketzer sei und sich alle, die seiner gegen den Reformator gerichteten Bulle »Exurge Dominis« Folge leisten, »in der vermaledeyung / ban / acht und anathema gottis« befänden.
Daneben findet man in deutschen Texten bis ins 19. Jahrhundert die Bedeutungen ›vom Kirchenbann getroffener‹ und ›Weiheopfer‹ – Letzteres naturgemäß vor allem in Schriften über die Antike, beispielsweise bei Jacob Burckhardt. Seit dem 18. Jahrhundert nimmt Anathema aber auch den allgemeinen Sinn an, in dem es noch heute bildungssprachlich gebraucht wird: ›etwas, das man allgemein für überflüssig und unwert hält, was man meidet, verdammt und abschaffen möchte‹. So liest man in wissenschaftlichen Schriften häufig über Nietzsches »Anathema« gegen die Religion. Und Kurt Tucholsky schöpft in seiner Briefmarkensammlerglosse »Zwei Welten« wie so oft Witz aus dem Trick, Banalstes mit einem hochgestochenen Wort zu bezeichnen. Über einen Philatelisten bemerkt er: »[G]erecht spricht er sein Anathema über falsche Thurn und Taxis und Mauritius.«
Daneben kommt das Wort heute in der gehobenen Mediensprache zum Einsatz. Es soll ausdrücken, dass über eine Sache nicht gesprochen werden darf, das hier sinnverwandte Tabu aber zu schwach oder zu abgegriffen erscheint. In diesem Sinne gemahnte der damalige Bundesaußenminister Joschka Fischer 2001 die Abgeordneten im Bundestag: »Kollege Kinkel [Fischers Amtsvorgänger von der FDP, Klaus Kinkel, mh] wird sich noch gut daran erinnern, dass es ein Anathema im EU-Kreis war, an eine Kooperation von NATO-Generalsekretär und EU überhaupt zu denken.« Fischer nutzte das Wort noch bei anderen Reden, war aber laut den Bundestagsprotokollen der Letzte.
-ant
Diese Adjektivendung ist immer ein starkes Indiz dafür, dass ein Wort der Bildungssprache angehört. Beispielhaft in diesem Buch sind abundant, eklatant, exorbitant, fulminant oder redundant. Flamboyant und mokant wären auch Kandidaten für eine Aufnahme gewesen. Auch heute alltägliche Wörter wie tolerant, amüsant oder penetrant entstammen ursprünglich der Bildungssprache. Wenn es zwei alternative Formen eines Adjektivs gibt wie bei frappierend und frappant, dann ist die auf -ant eindeutig diejenige, die ein stärkeres Bildungssignal sendet.
Das Affix geht auf die Endungen -ans, -ant(is) im Partizip lateinischer Verben der a-Konjugation zurück, die der deutschen Endung -end entsprechen. Doch schon die ältesten Adjektive auf -ant im Deutschen, etwa galant, penetrant und andere im 17. Jahrhundert, stehen unter französischem Einfluss. Amüsant, genant, süffisant, flamboyant, mokant, tolerant und viele andere sind direkte Übernahmen aus dem Französischen. Und selbst blümerant, das man heute für eine wortspielende Bildung mit dem deutschen Stammwort Blume halten könnte, geht zurück auf französisch bleu-mourant (›blassblau, sterbendes Blau‹). Etliche ältere Übernahmen aus der Hochzeit des französischen Einflusses auf die deutsche Sprache im 18. Jahrhundert sind bereits wieder verschwunden. Der Sprachreiniger Carl Wilhelm Kolbe nennt 1809 in seinem Buch »Über Wort-Mengerey« clairvoyant, attrayant, amusant, nonchalant, complaisant, brillant, choquant als Beispiele »mit gemischter Aussprache, lateinischfranzösisch«. Wie man sieht, hat sich das Wortbildungselement -ant deutlich stabiler im Deutschen festgesetzt als einzelne von Kolbe kritisierte Wörter. Attrayant, complaisant und choquant waren vielleicht zu Hochzeiten der Dominanz des Französischen als Bildungssprache gebräuchlich. Doch schon als Kolbes Buch erschien, wurden sie von den Weimarer Klassikern nicht mehr benutzt.
Antagonist
Georg Christoph Lichtenberg, der Physikprofessor, der den deutschen Aphorismus erfand und zugleich vollendete – mir fällt niemand ein, der danach in Deutschland in diesem Genre noch Vergleichbares geleistet hätte –, ist selbst noch nach 250 Jahren ein immer wieder überraschender Autor. Im Heft »D« seiner »Sudelbücher« fragt er im Aphorismus »D 653«, ob je ein Land seinen Schriftstellern so übel mitgespielt habe wie Deutschland. Fündig wird er vorgeblich am anderen Ende der Welt bei den Antipoden:
Das einzige Volk, von dem ich noch etwas Ähnliches erwarte, sind etwa die Neu-Seeländer, und zwar deswegen, weil wir in Deutschland fast eben dieselben Vertikal-Linien haben, und weil sie stolz tapfer und treu sind, wie die Deutschen, und endlich weil sie schon jetzt, da es ihr gänzlicher Mangel an Feder und Dinte nicht anders verstattet, bei gelehrten und andern Dispüten ihre Antagonisten auffressen.
Zu Lichtenbergs Zeit war das Wort Antagonist bereits seit etwa 200 Jahren mit der Bedeutung ›Widersacher, Gegenspieler‹ in deutschsprachigen Texten gebräuchlich. Gelehrte hatten es im 16. Jahrhundert aus dem Lateinischen entlehnt. Dem lag das griechische antagonistos zugrunde, in dem wie in Agonie das Wort agon (›Kampfplatz, Wettkampf‹) steckt.
In der Fachsprache der Medizin hat Antagonist eine freundlichere Bedeutung: Hier bezeichnet er den Muskel, der sich dehnt, nachdem ein agonistischer Muskel sich zusammengezogen hat; erst durch das Zusammenspiel beider kommt es zur Bewegung. Mit der philosophischen Frage, ob nicht auch in der Gesellschaft ähnliche Gegenspiele erst Veränderung ermöglichen, beschäftigte sich Karl Marx: Er sah die Klassengegensätze bekanntlich als Triebfedern der Geschichte und gebrauchte Antagonismus mit der Bedeutung ›dialektischer Widerspruch, der auf dem unversöhnlichen Interessengegensatz verschiedener gesellschaftlicher Klassen beruht‹. Diese Definition entnehme ich dem noch in der DDR erschienenen und deshalb sicher in solchen Fragen sehr kompetenten »Etymologischen Wörterbuch« von Wolfgang Pfeifer. Im ersten Band des »Kapitals« schreibt Marx: »Die Leitung des Kapitalisten ist […] Funktion der Ausbeutung eines gesellschaftlichen Arbeitsprozesses und daher bedingt durch den unvermeidlichen Antagonismus zwischen dem Ausbeuter und dem Rohmaterial seiner Ausbeutung.«
Für Nichtmarxisten bedeutet das im 18. Jahrhundert aufgekommene Wort schlicht ›Gegensatz, Widerstreit‹, früher manchmal auch ›feindseliger Vorbehalt‹. Im letzteren Falle spricht man von Antagonismus gegen etwas; sonst wird das Wort mit der Präposition zwischen verbunden oder zieht einen Genitiv nach sich. Theodor Mommsen zum Beispiel berichtet in seiner »Römischen Geschichte« vom »Antagonismus der Orientalen und Occidentalen«. Seit etwa 1800 ist zudem das Adjektiv antagonistisch verbreitet. So nennt der SPD-Mitbegründer Wilhelm Liebknecht 1878 Österreich und England »die beiden Mächte, deren Interessen denen Russlands am antagonistischsten sind«. Der Titel seines ausgesprochen russlandskeptischen Buchs »Soll Europa kosakisch werden?« klingt heute wieder beunruhigend aktuell – wie ein polemischer Kommentar zum russischen Imperialismus.
Aperçu
Für geistreich werden Deutsche in der Welt genauso wenig gehalten wie für witzig. Den Franzosen wird auf diesem Gebiet allgemein mehr zugetraut – offenbar auch von Deutschen. Es sagt doch einiges, dass beide Wörter für eine geistreiche Bemerkung, die in unserer Sprache existieren, aus dem Französischen übernommen wurden: Bonmot und Aperçu.
Das seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts im Deutschen nachweisbare Bonmot wird von Gerhard Augst noch zum bildungssprachlichen Wortschatz gezählt; in den Duden-Wörterbüchern ist es nicht als bildungssprachlich gekennzeichnet. Es handelt sich offenbar um einen Grenzfall.
Unstrittig bildungssprachlich ist dagegen das später entlehnte Aperçu. Bei Schiller und Goethe liest man es am Ende der 1790er-Jahre zunächst mit den jetzt im Deutschen nicht mehr üblichen Bedeutungen ›Wahrnehmung, Beobachtung‹ oder auch ›kurzer Überblick, Konzept‹. Schiller berichtet Goethe im Mai 1797 über seine Lektüre der Tragödientheorie des Aristoteles, »daß das Ganze nur aus einzelnen Apperçus besteht, und daß keine theoretische vorgefaßte Begriffe dabey im Spiele sind«. Goethe wiederum schreibt an seinen Dichterkollegen Anfang 1798 über den Fortgang seiner naturwissenschaftlichen Arbeiten: »Ich will nächstens Ihnen ein Aperçu über das Ganze schreiben, um von meiner Methode, vom Zweck und Sinn der Arbeit Rechenschaft zu geben.« Im Französischen ist aperçu bis heute in jenen Bedeutungen üblich; zudem kann es ›Seitenansicht‹ beim Computer meinen – aber eben nicht ›geistreiche Bemerkung, Bonmot‹; diesen Bezug hat es nur im Deutschen.
Im Französischen ist das Nomen aperçu die substantivierte Form vom Participe passé des Verbs apercevoir (›bemerken, wahrnehmen‹). Der Philosoph und Sprachkritiker Fritz Mauthner nutzt das Wort 1910 noch in der älteren Bedeutung:
Der Endbegriff, das Ziel, kann dem Denker oder Forscher durch einen Zufall geboten worden sein, durch ein Aperçu, d. h. durch scharfsinnige Beobachtung eines zufälligen Ereignisses.
Für gegenwartssprachlich möglich halten sowohl der Duden als auch das DWDS heute nur noch die Bedeutung ›prägnant formulierte Bemerkung‹, wie sie beispielsweise Thomas Mann in einem Satz über Toni Buddenbrook, verheiratete Frau Permaneder, im Roman »Buddenbrooks« im Sinne hat: »Was aber Madame Permaneder anging, so war sie glücklich, so äußerte ihre lichte Gemütsstimmung sich in Aperçus wie diesem, dass das irdische Leben doch hin und wieder auch seine guten Seiten habe.« Mann nutzt hier das auch von Kurt Tucholsky (Anathema) gern verwendete humoristische Stilmittel, Banales ironisch mit sehr hochgegriffenen Bezeichnungen zu adeln.
Aplomb
Dieses Wort hat eine paradoxe Karriere hinter sich: Es ist schwer wie Blei und kam dennoch in unsere Muttersprache hineingetänzelt. Im Französischen bedeutet plomb nicht nur einfach ›Blei‹, sondern bezeichnet zudem das spezielle Senkblei oder Lot. Solche Bleigewichte an einer Schnur spielten früher in der Architektur eine große Rolle, um gerade, vertikale Linien zu bestimmen. Daraus entstand im 16. Jahrhundert die adjektivische Redensart à plomb, die ursprünglich das Gleiche bedeutete wie unser aus einem ähnlichen Zusammenhang hergeleitete Adverb schnurstracks, nämlich ›vertikal, senkrecht gerade, lotgerecht‹. Bald darauf folgte das maskuline Nomen aplomb (›die Senkrechte‹). Es ist das Äquivalent zu unserem im Lot sein.
Im 17. Jahrhundert wurde aplomb auf Körperliches übertragen und bezeichnete bei Menschen wie Tieren das Gleichgewicht eines standhaften Körpers. Über eine Umschreibung für das seelische Gleichgewicht nahm aplomb schließlich die Bedeutung an, die es bis heute im Französischen hat: ›Sicherheit im Auftreten und Reden, soziale Anerkennung‹. Bei dieser Entwicklung könnte eine Rolle gespielt haben, dass aplomb auch ein Fachausdruck des Balletts ist; dort meint es die Balance, die aus der Fähigkeit zum Abfangen einer Bewegung herrührt. Da sogar der Sonnenkönig Ludwig XIV. in jüngeren Jahren als Tänzer vor Publikum auftrat, erscheint es nicht ganz unwahrscheinlich, dass ein Ausdruck, mit dem die Standfestigkeit beim Tanz beschrieben wird, bald auch auf das Standing bei Hofe übertragen wurde.
Nachdem das Substantiv im 18. Jahrhundert mit noch zwischen Maskulinum und Neutrum schwankendem Genus ins Deutsche gelangt war, lassen die Zitate noch lange eine Verbindung mit der Bühnenkunst erkennen ebenso wie zur Sphäre von Hof, Politik und Militär – auch beim Exerzieren kam es auf Aplomb an. Beides verbindet 1819 der liberale Autor Karl von Bentzel-Sternau in seiner autobiografischen Schrift »Der alte Adam«. Hier urteilt er über den Kurfürsten von Mainz, dass diesem »der Aplomb fehlte, den sich Ludwig der Große in seinen Jugendballetten herbeigetanzt«. Und in E. T. A. Hoffmanns Märchen »Meister Floh« heißt es 1822 über einen Flohzirkus und seinen Dompteur: »Die ganze Mannschaft hatte ein erstaunliches Aplomb, und der Feldherr schien zugleich ein tüchtiger Ballettmeister.«
Im Laufe des 19. Jahrhunderts nahm das Wort dann die heute dominierende Bedeutung ›Nachdruck, Wucht, Furor‹ an. In diesem Sinne kommt Kurt Tucholsky 1929 unter seinem Pseudonym Peter Panter in der Glosse »Mieter und Vermieter« zu der zeitlosen Feststellung, dass deutsche Hauswirte »mit dem ganzen Aplomb der gekränkten Leberwurst« auf Reparaturforderungen ihrer Mieter reagieren.
apodiktisch
Bei diesem Wort lässt sich eine subtile Bedeutungsverschlechterung feststellen. Meinte apodiktisch