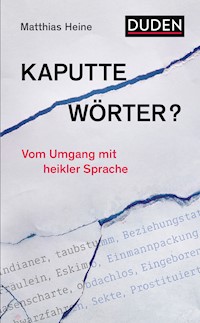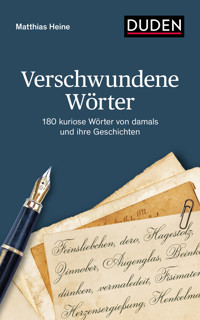Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliographisches Institut
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Duden-Sachbuch
- Sprache: Deutsch
Krass, dufte, kolossal - Jugendsprache ist kein Phänomen unserer Zeit. Schon im 18. Jahrhundert pflegten die Studenten ihren eigenen Jargon und die Wandervogelbewegung lieferte den Nazis manches Lieblingswort. Matthias Heine zeigt, dass Jugendliche schon immer eigene Gruppensprachen nutzten - nach innen als Erkennungszeichen, nach außen als Abgrenzung und natürlich auch ganz einfach zum Spaß. Dazu zieht er Quellen wie Goethes Studentenwörtersammlung, Kästners "Emil und die Detektive" oder die deutschen Synchronisationen der Beatles-Filme heran.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Immer wieder krass
Wie Tumult, Alkohol und Bandenwesen eine »eigene Kraftsprache« schufen
Die Entstehung eines Jugendjargons durch Randale vom 16. bis zum 18. Jahrhundert
Der Krieg mit den Pudeln und Schnurrbärten
Studenten als Halbstarke des 18. Jahrhunderts
Fichte gegen den Pennalismus
Wie der Philosoph als Unirektor in Berlin Duelle bekämpfte
Wo die wilden Renommisten wohnen
Wie in Jena und Halle »die Roheit aufs höchste« stieg
Wer um 1750 geprellt wurde
Robert Salmasius sammelt die »auf Universitäten gebräuchlichen Kunstwörter«
Als das Hospiz noch ein Gelage war
Woher wir überhaupt etwas über die alte Studentensprache wissen
Wer krass war, wurde Opfer
Die Wörterbücher von Kindleben und Augustin
Wer abgebrannt ist, muss jemanden anpumpen
Alte Studentenausdrücke heute
Wer einen Kater hat, der schwänzt eben
Von den Burschen zu Fridays for Future
Als Goethe Pech im Glück hatte
Studentensprachliches im Werk des größten deutschen Dichters
Der Luftikus in Schwulitäten
Vom Studentenlatein
Knopfmachen oder in den Puff gehen?
Der ewige Student – Friedrich Christian Laukhard
Wenn poussieren zur Blamage führt
Latein bekommt Konkurrenz aus Frankreich
Nur wer schofel ist, der mogelt
Einflüsse des Rotwelschen
Philister machen keine Faxen
Wie Heinrich Heine unter die Kümmeltürken kam
Als Haupthähne zum Wartburgfest einluden
Die Studenten werden politisch
Turnen im Julmond soll Bill werden
Wie Friedrich Ludwig Jahn die Jugendsprache mitprägte
Im Altdeutschen Gau des Turnvaters
Jahns Programm zur Worterneuerung und sein Fortwirken
Heil Wandervogel!
In Steglitz macht die Jugendsprache Fortschritte
Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein
Das Woodstock von 1913 auf dem Hohen Meißner
Tippeln? Nicht ohne meine Zupfgeige
Noch mehr Wandervogel-Wörter
Lieder zur Klampfe
Als bei Bertolt Brecht die bunten Fahnen wehten
Der Guru des Bundes empfiehlt ein Fahrtenmesser
Wie plötzlich alle Wandervögel nach dem Morgenland fliegen wollten
Immer Ärger mit den Paukern
Die Schülersprache um 1900
Eibein Kabapibitebel übüeber Gebeheibeimsprabacheben
Ein Kapitel über Geheimsprachen
Die Greise und der »Jargon des Kreises«
Was Thomas Mann von seinen Kindern über Jugendsprache lernte
Kolossale Jugend
Schülersprache um 1930 in »Emil und die Detektive« und anderswo
Elefantöses vor dem Untergang
Jugendsprache bei der Hitlerjugend 1941
Wenn beim Hotten die Tolle wackelt
Wie Swing Boys und Tangojünglinge redeten – am Beispiel der Geschwister Kempowski
Wenn Halbstarke mit ihrer Ische stenzen
Die Jugendsprache der Fünfzigerjahre
Der lange Weg des Dealers zum Görlitzer Park
In der Beat-Literatur von 1962 kommt uns manches bekannt vor
Hippies, Hip-hop, Hipster – alle sind hip
Die globale Jahrhundertkarriere eines Jugendworts
Zentralschaffe mit steilen Zähnen
Jugendsprache der frühen Sechzigerjahre
Mach schau für die Exis
Die Beatles und die deutsche Jugendsprache
Wie dufte verduftete
Aufstieg und Fall eines Jugendworts
Gammler und Gendarm im Englischen Garten
Ein Dokumentarfilm aus dem Jahre 1967
Fummeln am Schätzchen
Noch einmal München: Eine Filmkomödie aus Schwabing
Antiautoritäre, die im Spätkapitalismus alles ausdiskutieren
Das 68er-Deutsch als Jugendsprache
Durchgeknallte und Ausgeflippte, die Bambule machen
Jugendsprache um 1970 im Grenzbereich zwischen Hippies und APO
Abends in die Disco – trotz Koffer und Giftzettel
Pennälersprache der Siebziger
Du, ich bin gefrustet, obwohl ich mich so sehr eingebracht habe, du
Der Jargon der Betroffenheit
Würg, ein Fuzzi!
Udos Werk und Feuersteins Beitrag: Wie Einzelpersonen die Jugendsprache beeinflussen
Null Bock und trotzdem aufgegeilt
Ein kurzer Spaziergang auf dem Flickenteppich der 80er-Jugendsprachen
Glanz und Elend der Tussi
Eine Germanenprinzessin in der deutschen Jugendsprache
Alles hat ein Ende, nur das urst hat zwei
Jugendsprache in der DDR
Wer simst, kann leicht über seine eigenen Dickies stolpern
Die Neunzigerjahre
Krass ist wieder da
Die Rückkehr eines uralten Jugendwortes mit neuer Bedeutung
Der Digga, der Babo und ihr mega Endgegner– das VSCO Girl
Tendenzen der zeitgenössischen Jugendsprache seit 2000
Anhang
Anmerkungen
Literatur (Auswahl)
Alle Jugendwörter von A bis Z
Personenregister
Immer wieder krass
Jugendsprache wird von den meisten Menschen als eine moderne Verfallserscheinung empfunden, die bestenfalls nervt und unverständlich ist, schlimmstenfalls aber zur Zerstörung des Deutschen beiträgt. Dabei gibt es Grund anzunehmen, dass Jugendliche schon immer eigene Gruppensprachen nutzten – nach innen als Erkennungszeichen, nach außen zur Abgrenzung und natürlich auch ganz einfach zum Spaß. Und damit haben sie unsere Muttersprache nicht zerstört oder verhunzt, sondern ganz im Gegenteil zu allen Zeiten um zahlreiche Ausdrücke und Wendungen bereichert.
In Deutschland ist Jugendsprache seit etwa 500 Jahren nachzuweisen. Schon in Luthers Tischgesprächen, so die spätere Interpretation des großen Sprachhistorikers Friedrich Kluge, zeige sich ein Nachschein von Studentenritualen mit entsprechendem Jargon aus der Universitätszeit des Reformators. Erste verlässlichere Quellen stammen aus dem 17. Jahrhundert. Seit dieser Zeit sammelten Jungakademiker die Begriffe und Phrasen, die sie gemeinsam verwendeten, in speziellen Wörterbüchern. Auch Goethe legte eine kleine handschriftliche Sammlung von Studentenwörtern an.
Die Studentensprache hatte langfristig einen starken Einfluss auf die deutsche Standardsprache. Deshalb wird ihr in diesem Buch viel Platz eingeräumt. Zudem war sie rund 300 Jahre lang die einzige Jugendsprache, die wir in Quellen zu fassen kriegen. Womöglich war sie damals auch tatsächlich die einzige. Jugendsprache setzt ein Gruppenbewusstsein und kommunikatives Vernetzsein voraus, die so nur an Universitäten zu finden waren, vielleicht noch bei Handwerksburschen und -gesellen, aber wohl eher nicht unter Bauernkindern.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte sich erstmals eine nicht studentische Bewegung von Jünglingen mit eigenem Jargon: die Turner. Ihr Wortschatz wurde weitgehend von der Gründergestalt Friedrich Ludwig Jahn geprägt, der noch heute als »Turnvater« berühmt-berüchtigt ist. Die Rolle Jahns und seiner Jünger in der Geschichte der deutschen Jugendsprachen ist bisher weitgehend unbeachtet geblieben. Hier werden sie nun erstmals unter diesem Gesichtspunkt in den Blick genommen. Denn wie sich zeigen lässt, hatten die Turner einen erheblichen Einfluss auf die Sprache des Wandervogels und der Bündischen Jugend, die vom Ende des 19. Jahrhunderts an nach alternativen Formen des Gemeinschaftslebens suchten.
Anfang des 20. Jahrhunderts wird dann auch eine mehr oder weniger eigenständige Schülersprache greifbar. Sie bestand einerseits aus burschensprachlichen Ausdrücken, die sich die Schüler angeeignet hatten, andererseits aus ganz neuen Wortschöpfungen. Dazu gehörten Ausdrücke wie dufte, knorke und prima, die zum Beispiel 1929 in Erich Kästners »Emil und die Detektive« auftauchen, ebenso wie in der Verfilmung zwei Jahre später. Diese und andere Filme werden als Quellen für die Jugendsprache der jeweiligen Zeit herangezogen – Material, das bisher kaum in dieser Hinsicht ausgewertet wurde.
Später, in den Vierzigerjahren, nutzten junge Swing-Hörerinnen und -Hörer, die eher quer zum NS-Regime standen, ebenso wie die massenhaft in die Hitlerjugend gepressten Jugendlichen jeweils eigene Sprechstile. Diese überschnitten sich teilweise, betonten aber gleichzeitig bewusst bestimmte Eigenheiten, etwa durch den Gebrauch von englischen Sprachbrocken bei den Swings.
Weiter ging es mit Halbstarken und »Exis« in den Fünfzigern, langhaarigen Vertreterinnen und Vertretern der Gegenkultur in den Sechziger- und Siebzigerjahren, bis sich schließlich die Generationen der Jugendlichen seit den Achtzigern in immer mehr Untergruppen fragmentierten. Sie alle pflegten eigene Jargons und verfügten dennoch über einen verbindenden jugendsprachlichen Basiswortschatz. Dazu gehörte sei den Neunzigern das Wort krass, das 250 Jahre zuvor schon einmal, allerdings in einer ganz anderen Bedeutung, bei den Studenten im Gebrauch war. Es lag nahe, dieses Buch nach jenem emblematischen Wiedergänger zu benennen.
Wer ein Buch über Jugendsprache schreibt, muss darlegen, was er überhaupt damit meint. Die Wissenschaft ist sich zwar im Grunde einig, was Jugendsprache ist. Aber so unterschiedliche Bezeichnungen wie »Jugendjargon«, »Jugendslang«, »jugendliche Gruppenstile«, »Sprachgebrauch junger Menschen« oder »Sprechverhalten Jugendlicher« zeigen, dass noch um genauere Definitionen und Abgrenzungen gerungen wird.
Bis diese Debatte entschieden ist, was angesichts der Flüssigkeit geisteswissenschaftlicher Bestimmungen vielleicht nie der Fall sein wird, lege ich diesem Buch eine Selfmade-Definition von Jugendsprache zugrunde, der wohl niemand – sei es ein Linguist, sei es ein Jugendlicher – deutlich widersprechen wird: »Jugendsprache« fasse ich als eine Sprechweise, mit der sich junge Menschen nach außen sowohl von Älteren als auch von anderen Jugendlichen abgrenzen und die nach innen als eine Art Erkennungszeichen wirkt. So etwas gab es vor rund 500 Jahren, als Martin Luther studierte, genauso wie später bei flotten Burschen an Universitäten, Turnern, Wandervögeln, Straßenkindern im Berlin der Dreißigerjahre, Swing-Girls, Hitlerjungen, Halbstarken, Gammlern, Hippies und heutigen Hip-Hoppern oder Gamern.
Bei der Musterung dieser fünf Jahrhunderte werden wir hinter der historisch bedingten Verschiedenheit doch viele Gemeinsamkeiten entdecken. Ganz nebenbei wird noch der Mythos widerlegt, dass Jugendsprache wahnsinnig schnell veraltet und sich ständig wandelt. Im Gegenteil: Einige Leserinnen und Leser werden staunend feststellen, dass der vermeintlich brandneue Wortschatz ihrer eigenen Teenagerjahre schon zu Großvaters Zeiten auf den Schulhöfen in aller Munde war.
Matthias Heine im Januar 2021
Wie Tumult, Alkohol und Bandenwesen eine »eigene Kraftsprache« schufen
Die Entstehung eines Jugendjargons durch Randale vom 16. bis zum 18. Jahrhundert
Studententumulte sind keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, auch wenn uns unser historisches Kurzzeitgedächtnis dabei vor allem die 68er-Revolten in Erinnerung ruft. Vor 250 Jahren gebärdeten sich die Studenten viel krawalliger als heute. Die Häufigkeit und die Verbreitung ihrer Tumulte übertraf sogar alles, was sich in den Sechzigerjahren ohnehin nur in Berlin, Frankfurt und ein paar anderen großen Metropolen abspielte. Um 1750 rumste es selbst in Städtchen, deren Universitäten heute unter anderem deswegen längst nicht mehr existieren, weil Krawallmachen das einzige war, was die Studenten dort noch lernten. Sie duellierten sich und veranstalteten Saufgelage, die nach komplizierten und absurden Ritualen abliefen. Sie schikanierten die Philister, wie sie sie die Arrivierten und Honoratioren ihrer Studienorte nannten, oder prügelten sich mit Gnoten oder Knoten, den Handwerksgesellen, und Schnurrbärten, den vor Ort stationierten Soldaten. Nachts schmissen die Studiosi den Bürgern, die ihnen unliebsam geworden waren, die Scheiben ein oder veranstalteten anderen brutalen Unfug. Sie vergnügten sich mit Hürchen, für die sie die Ausdrücke barmherzige Schwestern oder Nymphen prägten, oder gefährdeten die Unschuld naiver Mädchen vom Lande, Kattunbesen oder Staubbesen genannt, die als Haushaltshilfen in die Städte gekommen waren. Selbst die Sittsamkeit gut bewachter, braver Bürgertöchter, der sogenannten Florbesen, stellten die Jungakademiker auf die Probe.
In diesen unruhigen Zeiten bildete sich die älteste deutsche Jugendsprache heraus, über deren Existenz wir heute noch etwas wissen. Und sie entstand nicht nur aus Tumult und Randale; sogar die Wörter Tumult und Randale selbst sind Produkt jener Exzesse. Rand hieß in der schlesischen Mundart ein Menschenauflauf, im Bairisch-Österreichischen konnte es »Posse, Streich« bedeuten.1 Nach dem Vorbild von Skandal bildeten die Studenten danach das seit dem frühen 19. Jahrhundert nachweisbare Wort Randal (damals noch ohne e) und dazu die Ableitungen randalieren, Randaleur und Randalist.2 Tumult kommt vom lateinischen tumultus »Unruhe, Getöse, (Kriegs)lärm«. Die Studenten münzten es auf ihren Widerstand gegen die Obrigkeiten der Universitätsstädte um. So erklärt ein Wörterbuch von 1749: »Ein Tumult aber ist eigentlich nichts anderes, als ein gewisser Krieg, der daraus entstehet, wenn man den braven Burschen ihre Freiheit nehmen will.«3
Der Begriff »Freiheit« ist für uns heute äußerst positiv besetzt, und so könnten wir, ohne die Hintergründe genau zu kennen, durchaus Sympathien aufbringen für die Tumulte der Burschen oder Purschen, wie sich die Studenten seit dem 17. Jahrhundert selbst bezeichneten – eine Anspielung auf die Bursen, die Vorläufer moderner Studentenwohnheime, in denen alle idealerweise aus einer Kasse (Burse) zehrten. Doch was den Jungakademikern als Freiheit galt, empfanden die meisten ihrer Zeitgenossinnen und -genossen als gefährliche Verwahrlosung. Der evangelische Pfarrer und Pädagoge Christian Gotthilf Salzmann malt in seinem zwischen 1783 und 1788 erschienen sechsbändigen Zeitroman »Carl von Carlsberg« die moralischen Gefahren, die von den Tumulten ausgingen, in den düstersten Farben:
»Unsere Akademien scheinen mir für die Tugend und Zufriedenheit der Menschen so gefährlich zu seyn, als der Sitz der Pest, Constantinopel und Smyrna, für ihr Leben. Und ich kann nicht begreifen, wie ein Vater, der die Akademien kennt, und auf denselben einen Sohn hat, viele frohe Stunden haben kann. Ich werde weit ruhiger seyn, wenn mein Sohn einmal gegen die Russen oder Türken zu Felde liegen sollte, als wenn er auf der Akademie seyn wird. Denn wenn ihm auch eine Kartätsche in den Unterleib geschossen werden sollte – nun – so wird es mir ein paar traurige Wochen kosten, dagegen ich lebenslang den Ruhm haben werde, daß ich ein Vater eines Sohnes bin, der als ein Held starb. Aber wie viele schreckliche Nachrichten muß ich von ihm erwarten, wenn er auf der Akademie ist: daß er sich krank getrunken; daß er sich zum Betrüger herab gespielet hat; daß er an einer venerischen Krankheit darnieder liegt; oder im Duell erstochen worden ist.«4
Ein Glück, dass diesen Schrecknissen nur eine relativ überschaubare Menge von jungen Männern ausgesetzt war. Während des 18. Jahrhunderts waren niemals mehr als 9000 Studenten an den 42 deutschen Universitäten eingeschrieben, und ihre Zahl sank sogar – trotz des Bevölkerungswachstums und steigender Schülerzahlen. Offenbar wurde in Salzmanns Roman die nachlassende Strahlkraft und das abschreckende Negativimage der deutschen Universitäten ganz realitätsnah eingefangen.
Orte der Unzucht, des Suffs und der Gewalt waren die Hochschulen schon immer und überall, wie das Beispiel des französischen Dichters François Villon zeigt, der in den 1450er-Jahren nach seinem Bakkalaureat und der Magisterprüfung so sehr verwahrloste, dass er zum Mörder und Berufskriminellen wurde. Genauso hatten Luther und Melanchthon im Wittenberg des 16. Jahrhunderts größte Mühe, gewalttätige Unruhen der Studenten zu zügeln. Andererseits erinnerte sich Luther offenbar noch als Ehemann und weltumstürzender Reformator an bestimmte Trinksitten seiner eigenen Universitätszeit. Bei einer aus lauter Akademikern bestehenden Tischgesellschaft zu Ehren des in Eisleben geborenen Johannes Agricola präsentierte Luther ein großes Weinglas mit drei Reifen. Diese markierten verschiedene Füllstände, die jeweils mit religiösen Ausdrücken verbunden waren: Bis zum ersten Reif ausgetrunken hatte man »die zehn Gebote« erreicht, beim zweiten »den Glauben«, und war das ganze Glas geschafft, so war man bei »Vaterunser und Katechismus« angelangt. Luther leerte ein komplettes Glas auf das Wohl seines Gastes, aber Agricola schaffte es nur bis zum ersten Reif und musste sich dafür milde verspotten lassen: »Ich wußts vorhin wohl, das Mag. Eisleben die zehen Gebote saufen könnte, aber den Glauben, Vaterunser und den Katechismus würde er wohl zufrieden lassen.«5
Solche Saufrituale, bei denen es darum ging, dem anderen etwas vorzutrinken und ihn damit zum Leeren des eigenen Glases zu nötigen, gehörten jahrhundertelang zu den Lieblingsspäßen deutscher Studenten, die dafür ein reichhaltiges Vokabular entwickelten. Die Anekdote beweist, dass dergleichen schon um 1500 zu Luthers Studentenzeit üblich gewesen sein muss. Daneben ist die Episode eine der ältesten Überlieferungen deutscher Jugendsprache. Der große Erforscher der studentischen Sprechstile, Friedrich Kluge, geht davon aus, dass der Reformator die Bezeichnung der verschiedenen Füllgrade nicht aus dem Stegreif erfunden, sondern aus der Erinnerung an sein Studentenleben hervorgekramt hatte. Luther war etwa 17 Jahre alt, als er im Sommersemester 1501 an der Erfurter Universität für das Grundstudium eingeschrieben wurde: kein Mönch oder angehender Theologe, sondern ein Söhnchen aus wohlhabendem Haus, das sich nach dem Wunsch der Eltern auf ein Jurastudium vorbereiten sollte. Dass Luther damals mancherlei modischen Jungakademikerunfug mitmachte, lässt sich an der Tatsache ablesen, dass er wie ein echter Renommist – so die Bezeichnung für einen stolzen, trinkfesten und prügelfreudigen Studenten – einen Degen trug, mit dem er sich allerdings selbst schwer am Oberschenkel verletzte. Diese Art der Bewaffnung, die an den alten Adel erinnerte, war eine neue Gewohnheit, die gerade Studenten aus gut situierten Aufsteigerfamilien begeistert aufnahmen. Im Jahr 1514 erlaubte Kaiser Maximilian I. den Jungakademikern das Tragen von Stichwaffen ausdrücklich als Zeichen ihrer gehobenen Gesellschaftsposition.
Eine gewisse Zügellosigkeit gehörte schon immer unausgesprochen zum Studentendasein dazu. Sie bildete gewissermaßen die dunkle Kehrseite der akademischen Freiheit als wesentliche Grundlage der Universität, dieser einzigartigen europäischen Institution. Die Autonomie der Hochschulen wurde zuerst in Bologna und Paris, den Ur-Universitäten des Abendlands, erkämpft, ausgehandelt und verteidigt. Mitte des 12. Jahrhunderts schufen Professoren und Studenten Formen der Selbstverwaltung, die ihre soziale, rechtliche und geistige Selbstständigkeit gegen die weltlichen und geistlichen Mächte der jeweiligen Universitätsorte absichern sollten. Ihren Sonderstatus ließen sie sich von übergeordneten Instanzen wie Kaiser und Papst durch Privilegien und Gründungsurkunden garantieren. Bereits 1158 gewährte Friedrich Barbarossa auf dem Reichstag im oberitalienischen Roncaglia Sonderrechte für Scholaren, insbesondere für diejenigen in den Rechtswissenschaften. Und 1217 mahnte Papst Honorius III. die Studenten der Universität Bologna, lieber die Stadt geschlossen zu verlassen als die Beschneidung ihrer libertas scholarium hinzunehmen. Der gemeinsame Auszug von Professoren und Studenten gehörte zu den mächtigsten Druckmitteln der Universitätsangehörigen. Viele mittelalterliche Neugründungen von Hochschulen in Frankreich und Italien gingen auf einen solchen Exodus zurück, der damit endete, dass sich die komplette akademische Schicht einer Stadt einfach woanders niederließ. Auch die Gründung der Universität Leipzig, der zweitältesten ununterbrochen bestehenden Hochschule im heutigen Deutschland, erfolgte 1409, nachdem etwa 1000 deutschsprachige Studenten samt ihren Professoren die Universität Prag verlassen hatten. Dort war es zu internen Konflikten um theologische Reformbestrebungen sowie das Verhältnis zwischen deutschen und böhmischen Universitätsangehörigen gekommen.
Doch nicht nur solche rechtlichen Besonderheiten gaben den Studenten das Gefühl, ein ganz eigenes Völkchen zu sein. Durch ihre soziale Zusammensetzung verflüssigten sie zudem die Standesschranken des Mittelalters und der frühen Neuzeit. An den großen und attraktiven Universitäten wie Paris oder Bologna strömten Akademiker aus ganz Europa zusammen. Bekanntlich hat William Shakespeare seinem Hamlet ein Studium im sächsischen Wittenberg angedichtet, das nach der Reformation ein Magnet für Scholaren aus aller Herren Länder geworden war. Unter anderem verbrachte William Tyndale, der die erste protestantisch beeinflusste Bibelübersetzung ins Englische anfertigte, im Jahr 1524 ein Semester in Wittenberg. Vor allem aber war die gesellschaftliche Herkunft der Studenten und Lehrer überaus divers: Adelige fanden sich unter ihnen genauso wie Söhne von Bürgern und Bauern. Der Anteil von armen Studenten, denen man die Gebühren erließ, war immer relativ hoch. Stipendien und sogenannte Freitische, das waren kostenlose Mahlzeiten bei Familien der Stadt, halfen ihnen zusätzlich über die Runden.
Den Erwachsenen außerhalb der Universität war durchaus klar, dass der akademischen Freiheit die Freiheit zum Bummeln, Huren, Saufen, Spielen und Sich-Prügeln gegenüberstand – und oft sogar die Freiheit zum Duellieren und Totstechen. Man nahm es in Kauf. Der Gesellschaftshistoriker Hans-Ulrich Wehler nennt es ein »soziales Ventil«6: Die Jünglinge sollten sich ohne Angst vor ernsthaften Strafen die Hörner abstoßen, bevor sie in das Korsett eines viel strikter als heute geregelten Berufs-, Sozial- und Familienlebens gezwängt wurden und sich damit selbst in Philister verwandelten. Das Problem war im 18. Jahrhundert, dass die angehenden Akademiker neben all dem Allotria immer weniger lernten. In den Vorlesungen fanden sich oft nur zwei bis drei Hörer ein. Dies waren die Finken, wie die anderen sie abfällig nannten. Sie scherten sich nicht um den Komment, das selbst geschaffene Verhaltensregelwerk der Studenten, hielten sich von Schlägereien und Besäufnissen fern, machten keine Schulden und lernten brav.
Für viele Studenten waren gerade die Rechtsfreiheiten der Universitäten ein Hauptanziehungspunkt. Junge Männer kamen nicht mehr unbedingt an die Hochschulen, um zu studieren, sondern um frei zu leben. Hier konnte man zwischen dem 16. und dem 23. Lebensjahr einen relativ ungebundenen und zugleich geschützten sozialen Status genießen. Manch einer kehrte nach ein paar Jahren etwa als Hauslehrer sogar noch einmal an die Alma Mater, die »gütig versorgende Mutter«, zurück und verbrachte dort eine zweite Lebensphase vom 25. bis zum 30. Lebensjahr. Der miserable Ruf der Universitäten stieß zwar die Guten ab, die Schlechten zog er aber magisch an.
Der Krieg mit den Pudeln und Schnurrbärten
Studenten als Halbstarke des 18. Jahrhunderts
Man ließ den Studenten auch deshalb so viel durchgehen, weil sie für die Universitätsstädte ökonomisch enorm wichtig waren. Gegen Einschränkungen ihrer längst pervertierten Freiheiten wehrten sie sich mit dem schon aus dem Mittelalter bekannten Auszug. Dabei ging es jedoch längst nicht mehr um Neugründungen, sondern nur darum, in der Nähe der Stadt in einer Art Konsumstreik zu verharren, bis die Wirte, Zimmervermieter, Schneider, Schuhmacher, Pferdeverleiher und wer sonst alles noch von den Akademikern wirtschaftlich abhing, die Stadtobrigkeit zum Nachgeben drängten.
Solche Machterfahrungen gaben den Studenten ein giftiges Gefühl für ihre eigene Bedeutung. Der Aufklärungsphilosoph Johann Jakob Engel versprach sich vom Klima der Großstadt einen pädagogisch-abkühlenden Effekt auf die Masse der Lümmel aus der Provinz, wie er in seiner im März 1802 publizierten »Denkschrift zur Errichtung einer großen Lehranstalt in Berlin« ausführt:
»Wo der Student einen Grad von Wichtigkeit, von Ansehen hat: da sieht er gern auf seine Mitbürger als auf eine geringere Menschen-Klasse hinab, er macht eine eigene Korporation aus, folgt Tonangebern, die insgeheim zu dem rohesten, ausschweifendsten, kecksten Haufen gehören, errichtet Landsmannschaften, Ordensverbindungen, bekommt einen falschen Ehrgeiz, ein falsches Interesse in die Seele, wird sittenlos in seinem Innern und ungesittet in seinem Äußern. Alles das fällt weg, wo der Student sich unbemerkt unter den übrigen Menschen verliert, wo er noch eben so wenig bedeutet,als [er] wirklich ist; wo er sogleich dem öffentlichen Gelächter bloß stände, wenn er sich’s einfallen ließe, Figur zu machen, eine eigene Kraftsprache zu reden, eine eigene Kleidertracht anzulegen. Berlin zählt schon jetzt, wegen der einzigen hier blühenden Fakultät, der studierenden Jünglinge mehr als die Universitäten Greifswald, Rostock, Kiel, Rinteln zusammengenommen; aber wer sieht hier solche Karikaturgestalten, hört hier von solchen Wildheiten und Ausschweifungen, als an jeden kleineren Örtern tagtäglich vorkommen?«7
Selbst vor der zuständigen Gerichtsbarkeit der Universitätsbehörden mit ihren eigenen Sicherheitsleuten, den als Pudel verspotteten Pedellen, fürchteten sich die Studenten längst nicht mehr. Nicht nur friedliche Spaziergänger wurden aus Launen heraus überfallen. Wenn es darauf ankam, schlugen sich die Jungakademiker auch mit Angehörigen der Stadtmilizen oder gar des Militärs, von den Studenten verächtlich Schnurrbärte genannt. Diese wurden, wenn es in der Stadt eine Garnison gab wie beispielweise in Halle, oft herbeigerufen, um dem Studententreiben Einhalt zu gebieten. Den Burschen galt nur noch für Recht, was sie selbst untereinander im Komment, dem eigenen Regelwerk ihrer Studentenverbindungen, festgelegt hatten. Der Soziologe Helmut Schelsky urteilt in seinem Standardwerk über die Entstehung der modernen Universitäten: »Man muss sich die Studentenschaft des 17. und 18. Jahrhunderts leider als eine Sammlung der ›Halbstarken‹ jener Zeit vorstellen.«8
Da es von diesen frühneuzeitlichen »Halbstarken« sehr viele gab, waren die Universitäten tendenziell überfüllt. Die erwähnten niedrigen Studentenzahlen waren bereits das Ergebnis zahlreicher Maßnahmen, die Ungeeignete vom Studium abhalten sollten. Die meisten Erstsemester kamen mit sehr geringer schulischer Vorbildung, oft nur mit einigen Lateinkenntnissen an die Hochschulen. Preußen erließ 1708, 1718 und 1733 Verordnungen, die Mindeststandards an Kenntnissen verlangten. Dabei ging es nicht zuletzt darum, ein gewisses Schnorrerwesen, das Universitäten gerade für Arme interessant gemacht hatte, einzudämmen. Stipendien und Freitische waren für manche wesentlich verlockender als die Aussicht auf akademische Bildung. Daneben konnte man sich als Student der Militärpflicht entziehen, was den Status des Akademikers für Angehörige der unteren Schichten zusätzlich attraktiv machte. Wer es allerdings allzu toll trieb, konnte trotzdem schneller unter die Soldaten kommen als gedacht. Fürst Leopold von Anhalt-Dessau, ein General Friedrichs des Großen, war in der Universitätsstadt Halle stationiert. Dort ließ der »Alte Dessauer«, wie er genannt wurde, die schlimmsten Ruhestörer verhaften und steckte sie zwangsweise als Rekruten in sein Regiment. Uns kommt das heute wie eine unsagbar drakonische Maßnahme aus schlimmsten Feudalzeiten vor, aber Schelsky schreibt dazu, wir müssten »in Würdigung der historischen Wahrheit wohl doch zugeben, dass diese da besser hingehörten als auf die Universität.«9
In dem Edikt von 1708 wird verlangt, nicht »jeglicher von niedrigem Stande« solle seine Kinder auf die Universitäten schicken, wenn sie dazu nicht geschickt seien und auf gemeine Kosten versorgt werden müssten. Besser sei es, wenn »solche unfähigen Köpfe bei Manufakturen, Handwerken, der Miliz oder dem Ackerbau« ihren Broterwerb suchten.10 Doch erst die Einführung der Abiturientenprüfung 1788 wies den Weg zu Verhältnissen, wie wir sie heute für selbstverständlich halten. In der Instruktion heißt es: »Alle von öffentlichen Schulen abgehenden Jünglinge sollen vorher auf der von ihnen besuchten Schule geprüft werden und ein detailliertes Zeugnis über ihre dabei befundene Reife oder Unreife erhalten.«11 Heute macht man sich ja gern über das Wort »Reifeprüfung« lustig, aber damals war eine Begutachtung der geistigen und seelischen Reife künftiger Studenten bitter nötig.
Erst durch tiefgreifende Reformen, die in der zweiten Hälfte des Säkulums von Halle und Göttingen ausgingen und dann zum Vorbild für die Hochschulpolitik Wilhelm von Humboldts in Preußen wurden, konnten die deutschen Universitäten gerettet werden. Doch selbst dafür schien Zwang unabdingbar. So erließ der preußische Minister von Massow 1798 eine berüchtigte, aber wohl notwendige »Verordnung wegen Verhütung und Bestrafung der die öffentliche Ruhe störenden Exzesse der Studierenden auf sämtlichen Akademien in den königlichen Staaten«. Darin wurde die Aufsicht über die Studenten der staatlichen Polizei übertragen und ihnen Gefängnis und Prügelstrafen angedroht. Der Protest der Professoren, die sonst auf ihre akademischen Freiheiten bedacht waren, hielt sich in Grenzen. Das Maß war voll.
Fichte gegen den Pennalismus
Wie der Philosoph als Unirektor in Berlin Duelle bekämpfte
Für das Unwesen und den Straßenterror, der von den Burschen ausging, prägten die Zeitgenossinnen und -genossen einen eigenen Begriff: Pennalismus. Im Jahr 1811, in seiner Antrittsrede mit dem programmatischen Titel »Über die einzig mögliche Störung der akademischen Freiheit«, prangert Johann Gottlieb Fichte als erster frei gewählter Rektor der neugegründeten Berliner Universität den Pennalismus als größte Gefahr für das Ideal der Universität an. Für Fichte war die Wurzel allen Übels, dass sich die Studenten für eine besondere Art von Menschen hielten, die nur ihren eigenen Regeln zu folgen hätten und von allen anderen Akzeptanz und Unterordnung erwarteten. Die verblendete Selbstwahrnehmung der Studenten schildert Fichte so:
»[…] sie stellen dar das auserwählte Volk Gottes, alle Nichtstudenten aber werden befaßt unter den Verworfenen. Drum müssen alle andere Stände ihnen weichen, und ihnen allenthalben, wo sie hinkommen, den Vortritt oder Alleinbesitz lassen; alle müssen von ihnen sich gefallen lassen, was ihnen gefällt denselben aufzulegen, keiner aber darf es wagen, ihnen zu mißfallen; alle Nichtstudenten, ihre Lehrer und unmittelbare Obrigkeiten am wenigsten ausgenommen, müssen durch ehrerbietigen Ton, durch Reden nach dem Munde, durch sorgfältige Vermeidung alles dessen, was ihre zarte Ohren nicht gern hören, sich ihrer Geneigtheit empfehlen; das ist die Pflicht aller gegen sie; sie aber dürfen alle Menschen ohne Ausnahme aus dem Gefühl ihrer Erhabenheit und Ungebundenheit herab behandeln, das ist ihr Recht auf Alle.«12
Die Krebsherde dieses Sonderbewusstseins waren nach Fichte die studentischen Verbindungen, Landsmannschaften und Orden, die nicht nur mit dem Trinkkomment, in dem rituelles Betrinken geregelt und erzwungen wurde, das Ziel aller Bildung untergruben. Als noch verwerflicher und zerstörerischer empfand Fichte den selbst auferlegten Zwang der Studentenkaste, alle Dinge durch hemmungslose Schlägereien mit dem Degen zu regeln.
Doch selbst als Rektor der neuen Reformuniversität Berlin gelang es ihm nicht, diese Unsitte zu unterbinden. Eine Auseinandersetzung mit Friedrich Schleiermacher, dem damaligen Dekan der theologischen Fakultät, und dem Universitätssyndikus, dem Juraprofessor Friedrich Eichhorn, um den Duellzwang führte schließlich zu Fichtes Rücktritt: Der jüdische Medizinstudent Joseph Leyser Brogi aus Posen war in Streit mit dem ebenfalls aus Posen stammenden Burschen Melzer geraten. Antisemitische Motive spielten bei dem Konflikt mit Sicherheit eine Rolle. Sogar die sich neutral gebenden Quellen schildern Brogi als »Sohn eines jüdischen Händlers von schlechten Manieren, schäbig in der Kleidung und, was selbst diejenigen, die ihm wohlwollten, nicht zu leugnen vermochten, auch von Gesinnung«. Brogi verweigerte ein von Melzer gefordertes Duell. Daraufhin lauerte dieser ihm am helllichten Tage auf dem Platz vor der Universität auf und schlug ihn mit der Hetzpeitsche. Das entsprach dem studentischen Komment. In Kindlebens Wörterbuch der Studentensprache, von dem später noch genauer die Rede sein wird, wird die Hetzpeitsche als ein quasi-juristischer Gegenstand beschrieben: »Einem die Hetzpeitsche geben ist unter den Musensöhnen die größte Prostitution, das größte Skandal, welches nicht anders als durch einen Duell ausgelöscht werden kann. Oft bekommt auch derjenige die Hetzpeitsche, der von einem herausgefordert worden ist, und sich nicht gestellt hat.«13
Brogi beklagte sich über diesen unerhörten Rückfall in übelste Zustände des Pennalismus bei Fichte, der selbst eigentlich ein Judenfeind war. Dennoch wollte der Rektor – ganz im Sinne seiner Eröffnungsrede – gegen solches Mobbing, wie wir heute sagen würden, einschreiten. Er empfahl, den Fall vor den Senat der Universität bringen. Damit wollte er die nicht studentische akademische Gerichtsbarkeit stärken. Doch Schleiermacher und der Syndikus bremsten Fichte aus. Die Affäre gelangte vor eines der berüchtigten studentischen Ehrengerichte. Dort wurde Melzer eine vergleichsweise milde Karzerstrafe von vier Wochen auferlegt – und dem eigentlichen Opfer Brogi genau dieselbe Zeit.
Bald nach der Entlassung wurde Brogi erneut gedemütigt: Ein Student namens Klaatsch ohrfeigte ihn öffentlich. Fichte platzte nun endgültig der Kragen. Diesmal brachte er den Fall wirklich vor den Senat. Als das Gremium ebenfalls nur eine milde Strafe verhängte und eine Drohung gegen das Opfer Brogi aussprach, bat Fichte um seine Entlassung aus dem Rektorenamt. Nach weiteren harten Auseinandersetzungen wurde sie am 16. April 1812 genehmigt.
Wo die wilden Renommisten wohnen
Wie in Jena und Halle »die Roheit aufs höchste« stieg
Fichte hatte seinen Kampf verloren. Dabei galt die Berliner Hochschule schon als Reformuniversität, an der es vergleichsweise gesittet, streng und modern zuging. Als schlimmste Brutstätte des Pennalismus galt Jena, gefolgt von Halle, Gießen und Königsberg. Man sprach nicht umsonst von der »jenensischen Lebensart«. Vor allem protestantische Universitäten taten sich bei der Herausbildung dieser Subkultur hervor. Dort war die akademische Freiheit größer als an anderen und sie wurde besonders selbstbewusst verteidigt. Doch dies machte sie auch zu Hochburgen des Renommistenunwesens.
Als Renommist bezeichneten sich die nach dem Komment lebenden Studenten selbst, bis das Wort Bursche den älteren Ausdruck im späten 18. Jahrhundert allmählich verdrängte. Kindleben erklärt diese Lebensform in seinem Lexikon: »Renommist heißt ein Student, der am Schlagen, Raufen, Saufen und Schwelgen Vergnügen findet, alle Kollegia versäumt, und sich sowohl durch seine ungebundene freie Lebensart, als durch seine Kleidung und Miene auszeichnet.«14
Diesen Gesellen widmete Justus Friedrich Wilhelm Zachariä 1744 ein scherzhaftes Heldengedicht namens »Der Renommist«, dessen Hauptfigur Raufbold ein nach den Maßstäben des Komments vorbildliches Studentenleben führt – natürlich in Jena:
»Dort war sein hohes Amt, ein großes Schwert zu tragen,
Oft für die Freiheit sich auf offnem Markt zu schlagen,
Zu singen öffentlich, zu saufen Tag und Nacht,
Und Ausfäll’ oft zu tun auf armer Schnurren Wacht.
Als Hospes war er oft des Bacchus erster Priester,
Und ein geborner Feind vom Fuchs und vom Philister.
Er prügelte die Magd, betrog der Gläub’ger List;
Bezahlen mußte nie ein wahrer Renommist.«15
Fichte hatte wohl nicht zuletzt deshalb in Berlin so hart reagiert, weil er in seinen Professorenjahren in Jena erlebt hatte, wie derartiges Verhalten eine Universität von innen zerstören konnte. Goethe schrieb 1812 in »Dichtung und Wahrheit« über die Zeit um 1770:
»In Jena und Halle war die Roheit aufs höchste gestiegen, körperliche Stärke, Fechtergewandtheit, die wildeste Selbsthülfe war dort an der Tagesordnung; und ein solcher Zustand kann sich nur durch den gemeinsten Saus und Braus erhalten und fortpflanzen. Das Verhältnis der Studierenden zu den Einwohnern jener Städte, so verschieden es auch sein mochte, kam doch darin überein, daß der wilde Fremdling keine Achtung vor dem Bürger hatte und sich als ein eignes, zu aller Freiheit und Frechheit privilegiertes Wesen ansah.«16
Jena war die Hochburg der studentischen Korporationen. Gegen deren Einfluss und Unflätigkeit musste Goethe später selbst als zuständiger Minister im Herzogtum Sachsen-Weimar einschreiten. Im Jahr 1791/92 erläuterte er in einem Gutachten zur »Abschaffung der Duelle an der Universität Jena« die Regeln, die sich die Studenten dort selbst auferlegt hatten: »[D]er wie eine Krankheitsgeschichte merkwürdige Purschen-Komment verdiente von dieser Seite einen Kommentar und man würde sehen, wie man in diesem abenteuerlichen Gesetz gesucht hat, die Leidenschaften und das Betragen eines Bauern, eines Schülers und eines Edelmanns zu vereinigen.«17 Gegen die Duellsucht empfiehlt Goethe harte, konsequente Strafen: »[…] ich wünschte die Zeit zu sehen, wo auf einen bloßen Schlag die Relegation gesetzt wäre, und ich würde unter wenig veränderten Umständen dieses Gesetz vorzuschlagen wagen. Wer schlägt, gehört dahin, wo man mit Schlägen unterrichtet, und hört auf ein akademischer Bürger zu sein.« Goethe beschreibt zudem die »lächerlichen Aufstufungen von der Ohrfeige bis zum Knittel und Hetzpeitsche« der Schläge, mit denen ein Bursche einen anderen Studenten zum Duell forderte. Am Ende schränkt er jedoch ein, dass das von ihm vorgeschlagene Gesetz, das schon bloßes »Schuppen oder Stoßen« mit einer Strafe im Studentengefängnis, dem Karzer, ahndet und jeden Schlag mit »einer irremissiblen Relegation bestraft«, wohl nur Segen stiften würde, »wenn die Akademie vorher von den Ordensverbindungen gereinigt wäre«, deren ganze Existenz darauf beruhe, »daß sie die Roheren an sich ziehen und die übrigen schrecken.«18
Wer den bei aller amtlichen Zurückhaltung sehr deutlichen Goethe-Text kennt, versteht besser, warum Fichte, der zwei Jahre später nach Jena kam und das geschilderte Treiben dort selbst miterlebte, sogar seine eingefleischte Judenfeindlichkeit hintanstellte, um solche Sitten keinesfalls an der neuen Berliner Universität einreißen zu lassen. Trotz Fichtes Niederlage entwickelte sich Berlin aber niemals zum Zentrum irgendeiner Art von Burschenherrlichkeit. Die Großstadt wirkte vielleicht doch abkühlend, so wie Engel es erhofft hatte. In Göttingen, Heidelberg, Halle und Jena hingegen konnte der Komment das Leben viel stärker bestimmen. Und so verwundert es nicht, dass die ältesten Wörtersammlungen jener »eigenen Kraftsprache«, die der Universitätsreformer so lächerlich fand, aus Halle und Jena stammen, die Mitte des 18. Jahrhunderts die ersten berüchtigten Brutstätten des studentischen Größenwahns und der Gewalt waren.
Wer um 1750 geprellt wurde
Robert Salmasius sammelt die »auf Universitäten gebräuchlichen Kunstwörter«
Im Februar und März des Jahres 1749 unterhielt ein gewisser Robert Salmasius die Leserschaft der »Vergnügten Abendstunden«, einer in Erfurt erscheinenden Zeitschrift, mit einer mehrteiligen Serie mit dem sich zeitgemäß spreizenden Titel »Kompendiöses Handlexikon der unter den Herren Purschen auf Universitäten gebräuchlichsten Kunstwörter«. Im November erweiterte dann ein unbekannter Autor unter dem Pseudonym Lizentius Prokax die Salmasius’sche Sammlung mit zwei Fortsetzungen im selben Magazin.
Ein Völkchen, das sich so sehr als eigener Stand fühlte wie die Studenten der frühen Neuzeit, musste unweigerlich nicht nur eigene Sitten, sondern auch einen eigenen Sprachgebrauch herausbilden. Was Salmasius »Kunstwörter« nannte und Engels »Kraftsprache«, diente dem gleichen Zweck, den Gruppensprachen bis heute haben: Die Eingeweihten, die diese Ausdrücke kennen und gebrauchen, wollen sich als Clique zusammenschweißen und nach außen abgrenzen gegen all jene, die diese Wörter nicht verstehen oder – noch viel peinlicher – verständnislos nachplappern.
Salmasius, der auf dem Titel als »JCto« (von Juris consultus, »Rechtsgelehrter«) bezeichnet wird, hatte in Jena studiert. Er schilderte die Welt, in der die studentische Jugendsprache entstanden war, bereits als untergegangen. Dafür macht er »eigensinnige Fürsten und neuerungsliebende Ministers« verantwortlich. Seine Zustandsbeschreibung klingt, als hätten sich Politiker vom Schlage Goethes und Massows, Militärs wie der Alte Dessauer oder Rektoren wie Fichte schon um 1750 durchgesetzt – was, wie wir gesehen haben, gerade in Jena ganz und gar nicht der Fall war:
»Man schrieb andere Gesezze; man bestellete andere Ordnungen; man schränkete die edle Purschenfreiheit auf allen Seiten aufs ungebührlichste ein; man strafete; man relegirete, und mit einem Worte: man taht alles, was prave und für die Freiheit streitende Pursche nur immer kränken, betrüben und in die äusserste Bewegung sezzen konte. Diese Pedanterei hat wie ein Krebsschaden um sich gefressen; und leider ist sie so weit eingerissen, daß der praven Purschen immer weniger werden, und daß solche, die es sonst mit dem Teufel in der Hölle aufgenommen hätten, sich jezt nicht einmal mehr unterstehen, einen Mukker tod zu stechen, da sie sonst wol den pravesten Purschen von der Welt tod stechen konten.«19
Hier lernen wir einige studentensprachliche Wörter kennen. In seinem Lexikon erläutert uns Salmasius: »Mukker heist im algemeinen Verstande so viel wie Klos. Im besonderen Verstande heist es ein Pietist.« Unter dem Stichwort Klos findet man die weitere Erklärung: »Klösse sind die dummen Kerrels, die immer in die Collegia laufen, sich den Kopf zerbrechen, Petimäters und Pedanten werden; und mit einem Worte: die den praven Purschen entgegen gesezzet sind.« Über Pedanten heißt es an der entsprechenden Stelle: »Dis sind eigentlich die Narren, die Latein können; überhaupt diejenigen, die studiren und was lernen, und sich dem Joche der Gesezze unterwerfen.« Petimäter, so erklärt Salmasius, seien »solche Leute, die im Reden, in Minen, im Gange, in Kleidung und in allem was besonders vorstellen wollen, allerlei Tohrheiten und Eitelkeiten verrahten, und darüber ausgelachet werden«. Es handelt sich offenbar um eine Art frühe Hipster, denen nichts peinlicher ist als so herumzulaufen wie alle anderen – und die gerade deshalb alle gleich aussehen:
»So bald ein Petimäter, der sich gestern erst eine neue Kokarde gekaufet, heute ein siehet, von der er höret, daß sie mehr Mode sey, sobald mus er sie haben. So bald heute eine neue Art von Bändern aus Leipzig komt, so bald mus sie schon an seinem Degen oder Stokke seyn; er mus zehnerlei Uhren, Dosen, Schuhschnallen u[nd] dergl[eichen] besizzen; er mus Ringe am Finger tragen, u[nd] w[as] d[essen] m[ehr] ist.«20
Das Gegenbild zu ihnen ist der brave Bursch oder prave Pursch. Das P in Pursch ist möglicherweise auf eine hyperkorrekte Aussprache der Studenten zurückzuführen, die oft erst an der Universität, wo Erstsemester von überallher zusammenkamen, ihren Dialekt ablegten und Hochdeutsch lernten. Noch Goethe erging es so, als er sein Studium in Leipzig aufnahm. In »Dichtung und Wahrheit« erinnerte er sich Jahrzehnte später:
»Ich war nämlich in dem oberdeutschen Dialekt geboren und erzogen, und obgleich mein Vater sich stets einer gewissen Reinheit der Sprache befliß und uns Kinder auf das, was manwirklich Mängel jenes Idioms nennen kann, von Jugend an aufmerksam gemacht und zu einem besseren Sprechen vorbereitet hatte, so blieben mir doch gar manche tiefer liegende Eigenheiten, die ich, weil sie mir ihrer Naivetät wegen gefielen, mit Behagen hervorhob, und mir dadurch von meinen neuen Mitbürgern jedesmal einen strengen Verweis zuzog.«21
Goethe traf es in Sachsen sicher besonders hart. Denn dort bildete man sich ein, das beste Deutsch zu sprechen, weil Luther die sächsische Kanzleisprache und teilweise die mitteldeutsche Mundart zur Grundlage seines Bibeldeutsch gemacht hatte. Aber einen vergleichbaren Dialektschock erlitt sicher fast jeder Student: Wer die recht kurze Schulzeit mit Latein und einem dialektal gefärbten Deutsch noch gut überstanden hatte, lief an der Universität Gefahr, von den Kommilitonen nicht verstanden oder gar verlacht zu werden.
Brav zu sein, das bedeutete damals genau das Gegenteil von dem, was heute damit gemeint ist. Der Ausdruck war auf dem Umweg über die Soldatensprache aus dem französischen brave (»mutig, tapfer«) entstanden. Salmasius fasst anschaulich zusammen, welche Art von Tapferkeit in seinen Universitätsjahren, auf die er »[n]icht ohne Vergnügen, obgleich mit Wehmuht« zurücksah, erwartet wurde: »Was ein praver Pursch war, der stund.« Bei einem Auszug, mit dem man die Stadtobrigkeit unter Druck setzen wollte, galt es durchzuhalten: »Man kampirete zu Hause, und zu Dorfe, ganze Wochen, ganze Monate, ganze Jare«. Vorher und nachher führte man sich möglichst ungestüm auf:
»[…] man schlug sich; man stach auf der Stelle tod; man prellete die Füchse; man schlug dem Professor so wie dem Philister die Fenster ein, so oft man nur Lust hatte; […] man wezzete und perirte; man sang die schönsten und kurzweiligstenLieder zum Fenstern heraus; An Stat der Bezalung gab man dem Manichäer eine Tracht Schläge […]. Man hutschete, man borgete, man prellete, man zog aus. Kurz: man taht alles, wozu man Lust und Belieben hatte […]. Dis war das güldene Alter der Pursche. Freiheit, Freiheit; Alles war Freiheit!«22
Auch bei diesem Zitat sind einige Worterläuterungen nötig: Wetzen war der Krach, den die Studenten veranstalten, wenn sie ihre Säbel auf dem Straßenpflaster hin und her scheppern ließen. Möglicherweise hatte sich der junge Luther einst bei einer solchen Aktion ins Bein geschnitten: »Es geschiehet dieses zunachte auf den Gassen. Man hauet von einer Seite zur andern. Je mehr Funken, je mehr Galle.« Periren bedeutete das Hinausbrüllen der lateinischen Beschimpfung pereat (»Nieder mit ihm!) entweder vor dem Haus eines Gegners oder hinter den uniformierten Häschern – bei Letzteren natürlich mit gebührendem Abstand »von 2 oder 3 Büchsenschus«, »denn«, so Salmasius, »die Kerrels brauchen gar keine raison, sondern sie schlagen auf 2 bis 3 Monate lendenlahm.« Manichäer meinte nicht einen Anhänger des altpersischen Religionsstifters Mani, sondern bezeichnet einen Gläubiger, der – Obacht: ein Wortspiel! – sich erdreistet, die Bezahlung seiner Schulden zu mahnen. Füchse hießen die unerfahrenen Studenten, die ganz neu auf der Universität sind und von den älteren Semestern beliebig gequält und ausgenutzt wurden. Und hutschen nannte man einen rituellen Kleiderwechsel, bei dem sich die Burschen durch kompletten Tausch ihrer Wäsche zu Brüdern auf Lebenszeit erklärten und ewige Treue gelobten.
Diese Begriffe sind außer unter Burschenschaftern in Vergessenheit geraten. Nur prellen, das im genannten Zitat gleich zweimal auftaucht, ging wie so viele andere Wörter des studentischen Jargons in die allgemeine Umgangssprache ein. Es bedeutete zunächst »ausnutzen«, denn die Füchse mussten den Burschen Getränke und Essen bezahlen. Im verschärften Sinne hieß es »leihen und nicht wiedergeben«. Sicher sprach Salmasius seinen chronisch klammen Kommilitonen aus dem Herzen, wenn er fragte: »Wie wolte mancher ehrlicher praver Pursch herdurch kommen, wenn kein Prellen erlaubet wäre?« In dieser Bedeutung steckt das Wort noch heute im gängigen Ausdruck Zechprellerei. Wenn jemand die Zeche prellt, kann er sich also ganz auf die jahrhundertealte Tradition der Burschenfreiheit berufen – zumindest, wenn er Student ist.
Als das Hospiz noch ein Gelage war
Woher wir überhaupt etwas über die alte Studentensprache wissen