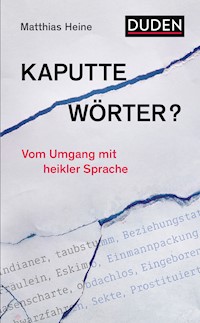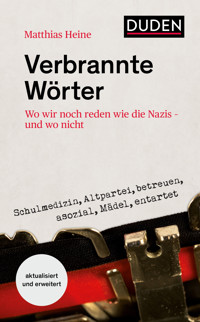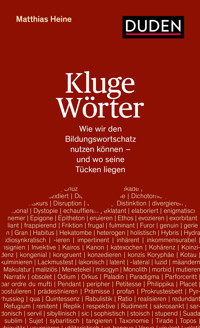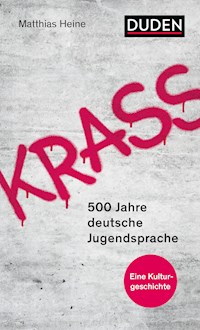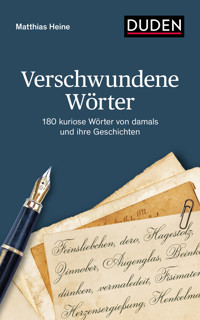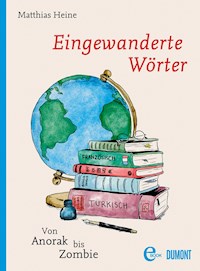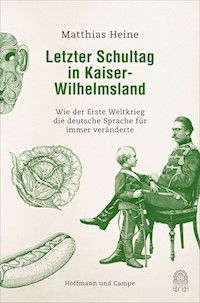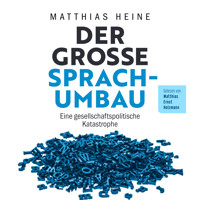
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: isid.de - media production
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Sprache ist in nie gekanntem Maße zu einem politischen Kampfplatz geworden. Es geht längst nicht mehr um einzelne Wörter, sondern Aktivisten wollen die ganze Struktur des Deutschen umbauen, um so die Gesellschaft zu verändern. Die Rechtschreibreform war nur die erste Schlacht, mit der dieser Sprachkampf eröffnet wurde. Die Angreifer treten im Namen des Fortschritts auf – darunter eine Linke, deren Unbehagen an der deutschen Sprache bis zum Hass reicht. Matthias Heine beschreibt die Baustellen, an denen die Weltveränderer die Sprache umbauen wollen – nicht nur beim Gendern. Der Journalist und Linguist nennt die Akteure, ihre Methoden und Motive. Und er erklärt, wie das alles damit zusammenhängt, dass die Linke sich als "Internationale der Diskriminierten" neu erfunden hat.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MATTHIAS HEINE
DER GROSSE
SPRACHUMBAU
Eine gesellschaftliche Katastrophe
Distanzierungserklärung: Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen
© 2025 LMV, ein Imprint der Langen Müller Verlag GmbH, Thomas-Wimmer-Ring 11, 80539 München, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten
Wir behalten uns auch die Nutzung von uns veröffentlichter Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44b UrhG ausdrücklich vor.
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: iStock/AlexLMX
Satz: Ralf Paucke, Langen Müller Verlag
E Book Konvertierung: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-7844-8509-6
www.langenmueller.de
Inhalt
Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit
Wer ist schuld am Sprachkampf?
ERSTER TEIL: SPRACHUMBAU FRÜHER – DER LANGE WEG ZUR EINHEITSSPRACHE
Der Grundstein: Martin Luther
Opitz und Gottsched als Vollender Luthers
Die ersten Rechtschreibreformer
Die ersten amtlichen Rechtschreibreformen
Fraktur oder Antiqua. Der Kampf um die Schrift
Das Dritte Reich und die DDR gegen die Dialekte
Der Mann, der den König zum „Könich“ machte
Der ewige Streit um die Fremdwörter
Haben Sie etwas vielleicht etwas kleiner? Der Kampf gegen die Majuskeln
ZWEITER TEIL: SPRACHUMBAU HEUTE
Baustelle 1: Die Rechtschreibreform als Mutter aller gegenwärtigen Sprachumbauten
Baustelle 2: Von der autogerechten Stadt zur geschlechtergerechten Sprache
Baustelle 3: Pronomen. Ein kurzes Kapitel über kleine Wörter
Baustelle 4: „Diskriminierende“ Begriffe. Noch jemand ohne Diskriminierung?
Exkurs: Die Rolle von Experten beim großen Sprachumbau
Baustelle 5: Unwörter
Baustelle 6: Tiefergelegtes Deutsch
Baustelle 7: Vom Denglisch übers Englisch zum Globish
Resümee: „Gerechte“ Sprache als Neusprech?
Literaturverzeichnis
Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit
Im Berliner Bezirk Wedding liegt vor einem etwas heruntergekommenen Schwimmbad aus den Siebzigern, umtost vom Verkehr zweier viel befahrener Verbindungsstraßen, ein Platz, der nach Berlins erstem weiblichen Bürgermeister heißt: Louise Schroeder. Wie andere Berliner Stadtoberhäupter hat Schroeder wenig Glück mit dem Ort, der posthum nach ihr benannt wurde. Der Ernst-Reuter-Platz ist ein monströser Kreisel, der das Grauen der „autogerechten Stadt“ verkörpert. Der Richard-von-Weizsäcker-Platz ist gar kein Platz, sondern bestenfalls eine Stelle, an der die Hauptstraße in Schöneberg ein bisschen breiter wird. Der Flughafen Willy Brandt wurde zum Symbol für alles, was man in der Hauptstadt nicht hinkriegt. Und auch Louise Schroeder hat kein schönes Stückchen Erde abbekommen. Ihr Platz ist baumlos, trostlos und meist menschenlos. Die Grünanlage ist im Sommer eher eine Beige-Anlage und im Winter eine Grau-Anlage. Manchmal sitzt dort eine Weddinger Witwe mit Hund an der kurzen Leine auf einer Bank. Sonst ist der Platz leer – was ihn wiederum gerade als Fotohintergrund interessant macht. Das Aufregendste, dem man hier zusehen kann, ist von Zeit zu Zeit eine Influencerin, die posierend einen Kreisel von Verrenkungen rund um die Rabatten vollführt, während ihr Insta-Boyfriend sie photographiert.
An einer Ecke des Louise-Schroeder-Platzes befindet sich ein Fels. Darauf wird knapp erklärt, wer Schroeder war und wann sie gelebt hat. Louise Schroeder war der Fels, auf den die SPD baute, als die Sowjets sie vernichten wollten. 1947 bis 1948 war sie kommissarischer Oberbürgermeister anstelle von Ernst Reuter, den die Russen nicht zuließen, danach bis 1951 nur noch Bürgermeister. Ja. Bürgermeister. Ohne die weibliche Endung -in. So nannte sich Louise Schroeder. So bezeichnete sie sich selbst. So stand es noch in ihrer Todesanzeige 1957. So war es üblich.
Die Zeitungen differenzierten allerdings. Wenn von Louise Schroeder ganz konkret als Person die Rede war, wurde oft die weibliche Form genutzt, beispielsweise in einer Spiegel-Reportage 1948 über die von den Ost-Berliner Kommunisten gesteuerten Tumulte angesichts der D-Mark-Einführung in West-Berlin, wo man sie als „die zierliche Oberbürgermeisterin, auf der Tonnenlasten von Arbeit liegen“ bezeichnete. Wenn aber der Titel in offiziellen Verlautbarungen genannt wurde, lautete er Bürgermeister. So schrieb die Deutsche Presseagentur am 26. Oktober 1950: „Oberbürgermeister Prof. Ernst Reuter und Frau Bürgermeister Louise Schröder haben aus Anlaß der feierlichen Übergabe der Freiheitsglocke eine große Anzahl von Glückwunschadressen aus dem sowjetisch besetzten deutschen Gebiet erhalten.“ „Bürgermeister von Berlin“ stand noch 2020 auf dem Louise-Schroeder-Fels. Es erinnerte daran, dass andere Zeiten Dinge anders betrachtet und ausgedrückt haben. Doch irgendjemand hat das nicht mehr ertragen. Die Platte auf dem Granitbrocken wurde neu graviert, und jetzt steht da: Louise Schroeder, „Bürgermeisterin von Berlin“. Den Russen hat Luise Schroeder als Bürgermeister von Berlin standgehalten, aber nicht dem Kratzen des Zeitgeists.
Gegen das Wort Bürgermeisterin gibt es auf den ersten Blick nichts einzuwenden. Die Änderung entspricht heutigem Sprachgefühl und ist meilenweit entfernt von den Verrenkungen der Gendersprache. Dennoch ist eine geschichtliche Dimension verloren gegangen. In der alten Fassung erinnerte dieser Gedenkstein nicht nur an die Person Louise Schroeder, sondern auch an die andere Welt, in der sie gelebt hat.
Man weiß auch nicht, wie Louise Schroeder selbst es gefunden hätte. Vielleicht hätte sie die weibliche Endung gar als Herabwürdigung empfunden, so wie jene Frauen in der DDR, die selbstverständlich sagten: „ich bin Arzt“ oder „ich bin Physiker“ – so nannte sich Angela Merkel, bevor sie sich dem westlichen Gesinnungshauptstrom anpasste. Ihnen war noch geläufig, dass die allgemeine Berufsbezeichnung Arzt, Physiker oder eben Bürgermeister lautet. Wenn man sie Physikerin, Ärztin, Bürgermeisterin genannt hätte, hätten sie sich als ausschließlich auf den weiblichen Teil der Menschen, die diesen Beruf ausüben, reduziert gefühlt. Eine sprachliche Ghettoisierung. Zu solchen Fragen hat die alte Inschrift angeregt. Nun ist da nichts mehr, wo das Nachdenken einhaken könnte. Der Schroeder-Fels war ein Stein des Anstoßes. Jetzt ist er nur noch ein Stein.
Als Alexander Kluge 1988 seinen Film „Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit“ drehte, war der Titel lediglich ein skeptisches Bonmot. Heute wirkt er wie die Prophezeiung eines Sehers, der die kulturellen Entwicklungen des frühen dritten Jahrtausends erahnte. Der umfassende Angriff zielt nicht bloß auf die Sprache, deren Grammatik und Wörter auf versteckte ideologische Giftpaketchen abgetastet werden. Er gilt auch den Denkmälern. Nicht nur denjenigen, auf deren Sockeln Menschen stehen, welche nicht den hohen moralischen Ansprüchen gerecht werden, die wir Nachgeborenen selbstverständlich mühelos erfüllen. Sondern sogar denen, die – wie der Louise-Schroeder-Findling – nicht den Ansprüchen einer modernen Weltverbesserungsgrammatik entsprechen. Ihre Apologeten können es nicht nur nicht ertragen, dass Menschen der Gegenwart den von ihnen gewünschten Verbesserungen der deutschen Sprache keine Folge leisten – sie ertragen es auch nicht mehr, dass Menschen früher anders gesprochen haben. Die Umgravierung des Louise-Schroeder-Steins folgte dem gleichen Impuls wie die Änderungen in Kinderbüchern, wie die Debatten darüber, ob man Schülern und Lehrern noch Klassiker, in denen Wörter wie Neger oder Zigeuner stehen, zumuten kann, und wie das Durchkämmen von Straßennamen-Verzeichnissen nach Menschen, die vor 100 oder 500 Jahren gegen den Moralkodex der Jetztzeit verstoßen haben.
Dieser Impuls entsteht aus einem großen Unbehagen an der deutschen Sprache, das Menschen empfinden, die sich als fortschrittlich definieren. Die neumodische Kategorie „woke“ beschreibt diese Akteure nur unzulänglich, denn das Bestreben, das Deutsche zu optimieren, ist viel älter als dieser Begriff. Die Sprachumbauer und -modernisierer sind auch nicht unbedingt immer links gewesen: Adolf Hitler betrieb, wie wir in diesem Buch sehen werden, eine fortschrittliche Sprachpolitik. Auch die Rechtschreibreform, die eine weitgehend unbekannte Vorgeschichte in der NS-Zeit hatte und nach jahrzehntelanger Vorbereitung 1996 verabschiedet wurde, ging auf die Idee zurück, unsere Muttersprache – in diesem Falle ihre Verschriftlichung – sei unzulänglich, fortschrittsfeindlich und verbesserungsbedürftig. Und schon seit den frühen Achtzigerjahren gibt es Bestrebungen, die angebliche „Männersprache“ Deutsch durch gegenderte Formen zu verweiblichen. Mittlerweile findet der große Sprachumbau auch noch auf weiteren Baustellen statt. Er wurde zu einem der wesentlichen Gegenwartsprojekte von im weitesten Sinne linker Politik.
Der Kampf um die deutsche Sprache ist eines der bestimmenden politischen Themen. Wenn man Medien und öffentlichen Debatten folgt, erscheint es, als wären sprachliche Fragen wichtiger als Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem, Steuergerechtigkeit für Wenigverdiener oder Entlastungen für Familien und alleinerziehende Mütter. Teile der politischen und akademischen Klasse erwecken den Eindruck, der gesellschaftliche Fortschritt hänge entscheidend davon ab, dass linguistische Optimierungsmaßnahmen durchgesetzt würden und dass Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, Inklusion und das Zurückdrängen des Rassismus im Wesentlichen durch verbale und grammatische Relikte abgelebter Epochen behindert werden, die wir immer noch mit herumschleppen. Zwar ist das jahrzehntelange Ringen um die Rechtschreibreform beendet, und man versucht nun, mit einem Kompromiss zu leben, der weder Radikalreformer noch Bewahrer zufriedenstellt. Dafür wird um „gendergerechte Sprache“, „diskriminierende Begriffe“, „Unwörter“, Neo-Pronomen und Anglizismen umso heftiger gekämpft. Ein weiteres Projekt im linguistischen Bastelbuch sich als fortschrittlich verstehender Kräfte ist die „leichte Sprache“. Je mehr die Schulen bei der Aufgabe versagen, Absolventen korrektes Standarddeutsch beizubringen oder sie auch nur hinreichend zu alphabetisieren, desto mehr wird eine komplexitätsreduzierte Form des Deutschen als Mittel zum Abbau von Barrieren und zur Förderung der Inklusion propagiert.
Wer den Sinn all dieser einschlägigen Umbaumaßnahmen am Deutschen in Frage stellt, wird als Rechter gebrandmarkt. Kritik an der Gendersprache, Widerwille gegen die Flut unnötiger und lächerlicher Anglizismen, Zweifel am diskriminierenden Sinn von bewährten Ausdrücken wie „Schwarzfahrer“ oder „Flüchtling“ werden als Elemente eines von der Neuen Rechten vom Zaun gebrochenen „Sprachkampfs“ dargestellt. Laut der These vom „Sprachkampf“, den die Rechten begonnen haben, sind der Verein deutsche Sprache oder die Volksinitiativen gegen Gendern wie in Hamburg oder Hessen die Angreifer in diesem Kampf. Ihnen wird nachgesagt, sie agierten als eine Art Vorfeldtruppe der AfD im Ringen um kulturelle Hegemonie.
Das ist eine groteske Umkehrung der Kausalitäten und der historischen Tatsachen. Denn die genannten konservativen und rechten Reflexe sind vielmehr als Reaktion auf sprachliche Umbaumaßnahmen im Namen des Fortschritts zu verstehen, die seit Jahrzehnten vorangetrieben werden. Angesichts des Vorgehens der Sprachumbauer kommt einem das Gedicht von Bertolt Brecht in den Sinn, in dem er der Regierung der DDR nach dem Aufstand vom 17. Juni 1953 empfahl, ein anderes Volk zu wählen. Die linguistischen Optimierer wählen nur ein anderes Deutsch. Ihre Hoffnung ist, dass dieses andere Deutsch dann auf dem Wege der sprachlichen Umprogrammierung auch ein völlig verändertes Volk hervorbringen wird, das zum schlechten alten Denken gar nicht mehr fähig ist.
Die verschiedenen Baustellen des großen Deutsch-Umbaus werden in diesem Buch erstmals unter dem verbindenden Aspekt des angestrebten Fortschritts und der vermeintlichen Modernisierung zusammengefasst dargestellt. Dabei fällt auf, dass all den neueren Formen von Sprachkritik ein Unbehagen an der Muttersprache zugrunde liegt, das es so intensiv und vielfältig nur in Deutschland gibt. Analog zum internationalen Modebegriff „German Angst“, kann man es als „German Linguistic Angst“ bezeichnen. Die Wurzeln dieser Angst liegen in der Humboldtschen Vorstellung, Sprache präge und begrenze das Denken nahezu unentrinnbar. Diese Überschätzung der Sprache liegt auch der spezifisch im deutschsprachigen Raum wirksamen historischen Sprachkritik zugrunde, für die Namen wie Karl Kraus oder Victor Klemperer oder Titel wie „Aus dem Wörterbuch des Unmenschen“ stehen.
Die genannten Menschen hatten alle Recht mit ihrer Sprachkritik, aber sie überschätzen die Rolle der Sprache in den Dehumanisierungsprozessen des frühen 20. Jahrhunderts. Marxistisch ausgedrückt: Sie hielten manchmal den Überbau für entscheidender als die Basis. Den gleichen Denkfehler begehen nun Apologeten einer gendergerechten Sprache, Rechtschreibreformer, Unwortjäger und Diskriminierungsfahnder. Allzu oft wird die Forderung, die Sprache müsse geändert werden, wichtiger genommen als die dringend notwendigen realen Änderungen der ungerechten Verhältnisse.
Neben dem übergroßen Rang, den philosophische und politische Sprachkritik in Deutschland historisch bedingt haben, gibt es noch eine jüngere Ursache für das Unbehagen „fortschrittlicher“ Kräfte an der deutschen Sprache. Die Linke hat sich nach 1989, als die alten marxistischen Theorien durch den Zusammenbrauch der kommunistischen Systeme diskreditiert schienen, als „Internationale der Diskriminierten“ neu erfunden, bzw. es scheint ihr bislang noch nichts anderes eingefallen zu sein. Da als „Diskriminierung“ heute oft nicht mehr in Zahlen messbare Phänomene (wie die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen oder die Benachteiligung von Migranten bei der Wohnungssuche) bezeichnet werden, sondern gefühlte Bedeutungen und traumatisierende Mikroaggressionen, kommt es zu einer Diskriminierungsinflation. Diskriminierend ist nun alles, was irgendjemand als diskriminierend empfindet. Es ist kein Zufall, dass linke Kritik am vermeintlich antidiskriminatorischen Sprachumbau häufig (aber nicht nur) von klassischen Marxisten kommt, die daran festhalten, dass Klassenzugehörigkeit und Klassenkampf die entscheidenden Faktoren der Politik sind, die alle anderen Gegensätze „überdeterminieren“ (Althusser).
Durch kapitelweise Überblicke über die Geschichte diverser Sprachumbau-Projekte belege ich in diesem Buch, dass es nicht die Rechte war, die den „Sprachkampf“ begonnen hat. Als „rechts“ gelten heutzutage Menschen schon allein dann, wenn sie ein affektives, liebevolles Verhältnis zur Muttersprache haben. Sie empfinden die Versuche, das Deutsche zu verbessern und zu modernisieren, als Willkürakt. Vom daraus herrührenden Klima der Gereiztheit versuchen Rechtspopulisten in der Tat zu profitieren, aber sie haben es nicht geschaffen.
Matthias Heine, im Oktober 2024
Wer ist schuld am Sprachkampf?
Im Jahre 2023 erschien eine Karikatur, die einen Mann zeigt, der angesichts marschierender Nazis erklärt: „Ich würde ja gerne was dagegen tun, aber ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, mich übers Gendern aufzuregen.“
Es war auf der einen Seite das Jahr, in dem in Sachsen, Bayern, Hessen und Baden-Württemberg sogenannte „Genderverbote“ erlassen oder angekündigt wurden. In Wahrheit sind es nur überfällige Anordnungen, die eine Rückkehr zu einer an den amtliche Rechtschreibregeln orientierten und verständlichen Sprache in Schulen, Universitäten und Ämtern einleiten sollen. Von einem „Genderverbot“ zu sprechen ist in diesen Fällen so unangebracht wie es unpassend wäre, von einem „Legasthenieverbot“ zu sprechen, nur weil korrekte Rechtschreibung verlangt wird. Vorangetrieben wurde die Politik durch Volksinitiativen gegen das Gendern, die sich in vielen Bundesländern formiert hatten. Im Falle Sachsens war das „Gender-Verbot“ eine besonders spektakuläre Wende, weil hier 2020 erstmals in einem Bundesland per Kabinettsbeschluss die Maßgabe verabschiedet wurde, Gesetzestexte künftig in „geschlechtergerechter Sprache“ zu formulieren.
Auf der anderen Seite fühlte sich der Rat für deutsche Rechtschreibung, der die amtliche Rechtschreibung für Deutschland, die Schweiz, Österreich und einige kleinere deutsche Sprachgebiete festlegt, erstmals gedrängt, in das Regelwerk eine Passage zu Gender-Sonderzeichen aufzunehmen. Sie lautet: „Sonderzeichen innerhalb von Wörtern beeinträchtigen die Verständlichkeit, die Lesbarkeit, die Vorlesbarkeit und die automatische Übersetzbarkeit sowie die Eindeutigkeit und Rechtssicherheit von Begriffen und Texten. Diese Sonderzeichen als Bedeutungssignale innerhalb von Wörtern können nicht in das Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung aufgenommen werden, weil sie derzeit nicht wissenschaftlich eindeutig zu begründen sind. Andererseits kann der Rat nicht darüber hinwegsehen, dass Wortbinnenzeichen zur Kennzeichnung aller Geschlechter benutzt werden.“ Schon in einer Pressemitteilung vom Sommer 2023 hatte der Rat „die Aufnahme von Asterisk (,Gender-Stern‘), Unterstrich (,Gender-Gap‘), Doppelpunkt oder anderen Sonderzeichen im Wortinnern, die die Kennzeichnung aller Geschlechtsidentitäten vermitteln sollen, in das Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung nicht empfohlen.“
An die Bildungsinstitutionen sandte der Rat eine Botschaft, die ebenfalls recht eindeutig klingt: „Inwieweit den Hochschulen das Recht zusteht, von der amtlichen deutschen Rechtschreibung abzuweichen, ist strittig.“ Hochschulen und Lehrende hätten zu beachten, dass sie für die Bildung und Ausbildung der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen Verantwortung tragen, in denen Schülerinnen und Schülern die Rechtschreibung nach dem amtlichen Regelwerk zu vermitteln ist, auf das sich die zuständigen staatlichen Stellen der deutschsprachigen Länder verständigt haben. Weiter steht dort: „Die Schule ist der Ort der Vermittlung der orthografischen Normen. (…) In den jüngeren Jahrgangsstufen geht es vor allem um den Erwerb einer sicheren Rechtschreibkompetenz. Deshalb hat die Systematik der Rechtschreibung und ihrer Regeln den Schwerpunkt des Unterrichts zu bilden. In den höheren Schulstufen können dann auch die Entwicklungen der geschriebenen Sprache der letzten Jahre mit den Sonderzeichen im Wortinnern und zwischen Wörtern zur Kennzeichnung einer geschlechtsübergreifenden Schreibintention thematisiert und reflektiert werden. Vorgaben für die Bewertungspraxis liegen in der Zuständigkeit der Schulpolitik und obliegen nicht dem Rat für deutsche Rechtschreibung.“ Die letzte Passage ist besonders interessant, weil sie klarstellt, dass politische Maßgaben darüber, wie viel Gendern in Schule und Universität erlaubt ist, durchaus von den gewählten Volksvertretern verabschiedet werden können. Im politischen Streit ums Gendern werden sogenannte „Gender-Verbote“ wohl auch künftig nicht mit Hinweisen auf veränderte Bestimmungen der amtlichen Rechtschreibung oder die Beschlüsse des Rechtschreibrats abgewehrt werden können.
Die zitierte Empfehlung klingt nicht wie eine offizielle Anerkennung der Gendersprache, mit der der Rat sich über die Ansicht der Mehrheit aller Deutschsprecher hinweggesetzt hätte – so wie es einst bei der Rechtschreibreform geschah. Aber Genderskeptiker sehen schon in der bloßen Erwähnung der Sonderzeichen einen ersten Schritt auf dem Wege, an dessen Ende die „gendergerechte Sprache“ als neue Norm steht. Ein trojanisches Pferd, mit dem Gender-Befürworter ihr Steckenpferd als neuen Standard in die amtliche Rechtschreibung schmuggeln wollen. Der Verdacht wird verstärkt durch eine Formulierung, die am Beginn der Rechtschreibrat-Verlautbarung steht: „Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat in seiner Sitzung am 15.12.2023 seine Auffassung bekräftigt, dass allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden soll.“ Im weiteren Verlauf wird dann auch mit Doppelnennungen und Formen wie „Lehrende“ gegendert. Wenn es stimmt, dass die Beschlüsse des Rats das Ergebnis intensiver und langer Detaildiskussionen eines Gremiums von Experten waren, dann überrascht die Formulierung. Denn mit der wohlwollenden Erwähnung „geschlechtergerechte Sprache“ erkennt der Rat implizit an, dass die bisherige Sprache ohne die ganzen neuen Werkzeuge „ungerecht“ sei.
Als ich diesen Passus in einem Zeitungsartikel kritisierte, ist mir von einem Mitglied des Rates erwidert worden, der Wortbestandteil „gerecht“ sei hier lediglich im Sinne von „angemessen“ oder „zugänglich“ zu verstehen – so wie in den Zusammensetzungen „kindgerecht“ oder „behindertengerecht“. Doch man muss schon die Augen vor den jüngsten Bedeutungsentwicklungen verschließen, um nicht zu sehen, dass „gerecht“ oder „Gerechtigkeit“ in der gegenwärtigen Politik vielfach mit einem Pathos gebraucht werden, das ein ungerechtes System anklagen soll, welches die angeklagten Missstände hervorgebracht hat. Wenn von „Klimagerechtigkeit“ oder „Geschlechtergerechtigkeit“ die Rede ist, dann wird nicht einfach nur sachlich zu einem angemesseneren Umgang mit der Klimafrage oder der Geschlechterungleichbehandlung aufgerufen, sondern die Überwindung eines ungerechten – nicht bloß unangemessenen, nicht mehr passenden – Systems gefordert. So erklärt etwa der Linguist und Direktor des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache, Henning Lobin, in seinem Buch „Sprachkampf“, die Debatte ums Gendern sei „eine grundsätzliche Frage sprachlicher Gerechtigkeit“. Auch hier ist wohl kaum Angemessenheit in einem neutralen Sinne gemeint, sondern „Gerechtigkeit“ wird im pathetisch-politischen Sinne gebraucht. Das färbt natürlich auch auf die Semantik des Adjektivs gerecht ab, egal ob es für sich oder als Suffix in Wortzusammensetzungen steht. Die SPD hat ein Forum namens „SPD.Klima.Gerecht“, und wenn Genderbefürworter eine „geschlechtergerechte“ Sprache verlangen, dann wollen sie nicht nur angemessen im Sinne der Höflichkeit angesprochen werden, sie wollen die „ungerechte“ Männersprache überwinden.
Wenn ein Leben-und-Tod-Thema wie das Klima und der Kampf fürs Gendern beide heute gleichermaßen mit den pathetischen Hochwertwörtern „gerecht“ oder „Gerechtigkeit“ verbunden werden, dann zeigt das, wie sehr die Debatte um Sprache zum zentralen politischen Thema geworden ist. Von Mitte-Links bis ganz Woke-Links wird die Schuld daran den Rechten gegeben. Die These lautet: Die AfD und andere Rechtspopulisten „instrumentalisieren“ den Kampf um die Sprache. Und wer sich Verbesserungen des Deutschen entgegenstellt, gibt sich damit automatisch als reaktionärer Fortschrittsfeind zu erkennen. Aufgrund dieser These werden Sprachbewahrer grundsätzlich als Rechte abgestempelt, ganz egal, wie weit sie mit ihren politischen Positionen einer traditionellen Linken nahestehen. Dieses Kurzschlussdenken ist längst keine Angelegenheit radikaler Randgruppen mehr, sondern es ist in staatliche Institutionen und die von ihnen finanzierten Nichtregierungsorganisationen eingesickert. Noch ist es kein Delikt, nicht zu gendern. Aber die Befürworter der sogenannten „geschlechtergerechten Sprache“ sind bereits dabei, Menschen, die diesen Angriff auf die korrekte Grammatik und Orthographie ablehnen, zu diffamieren und zu deren Denunziation aufzurufen. Dabei werden sie mit Staatsgeld unterstützt.
Ein besonders gravierendes und zugleich typisches Beispiel dafür ist die Webseite antifeminismus-melden.de der Amadeu Antonio Stiftung. Auf diesem Portal sollen Personen „antifeministische“ Vorfälle melden, damit sie „dokumentiert“ werden können. Was gemeint ist, definiert die Stiftung so: „Sexistisch, frauenfeindlich, queerfeindlich. Menschenfeindliche Botschaften, Angriffe auf Gleichstellung, politische Strategien gegen Emanzipationsbestreben. Antifeminismus zeigt sich vielfältig.“ Unter den vielen tatsächlich oder vermeintlich frauenfeindlichen Aktivitäten, die man dort melden kann, steht auch folgender Tatbestand: „Organisierte Kampagnen gegen geschlechtergerechte Sprache“. Das selbstverständliche demokratische Recht, sich gegen einen wissenschaftlich umstrittenen und von der Mehrheit abgelehnten Politjargon zu wehren, wird dort in einer Reihe mit Straftaten wie körperlichen Angriffen oder dem Versenden von Drohnachrichten genannt.
Gemünzt ist die Formulierung „organisierte Kampagnen“ nicht nur auf die genannten Bürgerinitiativen gegen das Gendern in vielen Bundesländern, sondern auch auf einen Aufruf, der im Herbst 2022 auf der Webseite linguistik-vs-gendern.de veröffentlicht wurde. Darin üben Menschen, die sich wissenschaftlich mit Sprache beschäftigen, massive Kritik an der Genderpraxis der öffentlich-rechtlichen Sender. Zu den 70 Erstunterzeichnern des Aufrufs gehören hochrenommierte Linguisten und Mitglieder des Rates für Rechtschreibung. Sie schreiben, die Sender hätten „die Verpflichtung, sich in Texten und Formulierungen an geltenden Sprachnormen zu orientieren und mit dem Kulturgut Sprache regelkonform, verantwortungsbewusst und ideologiefrei umzugehen. Mehr als drei Viertel der Medienkonsumenten bevorzugen Umfragen zufolge den etablierten Sprachgebrauch – der ÖRR sollte den Wunsch der Mehrheit respektieren.“ Sie fordern „eine kritische Neubewertung des Sprachgebrauchs im ÖRR auf sprachwissenschaftlicher Grundlage.“ Den Aufruf, der mit Briefen an jedes einzelne Mitglied deutscher Rundfunkräte geschickt wurde, haben mittlerweile mehr als 1000 Linguisten und Literaturwissenschaftler unterschrieben.
Bei einigen öffentlich-rechtlichen Sendern hat der politische und öffentliche Gegenwind zumindest ein erstes Nachdenken eingeleitet. Im Februar 2023 verkündete der Programmdirektor des WDR, Jörg Schönenborn, man werde bei seiner Anstalt künftig gegenderte Sprache nicht mehr als Standard betrachten und womöglich gar ganz darauf verzichten. Vorangegangen war eine vom Sender in Auftrag gegebene Umfrage. Demnach fanden nur 41 Prozent der Befragten das Gendern in der Berichterstattung noch richtig und wichtig.
Das alles ficht aber Aktivisten überhaupt nicht an. Judith Rahner von der Amadeu Antonio Stiftung stellte in einem von der Zeit moderierten Streitgespräch mit der ehemaligen Familienministerien Kristina Schröder (CDU) klar, dass wissenschaftliche Kompetenz sie überhaupt nicht beeindruckt, solange sie auf „falschen“ politischen Grundlagen beruht. Eine unverhüllt neostalinistische Position. Den Aufruf der Linguisten und Literaturwissenschaftler, darunter auch viele Frauen, betrachtet Rahner als meldewürdiges antifeministisches Vergehen: „Aber natürlich schauen wir uns auch diese Kampagne an, wer da mitmacht und wer sie bezahlt. Das sind für uns wichtige Hintergrundinformationen. Denn nicht nur im rechtsextremen Spektrum, auch in anderen Spektren (…) gibt es Leute, die über das Ticket ‚Gender‘ versuchen, die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen umzugestalten. Darunter sind Demokratiefeinde, die Frauen zurück an den Herd wünschen.“ Dies ist die mittlerweile beim Gendern übliche Umkehr dessen, was tatsächlich politisch stattfindet. Die Gesellschaft umgestalten wollen ja gerade nicht die Gender-Skeptiker, sondern vielmehr diejenigen, die ihre Positionen in Universitäten, Stadtverwaltungen oder im staatlich privilegierten Rundfunk nutzen, um ihren Politjargon als neue Amtssprache durchzusetzen. Dagegen wollen die Genderkritiker die mit graswurzeldemokratischen gesellschaftlichen Prozessen innerhalb eines Jahrtausends ausgehandelten Normen und Regeln des Deutschen vor solchen radikalen Eingriffen bewahren – während sie gleichzeitig anerkennen, dass langsamer, quasi-natürlicher Sprachwandel unvermeidlich ist.
Interessant ist auch die Unterstellung, die Kampagne werde aus irgendwelchen verschleierten Quellen bezahlt. Es ist ein zutiefst verschwörungstheoretischer Ansatz, der sich die Existenz abweichender Meinungen nur damit erklären kann, dass dunkle Fürsten des Geldes diese unerwünschte Opposition sponsern. Billigste sexistische Propaganda ist dann der Satz mit den Frauen, die irgendwer angeblich an den Herd zurückwünscht. Da erhebt sich die Aktivistin von der Amadeu Antonio Stiftung über die vielen Unterzeichnerinnen des Aufrufs, die ihre wissenschaftliche Qualifikation wahrlich nicht in der Küche erworben haben. Rahners selbst hat übrigens Gender Studies studiert. Wer Kritik an diesem Fach übt und es als „unwissenschaftlich“ oder „Geldverschwendung“ bezeichnet, soll auch als Antifeminist beim Meldeportal verpetzt werden.
Noch weiter als die Aktivistin ging sogar das von der Grünen Lisa Paus geführte Bundesfamilienministerium, als die Initiatoren des Portals „Linguistik vs. Gendern“ um Aufklärung baten, was denn genau mit „Antifeminismus“ gemeint sei und wieso ein wissenschaftlich begründeter Aufruf an der Genderpraxis unter einen solchen Verdacht gestellt werde. Im Antwortbrief des Ministeriums heißt es: „„Antifeminismus speist sich aus der misogynen Vorstellung, dass Frauen in einer ,natürlichen Ordnung‘ Männern untergeordnet sein sollten und Emanzipation diese Ordnung und die gesellschaftliche Machtposition von Männern gefährde. (…) Als Ideologie der Ungleichwertigkeit weist Antifeminismus eine enge Verbindung und Anschlussfähigkeit zu anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit auf, wie z. B. zu Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, antimuslimischem Rassismus und anderen Phänomenen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Antifeminismus zeigt sich zum Teil auch sehr gewaltsam: So spielte Antifeminismus eine große Rolle für die Attentäter von Hanau (2020), Halle (2019) oder auch Christchurch (2019), Isla Vista (2014) und Oslo/Utøya (2011).“ Zur Erinnerung: In Hanau, Halle und Utøya wurden keine Appelle unterschrieben, sondern Menschen umgebracht. Unklar bleibt, was die Nennung dieser Ortsnamen mit über 1000 sachlich hochqualifizierten Frauen und Männern zu tun hat, die Kritik am politisch gewollten Zugriff auf die gewachsene deutsche Standardsprache üben. Doch die Unklarheit erfüllt einen Zweck: Man verlässt sich darauf, dass irgendwer beim Lesen schon die Verbindung zwischen Genderskepsis, dem „rechten Spektrum“ und tödlicher Gewalt herstellen wird. Die Begründung hat das Niveau des Spruchs „Wer lange Haare hat, zündet auch Häuser an“ aus den Sechzigerjahren. Mit dem Unterschied, dass das damals ein Witz war und noch nicht einmal die schwärzesten Konservativen so blöd waren, das wirklich zu glauben.
Mehr Mühe hat sich der erwähnte Henning Lobin in seinem Buch „Sprachkampf“ gegeben. Der Direktor des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (VDS) analysiert darin, welchen hohen Stellenwert das Thema Sprache im Programm der AfD einnimmt. Schon die Frage auf dem Klappentext des Buchs schlägt eine verschwörungstheoretische Saite an: „Was steckt dahinter?“ Natürlich ist der renommierte Wissenschaftler, der selbst nicht gendert, nicht so dumm, an dunkle Strippenzieher zu glauben, die unter dem Banner der deutschen Sprache ein antifeministisches und rechtsradikales Netzwerk geknüpft haben. Aber auch er dreht die Kausalzusammenhänge um und sieht den erregten Streit um Sprache als das Ergebnis rechter Machenschaften. So werden dann auch Menschen, die Deutsch ins Grundgesetz aufnehmen wollen, die Anglizismen und Gendern lächerlich finden oder sich für eine starke Rolle unserer Muttersprache in der EU einsetzen, zumindest unter Anfangsverdacht gestellt. Erst recht, wenn sie sich im Verein Deutsche Sprache organisieren, den Lobin und sein Kollege Thomas Niehr, Linguistikprofessor an der RWTH Aachen, 2016 als „Sprach-Pegida“ bezeichnet haben – damit eine Prägung des Medienjournalisten Stefan Niggemeier aufgreifend, der dem Verein eine „Pegidahaftigkeit“ nachgesagt hatte.
Lobins wesentlicher Vorwurf an den VDS ist, er habe „der AfD den Teppich ausgerollt, das Thema ,deutsche Sprache‘ als einen moderaten Ersatznationalismus etablieren zu können.“ Mit Leserbriefkampagnen, Prozesshilfen für Menschen, die beispielsweise gegen die Verwendung von Gendersprache klagen, und „Unterstützungsnetzwerken“ schaffe es der Verein, seine sprachpolitische Agenda immer wieder überproportional in den Medien und in politischen Debatten präsent sein zu lassen. Er habe dabei einen Stil etabliert, der deutliche Polarisierungen hervorrufe. Beispielhaft dafür sei eine im Jahre 2012 gestartete Kampagne, wonach Deutsch als Staatssprache im Grundgesetz verankert werden solle. Diese Forderung wurde 2016 nicht nur von der CDU aufgegriffen, obwohl die damalige Bundesvorsitzende Angela Merkel dagegen war, sondern auch von der AfD, die sie im selben Jahr in ihr Parteiprogramm aufnahm. Auch das Thema „Deutsch als Arbeitssprache der EU“ werde vom VDS „am Köcheln“ gehalten. Als Ergebnis solcher Kampagnen sei erstmals in der Geschichte das Parlament zu einem sprachpolitischen „Aufmarschgebiet“ geworden. Es ist sicher ungerecht, Lobin, der im Rechtschreibrat und in seinem Buch keine Extrempositionen in den Sprachkämpfen vertritt, dabei Sehnsucht nach den guten alten Zeiten zu unterstellen, als die Kulturministerkonferenz im Dezember 1996 noch ohne große parlamentarische Debatten die Rechtschreibreform beschließen konnte. Vor allem deshalb, weil er das Desaster der Reform zurecht damit erklärt, dass sie rein „aus der Binnenperspektive der Sprachwissenschaft betrieben wurde“. Er räumt auch das Unübersehbare ein: Nämlich, dass es in der Sprachwissenschaft keine einheitlichen Positionen zur Rechtschreibreform und zum ähnlich umstrittenen Thema Gendern gebe und dies auch „gerade in der Wissenschaft kaum zu erwarten“ sei. Ergänzen möchte man: gerade in den Geisteswissenschaften. Denn hier hat man es ja überwiegend nicht wie in den exakten Wissenschaften mit messbaren oder falsifizierbaren Werten zu tun, sondern mit einer Theorienkonkurrenz. Jede neue Theorie ist keine Entdeckung oder Erkenntnis im naturwissenschaftlichen Sinne, sondern eine Bewerbung um eine Stelle im akademischen Betrieb. Neue Theorien machen die alten nicht falsch, sondern nur unmodern. Deswegen gibt es kein dünneres Argument, als die Feststellung, irgendetwas entspreche in den auf Englisch sogenannten „Humanities‘“ nicht mehr dem gegenwärtigen theoretischen Stand.
In der Wissenschaft kann man geteilter Meinung sein, aber die überwältigende Mehrzahl derjenigen, die die deutsche Sprache sprechen und denen sie damit auch gehört, möchte Lobin bei den Debatten doch lieber nicht dabeihaben. Wenn er feststellt, die gegenwärtigen Sprachkämpfe bezögen ihre Spannung daraus, dass zwischen „laienlinguistischen Grundüberzeugungen“ und dem „von der Sprachwissenschaft gezeichneten Bild der Sprache“ eine Kluft bestünde, hört man dann doch wieder das leicht indignierte Staunen des Wissenschaftlers darüber, dass es Menschen gibt, die die deutsche Sprache, die schon gut 1000 Jahre vor der Sprachwissenschaft existierte, nicht nur als Struktur, System oder Instanz, sondern als Heimat ansehen. Letzterer Begriff gilt einer bestimmten politischen Klientel (nicht Lobin) als Teufelswort, wofür beispielhaft der 2019 erschienen Sammelband „Eure Heimat ist unser Albtraum“ steht. Dessen Klappentext erläutert den Ekel, den seine Autoren und Herausgeber vor dem Wort Heimat und den damit verbundenen Vorstellungen empfinden: „Dieses Buch ist ein Manifest gegen Heimat – einem (sic!) völkisch verklärten Konzept, gegen dessen Normalisierung sich 14 deutschsprachige Autor_innen wehren. Zum einjährigen Bestehen des sogenannten ,Heimatministeriums‘ sammeln Fatma Aydemir und Hengameh Yaghoobifarah schonungslose Perspektiven auf eine rassistische und antisemitische Gesellschaft.“ Der Titel des Buches und der Ton, der darin angeschlagen wird, mag als Beispiel dafür dienen, dass Übertreibung, Krawall, erregtes Opfergetue und „Inzivilität“ (Lobin) nicht ausschließlich Methoden sind, die der VDS und insbesondere sein – vorsichtig gesagt – ziemlich schillernder Vorsitzender Walter Krämer oder die AfD beherrschen, sondern auch auf der Seite derjenigen zu finden sind, die glauben, den gesellschaftlichen Fortschritt zu repräsentieren.
Für „Inzivilität“ bei VDS und AfD bringt Lobin in seinem Buch etliche anschauliche Beispiele, häufig aus dem Munde des Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner. Vor allem aber stellt er dar, wie die AfD das Thema Sprache für sich politisch nutzt. Er vergleicht die Parteiprogramme darauf hin, inwieweit sie Forderungen und Punkte zum Thema Sprache beinhalten – das reicht von „auswärtige Sprachpolitik“ über „Zusammengehörigkeit“ bis zu „Mehrsprachigkeit fördern“. Letzteres wird wenig überraschend im Parteiprogramm der AfD nicht verlangt. Als einzige Partei hat sie dafür die Punkte „Deutsch ins Grundgesetz“, „Deutsch als immaterielles Kulturerbe“, „Ablehnung von Anglizismen, Gendern und ,Sprachverboten‘“, „Deutsch an Hochschulen“ und „Digitalisierung von Literatur“. Lobin summiert: „Mit 12 bis 13 sprachpolitischen Positionen liegt die AfD damit weit vor der CDU mit acht und den weiteren Parteien mit nur zwei bis fünf Positionen.“ Der Linguist hält dies für eine Obsession rechter Parteien und stellt fest, dass in den Programmen etwa der NPD und der österreichischen FPÖ eine ähnliche Häufung von sprachpolitischen Positionen zu bemerken sei, „vor allem solche mit einer deutlich identitätspolitischen Ausrichtung“. Zuvor hatte er in den Programmpunkten und anderen Äußerungen der AfD ausgezählt, wie oft dort die Begriffe „Identifikation“ und „Identität“ verwendet werden. Er begreift das als Untermauerung seiner These, wonach das Thema Sprache in der Strategie der Rechten in Wahrheit dazu diene, Nationalismus und identitäre Vorstellungen davon, wer Deutscher ist und wer nicht, zu propagieren: „Identitäre Sprachpolitik erlaubt es, die Werte einer so verstandenen Identität in einer attraktiven Gewandung mehrheitsfähig zu vermitteln.“
Lobins 2020 beim Erscheinen des Buches sicher richtige Feststellung, die AfD verfolge als einzige Partei im Bundestag dezidiert sprachpolitische Zielsetzungen, kann zwar heute so nicht mehr aufrechterhalten werden. Die CDU hat 2023 „Genderverbote“ in Sachsen, Hessen und Baden-Württemberg angeschoben, die CSU tat Gleiches in Bayern. Friedrich Merz machte Schlagzeilen mit Tiraden gegen die „Gender-Sprache“. 2024 verkündete das österreichische Kanzleramt an, Genderschreibweisen mit Sonderzeichen nicht mehr zu verwenden. Lobin wird das vermutlich als Bestätigung seiner Grundthese sehen, der „Sprachkampf“ sei von rechts eröffnet worden.
Aber ist das wirklich so eindeutig? In Wahrheit ist die „Instrumentalisierung“ durch die AfD und neuerdings auch durch die CDU/CSU eine Abwehrreaktion gegen vielfältige und immer drastischere Eingriffe in die deutsche Sprache im Namen des gesellschaftlichen Fortschritts. Diese finden auf verschiedenen Baustellen seit Jahrzehnten statt. Sie begannen lange bevor die AfD und der VDS existierten. Wenn AfD und CDU/CSU sie nun „instrumentalisieren“, dann tun sie etwas, was in der Politik selbstverständliches Tagesgeschäft ist. Die ganze Parteipolitik beruht darauf, dass Parteien versuchen, Unzufriedenheit und Wünsche in der Bevölkerung für ihre Zwecke zu nutzen.
Die Gereiztheit von Menschen, die die deutsche Sprache lieben und als Heimat betrachten, wird durch Umbaumaßnahmen auf mindestens sieben Baustellen ausgelöst. Die auf den ersten Blick recht unterschiedlichen Erscheinungen der „gendergerechten Sprache“, „Diskriminierungs“-Kritik, Unwort-Jury-Abstimmungen, leichten Sprache, Rechtschreibreform, Neo-Pronomen und auch das scheinbar unpolitische Thema Anglizismen hängen zusammen. Ihnen allen liegt ein Unbehagen „fortschrittlicher“ Kräfte an der deutschen Sprache zugrunde. Sie wird als Hemmnis für eine Modernisierung der Gesellschaft angesehen. Solche Fortschritts-Apologeten sind nicht immer links, grün, linksliberal, woke oder wie die Selbst- und Fremdzuschreibungen eines bestimmten politischen Spektrums lauten. Zwar sind sie in der Gegenwart eher links. Aber es gibt und gab sie auch unter Rechten – sogar Adolf Hitler und Josef Goebbels waren solche Möchtegern-Sprachumbauer. Was beide Lager verbindet, ist ein autoritärer Zugriff auf die Sprache, der auf historisch Gewachsenes und auf wissenschaftliche Erkenntnisse pfeift. Wer weiß schon, dass die Rechtschreibreform, die in den späten Kohl-Jahren verordnet wurde, ursprünglich ein „fortschrittliches“ Projekt war, das von linken Germanisten im Westen und ganz entschieden auch von solchen aus der DDR vorangetrieben wurde – und dass diese dabei auf Konzeptionen aus der Nazizeit zurückgriffen? Nicht jedem sind die personelle Zusammensetzung und die unübersehbare politische Schlagseite der „Unwort“-Jury bewusst. Ähnlich wenig bekannt ist, dass die Kritik am „Deutschen als Männersprache“ (so der Titel eines Bestsellers von Luise F. Pusch) schon in den späten Siebzigern mit dem Aufkommen einer akademischen „feministischen Linguistik“ begann. Ihren heutigen Stellenwert bekam sie aber erst durch die beschriebene Entwicklung der Linken nach 1989 zur Einheitsfront der Diskriminierten. Plötzlich konnten sich sogar privilegierte Mehrfachimmobilienbesitzerinnen mit Chefarztfamilienhintergrund der Internationale der Diskriminierten zugehörig fühlen, weil sie angeblich sprachlich nicht repräsentiert wurden.