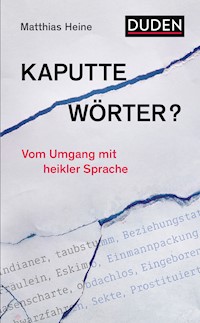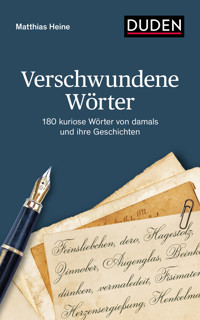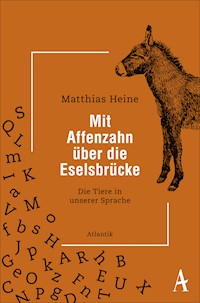
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wann wird der Hund in der Pfanne verrückt? Was tun, wenn es wie Hechtsuppe zieht? Und warum ist das Leben kein Ponyhof? Viel häufiger als in der Natur begegnen wir den Tieren tagtäglich in unserer Sprache, in Metaphern und Redewendungen. Wann und wie sind sie sprichwörtlich geworden? Matthias Heine hat sich auf ihre Fährten begeben. Ein Buch voll kurioser wie aufschlussreicher Entdeckungen, das uns Zusammenhänge eröffnet, die uns bisher höchstens schwanten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Matthias Heine
Mit Affenzahn über die Eselsbrücke
Die Tiere in unserer Sprache
Atlantik
Vorwort
Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier war über viele Jahrtausende eine Sache von Leben und Tod. Am Anfang hieß es: Beute machen oder Beute sein. Die ersten Künstler in den Höhlen von Altamira oder Lascaux wählten Tiere als Motive. Das heißt: Sie hatten eigentlich gar keine Wahl, sondern ihre Kunst entstand überhaupt erst aus dem Versuch, animalische Widersacher und Jagdtiere mit Bildern zu bannen.
Später, als viele Tiere domestiziert waren, oder sich – wie Ratten, Wanzen und Katzen – auf unterschiedliche Weisen als Kulturfolger in menschliche Häuser eingenistet hatten, lebten Menschen auf engstem Raum mit ihrem Vieh, ihren Haustieren und ihren Plagegeistern zusammen. Die Trennung von Ställen und Zimmern, dann gar von Ställen und Menschenhäusern ist eine relativ junge Errungenschaft der menschlichen Zivilisation. Wenn wir manchmal von Katzenmuttis und anderen Verwirrten lesen, die in ihren Wohnungen eine maßlose Menge von Tieren halten, dann berührt uns das unangenehm, weil solche von Gestank, Dreck und Parasiten geprägten Verhältnisse früher Alltag zumindest der Bauern und einfachen Leute waren. Einst kannte der Mensch die Tiere gut. Er spiegelte sich in ihnen. Und er verglich. Das hat unsere Sprache um zahlreiche Redensarten und Ausdrücke bereichert, die wir heute oft gar nicht mehr verstehen. Einige dieser verdunkelten tierischen Elemente des Deutschen werden in diesem Buch wieder erhellt.
Das 19. Jahrhundert mit seiner Urbanisierung und das 20. Jahrhundert mit dem Aufkommen der industrialisierten Landwirtschaft haben zu einer großen Entfremdung und Distanzierung zwischen Mensch und Tier geführt. Recht spät, als schon längst nicht mehr selbstverständlich jeder Deutsche Schweine, Kühe oder Hühner aus eigener Anschauung kannte, verschwanden auch die Pferde zumindest aus den Städten. Dafür kamen Tiere in die Wohnungen, die es dort vorher nicht gegeben hatte, jedenfalls nicht in Deutschland: Hamster, Wellensittiche, Reptilien. Und bei einigen Arten änderte sich das Verhältnis zum Menschen fundamental: Mäuse oder Hasen wurden jetzt weniger als Schädlinge oder jagdbares Wild wahrgenommen, sondern eher als lebendes Spielzeug für den Käfig im Kinderzimmer.
Als ich anfing, zu schreiben, dachte ich, aufgrund jener Distanz wären in der neueren Zeit weniger Redensarten und Wörter mit Bezug zur Tierwelt entstanden, als in den Jahrhunderten, die noch stärker von Bauern und Jägern geprägt waren. Diese Theorie hat sich nicht bestätigt. Auch im 20. Jahrhundert dehnte sich das Tierreich der Sprache aus – der Ponyhof, der das Leben nicht ist, die Wanze, mit der man abhört, der angeblich so stinkende Pumakäfig und der Bug im Computer sind nur drei Beispiele. Mögen die Tiere uns auch nicht mehr so nahe sein – sie flattern, schleichen, galoppieren und robben noch durch unsere Phantasie. Nur ist es noch ein bisschen egaler als früher, wie die Tiere wirklich sind. Dies ist weniger ein Buch über Tiere als ein Buch über Menschen, die Tiere nutzen, um sich selbst zu deuten. Wir haben uns einen riesigen Sprachzoo geschaffen. Wenn wir darin schauend umherwandeln, lernen wir zwar auch ein bisschen über die Natur, aber vor allem über unsere Zivilisation. Dieses Buch soll ein kleiner Wegweiser für den Spaziergang durch unseren Zoo sein.
Aal
Der Aal ist ein Fettfisch; bis zu 30 Prozent seiner Körpermasse können aus Fett bestehen. Der hohe Fettanteil muss den Aalen das Überleben auf der langen gefahrvollen Reise aus den Binnengewässern über die Flüsse zu ihren Laichgründen in der Sargassosee im Westatlantik sichern, denn wenn sie sich im Herbst auf den Weg machen, hören sie auf zu fressen, die Verdauungsorgane und der After verschwinden und an ihrer Stelle füllen Geschlechtsorgane die ganze Leibeshöhle aus.
Gerade der hohe Fettanteil machte den Aal in früheren Zeiten, als Kalorien noch keine Belastung, sondern kostbarer, den Hunger stillender Brennstoff waren, zum wichtigen Speisefisch. Die Stadt Lübeck ernannte deshalb im 15. Jahrhundert einen Aalherrn. Das war ein Mitglied des Rates, das den städtischen Aalfang am Hüxterdamm beaufsichtigte.
Wie man sich den Aalfang vorzustellen hat, glaubt jeder zu wissen, der Günter Grass’ Roman »Die Blechtrommel« gelesen oder den Film von Volker Schlöndorff gesehen hat: Dort werden die Aale mit Pferdeköpfen geangelt, die man nachts in der Weichsel auslegt und in die die Tiere sich verbeißen. In Wirklichkeit meiden Aale Aas; mit ihrem sehr feinen Geruchssinn lassen sie sich nur durch frisch getötete Köder anlocken. Grass hatte möglicherweise in seiner Danziger Jugend einmal beobachtet, wie die Aalfänger fleischlose Pferdeschädel ins Wasser hängten und sie voller Fische herauszogen. Diese Methode beruhte aber darauf, dass Aale Höhlen aller Art gerne als Versteck nutzen – ein Pferdeschädel war eine Einladung, es sich darin gemütlich zu machen, und man benutzte ihn früher anstelle von Aalreusen, wenn man die Fische nicht mit Aalharken, also rechenförmigen Geräten, die durch den Schlick gezogen wurden und auf deren Zinken die im Schlamm verborgenen Aale aufgespießt wurden, regelrecht erntete.
Der Aal ist nicht glitschiger als andere Fische, aber der Anblick der sich schlängelnden glänzenden Tiere erweckt den Eindruck besonderer Glätte. Schon bei den Römern war der Aal Inbegriff des listigen Menschen, der sich aus Schwierigkeiten herauswindet. In Plautus’ Komödie »Pseudolus«, die 191 v. Chr. uraufgeführt wurde, heißt es: »Anguilla est: elabitur« (Er ist ein Aal, er entwischt). Und im fünften Akt von Goethes »Faust II« brüsten sich die Pulcinelle, die weißen Clowns, ihrer Fähigkeit, »durch Drang und Menge aalgleich zu schlüpfen«. Wer sich windet wie ein Aal will sich aus einer peinlichen Lage herausschlängeln; so steht es schon bei Walther von der Vogelweide: »Der sich dem man wint ûz der hant reht als ein âl.«
Das Wort aalglatt existiert seit Mitte des 19. Jahrhunderts, und von Anfang an ist es mit einem moralischen Verdammungsurteil belegt gewesen, oft auch mit einem rassistischen oder nationalistischen Unterton – das Aalglatte ist das schlechthin Undeutsche. In seinem autobiographischen Roman »Der Amerika-Müde« nennt Ferdinand Kürnberger Philadelphia 1855 »ein aalglattes Quäkernest«, Albert Berg beschreibt 1873 in seinem Bericht über »Die Preussische Expediton nach Ost-Asien« Chinesen mehrfach als Menschen von »aalglatter Liebenswürdigkeit«, Ernst Haeckel gesteht 1899 dem Papst Leo XIII. widerstrebend zu: »Die neu gestärkte Macht des Vatikans nahm seitdem wieder mächtig zu, (…) durch die gewissenlosen Ränke und Schlangen-Windungen seiner aalglatten Jesuiten-Politik.« So geht es im 20. Jahrhundert in ungezählten Stellen in Literatur und Presse weiter – es ist ein Lieblingswort Kurt Tucholskys zur Beschreibung kaltschnäuziger Reaktionäre, aber auch im »Völkischen Beobachter« nutzt man es gerne, beispielsweise 1940 zur Stigmatisierung eines »aalglatten Patrons, der in sämtlichen Sprachen kauderwelschte«. Heute sind in einer Publikation wie der »Zeit« mal Wall-Street-Anwälte, mal Zocker, mal Karrieristen, mal Geschäftemacher aalglatt. Man sieht an dieser Liste, dass das Wort vor allem als Bauteil in die Phrasendreschmaschinen antikapitalistischer Rhetorik eingespeist wird – gerne mit leicht antisemitischem Zungenschlag.
Freundlicher ist das Verb aalen, das früher schlicht bedeutete: »Aale fangen« oder »eine verschlammte Röhre reinigen, indem man einen Aal an einem Strick durchzieht oder ihn lebendig durchschlüpfen lässt«. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird es im Sinne von »sich vor Wohlbefinden räkeln« gebraucht. Heute liest man es vor allem in der Redensart sich in der Sonne aalen, die, wie wir gesehen haben, streng zoologisch betrachtet paradox ist – der Aal aalt sich lieber in der Dunkelheit eines Pferdeschädels.
Affe
Woher kannten die Germanen Affen? In den südostniedersächsischen Gebieten, in denen mittlerweile die Urheimat der Germanen vermutet wird, gab es diese Tiere ja nicht. Trotzdem ist das Wort in vielen germanischen Sprachen vertreten, etwa im Altsächsischen als apo und im Altnordischen als api, im Englischen existiert es bis heute als ape, womit ein großer Menschenaffe gemeint ist, im Original war Tarzan »Lord of the apes«.
Bekanntlich sind die Germanen in den Jahrhunderten nach Christi Geburt ziemlich viel herumgekommen – als Söldner im römischen Heer oder als Eroberer, die sich römisches Reichsgebiet aneigneten. Die Goten verschlug es bis nach Spanien, die Vandalen bis nach Nordafrika. Von dort irgendwo könnten Germanen die Tiere und das Wort dafür in den Norden gebracht haben. Eine andere Theorie geht davon aus, dass reisende Kaufleute die Germanen mit dem Tier bekannt gemacht haben. Eine der vielen Spekulationen über den dunklen Ursprung von Affe ist, dass es aus einem semitischen Wort entstanden ist, dass auch im Altindischen als kapi existierte. Bei der Entlehnung aus dem Arabischen sei dann das K verloren gegangen. Andere vermuten, das Wort stamme aus dem Keltischen, wo es »Wasserzwerg« oder »Wassermonster« bedeutet habe. Der Bezug zum Wasser sei dann im Germanischen verschwunden.
Die Eigenschaften des Affen haben schon früh Übertragungen auf den Menschen provoziert, auch wenn affig im Sinne von »albern, geziert« erst im 19. Jahrhundert in der Berlinischen Mundart auftaucht. Schon im Mittelhochdeutschen ist Affe gleichbedeutend mit Narr in Zusammensetzungen wie affentanz, affenwort, affenzeit. Es gibt auch bereits das Wort äffen in den Bedeutungen »zum Narren werden« oder »zum Narren machen«. In letzterem Sinne hat es Heinrich Heine gebraucht, als er in seinem wütenden berühmten politischen Gedicht die schlesischen Weber singen ließ: »Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten / In Winterskälte und Hungersnöten; / Wir haben vergebens gehofft und geharrt, / Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt.«
In unserer Zeit ist davon nur noch nachäffen im Sinne von »nachmachen« übrig geblieben, das möglicherweise – wie so vieles – von Luther erfunden wurde. Jedenfalls taucht es in der substantivierten Form »das teuffelische nachaffen« bei ihm in den Tischreden auf. Es ist eventuell eine volksetymologische Umdeutung für das ältere nachäfern – »wiederholen«, das mit Affen gar nichts zu tun hatte, sondern mit der alten Bedeutung »wieder« von aber/afer zusammenhängt.
Für jemanden, der aus eigener Schuld zum Narren wird, sagen wir heute eher Er macht sich zum Affen. Wolf Biermann verbindet das wieder mit äffen: »Der aufrechte Gang wird selber / Zur Pose und zum Geschäft. / Der Mensch macht sich zum Affen / Der sich noch selber äfft!«
Einen Affen nennt man seit dem 18. Jahrhundert einen Alkoholrausch, vermutlich weil sich Betrunkene nicht selten wie Affen gebärden. Ähnliche Entwicklungen gibt es auch im Italienischen und Spanischen. Als Bezeichnung für einen Tornister in der älteren Soldatensprache leitet sich Affe vom Fellbezug her und davon, dass man diesen Gegenstand wie einen Affen auf der Schulter trug.
Die Kunst besteht darin, auch mit einem Affen auf dem Rücken noch eine affenartige Geschwindigkeit zu entwickeln. Das gelang den Preußen im Preußisch-Österreichischen Krieg 1866 recht gut. In der Wiener »Presse« kommentierte August Krawani am 18. Juni 1866 Nachrichten vom raschen Vormarsch des Feindes im Norden: »Die Preußen entwickeln überhaupt eine affenartige Beweglichkeit.« Zwei Wochen später waren die Österreicher in der Schlacht bei Königgrätz besiegt. Die Preußen griffen den Wiener Spott gerne auf und machten sich etwa im »Kladderadatsch« lustig, sie verfügten nicht nur über »affenartige Beweglichkeit«, sondern auch über »froschartige Kaltblütigkeit«, »hasenartige Schnelligkeit« usw. In der Umgangssprache ist daraus dann die affenartige Geschwindigkeit geworden.
Mit Affen kannten sich die Österreicher tatsächlich besser aus als die Preußen. Sie hatten ihre Anschauungen aus den Affentheatern gewonnen, von denen es in der k.u.k. Monarchie offenbar einige gab. Darin führten dressierte Affen Kunststückchen vor. 1819 berichtet ein Korrespondent der »Wiener Theaterzeitung« von solch einem Spektakel auf dem Pester Johann-Enthauptungsmarkt. 1829 wird im gleichen Blatt ein Affentheater als »neu« in Wien erwähnt. Später haben sich derartige Volksbelustigungen auch im Norden Deutschlands verbreitet, aber erst in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts wird das Wort im übertragenen Sinne gebraucht. Thomas Mann benutzt es 1924, um im Roman »Der Zauberberg« die lächerlichen und undurchsichtigen Duellaffären polnischer Patienten zu bezeichnen, und Kurt Tucholsky schreibt ein Jahr später in einer Laudatio zum 50. Geburtstag des Kritikers Alfred Polgar: »Sie haben aber nicht nur immer Bühnenkunst durchleuchtet, sondern auch einmal jenes große Affentheater von 1914 bis 1918.«
Eine übertriebene Liebe bezeichnet man seit um 1600 als Affenliebe, so spricht etwa der lutherische Prediger Johann Schreiter 1617 von der Affenliebe des Papsttums zu seinen Irrlehren. Häufiger taucht das Wort schon damals in Erziehungsratgebern auf, wo die Eltern davor gewarnt werden, eine für alle Fehler blind machende Affenliebe für ihre Kinder zu hegen. Goethe schreibt in einem Brief von 1819, er habe »einen mehr als jährigen Enkel, den ich mit großväterlicher Affenliebe, die größer als der Eltern seyn soll, für das allerliebste Geschöpf von der Welt halte«.
In vielen Verbindungen ist Affe ein bloßes, ziemlich sinnentleertes Steigerungspräfix. So wurde aus Zahn, das seit den zwanziger Jahren »Geschwindigkeit« bedeuten konnte, weil in frühen Autos und Flugzeugen die Geschwindigkeit mit einem Zahnrad geregelt wurde, im Laufe der Fünfziger der Affenzahn im Sinne von »hohe Geschwindigkeit«. Das DDR-Satireblatt »Eulenspiegel« schrieb 1958: »Leider ist bei den Lastkraftwagen des Großhandelskontors Haushaltchemie, Dresden, Lager Pirna, der Affenzahn im Fortbewegungstempo nicht für die Dauer zu erhoffen, weil der Zahn der Zeit an diesen Wagen nagt.«
Affenschande nennen wir seit dem 19. Jahrhundert etwas, für das sich selbst die notorisch schamlosen Affen schämen würden. Das Wort lässt sich erstmals nachweisen in einer am 14. September 1835 erschienenen Rezension des religionsskeptischen Romans »Wally, die Zweiflerin« von Karl Gutzkow. Über dessen Gesinnung flucht der Kritiker Wolfgang Menzel im »Literaturblatt« des »Morgenblattes für die gebildeten Stände«: »Herr Gutzkow hat es über sich genommen, diese französische Affenschande, die im Arme von Metzen Gott lästert, auf’s Neue nach Deutschland überzupflanzen, in einem Zeitalter, das Gott sey Dank gereifter und männlicher ist, als das Jahrhundert Voltaires.«
Bär
Der Bär ist das einzige Raubtier, das zumindest gelegentlich auf zwei Beinen steht. Das hat schon die Jäger in der frühesten Steinzeitepoche, dem Paläolithikum, auf die Idee gebracht, der Bär könne ein dem Menschen verwandter Dämon sein oder ein gottartiges Wesen, dem gegenüber es nicht nur praktische Vorsicht – um nicht gefressen zu werden – an den Tag zu legen gelte, sondern auch spirituelle Achtsamkeit. Überall in Eurasien lassen sich Spuren eines uralten religiösen Bärenkults nachweisen. Bei den westsibirischen obugrischen Völkern, den Chanten und Mansen, wird der Bär bis heute als Totemtier verehrt. Diese Indigenen leiten ihre Herkunft von einem Bären ab, einem Sohn des Himmelsgottes, der auf die Erde kam und sich dort eine Frau nahm.
Bei den Obugriern unterliegt alles, was mit dem Bären zu tun hat, einem sprachlichen Tabu. Das göttliche Tier wird »der Alte aus dem Wald« oder »alter Liebling« genannt, auch seine Körperteile und Gewohnheiten benennt man lieber indirekt, das Vokabular der Tabuwörter umfasst 360 Ausdrücke. Harald Haarmann schreibt in seinem Buch »Auf den Spuren der Indoeuropäer«: »In den frühen indoeuropäischen Regionalkulturen waren ebenfalls Tabuwörter für den Bären verbreitet: altindisch madhv-ád ›Honigesser‹ (ebenso altkirchenslawisch medvedi), litauisch lokys ›Eisbrecher‹, altnordisch bjorn ›der Braune‹.«
Solche Hüllwörter für den Bären gab es auch im Deutschen. Wer Johann Christoph Adelungs »Grammatisch-kritisches Wörterbuch« von 1774 aufschlägt, ahnt heute nicht mehr, dass der Familienname von dessen Verleger Breitkopf auf einen Ausdruck für den Bären zurückgeht, ebenso der Name Breithaupt.
Die Faszination für den Bären hat eine Menge Redensarten inspiriert, die entweder auf seine Stärke oder vermeintliche Plumpheit anspielen. Auch der Anblick der elenden Tanzbären, die von zwielichtigen Gesellen herumgeschleift wurden, schlug sich in der Sprache nieder. Die meisten dieser Wendungen sind aus der Mode gekommen, seitdem schon Ende des 17. Jahrhunderts im Harz und 1835 in Bayern die letzten deutschen Braunbären erschossen worden sind: ein ungeleckter Bär für »ein ungehobelter Geselle«, den Bären machen für »zu niedrigen Diensten missbraucht werden«, dem Bären ins Ohr blasen für »unter Lebensgefahr die Wahrheit aussprechen«, es ist ihm noch kein Bär in den Weg gekommen für »er weiß nichts von Anfechtung«.
Noch in Gebrauch ist bärbeißig mit der Bedeutung »brummig, unfreundlich«. 1693 in Christian Weises Rhetorik-Lehrbuch »Der freimütige und höfliche Redner« taucht es erstmals auf, mit der von heute leicht abweichenden Bedeutung »bissig, frech«. Dort steht der Ratschlag für den Konfliktfall: »Wir müssen zuvor sehen / wer es gethan hat / gegen einen grossen Herrn dürffen wir uns doch nicht bär-beißig machen.« Häufiger wird das Wort erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts benutzt. Bei Adelung wird es 1774 mit »zänkisch, auffahrend« definiert.
Komplizierter ist der Ursprung der Redensart jemandem einen Bären aufbinden. Ursprünglich meinte einen Bären anbinden seit dem 17. Jahrhundert »Schulden machen«. Bei Johann Balthasar Schupp heißt es 1663 über einen Hallodri: »Du hast ansehnlich gereiset / durchs gantze Schlauraffenland / und in allen Weinkellern / Bubenwinckeln / wol gar Käuchen und Narrenhäuseln / deines Namens Gedächtnus hinterlassen; manchen Bären angebunden / manchen Affen gefangen / manche Sau gehetzet / Füchs geschossen / Hasen agirt.« Dem liegt das missverstandene mitteldeutsche und niederdeutsche Wort Bere, Bäre zugrunde, das »Abgabe« bedeutet und im Mittelhochdeutschen sogar in der Form bern vorkommt.
Möglicherweise hat einen Bären anbinden dann schon bald zusätzlich die Bedeutung »schwindeln« angenommen, weil man beim Schuldenmachen so viel lügen muss. So schreibt Grimmelshausen im »Simplicissimus« 1668 über Menschen, die so gutgläubig waren, »dass ich ihnen, wenn ich nur aufschneiden wollen, seltsame Bären hätte anbinden können«. Und Johann Beer lässt 1680 den Helden seines Roman »Jucundi Jucundissimi Wunderliche Lebens-Beschreibung« sich über die Tochter eines Wirts entsetzen, die dieser dem Helden als Ehefrau andrehen wollte: »Dann da wurden wir erst gewahr / daß uns der Wirth einen grausamen Bären angebunden hatte / dann ich kan nicht genugsam beschreiben / wie ein ungestaltes langseitiges Mensch die Jungfer ware; Sie schielte mit den Augen / und die Nase war ihr um zwey gute Finger zu kurz / und was noch das ärgste war / so gieng sie auf der Steltzen.«
Einen Bären aufbinden im heutigen Sinne ist offenbar jünger. Es lässt sich nicht vor dem späten 18. Jahrhundert nachweisen. Dann aber findet es sich bei Wieland und anderen.
Noch um 1800 kann laut Adelung einen Bären anbinden sowohl »Schulden machen« als auch »weismachen« bedeuten. Doch wurde anbinden, wenn vom Schwindeln die Rede war, immer häufiger durch aufbinden ersetzt, vermutlich, um den Doppelsinn zu vermeiden und klarzumachen, was eigentlich gemeint ist.
Eindeutiger ist die Überlieferungslage beim Bärendienst. Die Bedeutung »Handlung, die in guter Absicht erfolgt und trotzdem schlechte Folgen hat« geht wohl auf die Fabel »L’ours et l’amateur des jardins« (deutsch: »Der Bär und der Gartenfreund«) von Jean de La Fontaine aus dem späten 17. Jahrhundert zurück, die im 18. Jahrhundert ins Deutsche übersetzt wurde. Darin hat ein Greis, der einsam im Wald lebt, sich mit einem Bären angefreundet. Eines Tages will der Bär eine Fliege, die sich auf dem Gesicht des schlafenden alten Mannes niedergelassen hat, verjagen und wirft einen Pflasterstein nach ihr. Zwar trifft er genau, aber er zerschmettert dem Freund damit den Kopf. Moral: »Nichts bringt so viel Gefahr uns wie ein dummer Freund; weit besser ist ein kluger Feind.«
Der erzählerische Kern der Fabel ist viel älter, La Fontaine hat sie dem »Panchatantra« entnommen, einer indischen Sammlung moralischer Tiergeschichten aus dem 6. Jahrhundert nach Christus. Eine persische Fassung der Sammlung hatte der Orientalist Gilbert Gaulmin 1644 ins Französische übersetzt. Im Deutschen lässt sich das Wort Bärendienst allerdings erst 1875 nachweisen. Das spricht dafür, dass nicht irgendwelche mittelalterlichen Vorstellungen, sondern La Fontaines Fabel der Ursprung des Ausdrucks war, der auch in vielen nord- und osteuropäischen Sprachen vorkommt. Die Macher des Grimm’schen Wörterbuchs vermuten, Bärendienst sei eine Entlehnung aus dem Russischen nach medweschna usluga, denn dieses ist älter und geht auf eine sehr populäre Version der La-Fontaine’schen Fabel zurück, die Iwan Andrejewitsch Krylow gedichtet hat.
Ziemlich eindeutig ist die Lage auch bei faul auf der Bärenhaut liegen für »durch Nichtstun verderben«. Anfang des 15. Jahrhunderts wurde die »Germania« des römischen Historikers Tacitus entdeckt, die mittels eines einzigen Exemplars in der Abtei Hersfeld die Zeiten überdauert hatte. Um 1500 nutzten Humanisten wie Ulrich von Hutten das Buch zur Konstruktion eines Germanenmythos, der die Vorfahren der Deutschen als kriegerisch und frei verherrlichte. Das passte auch zur allgemeinen Rom-Skepsis der reformatorischen Epoche.
Im Kapitel 15 der »Germania« heißt es über den germanischen Krieger: »Liegt er nicht zu Feld, so gehören seine Tage dem Waidwerk, noch mehr aber dem geliebten Nichtstun, dem Schlafen, Essen und Trinken. In tatenloser Ruhe liegen diese tapfern kriegerischen Leute, die Sorge für Haus und Herd und Feld ist den Weibern und Alten und jedem Schwächling der Familie überlassen, die Männer sehen müßig zu.« 1509 lässt sich dann die Wendung auf der Bärenhaut liegen das erste Mal nachweisen. Das Bärenfell war als Ruhedecke und Zeltteppich im 15. und 16. Jahrhundert noch ein weitverbreitetes Reiseutensil. Mit ihm verband sich in der Phantasie der Zeitgenossen die Vorstellung von den faulenzenden Germanenkriegern, obwohl Tacitus ja gar keine Bärenfelle erwähnt. Von dort leitet sich auch das im Humanismus und Barock überaus beliebte Schimpfwort Bärenhäuter her, das 1536 bei Georg Witzel erstmals zu finden ist. Ein knappes Jahrhundert später, 1605, heißt es in Berthold von der Beckes »Soldatenspiegel« über Faulenzer und Feiglinge: »Rechtschaffene Soldaten lassen sich solcher Bernhäuter vnd Müssiggänger Geschwetz im geringsten nichts hindern noch anfechten.«
Bevor man auf der Bärenhaut liegen kann, muss man sie aber erst mal fleißig erjagen oder wenigstens kaufen. Hier tut sich ein Abgrund an Betrug und Jägerlatein auf. Schwankgeschichten von Taugenichtsen, die das Fell eines Tieres verkauften, das sie noch gar nicht hatten, existieren seit uralten Zeiten in vielen Ländern. Schon bei den Römern wurde gewarnt, man solle nicht priusquam mactaris, excorias – »schinden, bevor man geschlachtet hat«. Im Deutschen spottet Thomas Murner 1512 über Priester, die »hondt die Berenhüt verkoufft. Ee das ir eine in erloufft«. Der frühkapitalismuskritische Luther prangert ein paar Jahrzehnte später überreiche und risikofreudige Kaufleute an, welche die »dreizehende bernhaut« verkaufen. Heute nennen wir Haut nur noch, was weitaus geringer behaart ist, und die moderne Variante der Redensart, die davor warnt, sich des Erfolges allzu früh sicher zu sein, lautet: Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erlegt ist.
Gewissermaßen am anderen Ende der Zeitskala, die bis zu Germanen und Römern zurückreicht, steht der Bär als Idealbild in der Mythologie gegenwärtiger Schwuler: Bär heißt hier ein meist in Leder gewandeter Typ von Mann, der mit stämmiger Figur und kräftiger Behaarung nicht nur im Gesicht die Blicke auf sich zieht. Deshalb nennt sich eine Kneipe im alten Ost-Berliner Schwulenviertel Prenzlauer Berg »Bärenhöhle«. Diese Bären sind das Gegenbild zur effeminierten Tunte, aber auch zum jungen knabenhaften Schwulen. Obwohl es derartige Vorlieben natürlich schon immer unter deutschen Homosexuellen gegeben hat, sind die Szene und der Begriff dafür aus den USA, genauer aus San Francisco importiert, wo seit 1987 ein »Bear Magazine« erscheint, dessen Herausgeber Richard Bulger als großer Popularisierer des Ausdrucks bear gilt. Sein Urheber war möglicherweise der Journalist George Mazzei, der 1979 in einem Artikel für »The Advocate«, das älteste Homosexuellenmagazin der USA, unter dem Titel »Who’s Who in the Zoo?« Schwule in sieben verschiedene Tierarten einteilte, darunter auch bears.
Doch auch Heterosexuelle haben eine Bärenmetapher: Wie fast jedes andere haarige Tier musste auch der Bär als Synonym für das weibliche Geschlechtsteil herhalten. Nachdem 1972 die deutsche Ausnahmeathletin Ulrike Meyfarth bei den Olympischen Spielen in München die Goldmedaille im Hochsprung gewonnen hatte, erzählten sich pubertierende Jungen den Witz: »Welcher Bär springt am höchsten? Der von Ulrike Meyfarth.«
Biene
Die Biene ist eine unserer ältesten Bekannten. Sie ist das erste Insekt, mit dessen Lebensweise sich Menschen genauer beschäftigt haben. Denn Honig schätzt man seit etwa 13000 Jahren. Bei der Gewinnung dieses süßen Naturstoffs muss zwischen frühem Honigsuchen und späterem Honigsammeln unterschieden werden. Anfangs wurde der Honig einfach aus den Nestern der Wildbienen geholt, die man immer wieder neu suchen musste. Doch dann lernten die Menschen, wilde Bienen in Baumhöhlen anzusiedeln. Dort produzierten sie den Honig unter menschlicher Kontrolle. Für diese Waldimkerei gab es im Deutschen das Verb zeideln, das heute nur noch im Familiennamen Zeidler lebt.
Das Zeideln lohnte sich, seit sich nach der letzten Eiszeit überall in Europa die Bedingungen für Blütenpflanzen verbessert hatten. Die bevorzugten Bäume der Honigbienen – die Linde und die Eiche – verbreiteten sich damals in der eurasischen Waldsteppe, in der sich frühe Indoeuropäer und frühe uralische Völker begegneten. Die Wörter meksi »Biene«, medhu »Honig« und wosko oder wokso gehören zur ältesten Schicht der indogermanischen Sprachen; die Letztgenannten erkennt man trotz zahlreicher Formwandlungen innerhalb vieler Jahrtausende unter anderem noch im französischen miel und in unserem Wachs wieder.
Die Unermüdlichkeit, mit der die Bienen schwärmen und winzige Nektartröpfchen zum Stock bringen, hat schon früh dazu geführt, dass man sie als Inbegriff des Fleißes ansah. Allerdings galt das in der Antike, in der Arbeit etwas für Sklaven war, das den Vornehmen schändete, nicht immer als etwas Positives: Demokritos verabscheute Bienen und verglich sie mit dem Geizigen. Beide arbeiteten, als ob sie ewig leben würden. Die Biene wird hier zum Schreckbild des seelenlosen Menschen, der nur noch für die Arbeit lebt, so wie es in der Moderne der Roboter geworden ist.
Nachdem das Christentum spätestens durch die mönchische Parole ora et labora die Arbeit geheiligt hatte, betrachtete man den Bienenfleiß und die geheimnisvolle Organisation des Bienenstaats fast nur noch mit Sympathie und Dankbarkeit. Im Lorcher Bienensegen aus dem 10. Jahrhundert werden die Bienen in einer rheinfränkischen Variante des Althochdeutschen als verständige Partnerwesen angeredet: »Kirst, imbi ist hûcze / Nû fliuc dû, vihu mînaz, hera / Fridu frôno in munt godes / gisunt heim zi comonne.« (Christ, der Bienenschwarm ist hier draußen! / Nun fliegt, ihr meine Bienen, kommt. / Im Frieden des Herrn, unter dem Schutz Gottes / kommt gesund zurück.) Und auch im Grimm’schen Märchen von der Bienenkönigin sind die Insekten verständige und dankbare Partner: Die Königin hilft dem jüngsten, dümmsten, aber rücksichtsvollsten von drei Brüdern, herauszufinden, welche von drei schlafenden Königstöchtern Honig gegessen hat. Als er diese Aufgabe gelöst hat, werden seine zu Stein verwandelten Brüder und alle anderen im verwunschenen Schloss erlöst. In »Tischlein deck dich« ist es die Biene, die am Ende die intrigante und verlogene Ziege, die das Unglück der drei Brüder heraufbeschworen hat, zur Strafe in den Kopf sticht.
In vielen Städtewappen steht die Biene für Fleiß. Napoleon machte daraus ein regelrechtes Propagandastilmittel und zeichnete »gute Städte des französischen Imperiums« mit drei Bienen aus. Auf vielen französischen Wappen wurden in der napoleonischen Zeit die bourbonischen Lilien durch Bienen ersetzt. Doch die Biene als Symbol ist natürlich kein exklusiver Besitz Frankreichs. Wer aufmerksam die Portale von deutschen Schulen aus der Gründerzeit und dem frühen 20. Jahrhundert betrachtet, wird dort häufig in Stein gemeißelte Bienen entdecken, die den Schülern als Vorbild an Fleiß und Untertanentreue präsentiert wurden.
In solchen Schulen wurden aber noch keine Bienchen oder Fleißbienchen als Auszeichnungen für vorbildliche Leistungen in die Mitteilungshefte gestempelt, obwohl sich ähnliche Hefte bereits 1838 an einer Berliner höheren Töchterschule nachweisen lassen und sicher auch anderswo existierten. Die Wörter Bienenfleiß und bienenfleißig nutzte man ebenfalls schon im 19. Jahrhundert. Und Wilhelm Raabe nennt in seiner letzten vollendeten Erzählung »Halstenbeck« 1898 ein Findelkind, das sich im Pfarrhaushalt zu einer besonders fleißigen jungen Frau entwickelt, das »Bienchen von Boffzen«. Der Bienchenstempel ist dennoch offenbar eine Erfindung der DDR, wo die oben genannten Hefte Muttihefte hießen. Möglicherweise ist der erklärende Zusatz Fleiß in Fleißbienchen erst nach der Wende entstanden, als man den Wessis erklären musste, was gemeint war. In der DDR verstand auch jeder das einfache Bienchen. Noch 1995 heißt es in der Ost-»Berliner Zeitung« über Heiko Herrlich, der sich beim EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien hervorgetan hatte: »Herrlich: Ein Bienchen für Fleiß und Einsatz, nicht von ungefähr am zweiten deutschen Treffer beteiligt.«
Biene oder Filzbiene war in der Sprache der Soldaten, wandernden Handwerker, Landstreicher oder Bettler auch ein Hüllwort für Läuse. 1916 nennt ein humoristisches Gedicht in einer Soldatenzeitung die an der Westfront allgegenwärtige Laus Schützengraben-Biene. Ich habe diese Bedeutung erst durch den Roman »Madita« kennengelernt, der wie fast alle Bücher Astrid Lindgrens von Anna-Liese Kornitzky übersetzt wurde. Hier fängt sich die Titelheldin, die aus einem wohlhabenden Haus stammt, die »Bienchen« bei der armen Mia ein, die in ihre Klasse geht. Als das Dienstmädchen Alva die beiden entlaust, werden die Kinder, die sich früher oft geprügelt haben, endgültig Freunde. Das Buch spielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs (alle Anspielungen darauf wurden in der deutschen Fassung getilgt) und die 1909 geborene Übersetzerin hat 1961, als »Madita« hierzulande herauskam, möglicherweise ganz bewusst ein Wort aus ihrer Kindheit gewählt.
1962 ist Biene erstmals als Bezeichnung für ein attraktives junges Mädchen in der Jugendsprache belegbar. Im Teenager-Wörterbuch »Steiler Zahn und Zickendraht« konkurriert es damals allerdings noch mit Bombe, Eule, Ische, dufte Kante, steiler Zahn und Stoßzahn. Neu ist daran nur, dass Biene hier positiv und anerkennend gebraucht wird. Für Dirnen und andere Mädchen mit niedriger sozialer Stellung war ein abwertendes Fabrikbiene (»Arbeiterin«), kesse Biene (»schlaue Dirne«) oder Bruchbiene (»Soldatenhure«) bei Schülern und Studenten schon früher im Gebrauch. Bienchen als Kosename benutzt dagegen bereits der Barock-Poet Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau. Die Gleichsetzung von Bienen und Frauen rührt wahrscheinlich vom Vergleich der weiblichen Figur und ihrer früher einmal modischen Einschnürung in der Mitte mit dem gekerbten Körper der Bienen her – auch wenn sich für diese modische Torheit in der Allgemeinsprache heute der Ausdruck Wespentaille durchgesetzt hat, dessen Spuren sich bis zu E.T. A. Hoffmann zurückverfolgen lassen.