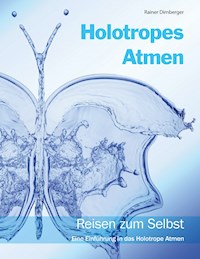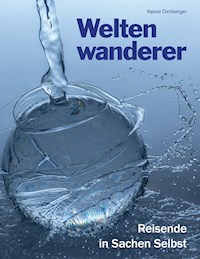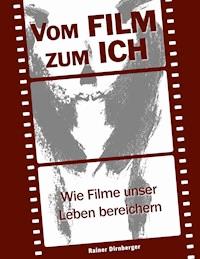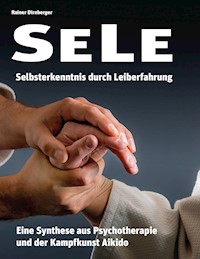
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
SELE – Selbsterkenntnis durch Leiberfahrung – ist eine Synthese aus den Weisheitslehren östlicher Kampfkunst und westlicher Psychotherapie, entwickelt vom Autor aus seiner nunmehr jahrzehntelangen Erfahrung in Praxis und Lehre als Aikidoka und transaktionsanalytischer Psychotherapeut. SELE ist ein homogen durchdachtes, am ganzheitlichen Erleben ausgerichtetes, Konzept empathischer Selbsterfahrung. Die vorgestellten Übungen, veranschaulicht durch viele erläuternde Bilder, werden eingebettet in einen theoretischen Kontext und Erklärungsrahmen. SELE wendet sich an TherapeutInnen, Interessierte und Praktizierende von: Körper- und Leibarbeit, Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung, Kampfkünsten
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor – Mag. Rainer Dirnberger
Transaktionsanalytischer Psychotherapeut, Lehrtherapeut, Supervisor und Coach, Klinischer- und Gesundheitspsychologe, Transpersonale Psychologie und Atemarbeit, Leitung von Gruppen und Seminaren.
5. Dan Aikido, Aikido-Lehrer, Aikido Dojo Steiermark, Graz
Weitere Informationen unter www.dirnberger.co.at
Über dieses Buch
SELE ist eine Verschmelzung östlicher und westlicher Weisheit mit dem Ziel wohlwollender Selbsterkenntnis.
Dabei ist SELE Bezugsrahmen und Interventionsleitfaden für leiborientierte Selbsterkenntnisprozesse, eingebettet in ein humanistisches Menschenbild, eine humanistische Ethik und ganzheitliche Sichtweise.
SELE wendet sich an InteressentInnen und PraktikerInnen von leiborientierter Selbsterkenntnis und der Psychologie von Kampfkünsten. Darüber hinaus sollen LaiInnen motiviert werden, sich für leiborientierte Selbsterfahrung zu öffnen.
PraktikerInnen im Selbsterfahrungskontext können methodische wie theoretische Anregungen finden und Ermutigung, sich mit leiborientierter Arbeitsweise anzufreunden.
Ausübende einer Kampfkunst mögen ein tieferes Verständnis für ihr Üben und ihre Praxis gewinnen.
Basis und Prinzipien von SELE wurden so konzipiert, dass sie von unterschiedlich ausgebildeten TherapeutInnen und Praktizierenden von verschiedenen Leib-/Körperkünsten in ihren Arbeitsrahmen integriert werden können.
Wer andere beurteilen will, muss erst sich selbst beurteilen.
Wer andere erkennen will, muss erst sich selbst erkennen.
Erkenntnis lässt sich nicht von anderen lernen, sie muss aus dem eigenen Ich hervorgehen.
Nur die Allerweisesten und die Allerdümmsten ändern sich niemals.
Östliche Weisheiten
(frei nach Lü Bu Wei, Tseng Tse und Kungfutse)
Wir, die wir bewusst und würdig leben und Herren und nicht Sklaven im eigenen inneren Haus sein wollen, kommen nicht umhin, Kenntnis über uns selbst zu erlangen.
Es findet eine seelische Entwicklung statt, die bisherige, erstarrte Strukturen auflöst und neue Formen des Erlebens und Wollens möglich macht, so wird Selbsterkenntnis zu Selbstbestimmung.
Westliche Weisheiten
(frei nach Roberto Assagioli und Peter Bieri)
Inhaltsverzeichnis
1 Die Reise beginnt
2 Einleitung zu Theorie und Praxis von SELE
3 Anthropologie
3.1 Selbst
3.2 Erkenntnis – Selbsterkenntnis
3.2.1 Wie aber erkennen wir?
3.2.2 Erkenntnis und Bezugsrahmen
3.2.3 Wirklichkeitskonstruktion
3.2.4 Flexibler Bezugsrahmen
3.3 Selbsterkenntnis als Innenschau oder Außenkontakt
3.4 Entwicklung
3.5 Erfahrung
3.6 Leib
3.7 Spiritualität
4 Grundannahmen dieser Anthropologie
4.1 Ganzheit
4.1.1 Übung zur Ganzheit: „Erlebniswege“
4.2 Verbundenheit
4.3 Selbstbewusstheit
4.4 Bewusstseinsvariabilität
4.5 Offene, lebenslange Entwicklung
5 Basis von SELE als Leibentwicklung
5.1 Haltung
5.1.1 Körperliche Haltung
5.1.2 Geisteshaltung
5.1.3 Emotionale Haltung
5.1.4 Einstellung
5.1.5 Denken
5.1.6 Eigenverantwortung
5.1.7 Gelassenheit
5.1.8 Wachstumsbereitschaft
5.1.9 Die Haltung zu sich selbst
5.1.10 Haltungsübungen im Stehen: „Zentrierte Haltung“
5.1.11 Partnerübung zur Haltung: „Die Macht der Haltung“
5.2 Der Leib in Ruhe
5.2.1 Liegen
5.2.2 Übung im Liegen: „Entspanntheit im Liegen“
5.2.3 Sitzen
5.2.4 Übung im Sitzen: „Meditation“
5.2.5 Stehen
5.2.6 Übungen im Stehen: „Finden der Mitte“
5.2.7 Kleingruppenübung zu dritt: „Zentriertes Gleichgewicht“
5.3 Der Leib in Bewegung
5.3.1 Bewegung im Liegen, Sitzen, Stehen
5.3.2 Bewegungsübung im Stehen: „Gewichtsverlagerung: Schieben/Ziehen“
5.3.3 Bewegungsübung im Stehen: „Gewichtsverlagerung: Drehen“
5.3.4 Bewegung als Ortsveränderung
5.3.5 Übung zur Ortsveränderung: Schrittübung: „Perspektivenwechsel“
5.4 Berührung – berühren, berührt werden, sich berühren lassen
5.4.1 Partnerübung: „Bewegung durch Spüren der Hände“
5.4.2 Berührungsübung zu dritt: „Schlammausstreichen“
5.4.3 Partnerübung im Liegen: „Berührt werden durch Spüren der Hände“
5.5 Begegnung in der Bewegung
5.5.1 Gruppenübung: „Begrüßung als erstes Kennenlernen“
5.5.2 Gruppenübung: „Begrüßung als Reflexion von Erwartungshaltung und Einstellung“
5.5.3 Sensibilisierungsübung: „Blind geführt werden“
5.5.4 Partnerübung: „Sanftes Spüren der Kraft“
6 Basis von SELE als Selbsterfahrung
6.1 Bewusstheit
6.2 Austausch
6.3 Gegenwärtigkeit
6.4 Sicherer Erfahrungsrahmen
7 Prinzipien für positive Selbsterfahrung
7.1 Freiheit
7.1.1 Partnerübung: „Freiräume“
7.2 Achtsamkeit
7.2.1 Übung zur Achtsamkeit: „Geführte Entspannungsmeditation“
7.3 Verantwortung
7.3.1 Partnerübung: „Verantwortung übernehmen“
7.3.2 Illustrationsbeispiel: „Verantwortung übernehmen“
7.4 Macht durch Gewaltlosigkeit
7.4.1 Partnerübung: „Macht durch Gewaltlosigkeit“
7.5 Wohlwollen, wohlwollende Beziehung
7.5.1 Gruppenübung zum Wohlwollen: „Positive Zuwendung“
7.6 Illustrationsbeispiel: „Verstrickungen“
8 Prinzipien für positive Leiberfahrung
8.1 Dynamisches Gleichgewicht
8.1.1 Partnerübung: „Aus dem Gleichgewicht bringen“
8.1.2 Partnerübung: „Das Gleichgewicht aufgeben können“
8.1.3 Gruppenübung: „Symbiotisches Gleichgewicht I“
8.2 Weichheit
8.2.1 Partnerübung: „Macht der Weichheit“
8.3 Energie und Atmung
8.3.1 Atemübungen zur „Sammlung“ zum Beispiel am Ende einer Arbeitseinheit
8.3.2 Atemübung zum „Energetisieren“
8.3.3 Atemübung: „Ausdruck von Unmut“
8.3.4 Atemübung: „Begrüßung der Welt“
8.4 Illustrationsbeispiel: „Freiraum“
9 Prinzipien des Arbeitens mit SELE
9.1 Einstiegsübungen
9.1.1 Gruppenübung: „Leiblichkeit des Leidens“
9.1.2 Partnerübung: „Festgehalten werden“
9.2 Nutzen der Freiräume/Ressourcen
9.2.1 Partnerübung: „Die Macht der Ressourcen“
9.3 Aktivität statt Passivität
9.3.1 Partnerübung: „Ausweichen“
9.4 Zusammenführen statt Widerstand
9.4.1 Partnerübung: „Zusammenführen“
9.5 Leiten statt Manipulieren
9.5.1 Partnerübung: „Führen“
9.5.2 Partnerübung: „Tanz der Energien“
9.6 (Los-)Lassen statt (Fest-)Halten
9.6.1 Partnerübung: „Symbiotisches Gleichgewicht II“
9.6.2 Partnerübung: „Tragen – Ertragen“
9.6.3 Gruppenübung: „Getragensein – Loslassen“
9.7 Illustrationsbeispiel: „Wege zur Öffnung“
10 Konfliktbearbeitung mit SELE
10.1 Einführung
10.2 Partnerübung: „Konflikt – Lieblingsreaktion“
10.3 Partnerübung: „Stopp“
10.4 Illustrationsbeispiel: „Totstellen“
10.5 Beziehungsorientierte Konfliktlösung von SELE
10.5.1 A: Aufnehmen des Konfliktes
10.5.2 B: Durchleben des Konfliktes
10.5.3 C: Lösen aus dem Konflikt
10.6 Grundannahmen des beziehungsorientierten Konfliktlösemodells
10.7 Übungen zur beziehungsorientierten Konfliktlösung
10.7.1 Option: „Vorbeilassen“
10.7.2 Option: „Platz tauschen“
10.7.3 Option: „Tanz der Energien“
10.7.4 Variation des Angriffes: „Angriff von oben“
10.7.5 Gruppenübung: „Angriff von hinten“
10.8 Illustrationsbeispiel: „Konfliktlösung“
11 Übung macht den Meister?
11.1 Üben als Lernen, der Prozess von Aneignungsphase und Konsolidierungsphase
11.2 Übung als Struktur und Ritual
11.3 Meisterschaft oder Klassenbester
12 ANHANG:
Mein Weg zu SELE
12.1 Psychotherapeutische Selbsterfahrung
12.2 Transaktionsanalyse (TA
)
12.3 Kampfkunst
12.4 Aikido
12.4.1 Prinzipien des Aikido
12.4.2 Aikido-Prinzipien aus psychologischer Sicht
12.4.3 Aikido und Selbsterfahrung
12.5 Aikido als Problemlöseparadigma
12.5.1 Schritt 1 – Die Haltung
12.5.2 Schritt 2 – Das Herangehen
12.5.3 Schritt 3 – Das Aufnehmen
12.5.4 Schritt 4 – Das Vereinigen
12.5.5 Schritt 5 – Das Gemeinsame
12.5.6 Schritt 6 – Die Trennung
12.5.7 Schritt 7 – Die Haltung
12.6 Vergleich: Transaktionsanalyse – Aikido
12.7 Zusammenfassung: Therapeutische Effekte des Aikido
13 Bonusmaterial/Epilog: Ziel und Spiritualität
13.1 Ziel von Aikido und Selbsterfahrung
13.2 Aikido und Spiritualität
13.2.1 Atemübung: „Öffnung und Sammlung“
14 Literaturverzeichnis
15 Personenindex
16 Widmung
17 Dank
1 Die Reise beginnt
Als meine Frau vor nunmehr vielen Jahren als damalige junge Physiotherapeutin eines Tages nach Hause kam, erzählte sie mir Folgendes. Sie hatte am Nachmittag einen Patienten behandelt. Als sie an einer bestimmten Stelle physiotherapeutisch intervenierte, ich glaube mich erinnern zu können, dass die Berührung am oberen Brustbereich stattfand, brach der Patient plötzlich, für beide unvorhergesehen und überraschend, in Weinen aus. Beide konnten sich diese heftige emotionale Reaktion, ausgelöst durch eine sanfte Berührung, nicht erklären.
Diese Erzählung weckte in mir eine vergessene Erinnerung: Einst als junger Mann, ich hatte gerade mit dem Aikido begonnen, wurde ich von einem Trainingskollegen wegen Schulterschmerzen massiert. Er begann bei meiner Nackenmuskulatur und äußerte beiläufig, mit einer Mischung aus Überraschung und Mitgefühl: „Na ja, da trägst du aber auch einen ganz schönen Rucksack mit dir rum.“ Augenblicklich schossen mir Tränen in die Augen und ich wurde sehr traurig, ohne zu wissen, warum. In vielen Jahren Selbsterfahrung, therapeutischer Aus- und Weiterbildungen konnte ich so manches Geheimnis aus diesem Rucksack lüften.
Bis heute bleibt die Faszination hinsichtlich dieser Einheit unseres Seins, der Einheit von Geist und Körper, wenn wir unsere Leiblichkeit spüren, wahrnehmen und benennen können; Momente, in denen unser Körper eine Art Gedächtnis unseres Lebens zu sein scheint, jede Zelle zutiefst assoziiert mit Emotionen, Verhaltensimpulsen und Erinnerungen. Wie eindrucksvoll vermögen schon zarteste Berührungen diese auszulösen! Andererseits können diese Stellen unendlich oft ohne die geringste Reaktion berührt werden. Es ist das Erleben von Einfühlung und Wohlwollen, das diesen „Zauber“ der Berührung oft erst ermöglicht. Es sind sehr bewegende Augenblicke, wenn Berühren, Berührtwerden und Sich-berühren-Lassen heilsam wird. Vielleicht können wir das als die Seele von SELE bezeichnen: berührende Begegnung im Berühren, Berührtwerden, Sich-berühren-Lassen.
Ein weiser Mann oder eine weise Frau soll einmal gesagt haben:
„Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt vor die Haustüre. Bis auf eine! Die Reise zu dir selbst. Sie beginnt mit deinem ersten Atemzug und endet mit deinem letzten. Es ist nicht die Frage, ob du diese Reise antreten möchtest oder willst, vielmehr ist es entscheidend, ob du sie mit sehendem Blick, offenem Herzen und wachem Geist führst. Das entscheidet nicht nur darüber, ob du eines Tages ankommen wirst, oder die Reise einfach aufhört. Das Ende liegt ebenso wenig in deiner Hand, wie es der Beginn tat, auch wenn du sie jederzeit abbrechen kannst. Vieles wurde bereits bei deinem Start festgelegt, vieles durch Ereignisse im Laufe der Jahre. Zu erkennen, was auf dieser Reise in deiner Macht steht und was nicht, ist immer auch eine Gnade, aber auch Frage deines Willens und deiner Haltung. So kannst du zum Beispiel nicht beeinflussen, wer deine Mitreisenden sein werden, aber wie du ihnen begegnest, manchmal auch, wie oft du ihnen begegnest. Es ist die Reise deines Lebens, durch dein Leben zu deinem Selbst. Ich wünsche dir viel Glück, gute Erfahrungen und Wegbegleiter, weise Ratgeber und liebevolle Beziehungen.“
In diesem Sinne darf ich eine anregende, bereichernde und freudvolle Lesereise durch dieses Buch wünschen und mich dem letzten Satz des oder der (wer weiß das schon so genau) Weisen anschließen: Viel Glück, gute Erfahrungen und Wegbegleiter, weise Ratgeber und liebevolle Beziehungen!
Ad Gender: Im Bemühen um eine nette Lesbarkeit mit respektvoller Gender-Würdigung wechsle ich bei den Übungen das Geschlecht von Partner und Erfahrenden ab (ungeachtet der Geschlechtszugehörigkeit auf den Bildern zu den Übungen). Bei den TeilnehmerInnen sind mit der weiblichen Form auch alle männlichen Teilnehmer als großes I inkludiert. Vice versa hoffe ich, dass sich weibliche Leserinnen bei allfälligen männlichen Formulierungen nicht ausgeschlossen fühlen. Den Begriff Therapeut habe ich in männlicher Form im Text gehalten, als dezente Anspielung auf die Personalunion von mir als Autor und Therapeut, bei konstanter Geschlechterzugehörigkeit.
Die vorliegenden Überlegungen sind, ebenso wie die praktischen Übungen, aus meiner, nunmehr jahrzehntelangen, über gewisse Phasen sehr intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema Psychotherapie und Kampfkunst erfolgt. Wo immer es meiner Erinnerung und meinem Bewusstsein zugänglich war oder die Recherchen es ermöglichten, habe ich die Referenzen und Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erwähnt und zitiert. Variationen der oft gleichen Übungen habe ich in sehr verschiedenen Kontexten, Schulausrichtungen und Bezugsrahmen kennengelernt, sodass es mir unmöglich ist, so etwas wie einen „ersten Erfinder“ zu benennen.
Die Basis der Übungen lernte ich im Aikido von Tamura Sensei und seinen Schülern kennen sowie in der transaktionsanalytischen (TA) Ausbildung bei Mag. Almut Rottenbacher, Dr. Jan Hennig und anderen TA-lern (siehe Anhang). Mein Interesse führte mich weit über diese Basis hinaus. Wie eben angedeutet, begegnete ich so manchen Vorstellungen und Übungen, im leicht veränderten Gewande, immer wieder. Letztendlich ist das auch nicht wirklich verwunderlich, arbeiten doch alle immer mit denselben Erscheinungsformen, eben uns, dem Homo sapiens, auch wenn Erklärungsrahmen und Überlegungsansätze verschieden sein mögen.
Es entspricht meiner Gewohnheit, (die hier vorgestellten) Übungen situativen Anforderungen und Gegebenheiten anzupassen und sie, teils erheblich, zu verändern und zu variieren. In der hier dargelegten Form haben sie für mich die beste Anschaulichkeit und Gültigkeit. Wie im Weiteren deutlich wird, ist SELE kein Konzept einer starren Theorie und Übungsabfolge, vielmehr sind die Modelle flexibel, um den lebendigen Bedürfnissen der jeweiligen Situation adäquat und förderlich entsprechen zu können.
2 Einleitung zu Theorie und Praxis von SELE
Die Theorie von SELE ist eine Synthese aus psychotherapeutischem Basiswissen um entwicklungsförderliche Selbsterfahrung mit der Psychologie und Philosophie der Kampfkunst Aikido. SELE ist somit eine Verschmelzung östlicher und westlicher Weisheit mit dem Ziel wohlwollender Selbsterkenntnis. Ganz im Sinne psychotherapeutischer Arbeit ist dieses übergeordnete Ziel keine statische, vorgegebene Größe oder in irgendeiner Form ein Heilsversprechen. Vielmehr ist SELE ein Konzept zur Anregung und Inspiration für individuelle leibliche Erfahrung, die in Auseinandersetzung und Reflexion mit der jeweiligen Lebenssituation in Beziehung gesetzt wird, um Wege, Lösungen und Erkenntnisse zu eröffnen. SELE kennt kein übergeordnetes, per se festgelegtes Ziel im Sinne von „idealer Mensch“ oder „Erleuchtung“. SELE ist Bezugsrahmen und Interventionsleitfaden für leiborientierte Selbsterkenntnisprozesse, eingebettet in ein humanistisches Menschenbild, eine humanistische Ethik und ganzheitliche Sichtweise.
SELE ist somit kein eklektisches Verfahren, keine Kombination aus „Best of Aikido und Psychotherapie“, sondern vielmehr ein integratives, handlungsweisendes Modell leiborientierter, psychotherapeutischer Arbeitsweise. Die Übungen in SELE sind niemals Selbstzweck. Alle sind Methoden zur Unterstützung von Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis. Es liegt somit beim Therapeuten, durch begleitende Interventionen die Selbstreflexion zu fördern, um Bewusstseinsprozesse zu ermöglichen. Dies kann bereits durch kleine Aufforderungen erfolgen, indem die Übenden instruiert werden, in ihrer Bewegung anzuhalten (einzufrieren), kurzfristig zu erstarren, um so nachspüren zu können. Hier ist Anhalten im Unterschied zum Stopp zu verstehen, welcher jede Intervention sofort unterbricht und beendet.
Jede aktive Übungssequenz ist nur ein Teil der ganzen therapeutischen Arbeitsphase, das heißt, jede Übung schließt eine entsprechende Reflexion mit ein, um die Verarbeitungsprozesse abzurunden. Zum einen gilt es, das Erleben durch die Übungen aktiv, bewusst und in angemessener Weise in das Ich integrieren zu können. Zum anderen sollen Lebenszusammenhänge erkannt und reflektiert werden, um Raum für Alternativen und Neues zu öffnen.
Die hier beschriebenen Übungen sind zum Verdeutlichen der theoretischen Überlegungen bestimmt und sollen darüber hinaus TherapeutInnen, die mit SELE arbeiten wollen, dazu inspirieren, ihre eigenen Übungen zu entwickeln. Gleiches gilt für die Illustrationsbeispiele aus der Praxis. Sie sind keinesfalls gedacht als Anleitung, „so macht man das“, sondern ebenfalls als Hilfe, das Verständnis zu vertiefen.
Meine Idee von SELE ist, dass es keine Notwendigkeit gibt, Aikidoka zu sein, um mit SELE arbeiten zu können. Es sind viele körper- bzw. leiborientierte Ausbildungen bzw. Fähigkeiten geeignet, im Bezugsrahmen von SELE sinnvoll und verantwortungsbewusst eingesetzt zu werden, unabdingbare Voraussetzung scheint mir jedoch eine psychotherapeutische Basisqualifikation.
Im Anhang werde ich im Kapitel „Mein Weg zu SELE“ die Bereiche Psychotherapie und Kampfkunst, konkret Aikido und Transaktionsanalyse, in Bezug auf die jeweils daraus übernommenen Erkenntnisse kurz darstellen. Dies soll Zusammenhänge verdeutlichen und PsychotherapeutInnen verschiedener Therapieschulen und Praktizierende unterschiedlicher Leibkünste motivieren, SELE in ihren eigenen Praxis- und Erfahrungsrahmen zu transformieren.
Die Struktur der Gliederung in Basis und Prinzipien von Leib- und Selbsterfahrung soll der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit dienen.
3 Anthropologie
Die Anthropologie (Wissenschaft vom Menschen und seiner Entwicklung in natur- und geisteswissenschaftlicher Hinsicht, Duden 1982) von SELE wird über die Kernbegriffe, aus denen SELE konzipiert ist, erschlossen:
Selbst (Persönlichkeit, Charakter, Ich)
Selbst – Erkenntnis
Selbsterkenntnis als Innenschau (Ich-Ich) oder Außenkontakt (Ich-Du)
Entwicklung
Erfahrung
Leib
Spiritualität
Da eine ausführliche Diskussion dieser Begriffe den Rahmen dieses Buches bei Weitem sprengen würde, werden sie im Folgenden nur kurz erläutert. Dabei sollen Definitionen und Zusammenhänge nur insofern erwähnt werden, als sie für das Verständnis von SELE unmittelbar nützlich erscheinen.
3.1 Selbst
Das Selbst im Sinne von SELE wird als innerster, zeitlich stabiler, aber entwicklungsfähiger, der Erfahrung unmittelbar zugänglicher Wesenskern des Menschen gedacht.
Zeitlich stabil bedeutet dabei, dass das Selbst identitätsstiftend wirkt, sodass ein Mensch sich über seine gesamte Lebenszeit als konstantes Individuum, ICH-SELBST, erlebt.
„Entwicklungsfähig“ verdeutlicht den Umstand, dass das Selbst kein statischer, unveränderlicher menschlicher Kern ist, sondern verändert, entwickelt, aber auch verletzt, beschädigt werden kann. Wenn ich Fotos aus meiner Kindheit ansehe, so erkenne ich mich darauf. Ich weiß, dass ich darauf abgebildet bin, kann mich an mein Selbst als Kind erinnern, auch wenn ich heute, von meinen Zellen angefangen bis zu meinem Selbstverständnis, ein vollkommen anderer bin.
„Der Erfahrung zugänglich“ veranschaulicht, dass das Selbst im reflektierenden Erleben vom Menschen unmittelbar erfahren werden kann, sei es induziert durch psychologisch-psychotherapeutische Methoden, meditative Techniken oder unmittelbar in besonderen Lebenssituationen. Durch solche Erfahrungen ist das Selbst als innerster Wesenskern vielen Menschen gut intuitiv erfassbar.
Der Begriff ICH wird gewöhnlich als Synonym von Selbst im Sinne von ICH-SELBST verwendet. In der Psychologie wird ICH eher assoziiert mit Kompetenzen und Fähigkeiten, als Ich-Funktionen oder Systeme. Ähnlich wird der Begriff Charakter mit menschlichen Eigenschaften und Persönlichkeit mit eigenschaftsassoziierten Verhaltensweisen verbunden.
Im Rahmen dieser Begrifflichkeiten können wir sagen, dass SELE Ich-stärkend wirkt, die Persönlichkeit zu entwickeln fördert und sich positiv auf den Charakter auswirkt, indem es Bewusstheit für das Selbst fördert. Die Begründung dafür folgt in diesem Buch.
3.2 Erkenntnis – Selbsterkenntnis
Selbsterkenntnis wird hier als eine wesentliche Fähigkeit des Menschen verstanden. Selbsterkenntnis ist im System von SELE Voraussetzung für zielgerichtete, positive Entwicklung, im Weiteren von Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Freiheit (Bieri 2011). Bereits in der Antike stand über dem Eingangstor zum Orakel von Delphi die Aufforderung: „Erkenne dich selbst!“
Selbsterkenntnis ist die menschliche Fähigkeit, unser Handeln, Fühlen, Denken, unsere Wünsche, Ambitionen und Intentionen durch Introspektion zu erfassen und bewusst zu reflektieren. Das bedeutet, wir können unser So-Sein in seinem situativen Bezug erfahren und in seiner zeitlichen, historischen Dimension ebenso verstehen wie unser Begehren, Planen und Erträumen naher und ferner Zukunft.
3.2.1 Wie aber erkennen wir?
Wir erkennen durch Erfahrung. Erfahrung ist der permanente und immanente Prozess unseres lebendigen In-der-Welt-Seins. Meines Erachtens können wir vier sich ergänzende Erfahrungsmöglichkeiten definieren:
die sinnliche Erkenntnismöglichkeit im Spüren,
die kognitive Erkenntnismöglichkeit im Denken,
die emotionale Erkenntnismöglichkeit im Fühlen,
die intuitive Erkenntnismöglichkeit im unmittelbaren Gewahrwerden (Achtsamkeit).
Doch erst die Fähigkeit der Bewusstheit, der bewussten Reflexion der Wahrnehmungen, lässt aus Spüren, Denken, Fühlen und Intuition Erkenntnismöglichkeiten werden, sonst sind es einfach nur Wahrnehmungsmodi. Daraus begründet sich die Betonung von Bewusstheit und Reflexion in SELE, um alle vier Erkenntnisebenen für Selbsterkenntnis und Selbst-Bewusst-Sein durch Selbsterfahrung zu ermöglichen.
3.2.2 Erkenntnis und Bezugsrahmen
Was aber erkennen wir, Wirklichkeit oder Realität?
Im gewöhnlichen Sprachgebrauch werden Wirklichkeit und Realität oft als Synonyme verwendet. Gelegentlich macht es aber Sinn, die Begriffe zu unterscheiden: Realität ist all das, was DA IST. Realität ist somit alles, was unabhängig von uns, unserer Wahrnehmung existiert, unabhängig von unserem individuellen Sein, was vor uns existiert hat und nach uns existieren wird.
Wirklichkeit wäre dann die Welt, in der wir uns bewegen, wie wir sie sehen und wahrnehmen, eben, weil wir da sind. Nicht unbedingt die Welt, wie sie uns erscheint, sondern eher wie sie für uns ist, wie wir sie verstehen, uns erklären, um uns in ihr zu bewegen und zu überleben. Dabei ist Realität nicht im platonischen Sinne hinter einer fantasierten Wirklichkeit verborgen, noch ist es Aufgabe oder Ziel, eine Realität „hinter“ einer Wirklichkeit zu entdecken. In dieser Definition wäre das ohnehin sinnlos, da unmöglich. Vielmehr handelt es sich um eine pragmatische Unterscheidung, um die hilfreichen Konzeptionen von Wirklichkeitskonstruktion und flexiblem Bezugsrahmen zu verstehen.
3.2.3 Wirklichkeitskonstruktion
Wissenschaftliche Objektivität ist dann nicht ein Erkennen von Realität, sondern eine definierte und erprobte Vorgehensweise für gemeinsame Wirklichkeit. Diese wissenschaftliche, objektive Wirklichkeit haben wir methodisch von der narrativen (erzählenden) Wirklichkeit zu unterscheiden. Letztere ist die Wirklichkeitskonstruktion, die als gemeinsame Basis für Verständigung und Begegnung, zum Beispiel im therapeutischen Setting, notwendig ist (siehe z. B. Petzold 1991). Wie wirklich nun die Wirklichkeit ist, wie Watzlawick (1980) es pointiert formulierte, ob wir als Menschen überhaupt in der Lage sind, Realität zu erkennen, oder ob es so etwas wie Realität jenseits unseres Seins überhaupt gibt, füllt philosophische Bibliotheken.
Für uns mag folgende Überlegung für die Arbeit mit SELE nützlich sein. Je nach Bezugssystem bzw. Bezugsrahmen lassen sich Wirklichkeitskonstruktionen argumentieren und denken. Das gilt sogar für Extrempositionen wie die eines determinierenden Materialismus, in dem Leben als eine bessere Maschine gilt. In sich, im eigenen Bezugsrahmen, können Positionen durchaus schlüssig argumentiert werden, auch wenn sie außerhalb des eigenen Bezugsrahmens wenig Sinn machen.
Die entscheidende Frage ist nicht, ob wir einen Bezugsrahmen bzw. eine Vorstellung von Wirklichkeit haben. Der springende Punkt ist, welchen Bezugsrahmen wir haben, wie rigide oder flexibel er ist, um die Phänomene unseres Lebens und Seins förderlich abzubilden.
3.2.4 Flexibler Bezugsrahmen
Dazu folgendes Bild: Stellen wir uns den Menschen als System mit zu einem gewissen Grad willkürlich eingeteilten, aber sinnvoll definierbaren Subsystemen vor (Kritz 1997). Beginnen wir mit einer in beide Richtungen offenen Reihe bei:
* Zelle * Zellhaufen * Organe * Organsysteme * Körper * Leib * Psyche * Geist * Transzendenz/Spiritualität
Ein Problem solcher Unterteilungen besteht darin, dass sie dazu verleiten, einzelne Subsysteme als unabhängige, in sich geschlossene „Realitäten“ zu betrachten. Das ist in bestimmten Momenten auch angebracht.
Wenn z. B. ein Organ transplantiert wird, so ist dies in einem bestimmten Augenblick die „Verfrachtung“ dieses Organes aus einem Spenderkörper A in einen Empfängerkörper B. Spätestens beim Erwachen aus der Narkose haben wir aber einen „ganzen“ Menschen, der in all seinen Subsystemen mit der Operation zu leben hat:
auf zellulärer Ebene mit der Herausforderung, dass die Zellen des neuen Organs von seinen Immunzellen nicht als Fremdkörper abgetötet werden,
auf einer Organsystem-Ebene – dass das Empfängerorgan sich funktional in den Körper integriert,
psychisch muss der Patient mit der traumatischen Situation einer lebensbedrohlichen Operation und Lebenssituation mit all ihren Anforderungen und Änderungen zurechtkommen lernen,
spirituell mit dem Bewusstsein, einen Teil eines anderen, möglicherweise verstorbenen Menschen in sich zu tragen.
Wenn aber die Faszination über die Gesetzmäßigkeiten und Forschungserfolge auf einer Systemebene dazu verleitet, diesen Allgemeingültigkeit zuzuschreiben und sie daher „eins zu eins“ auf die anderen Subsysteme des Menschen zu übertragen, wird es in der Vorstellungswelt eng und problematisch.
Wilber (2008) kritisiert solche Modellvorstellungen zu Recht wegen ihres Mix aus materiellen und immateriellen Seinsvorstellungen, somit eines Nebeneinanders beziehungsweise einer Vermischung aus zu verschiedenen Konzeptideen. Das gilt vor allem, wenn wir diese Bereiche als Entwicklungsphasen, Stufen, Bedürfnishierarchie oder uns in sonst irgendeiner Weise als aufbauend, übereinander vorstellen. Wir aber wollen gleichwertige, willkürlich definierte Teile der Ganzheit Mensch betrachten.
Jedes dieser Subsysteme hat Anforderungen, „Bedürfnisse“ an das Leben, das Sein. Jedes kann das Gesamtsystem zum Kippen bringen, der wuchernde bösartige Zellhaufen wie die depressive Psyche durch Suizid. Obwohl immer der gesamte Mensch in irgendeiner Weise betroffen ist, können Erkenntnisse und Phänomene, die für ein Subsystem Gültigkeit haben, oft nicht sinnvoll auf die anderen übertragen werden. Vielmehr lassen sich unterschiedliche sinnvolle Verhaltensweisen für die verschiedenen Systeme formulieren.
In einem Artikel, in dem ich das Konzept von Leiblichkeit in die Theorievorstellungen der Transaktionsanalyse zu integrieren trachtete, habe ich anhand eines Skiunfalles mit Schienbeinbruch die unterschiedlichen Konzeptebenen beschrieben (Dirnberger 1998, S. 94). „Für den ersten Behandlungsschritt, eine Operation, wird das Körperkonzept das adäquate sein.“ Der Patient überantwortet sein Bein dem Chirurgen. Im zweiten Behandlungsabschnitt wird das Leibkonzept in der physiotherapeutischen Rehabilitation hilfreich sein, um mit Eigenverantwortung und Selbstsensibilität zur Heilung aktiv beizutragen. Um Vermeidungsstrategien vorzubeugen, können auf einer psychologischen Ebene etwaige traumatisierende Effekte aus dem Unfallgeschehen behandelt werden.
Ein und dasselbe Phänomen mag in den verschiedenen Subsystemen zu ganz unterschiedlichen Erkenntnissen, Funktionen und Konsequenzen führen. In derselben Publikation habe ich dies anhand des Traumes zu verdeutlichen versucht:
Auf einer zellulären Ebene ist der Traum ein elektromagnetischer Potenzialwechsel an den Synapsen der Gehirnzellen.
Auf organischer Ebene (Organ, Organsystem) können wir den Traum als Abfallprodukt dieser Organtätigkeit – des Gehirns – beschreiben.
Auf einer Körper- und Leibebene erleben wir den Traum als „Hüter des Schlafes“ und Funktion des Ruhetriebes, indem dieser vor externen Wahrnehmungen (z. B. Wecker) oder inneren Bedürfnissen (z. B. Harndrang) dadurch schützt, dass er sie ins Traumgeschehen einbaut, um den Schlaf zu verlängern.
Auf einer psychischen Ebene beschreiben wir den Traum als vielschichtigen Verarbeitungsweg und im Unterschied zum Wachbewusstsein als Ausdrucksform des Unbewussten.
Auf einer transzendenten Ebene wird der Traum als Zugang zu „höheren“ Bewusstseinsebenen betrachtet (Dirnberger 1998, S. 98).
So viel zur Verdeutlichung, was unter flexiblem Bezugsrahmen zu verstehen ist und dass Argumente auf einer Erklärungsebene nicht zwingenderweise für eine andere Gültigkeit haben.
Wie aber sich selbst erkennen?
3.3 Selbsterkenntnis als Innenschau oder Außenkontakt
Im Wesentlichen werden zwei Wege der Selbsterkenntnis unterschieden:
introspektive Selbsterkenntnis als Folge meditativer Innenschau und
kommunikative Selbsterkenntnis als Folge des Austausches und Kontaktes mit dem Gegenüber, dem anderen, einem Du.
Bei der meditativen Selbsterkenntnis erfolgt die Introspektion in, wie der Name schon sagt, meditativen Praktiken, indem die Aufmerksamkeit, der „Blick“, ausschließlich nach innen gerichtet wird, um so sich selbst zu erkennen. Ein Vorteil dieser Verfahren ist, dass sie zum Teil über Jahrhunderte an praktischer Erprobung und Erfahrung mit ausgefeilter Lehrmethodik verfügen.
Ein Nachteil ist, dass mit einer ausschließlichen individuellen Innenschau ein geschlossenes System vorliegt, dem das Gegenüber als Korrektur z. B. von Selbstbetrug, Selbsttäuschung, Wunschvorstellungen und Fehleinschätzungen fehlt. In dieser Innenschau besteht des Weiteren die Gefahr, dass das beobachtete Innere vom Selbst zum Gegenüber wird, also eine Subjekt-Objekt-Beziehung entsteht. Die Qualität existenzieller, verbundener Selbsterfahrung geht in Richtung eines „Wissens über etwas“ verloren.
Die kommunikative Selbsterkenntnis bezeichnet all jene Verfahren, in denen die Introspektion über die Wechselwirkung von „Innenschau“ und Kommunikation erfolgt. Dabei wird das Gegenüber zum „Reflexionsspiegel“, durch ein Erkennen des Selbst in und durch den Anderen, weil „sich der Mensch gerade erst durch ein Verhältnis zu einem anderen Selbst vollends in seiner Individualität begreife“ (Koren-Wilhelmer 2007, S. 147).
„Der Mensch wird am Du zum Ich“ (Buber 1992, S. 32).
Während von Philosophen (etwa Bieri, 2011) und Psychotherapeuten die Wichtigkeit kommunikativer Selbsterkenntnis betont wird, heben eher spirituelle Kreise und Vertreter asiatischer religiös-philosophischer Systeme die Vorteile der meditativen Praktiken hervor.
3.4 Entwicklung
SELE fasst den Menschen als entwicklungsfähiges Wesen auf. Damit wird biologischen Erkenntnissen um die Neuroplastizität des Gehirns (Bonney 2011) und der interaktionalen Funktionsweise der Gene (Bauer 2010) ebenso Rechnung getragen, wie den psychologisch-soziologischen Erkenntnissen um soziale Beziehungen und deren Einfluss auf den Menschen.
Das bedeutet, dass im Sinne von SELE der Mensch seinem Wesen nach weder gut noch böse ist, weder biologisch-genetisch determiniert noch psychologisch geprägt oder soziologisch geformt. Er ist in jedem Moment GEGENWART, zugleich HISTORIE, Resultat seiner einmaligen, individuellen sozio-psychologischen Entwicklung und Biologie, sowie ZUKUNFT, Entwicklungspotenzial, offenes System.
Entwicklung per se ist eine ungerichtete Eigenschaft lebendigen Seins. Wohin diese Entwicklung geht, zu „gut“ oder „böse“, um bei diesem simplen Bild zu bleiben, entscheidet die konkrete Ausformung der Entwicklung im Leben jedes Menschen. Solange er lebt, wird er sich entwickeln. Auf dieser Betrachtungsebene ist Entwicklung weder ein „innerer Drang“ zu Veränderung noch eine Verbesserung oder Verwirklichung, keine Notwendigkeit, sondern unspezifisches Faktum unseres So-Seins. Selbsterkenntnis eröffnet eine mögliche Option zielgerichteter Entwicklung.
SELE nimmt eine klare Position ein, in welche Richtung diese Entwicklung gefördert werden soll. Diese ethischen Prinzipien von SELE werden im Kapitel „Prinzipien für positive Selbsterfahrung“ beschrieben. Vorweg, SELE versteht Entwicklung zielgerichtet, als wohlwollende, entwicklungsfördernde Selbsterfahrung durch an Ganzheit orientierte Leiberfahrung zur Förderung empathischer, kooperativer und verantwortungsbewusster Beziehungsfähigkeit, zum anderen, seiner Lebensumwelt und zu sich selbst.
So etwa ließe sich diese psychotherapeutische Arbeit in einem Satz beschreiben.
3.5 Erfahrung
Erfahrung ist im Sinne von SELE, ähnlich wie Entwicklung, Charakteristikum menschlichen Lebens und per se ungerichtet, wertneutral. Einerseits ist jedwede Interaktion mit der Umwelt, jedwede Lebenssituation eine Erfahrung, andererseits ist Erfahrung nicht gleich Erfahrung.
Erfahrungen können Gesundheit und Wohlbefinden fördern oder krank machen, z. B. traumatisieren. Um das Ziel von SELE zu verfolgen, das konstruktive Entwicklungspotenzial im Menschen zu fördern und zu stärken, brauchen wir von Empathie und Wohlwollen getragene Erfahrung. Aus der einfachen Tatsache heraus, dass diese Art von Erfahrung am effizientesten das Konstruktive im Menschen fördert und ins Leben bringt. Erfreulicherweise ist dies (meistens) auch eine angenehme Form von Selbsterfahrung, selbst wenn sehr tiefe Emotionen von Trauer oder Wut erlebt werden.
3.6 Leib
Macht es Sinn, inhaltlich zwischen den Begriffen Leib und Körper zu unterscheiden? Häufig werden sie als Synonyme verwendet. Eine ausführliche Diskussion des Begriffes der Leiblichkeit unter philosophischen, gesellschaftlichen und therapeutischen Perspektiven findet sich bei Petzold (1986).