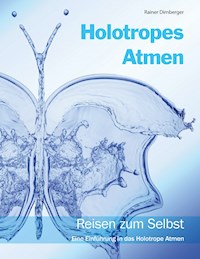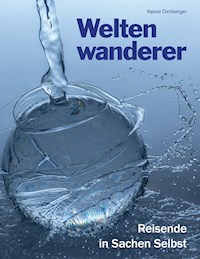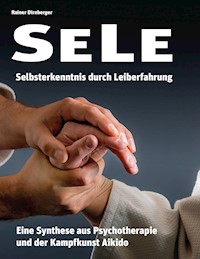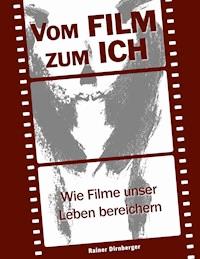Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der vorliegende Sammelband umfasst Beiträge aus den Jahren 1998-2023. Psychotherapie allgemein und konkret die Transaktionsanalyse bieten den Rahmen, in dem die verschiedenen theoretischen und praktischen Überlegungen entfaltet werden. Als Gemeinsamkeit der verschiedenen Arbeiten kann das Bestreben nach authentischer Selbsterkenntnis durch empathische Selbsterfahrung gesehen werden, immer aus der Perspektive des Praktikers betrachtet. Aufrichtige und redliche Selbsterkenntnis, in einer wohlwollenden, empathischen Grundhaltung, öffnet Optionen für ein konstruktives Selbstverständnis. Ein offener, ehrlicher und einfühlsamer Umgang mit sich selbst führt zu einem ebensolchen Umgang mit anderen. Das ermöglicht alternative Beziehungsgestaltungen und einen Selbstbezug in Würde und Achtsamkeit. Es ist diese Art von Selbsterkenntnis, die uns Menschen befähigt, Verbundenheit und Bezogenheit nicht nur kognitiv zu erfassen, sondern als Erlebnisqualität erfahrend zu erkennen. So können wir uns im Bezug zum Weltgeflecht als Geborene und Geborgene erfahren und verstehen lernen. Vielleicht ist es diese Art von resonantem Weltbezug, der uns bei den mannigfachen Problemen unserer Zeit, sowohl auf einer individuellen als auch gesellschaftlichen Ebene, hilfreich unterstützen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Mag. Rainer Dirnberger, Jg.1964, hat in Salzburg und Graz Psychologie studiert. Die Ausbildung zum Transaktionsanalytischen-Psychotherapeuten hat er bei
Mag. Almut Rottenbacher und Dr. Jan Hennig absolviert. 1993 erfolgte die Eintragung in die Listen von Psychotherapie und Klinischer Psychologie des österreichischen Gesundheitsministeriums. Ein Jahr später legte er die Prüfung zum internationalen Abschluss als Transaktionsanalytiker (CTA) ab. Er ist als Psychotherapeut, Lehrtherapeut und Sachbuchautor in Österreich tätig und hat den 5. Dan (Schwarzgurt) in Aikido.
Über dieses Buch
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Aufrichtige und redliche Selbsterkenntnis, in einer wohlwollenden, empathischen Grundhaltung, öffnet Optionen für ein konstruktives Selbstverständnis. Ein offener, ehrlicher und einfühlsamer Umgang mit sich selbst führt zu einem ebensolchen Umgang mit anderen. Das ermöglicht alternative Beziehungsgestaltungen und einen Selbstbezug in Würde und Achtsamkeit.
Es ist diese Art von Selbsterkenntnis, die uns Menschen befähigt, Verbundenheit und Bezogenheit nicht nur kognitiv zu erfassen, sondern als Erlebnisqualität erfahrend zu erkennen. So können wir uns im Bezug zum Weltgeflecht als Geborene und Geborgene erfahren und verstehen lernen.
Vielleicht ist es diese Art von resonantem Weltbezug, der uns bei den mannigfachen Problemen unserer Zeit, sowohl auf einer individuellen als auch gesellschaftlichen Ebene, hilfreich unterstützen kann.
Inhaltsverzeichnis
A – PSYCHOTHERAPIE – EINE LIEBESERKLÄRUNG
A1 Was ist Psychotherapie? Psychotherapie als Praxis einer beziehungsorientierten – bewusstseinsbasierten – Individualwissenschaft 2023/2016
A2 Es ist Zeit – Für Resonanz 2023
B – WEGE ZUR SELBSTERKENNTNIS
B1 Selbst-Erkenntnis-Leib-Erfahrung: Eine psychotherapeutische Liebeserklärung 2017
B2 Die Kampfkunst Aikido als Weg der Lebenskunst, Selbsterkenntnis und Spiritualität 2023
B3 Man kann auch auf der Matte Nein sagen lernen! 2022/2018
C – PSYCHOTHERAPIE und SPIRITUALITÄT
C1 Spiritualität in der Psychotherapie und Beratung zwischen „No Go“ und Idealisierung 2019
C2 Aufgeklärte Spiritualität für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 2023/2016
C3 Sechzehn Fragen und kurze Antworten zu einer „Aufgeklärten Spiritualität“ 2021
D – BEZIEHUNGSORIENTIERTE KONFLIKTLÖSUNG
Eine Synthese aus Psychotherapie–Transaktionsanalyse mit Kampfkunst–Aikido
D1 Psychotherapie und Kampfkunst Teil 1 – Transaktionsanalyse und Aikido 2000
D2 Psychotherapie und Kampfkunst Teil 2 – therapeutische Effekte und Aikido 2000
D3 Kognitives versus Beziehungsorientiertes Problemlösemodell oder die Rettung des Ödipus 2003
E – TRANSAKTIONSANALYSE und LEIBLICHKEIT
E1 Transaktionsanalyse und Leiblichkeit 2018
E2 Transaktionsanalyse - Leiblichkeit - Ich-Zustände 1998
E3 Die Weisheit des Leibes – ein Transaktionsanalytisches Konzept? 2006
Übersicht Abschnitt A
PSYCHOTHERAPIE Eine LIEBESERKLÄRUNG
Die beiden Artikel „Was ist Psychotherapie“ und „Es ist Zeit für Resonanz“ veranschaulichen aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Frage, wie betrachten und begegnen wir Menschen, wenn wir entwicklungs- und heilungsfördernde Beziehungen gestalten wollen. Diese „Menschheitsfragen“ sind im Moment ganz aktuell.
A 1 Was ist Psychotherapie? Psychotherapie als Praxis einer beziehungsorientierten – bewusstseinsbasierten – Individualwissenschaft (2023)
Dieser Essay ist ein Plädoyer für eine Psychotherapie die sich als beziehungsorientierte Behandlungsmethode, im Gegensatz und als Ergänzung zum medizinisch-naturwissenschaftlichen Behandlungsansatz, versteht. Psychotherapie ist radikal am Individuum und den phänomenologischen Äußerungen der therapeutischen Beziehungsphänomene orientiert. Dieses Psychotherapieverständnis wird in Theorie und Praxis dargelegt.
Die vorliegende Arbeit ist eine vollständig überarbeitete Version von: Dirnberger, R. (2016), Aufgeklärte Spiritualität und Psychotherapie: Zwei Essays für PsychotherapeutInnEn, united p.c. ISBN: 978-3-7103-2598-4.
A 2 Es ist Zeit – Für Resonanz (2023)
Resonanz wird als Form der Weltbeziehung einem verdinglichenden Weltverständnis gegenübergestellt und dessen Auswirkungen auf Psychotherapie und Spiritualität dargelegt. Resonanz ist in dieser Betrachtungsweise ein Grundbedürfnis des Menschen, eine spezifische Beziehungsqualität und ein Weltbezugssystem auf dessen Basis Bezogenheit zu Mitmenschen, sich selbst und der Umwelt theoretisch verstanden und praktisch gelebt werden kann.
Die vorliegenden Ideen wurden beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse (DGTA) vom 19-21.5.2023 in Lindau (gehalten am 19.5.2023) vorgetragen. Im Kongressreader wurde eine gekürzte Version des hier in vollem Umfang vorliegenden Textes veröffentlicht.
Dirnberger, R. (2023), Es ist Zeit – Für Resonanz. In: Seidenfus Ch. (Hrsg.) Es ist Zeit. Reader zum 42. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse. Lengerich: Pabst Science Publisher. S.: 71-78.
A 1 Was ist Psychotherapie?
Psychotherapie als Praxis einer beziehungsorientierten – bewusstseinsbasierten – Individualwissenschaft
Heutzutage steht die Psychotherapie unter mannigfachem Druck:
Psychotherapie steht im Sog der medizinischen, auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen begründeten, Behandlungsverfahren,
einer Deutungshoheit naturwissenschaftlicher Forschung,
dem Fortschritt in Gehirnforschung und Genetik, mit deren Schattenseite, einer zunehmenden „Verdinglichung“ des Menschen,
dem Spannungsfeld zwischen verdinglichendem und resonantem Menschenbild
dem ökonomischen Druck „schneller Erfolge“,
gesetzlicher Regulierungsvorschriften, die unreflektiert und unangepasst aus medizinischen Standards übernommen werden,
einem Anpassungsdruck marktwirtschaftlicher Einflussgrößen.
Um die tägliche Arbeit von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten angemessen verstehen zu können, ist es notwendig, die Besonderheit der therapeutischen Beziehung und des therapeutischen Settings darzulegen. Das psychologisch-psychotherapeutische Behandlungsparadigma unterscheidet sich in wesentlichen Teilen von dem naturwissenschaftlich-medizinischen Paradigma.
In der Medizin werden auf Basis der Diagnostik die entsprechenden Behandlungsinterventionen gesetzt. Die Diagnostik ordnet einen konkreten Menschen einer entsprechenden Patienten-Subgruppe, im Vergleich zu „allen Menschen“, zu. Daraus folgt die Medikation, die mit statistisch signifikanter Wahrscheinlichkeit wirken wird. Anders ausgedrückt, was allen dieser Diagnosegruppe hilft, wird auch dem Einzelnen helfen. Das funktioniert bei vielen Krankheiten hervorragend und wird laufend dank intensiver Forschung verbessert.
Die Psychotherapie hingegen geht einen grundlegend anderen Weg. Der Mensch wird als einmaliges, einzigartiges und unverwechselbares Individuum gesehen und als solches behandelt. Das impliziert ein grundlegend anderes Theorie-Verständnis und konkretes Handeln, etwa in Bezug auf Diagnose und Methodenindikation.
Im folgenden Essay werde ich diese Unterschiede aus einer pragmatischen Perspektive herausarbeiten: Der Unterscheidung zwischen naturwissenschaftlicher und individualwissenschaftlicher Denkweise anhand zentraler Kernbegriffe. Es werden die konkreten Auswirkungen auf zentrale Vorstellungen der Psychotherapie am Beispiel einer Gegenüberstellung zwischen psychotherapeutischen und neurophysiologischen Sichtweisen erörtert.
„Reibebaum“ dieser Kontroverse sind die Ausführungen des Philosophen Metzinger (2012), der letztere Position ausgesprochen wortgewaltig und pointiert formuliert. Abschließend werden konkrete Unterschiede zwischen medizinischem und psychotherapeutischem Behandlungsparadigma einander gegenüberstellt.
Ziel dieser Arbeit ist es, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten argumentative Unterstützung und schulen-übergreifende Orientierungshilfe zu sein.
Der vorliegende Essay ist auch ein Plädoyer für eine Psychotherapie als beziehungsbasierte Behandlung, eines individualisierten Wissenschaftsverständnisses und einer phänomenologischen Arbeitsweise.
Individualität
Die Betonung der Individualität in der Psychotherapie, wie sie hier beschrieben wird, erfolgt in klarer Abgrenzung, ja Gegensätzlichkeit, zu einem gesellschaftlichen „Individualismus“, einer „Scheinindividualität“, wie sie in der westlichen Kultur durch Massenmedien, Werbung und Großkonzerne verbreitet wird. Durch die allgegenwärtige Werbung wird suggeriert, dass Individualität mit dem Besitz von bestimmten Gütern gekauft und besessen werden kann.
Diese durch eine kapitalistische, neoliberale Politikauffassung befeuerte Pseudoindividualität ist u.a. gekennzeichnet durch ein Verschieben von gesellschaftlicher Verantwortlichkeit auf das Individuum, wodurch tatsächliche Individualität behindert und verhindert wird. Es ist hier nicht der Rahmen, um weiter auf diese Problematik einzugehen. Wichtig ist klarzustellen, dass die psychotherapeutisch verstandene Individualität als verantwortungsbewusstes Gegenkonzept, zu einer naiven, oft bösartigen Individualismus-Doktrin zu verstehen ist, a la: „Jeder ist seines Glückes Schmied“ Politik.
Psychotherapie wird hier als ein Weg zur Freiheit bzw. Befreiung des Individuums verstanden, in der Tradition einer aufgeklärt-humanistischen Psychologie, (im Unterschied zur manipulativen Anpassungspsychologie, Fromm 2013, Bornemann 1984).
Individualität bedeutet keineswegs Isolierung, Egoismus oder autistische Tendenzen gutzuheißen oder gar zu fördern. Im tiefen Wesenskern einer aufrichtigen, empathischen Selbsterkenntnis liegt das individuell Einzigartige mit dem universell Verbindenden. Das ist sowohl theoretisches Wissen als auch Erkenntnis aus erfahrendem Erleben um das Wesen der menschlichen Existenz. Mit den Worten von Erich Fromm: „Bei dieser Betrachtungsweise erfährt man sich selbst und seinen Mitmenschen als eine Variation des Themas „Mensch“ und den Menschen als eine Variation des Themas „Leben“ (2013, S.110). Mensch sein ist immer einmalige Einzigartigkeit und gesellschaftliche Kollektivität. Es gibt das eine nicht, ohne das andere.
Psychotherapie als Wissenschaft
Das deutsche wie das österreichische Psychotherapiegesetz betonen die beiden Aspekte: „Praxis“ und „Wissenschaftlichkeit“. Die gesetzliche Anforderung an die Psychotherapie, Praxis und Wissenschaftlichkeit zu vereinen, führt zu Missverständnissen bzw. Problemen. Praxis wird mit einem medizinischen Behandlungsparadigma verwechselt und bei der Formulierung von Wissenschaftlichkeit bleibt offen, welches Wissenschaftsverständnis als Denkbasis heranzuziehen ist.
Der deutsche Gesetzestext – PsychThG 15.11.2019 §1 (2):
Ausübung der Psychotherapie im Sinne dieses Gesetzes ist jede mittels wissenschaftlich geprüfter und anerkannter psychotherapeutischer Verfahren oder Methoden berufs- oder geschäftsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist. Im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung ist eine somatische Abklärung herbeizuführen. Tätigkeiten, die nur die Aufarbeitung oder Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben, gehören nicht zur Ausübung der Psychotherapie.
Zum Vergleich der österreichische Gesetzestext – BGBL. Nr. 361/1990 §1 (1):
Die Ausübung der Psychotherapie im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die nach einer allgemeinen und besonderen Ausbildung erlernte, umfassende, bewusste und geplante Behandlung von psychosozial oder auch psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen und Leidenszuständen mit wissenschaftlich-psychotherapeutischen Methoden in einer Interaktion zwischen einem oder mehreren Behandelten und einem oder mehreren Psychotherapeuten mit dem Ziel, bestehende Symptome zu mildern oder zu beseitigen, gestörte Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern und die Reifung, Entwicklung und Gesundheit des Behandelten zu fördern.
Im österreichischen Gesetz wird die „Interaktion“ zwischen zu „Behandelnden und Psychotherapeuten“ als ein Aspekt der psychotherapeutischen Praxis explizit genannt. Interaktion kann interpretiert werden als Betonung der Bezogenheit der handelnden Personen zueinander. Der Begriff lässt aber vollkommen offen, um welche Art der Beziehung es sich in diesem Falle handeln soll: Eine Arzt-Patient-Beziehung oder eine psychotherapeutische Beziehung (Zimmer 1983)? Ich werde diese Frage bei der Gegenüberstellung des medizinisch-naturwissenschaftlichen zu dem psychotherapeutisch-individualwissenschaftlichen Behandlungsparadigma aufgreifen.
Die Betonung der Anwendung wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer Verfahren impliziert, dass es sowohl wissenschaftlich nicht anerkannte Verfahren als auch unwissenschaftliche psychotherapeutische Verfahren gibt. In Diskussionen erlebe ich, dass diese beiden Kategorien zusammengezogen werden, womit „nicht anerkannte Methoden“ im selben Atemzug zu „unwissenschaftlichen Methoden“ werden. Das ist nicht nur ein „KO-Argument“, sondern verdeutlicht auch den Druck institutionelle Anerkennung zu erlangen, dem psychotherapeutische Erkenntnisse und Theorien unterliegen. Doch dies ist eine andere Diskussion (Kritz 2023).
Für diese Arbeit ist relevant, dass die Frage offenbleibt, welche „Wissenschaft“ in den Gesetzen gemeint ist. Das führt erfahrungsgemäß dazu, dass „wissenschaftlich“ mit „naturwissenschaftlich“ assoziiert wird. Damit stehen wir aber, sowohl methodisch als auch praktisch, vor dem Dilemma, dass damit Psychotherapie zu einem medizinischen Behandlungsmodell „verkommt“.
Warum Wissenschaft?
Wissenschaft kann sehr allgemein verstanden werden als das menschliche Bemühen, anhand von bekannten, überprüfbaren, zur Diskussion stehenden, logisch nachvollziehbaren Kriterien und Methoden korrigierbares Wissen und aus diesem wiederum Fakten, zu erlangen. Die Gesetzgeber betonen, meines Erachtens völlig zu Recht, die Wichtigkeit einer wissenschaftlichen Arbeitsbasis der Psychotherapie. Das verdeutlicht, dass Psychotherapie kein Glaubenssystem ist.
Des Weiteren definiert der Gesetzestext Krankheiten, die in den Zuständigkeitsbereich der Psychotherapie zuzurechnen sind und Abgrenzungen zu anderen psychologischen Behandlungsverfahren. Basis dafür ist ein medizinisches Diagnosesystem. Das mag seine Berechtigung haben, wenn öffentliche Geldgeber (Krankenkassen) die Therapiekosten übernehmen sollen. Die medizinische Diagnose spielt aber in der psychotherapeutischen Praxis eine andere Rolle, als in der medizinischen.
PsychotherapeutInnen sitzen keinen Verhaltensstörungen oder psychosomatischen Leiden gegenüber, also keinen Vertretern einer Diagnosekategorie. Vielmehr begegnen PsychotherapeutInnen Menschen, die leiden, genauer gesagt diesem konkreten, einzigartigen Menschen. Sie befinden sich in einer lebendigen Beziehung mit genau diesem einen menschlichen Individuum. Psychotherapie kann als „die Kunst“ beschrieben werden, hinter dem Menschen das Individuum zu erkennen.
Dieser Erkenntnisprozess des sich selbst Erkennens als der Mensch der ich bin, einzigartig in meinem Sosein und untrennbar verbunden mit allen Anderen, in der unmittelbaren, existentiellen Ich-Du Begegnung in der therapeutischen Beziehung, ist heilsam.
Der Mensch hat ein grundlegendes Bedürfnis als DER anerkannt, gesehen und respektiert zu werden, DER er ist: Einmalig und unverwechselbar. Auf dieses Bedürfnis einzugehen ist handlungsleitend für die Psychotherapie. Dadurch wird aus Interaktion – Kommunikation, aus Begegnung – Beziehung aus einer Diagnosekategorie – individuelles, konkret erfassbares Leiden.
Die Grundlagen psychotherapeutischer Behandlung sind in den Konzepten „psychotherapeutische Beziehung“ und „psychotherapeutisches Setting“ in der Fachliteratur ausführlich beschrieben. Sie lassen sich auf einer gewissen Abstraktionsebene allgemeingültig als wissenschaftliche Erkenntnisse erfassen.
Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sind nun aber grundverschieden zu denen der „naturwissenschaftlichen“ Forschung. Gravitation lässt sich eindeutig in Zahlen ausdrücken, wirkt allgemein und universell gleich. Die Gesetzmäßigkeiten von „Beziehung“ lassen sich auch allgemeingültig auf einem gewissen Abstraktionsniveau beschreiben. Im Falle der psychotherapeutischen Beziehung unter anderem als Einfühlungsvermögen, Stabilität und Sicherheit, wertschätzende Grundhaltung, achtsames Zuhören.
Diese Größen lassen sich aber weder sinnvoll in Zahlen ausdrücken, noch ist deren Wirkung weder universell noch individuell gleich. Ganz im Gegenteil! In der konkreten psychotherapeutischen Arbeit sind diese Bedingungen unterschiedlich und individuell auf das jeweilige Gegenüber „maßgeschneidert“ handzuhaben.
In der Psychotherapie begegnet uns der Mensch als Individuum und in mannigfachen Beziehungsgeflechten Verbundener. Dadurch ist sowohl das Individuelle-Sein als auch das Bezogen-Sein „Arbeitsgegenstand“ der täglichen Praxis. Als „Praxiswissenschaft“ verstanden (eine Wissenschaft, die aus und für die psychotherapeutische Praxis besteht), lässt sich eine Kombination von Beziehungswissenschaft (Bezogen-Sein) und Individualwissenschaft (Individuelles-Sein) definieren.
Beziehungswissenschaft umfasst jene Wissenschaftsbereiche von Geistes-, Natur- und Sozialwissenschaften, die sich den Phänomenen von Beziehung im weitesten Wortsinn widmen, z.B. Kommunikation, Bindung, Gruppen, Sozialisation und so weiter.
Individualwissenschaft ist der Überbegriff für Wissenschaften (oder Teilbereichen von diesen), die sich der Erforschung des Individuums als einmalig Seiendes widmen (wie Teilbereiche von Psychologie, Sozialwissenschaften, Soziologie, Philosophie etc.). Diese Art Wissenschaft steht in Abgrenzung und Ergänzung zu den „traditionellen“ Wissenschaftsbereichen der Naturwissenschaften und Teilen der Geisteswissenschaften.
Die Naturwissenschaften (insofern sie sich auf den Menschen beziehen, wovon in dieser Arbeit ausgegangen wird) und bestimmte Bereiche der Geisteswissenschaften haben als Forschungsgegenstand „den Menschen“, im Sinne von „alle Menschen“, für alle Menschen gültig. Im Gegensatz dazu erforschen die Individualwissenschaften den jeweiligen konkreten, einmaligen Menschen.
Da wir Menschen jedenfalls beides sind, Kollektiv und Individuum, sind beide Wissensbereiche gleich bedeutsam. Diese plakative Unterscheidung soll einem prinzipiellen Verstehen der Unterschiedlichkeit im zugrundeliegenden Denken von Naturwissenschaft und Individualwissenschaft dienen und die später ausgeführte Unterscheidung zwischen medizinischem und psychotherapeutischem Behandlungsparadigma verdeutlichen.
Klaus Holzkamp (1985) hat in „Grundlegung der Psychologie“ die Begriffe „Individualwissenschaft“ und „Subjektwissenschaft“ auf breiter Basis in die Psychologie eingeführt. Dabei verwendet er Individualwissenschaft allgemein, wie oben beschrieben, als Sammelbezeichnung für Wissenschaften, oder jenen Teilen daraus, die sich als Forschungsgegenstand dem Individuum widmen.
In einem psychotherapeutischen Verständnis kann Individualwissenschaft weiter differenziert werden, insofern als sie nicht nur „das Individuum“ als Forschungsgegenstand hat, sondern auch, wie dieses Individuum verstanden wird als: Lebendiges-Sein, ein einzigartigeinmalig Existierendes und kollektiv – untrennbar Verbundenes.
Ein weiterer hilfreicher Ansatz verfolgt die Idee einer „bewusstseinszustandsorientierten Wissenschaft“ (Tart, zitiert aus Belschner 2007). Diese geht von der Fähigkeit des Menschen zur Bewusstseinsvariabilität des Wachbewusstseins aus. Belschner (2007) spricht von „Bewusstseinsweite“ und von einer anzustrebenden „Bewusstseinskultur“. Dabei wird Bewusstsein als Kontinuum zwischen „sachlich-rationalem“ Alltagsbewusstsein und dem dazu veränderten Bewusstseinszustand von Nondualität aufgefasst. Die jeweiligen Endbereiche in diesem Kontinuum sind das „rationale Alltagsbewusstsein“ und ein „nonduales Einheitsbewusstsein“. Im Mittelbereich wird ein Bewusstseinszustand „empathischer Präsenz“ lokalisiert. Die Fähigkeit zwischen verschiedenen Bewusstseinszuständen, der eigenen „Bewusstseinsweite“, zu wechseln, wird als eigenständiger Faktor „Modulation der Präsenz“ oder auch als „Transzendenzfähigkeit“ bezeichnet.
Für die Psychotherapie sind zumindest zwei Überlegungen daraus praxisrelevant interessant. Die Idee eines Bewusstseinskontinuums in Richtung einer Bewusstseinserweiterung, eines „Überbewussten“ als Ergänzung zum Unbewussten öffnet den therapeutischen Bezugsrahmen für transpersonale, nonduale Einheitserfahrungen (mit allen damit verbundenen heilsamen Optionen aber auch Problemmöglichkeiten).
In der Psychotherapie ist die „andere“ Richtung des Kontinuums sehr vertraut als Bewusstseinseinengung und Bewusstseinstrübungen (Unbewusstes, Präpersonal, Regression). Ken Wilber (2008, 2001, 1991) hat die Aspekte Präpersonal (regressive Bewusstseinsverengung) – Personal (Alltagsbewusstsein) – und Transpersonal (transzendente Bewusstseinserweiterung) differenziert ausgearbeitet. Er spricht jedoch eher von Bewusstseinsstufen als von der Idee eines Bewusstseinskontinuums.
In der Bewusstseinswissenschaft werden wissenschaftliche Aussagen und Konzepte in Abhängigkeit des zugrundeliegenden Bewusstseins, aus dem diese heraus formuliert wurden, verstanden. (Naturwissenschaftliche Aussagen sind dieser Logik zufolge lediglich für den Bereich des rationalen Alltagsbewusstseins gültig.) Dies führt zum zweiten, in der Psychotherapie vertrauten Phänomen. Menschen äußern im Alltagsbewusstsein klar und aufrichtig, dass sie mit dem selbstschädigenden Verhalten aufhören. Dennoch wird dieser Vorsatz so nicht verhaltensrelevant, solange in anderen Bewusstseinsfeldern eben genau das Gegenteil gilt, z.B. in regressiven elterlichen Programmbotschaften oder Introjekten.
In der psychotherapeutischen Praxis sind Methoden der Bewusstseinsmodulation ein vertrautes Instrument, um mit regressiven Zuständen konstruktiv zu arbeiten. In diesem Sinne kann Psychotherapie als Unterstützung der Modulationsfähigkeit von Bewusstsein verstanden werden. Wenn Individualwissenschaft als Erforschung des „ganzen, konkreten“ Menschen verstanden wird, in all seinen Facetten, so können nonduale ebenso wenig wie regressive Bewusstseinszustände ausgeschlossen werden. Um diese nonduale Verbundenheit als Fähigkeit des ICHs erfahren zu können, bedarf es eines stabilen, sicheren ICH (Scharfetter 2008, Walch 2011).
In der von mir hier vertretenen psychotherapeutischen Grundposition sind Beziehungswissenschaft und Bewusstseinswissenschaft Aspekte einer Individualwissenschaft. Im Folgenden spreche ich von Individualwissenschaft, um den Unterschied im zugrundeliegenden Denken im Vergleich zu Aspekten der Naturwissenschaft anschaulich zu verdeutlichen.
Naturwissenschaften
In den Naturwissenschaften werden Aussagen, die für alle Menschen Gültigkeit haben, formuliert. Die Bezeichnung „Natur“ legt nahe, dass die „Natur des Menschen“ erforscht wird, was er seinem „natürlichem Wesen nach ist“. Tatsächlich wird aber nur ein klar definierter, eng umschriebener Teil der Natur des Menschen erforscht, nämlich jener, der den naturwissenschaftlichen Kriterien von Operationalisierbarkeit, Reliabilität, Validität, Signifikanz, Falsifizierbarkeit, Objektivität und Wiederholbarkeit entspricht. Vereinfacht: Die Art der Erkenntnisgewinnung ist die mathematische Berechenbarkeit. „Ich messe also bin ich – ich bin ein zu Messender ¬– also bin ich“. Alles was gemessen werden kann existiert.
Operationalisierbarkeit bedeutet Messbarmachung, also die Übersetzung von Begriffen, Phänomenen etc. in berechenbare Einheiten (Zahlen). Ob dieses Operationalisieren geglückt ist, wird wiederum berechnet.
Reliabilität ist der Zahlenwert, der angibt, inwieweit der Messvorgang tatsächlich etwas Konkretes misst, und nicht nur irgendwelche zufälligen Daten liefert.
Validität gibt wiederum Auskunft darüber, ob der Messvorgang tatsächlich das konkrete Konstrukt misst, das er vorgibt zu messen, und nicht irgendetwas Anderes.
Signifikanz ist eine mathematische Größe, auf die sich das Kollektiv der Wissenschaftler geeinigt hat, ab der ein Messergebnis als zutreffend, richtig oder wahr interpretiert werden darf. Ein Ergebnis ist signifikant, wenn die statistische Wahrscheinlichkeit, dass das Berechnete tatsächlich so ist, entsprechend groß ist und die Option, dass das Messergebnis zufällig zustande gekommen sein könnte, entsprechend gering ist.
In der Psychologie werden in der Regel Irrtumswahrscheinlichkeiten von 95% oder 99% (0,05% oder 0,01% Niveau) als Maßstab gewählt. Das heißt in 95 (99) von 100 Fällen trifft die Aussage zu, bzw. tritt das vorhergesagte Ereignis ein.
Es gibt aber eben auch den Fall (5 oder 1 von Hundert), in dem es anders sein wird. Aus Sicht der Naturwissenschaft ein irrelevanter, vernachlässigbarer, aber auch unvermeidbarer „Fehler“.
Das statistische Paradigma der Naturwissenschaft impliziert zwei Arten von Besonderheiten, die auch für die Individualwissenschaft von großer Bedeutung sind.
A: Selbst bei sehr hohen Wahrscheinlichkeiten kann es im Einzelfall auch anders sein.
B: In der Statistik kann immer nur eine Fehlerart (Fehler 1 oder Alpha) kontrolliert werden und der andere Fehler (Fehler 2 oder Beta) wird „begangen“ bzw. in Kauf genommen.
Ein Beispiel aus meiner Praxis soll dies veranschaulichen.
Ein Mann um die 60 Jahre lag mit der Diagnose „katatoner Stupor“ (ICD 10 F20.2) bewegungsunfähig und ohne kommunikativen Kontakt zur Umwelt, mehrere Wochen lang im Bett der psychiatrischen Behandlungsstation. Aufgrund der Starre und Reaktionslosigkeit des Mannes in diesem Krankheitszustand war es für Außenstehende unmöglich zu erkennen und zu beurteilen, ob dieser seine Umgebung wahrnehmen konnte oder ob er völlig bewusstlos und zu keinen äußeren Wahrnehmungen fähig war.
In diesem Fall lassen sich beispielhaft folgende zwei Hypothesen formulieren:
A: Er ist bewusstlos und „bekommt nichts von seiner Umwelt mit“, was impliziert, dass es vollkommen egal ist, wie und was ich neben ihm sage.
B: Auch wenn er nicht reagieren kann, nimmt er seine Umwelt wahr, was den Aufwand bedeutet, dass ich darauf zu achten habe, wie ich mich in seiner Gegenwart verhalte.
Wenn wir uns auf diese Situation mit diesen zwei Optionen einlassen und für uns die Fragestellung für dieses Beispiel so akzeptieren, ist ersichtlich, dass wir immer nur eine Position vertreten können und damit zwangsläufig die anderen Positionen als möglichen Fehler riskieren.
Vertreten wir die Position A, dass der Patient vollkommen bewusstlos ist, so riskieren wir, dass doch B zutreffend ist. Vertreten wir die Position B so riskieren wir, dass A zutrifft. Im Fall des katatonen Patienten schienen die behandelnden Fachkräfte tatsächlich vor diesem Dilemma zu stehen.
Aus diesem Beispiel soll ersichtlich werden, dass es keineswegs irrelevant ist, welche Art von Fehler wir bereit sind zu riskieren, und dass es unvermeidbar ist, einen Fehler einzugehen.
Im zitierten Fall gab es ÄrztInnen, die jeweils eine der Positionen vertraten (vermutlich ohne je über diese Tücke der Statistik nachgedacht zu haben). Position A: Sie sprachen neben dem Patienten so, als ob dieser gar nicht anwesend wäre. Position B: Sie gestalteten die Kommunikation mit den KollegInnen und dem Pflegepersonal so, als könne der Patient jedes Wort mithören.
Als der Patient wieder aus seiner Erstarrung erwacht war, verhielten sich alle ÄrztInnen dem Patienten gegenüber sehr einfühlsam und verständnisvoll. Dennoch konnte er einige der ÄrztInnen nicht leiden. Er selbst hatte keine Erklärung dafür. Für seine Tochter, die nahezu täglich in dieser Zeit an seinem Krankenbett zugegen war, war der Zusammenhang jedoch völlig offensichtlich. Jene ÄrztInnen, die Position A vertreten hatten, waren ihm, im Gegensatz zu jenen der Position B, unsympathisch.
Aus diesem Beispiel lassen sich u.a. verschiedene Überlegungen ableiten:
Mit welchem Menschenbild begegne ich dem Anderen und wann endet dieses?
Welche Konsequenzen hat mein Verhalten unter dem Aspekt von Alpha und Beta Fehler?
Doch nun zurück zu den noch ausstehenden Axiomen der Naturwissenschaft: Falsifizierbarkeit und Objektivität.
Falsifizierbarkeit bedeutet, dass ich meine Annahmen so zu formulieren habe, dass sie Bedingungen einschließen, unter denen sie sich als falsch herausstellen können. Anders ausgedrückt, wenn keine Signifikanz errechenbar ist, sind die Hypothesen zu verwerfen.
Objektivität ist wohl neben der Messbarkeit das Hauptwesensmerkmal des naturwissenschaftlichen Verständnisses. Es besagt, dass das Ergebnis jeder Untersuchung vollkommen unabhängig von der Person des Untersuchers zu sein hat. Unter denselben Messbedingungen muss jeder Mensch zu denselben Messergebnissen kommen. Dies bedeutet, dass das Ergebnis in keinster Weise durch menschliche Faktoren des Forschers beeinflusst werden darf. Das bedeutet aber auch, dass das Ergebnis unter denselben Bedingungen beliebig oft wiederholbar zu sein hat.
Diese Axiome der Naturwissenschaft sind als inhaltliche Forderung zu verstehen: Die einzelnen Erkenntnisse und Messergebnisse haben in einem kohärenten Zusammenhang mit den Erkenntnissen anderer Forscher zu stehen. (Dieses Phänomen und die damit verbundene Problematik hat Thomas Kuhn (1976) in dem Buch „Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen“ herausgearbeitet.) Diese Kriterien haben zu den atemberaubenden Erkenntnissen und Errungenschaften der modernen Welt geführt, seien diese nun Segen (z.B. medizinisches Wissen) oder Fluch (z.B. Waffentechnologie).
Individualwissenschaften
Kernannahmen der Individualwissenschaft sind die individuelle Einzigartigkeit und Einmaligkeit jedes einzelnen Menschen und seine kollektive Verbundenheit als Mensch und Lebewesen. Aus dieser kollektiven Verbundenheit des individuellen Menschen mit Anderen, aufgrund seines Menschseins, folgt die gegenwärtig gelebte Begegnung in der Ich-Du Beziehung. So gesehen ist ein Individuum losgelöst von dem Kontext des Seins, in Bezogenheit zu einem Gegenüber, einem Du, einer Umwelt, sinnvoll nicht denkbar. Kein Mensch ist „nur Individuum“, losgelöst von Verbindungen und Beziehungen. Demzufolge mag für die folgenden Ausführungen der beziehungswissenschaftliche Aspekt als dem individualwissenschaftlichen inkludiert betrachtet werden.
Kernfragen der Individualwissenschaften:
Was macht das Individuum einmalig, einzigartig (das genaue Gegenteil der Naturwissenschaften)? Individualwissenschaft widmet sich dem „Fehler, dem Störfaktor der Naturwissenschaften, der unwahrscheinlichen Ausnahme, dem einen von hundert Mal. Das bedeutet auch, Individualwissenschaft schließt Phänomene mit ein, die per Definition einmalig, einzigartig sind, die möglicherweise nur ein einziges Mal (im Leben eines Menschen) auftreten (also keine Rede von Wiederholbarkeit).
Wie können wir diese Einzigartigkeit im So-Sein mit der Gleichzeitigkeit des Verbunden- und Gemeinsam-Seins als Menschen erfassen?
Wie treten einzigartige, einmalige Individuen miteinander in Kontakt, in Beziehung. Wie transzendiert der Mensch die jeweilige Einmaligkeit des Ich-Ich zu einem Ich-Du und einem Wir?
Wie können wir den jeweiligen Menschen in seinem So-Sein im „Hier und Jetzt“ erfassen? Ihn gleichzeitig zu verstehen als: *in die Zukunft Gerichteter, mit Träumen, Befürchtungen, Wünschen, Wollen und Zielen und *als historisch Gewordener, aus dem Kollektiv – evolutionär Entwickelter, sowie *als sozialer Mensch unter Menschen und *individuell, in seiner einzigartigen Lebensgeschichte in diesem Raum, Zeit, Kultur Hineingeborener?
Diese Fragen entsprechen eins zu eins der psychotherapeutischen Alltagsrealität. Wenn wir diese exemplarischen Fragen einer Individualwissenschaft ernstnehmen, sehen wir, dass sie mit den oben beschriebenen Methoden der Naturwissenschaften nicht befriedigend beantwortet werden können.
Warum das so ist? Naturwissenschaft beschäftigt sich, per Definition, mit dem Allgemeingültigen. Eine der vielleicht bekanntesten mathematischen Verteilungen ist die Gauß´sche Glockenkurve. Das Interesse der Naturwissenschaft liegt zu gleichen Teilen links und rechts vom Mittelwert, allerdings nur so weit, wie dieser Bereich signifikante Gültigkeit hat.
Für die Psychotherapie und die Individualwissenschaft wird es hingegen genau an diesen Randbereichen interessant. Der Mensch will nicht als „ein Mensch“, sondern als „dieser Mensch, der nur er/sie ist“ gesehen, angenommen, erkannt- und verstanden werden.
Ich werde hier keine „Methoden der Individualwissenschaft“ im Unterschied zu naturwissenschaftlichen diskutieren. Die Methodenfrage ist eine Konsequenz aus der zugrundeliegenden Haltung und Einstellung zum Menschen.
Erlange ich Wissen über den Menschen, oder über diesen individuellen Menschen?
Ist diese Erkenntnis Folge einer „Objektivierung“ des Menschen zu einem Untersuchungsgegenstand oder Resultat einer „individuellen Begegnung“ mit diesem Menschen?
Individualwissenschaft ist kein Wissenschaftsreduktionismus, indem der Mensch ausschließlich als individuelle Person aufgefasst wird. Vielmehr stellt es den Versuch einer umfassenden Konzeption des Menschen dar, im Sinne eines ganzheitlichen, psychotherapeutischen Ansatzes.
Anmerkung: Petzold (2015) spricht in diesem Zusammenhang von „Humantherapie“ in der die Therapeutinnen und Therapeuten über mannigfache Methoden und Behandlungsstrategien auf unterschiedlichen Behandlungsebenen verfügen:
Curing, Heilen
Supporting, Unterstützen
Coping, Bewältigungshilfen geben
Enlargenment, Horizonterweiterung
Enrichment, Bereicherung des Lebens
Empowerment als Ermutigung zur Verwirklichung des Potentials eigener Möglichkeiten
Erweitert werden diese Anforderungen an eine umfassende Humantherapie um biologisches Wissen um Ernährung, Schlaf, Bewegung und Lebenszyklen. Diese Auflistung verfehlt aber ihr Ziel, wenn die Interventionen nicht auf Basis einer gelebten therapeutischen Beziehung erfolgen.
Die Sprache der Seele
Die „Sprache der Seele“ kann in der Psychotherapie, neben dem Gebrauch von Worten, vielfältig sein: z.B. als schöpferischer Ausdruck im Anfertigen von Zeichnungen, Musik, Tanz, Dichtung, leiblichen Ausdruck. In der Psychotherapie dienen diese Ausdrucksformen, im Unterschied etwa zur Kunst, ausschließlich als Hilfsmittel für eine „Sprache der Seele“, um das innere Erleben in Kommunikation und Begegnung mit dem Du zu bringen und dadurch Selbsterkenntnis zu ermöglichen.
Eine Besonderheit psychotherapeutischer Begrifflichkeit ist ihre Bezogenheit zum psychotherapeutischen Prozess. Das bedeutet, dass Begriffe mitunter in der jeweiligen konkreten Beziehungsgestaltung prozessabhängig unterschiedliche Bedeutungen erlangen können. So kann ein Bild in verschiedenen therapeutischen Phasen sehr unterschiedliche Bedeutungen ausdrücken. Sprache ordnet sich dem jeweiligen Beziehungsgeschehen unter. Dabei verliert sie selbstverständlich nicht ihre Allgemeingültigkeit, sondern wird um einen individuellen Aspekt bereichert. Somit ist Sprache zwischen dem Ich und Du keine „Geheimsprache“, aber mitunter prozessbezogen, spezifisch. Sprache, wie gesagt nicht ausschließlich verbal zu verstehen, ist das Hilfsmedium für Verstehen- und Verstanden werden. Die Herausforderungen an Sprache in der Psychotherapie sind nicht nur das Finden einer „gemeinsamen Sprache“ als Verständigungsbasis. Sprache wird darüber hinaus zur Basis der therapeutischen, Heilung eröffnenden, Beziehungsgestaltung. Des Weiteren ist Psychotherapie auch die „Kunst“ Impliziertes, Inneres, Gefühltes „in Sprache“ zu transformieren, Worte (Symbole, Ausdruck) für das „Unsagbare“, das „Unaussprechliche“, das Einzigartige zu finden.
Das tiefe existentielle Erleben, die einmalige Erfahrung, der namenlose Schmerz, die sprachlose Leere, das unbeschreibliche Grauen, wortloses Entsetzen, aber auch ekstatische Fülle und Verzücken werden durch sprachlichen Ausdruck behandelbar und damit in bewusste Auseinandersetzung und Reflexion gebracht.
Sprache ist Ausdruck des Selbst- und Menschenbildes. Die sprachliche Unterscheidung von Leib und Körper (Dirnberger 1998, 2018) mag in einer bestimmten Therapiesituation als existentiell unterscheidbare Erfahrung essentiell zum Erfolg beitragen. Andermal können die Worte getrost als Synonyme verwendet werden, ohne Einfluss auf die Therapie. Ein Beispiel aus der Praxis:
Ein Patient litt an diversen organischen Beeinträchtigungen, die wiederholte Arztkonsultationen und Spitalsaufenthalte bedingten. Zu Beginn der Therapie delegierte der Patient die mit seinen Leiden verbundenen Maßnahmen nach außen. Dabei überantwortete er nicht nur die medizinischen Notwendigkeiten an die behandelnden ÄrztInnen, sondern verschob die Verantwortung über Behandlungsmaßnahmen auf seine Frau und seine Eltern. Dies ging mit einer inneren Distanz zu seinem Körper einher.
Diese Distanz zum Körperselbst entsprach weitgehend den in den Spitalsaufenthalten erlebten Erfahrungen. Mit fortschreitender Psychotherapie und unter Zuhilfenahme einfacher leibtherapeutischer Interventionstechniken gelang es dem Patienten zunehmend sein Leibselbst, neben dem bekannten Körperselbst, zu erfahren. Parallel dazu ermöglichte ihm dies, die krankheitsbezogene Dynamik seiner Beziehungsstrukturen bewusst zu erfassen und zu verändern, sowie Einsichten in eine psychodynamische Perspektive seines Leidens zu gewinnen.
So wurde aus dem Körper, den ich habe, der distanzierten Subjekt – Objekt Beziehungsbeschreibung zum Organismus Mensch – der Leib der ich bin, der Mensch als leiberfülltes, sich leiblich erlebendes (beseeltes) Wesen.
Kernbegriffe einer Psychotherapie auf individualwissenschaftlicher Basis
Im Folgenden werde ich einige zentrale Begriffe der Psychotherapie exemplarisch aufgreifen und den Unterschied zwischen individualwissenschaftlicher zu naturwissenschaftlicher Betrachtungsweise darlegen.
Als Stellvertreter für eine naturwissenschaftliche Position werde ich, wie angekündigt, die Ausführungen des Philosophen Metzinger (2012, „Der Egotunnel“, worin er „Selbst“ und „Ego“ als Synonyme verwendet) heranziehen. Er verbindet moderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse der Neurophysiologie und Gehirnforschung zu einer „neuen Philosophie des Selbst“.
Ich werde die Begriffe Selbst, Erfahrung, Erkenntnis und Entwicklung (Veränderung) als zentrale Themen, erweitert um die Aspekte Leib, freier Wille und Tod, hier aufgreifen und kurz ausführen.
Auf andere wesentliche psychotherapeutische Vorstellungen wie Individuum, Beziehung, Gegenwärtigkeit, existentielle Betroffenheit, Bewusstseinsvariabilität, phänomenologische Prozessarbeit, etc. wird nicht weiter eingegangen. Dies würde zum einen den Rahmen dieses Essays sprengen, zum anderen sind die prinzipiellen Unterschiede zwischen den Betrachtungsweisen mit den angeführten Beispielen gut veranschaulicht.
Selbst
„Das bin ja ich, Ich-selbst, da ist kein Selbst dort und da bin ich, der Max, das bin Ich-selbst und das ist wunderbar!“ formulierte einer meiner Patienten.
Diese tiefe Seins-Erfahrung steht im diametralen Gegensatz zur neurophysiologisch-naturwissenschaftlichen Sichtweise, in der es kein Selbst gibt. Das Selbst ist in dieser Betrachtungsweise eine vom Gehirn erzeugte Halluzination, eine Illusion des Bewusstseins um (sich selbst) Kontinuität und Ichkonstanz vorzugaukeln, wo es tatsächlich nur zelluläre Erneuerung und Veränderung gibt.
Das Ich, Synonym mit Selbst und Ego, ist eine Fiktion ohne real Entsprechendes. Es gibt kein Selbst, daher sind wir nicht Selbst sondern „selbst-lose Ego-Maschinen“ wie Metzinger diese Sichtweise auf den Punkt bringt.
Hauptargumente sind u.a., dass das Selbst als erlebte, konstante Ganzheit getäuscht werden kann. Mit einem komplexen Versuchsaufbau konnte gezeigt werden, dass Versuchspersonen eine Plastikhand als ihre eigene fehlinterpretierten. Sie betrachteten diese Plastikhand als zu sich selbst gehörenden Körperteil. Das Selbst kann also auch ein falsches Selbst-Bild von sich entwickeln, vergleichbar dem Phantomschmerz bei Amputationen, wo ein nicht mehr existierender Körperteil reale Schmerzen verursacht. Etwas, dass man so fundamental täuschen kann, kann nicht real sein, scheint die Logik dahinter zu sein. Wesentlich schlagkräftiger ist noch der neurophysiologische Befund, dass (bisher) kein Gehirnareal oder Aktivierungsfelder im Gehirn als Selbst gefunden wurden. Sehr wohl sind aber unterschiedliche Gehirnaktivitäten entsprechend unterschiedlichen Bewusstseinszuständen ermittelt worden. Deswegen gibt es Bewusstsein, aber eben kein Selbst. Vielmehr ist das Selbst eine illusionäre Funktion des Bewusstseins.
Eines Bewusstseins, das sich selbst ein Selbst vortäuscht. (Klingt eigenartig, ist es vermutlich auch.) Das Bewusstsein kennt Zustände, in denen das Selbst aufgelöst, in Anderes transzendiert wird. Im Schlaf oder der Bewusstlosigkeit „verabschiedet“ sich das Selbstbewusstsein, wo ist dann das Selbst? Antwort Metzinger: Es gibt kein Selbst, das Selbstmodell ist ein „Fall dynamischer Selbstorganisation im Gehirn“. Es gibt keinen Geist, keinen „kleinen Mann“, keinen Homunculus, der hinter den Augen im Kopf sitzt, der von sich behauptet, er sei das Selbst und er steuere und lenke mittels des Gehirns den Körper. Nicht das Selbst hat das Gehirn, sondern das Gehirn hat ein Selbstmodell inklusive der Illusion eines real seienden Selbst.
Nun, aus individualwissenschaftlicher Sicht lässt sich bestätigen, gäbe es einen solchen Homunculus, der von sich behauptet, das Selbst zu sein oder –, realistischer –, ein Hirnareal, das als Selbst identifiziert wird, so könnten wir sagen, wer immer dieser Homunculus wirklich ist, mit was immer auch dieses Hirnareal korreliert, es ist sicher nicht „das Selbst“.
Das Selbst ist kein Ding, das unabhängig vom Individuum, vom lebenden und sich selbst erfahrenden und reflektierenden Menschen sinnvoll gedacht werden kann. Das bedeutet nicht, dass Theorien vom Selbst als psychische Instanz und Erlebnisrealität in psychologischen Theorien sehr wohl gewinnbringend konzeptualisiert werden können. Ganz im Gegenteil, psychologische Theorien vom Selbst sind nicht nur interessante Konzepte, sondern durchaus hilfreich für die psychotherapeutische Praxis. Das Selbst kann sinnvollerweise natürlich nicht auf einen Körperteil oder ein Gehirnareal reduziert werden, weil es Erfahrungsrealität einer verkörperten – leiblichen – Ganzheit ist. Manchmal wird das Selbst als Einheit der eigenen Existenz erlebt, in der Regel jedoch als die Kontinuität und Stabilität, als individuell, real, lebendig Seiendes, eben als „Ich-Selbst“. Damit ist das Selbst nicht ausschließlich ein Konzept, sondern erfahrbare Erlebnisrealität.
Und ja, es stimmt! Dieses Ich-Selbst kann getäuscht werden.
In einem Experiment konnten Archäologiestudentinnen (Dirnberger 2016) neuzeitliche Gegenstände nicht erkennen, sondern hielten diese für altsteinzeitliche Artefakte. Unsere Wahrnehmung und unsere Selbsteinschätzung können uns irreführen und irreleiten. Wir können uns täuschen und Fehler begehen. Diese sind in der Psychotherapie mitunter folgenschwer und schädigend, ich denke hier an Übertragung und Gegenübertragung, unaufgelöste, historische Verstrickungen, Wunschdenken und Egoismen. Diese existieren und können Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis beeinträchtigen und sich, unerkannt, negativ auf eine Psychotherapie auswirken. Es gehört in die Verantwortlichkeit der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, diese Phänomene in Selbstreflexion (z.B. Supervision) zu erkennen und in Förderliches für den therapeutischen Arbeitsprozess zu verwandeln, zu transformieren.
An dieser Stelle mag ein kleines Selbstexperiment hilfreich sein. Es dauert nur eine Minute in der Sie sich entspannt in Ihrem Sessel aufrichten, eine ihrer Hände im Herzbereich ruhen lassen und die Augen schließen. Achten Sie auf Ihre Atmung, jedoch ohne diese zu verändern. Konzentrieren Sie sich auf das ruhige „Ein und Aus“ ihrer Atmung. Spüren Sie Ihr Gewicht auf der Sitzfläche, wie es über die Sesselbeine und Ihre Fußsohlen in die Erde abgeleitet wird, in den Boden, der Sie sicher und verlässlich trägt. Spüren Sie die Berührung Ihrer Hand, können sie wahrnehmen, wie Ihre Atmung Ihren Brustkorb leicht bewegt? Spüren Sie Ihren Herzschlag?
In diesem entspannten und sicheren Zustand erlauben Sie sich nun, in Gedanken in der Zeit etwas zurückzugehen. Zum heutigen Frühstück. Vielleicht können Sie sich erinnern, ob Sie Tee oder Kaffee oder etwas anderes zu sich genommen haben. Wer war es, der diese Entscheidung für Tee oder Kaffee getroffen hat? Und wer ist es, der sich nun daran erinnert? Wer ist „Erinnerer“ und wer „Erinnerter“? Und wenn Sie nun wieder in die Gegenwärtigkeit dieses Augenblicks, mit geschlossenen Augen auf dem Sessel sitzend, zurückkehren, spüren Sie nochmals intensiv die Berührung Ihrer Hand. Auch hier können wir fragen: Wer ist es, der hier berührt wird? Und wer ist es, der berührt? Wer ist „Berührer“ und wer „Berührter“? Lassen Sie diese Fragen einen Moment in sich nachklingen bevor Sie mit einem tiefen Atemzug die Augen wieder öffnen.
Nun, wer ist es, der sich erinnert, der berührt? In irgendeiner Form wird die Antwort wohl „Ich, Ich-Selbst“ lauten.
Ganz offensichtlich gibt es ein SELBSTVERSTÄNDLICHES SELBSTVERSTÄNDNIS ÜBER DAS SELBST. Dieses „selbstverständliche Selbst-Verständnis“ entspricht dem Alltagsverständnis und findet sich in unserem Sprachgebrauch in Worten wieder wie:
Selbstbild, Selbstwirksamkeit, Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Selbstkontrolle, Selbstkritik, Selbstironie, Selbstverständnis, Selbsterfüllung, Selbstlosigkeit, Selbstschutz, Selbstliebe etc.
All diese Wörter bringen ein sinnvolles Selbst-Verständnis zum Ausdruck. Das Selbst als Orientierungs- und Ordnungsgröße im Alltag ist der konstante Faktor der Ich-Identität über die Zeit. Ein Selbst das, selten aber doch, als tiefste innerste Seins-Realität erfahrbar ist.
Letztendlich ist das Selbst die sinnstiftende Instanz, die Menschen zu „DIESEM einen Mensch“ macht. Erst das Selbst macht uns für uns und die anderen zu UNS-SELBST, diesem einzigartigen, einmaligen und unverwechselbaren Wesen. Im Selbst können wir erkannt werden und uns selbst erkennen. Das ist die Voraussetzung für tiefes Verstehen und Verstanden-werden, Sehen und Gesehen-werden, Berühren und Berührt-werden, für Beziehung.
Ja, das Selbst kann getäuscht werden, es kann falsche, schädigende und krankmachende Vorstellungen von sich entwickeln. Wir können uns ängstigend und krankhaft von uns selbst entfremden und uns selbst verlieren. Ganz anders können wir uns aber auch in einem transzendenten Akt der Erleuchtung von unserem Selbst lösen, „über uns selbst hinauswachsen“.
Das Selbst ist der Weg zu Selbstverständnis und Selbsterkenntnis. Warum es als Illusion und Wahnvorstellung bezeichnen? Welcher Wert, welch praktischer Nutzen oder Erkenntnisgewinn, welche Bereicherung unseres Lebensalltags, unserer Arbeitswelt, unserer spirituellen Entwicklung, würde darin liegen?
Ein Patient äußerte in einem tiefen Selbsterkenntnismoment die scheinbar banale Einsicht: „Ich stehe mir wirklich selbst im Weg!“ oder ein anderer: „Ich bin ja mit mir selbst eingesperrt!“
Es klänge doch eigenartig, wenn darauf geantwortet werden würde: „Gemäß der neuesten Philosophie des Selbst und den neuen Hirnforschungserkenntnissen gibt es gar kein Selbst. Das ist nur eine Einbildung, eine Illusion, also steht Ihnen gar nichts im Weg. Alles nur eine Phantasie Ihres Gehirns.“
Selbst wenn das Selbst tatsächlich eine Halluzination wäre, so wäre damit kein menschliches Phänomen oder Problem gelöst oder wegerklärt. Es würde uns nicht erspart bleiben, durch Selbsterfahrung zur Selbsterkenntnis zu gelangen.
„Mich auf mich einlassen“ formulierte einer meiner Patienten. Das „Erkenne, wer Du bist!“ wird zu einem „Erkenne, wer Du auch bist!“. Dabei ist Psychotherapie kein Prozess von „Wissensansammlung“, sondern vielmehr ein Prozess des Erkennens und Erfahrens des Selbst. Eine „Entdeckungsreise“ über das ICH zum SELBST, von einem „Das bin Ich“ zur Erkenntnis, „Das bin ich auch!“
Warum aber: „Das bin ich AUCH“?
Psychotherapeutische Selbsterforschung ist weniger ein summarischer, keinesfalls ein reduktionistischer, viel eher ein multiplikativer Prozess. Das „Ganze“ ist nicht nur mehr als die Summe seiner Teile, sondern auch etwas völlig Neues und in letzter Konsequenz Unerschöpfliches.
Diese „Bewusstwerdung des Ich-Selbst“ ist ein aktiver, willentlicher Vorgang, „das Selbst will Sich-selbst erkennen“ (im Unterschied zum Sich-selbst als Selbstillusion vorgaukeln). So wie das Ich(selbst) sich ursprünglich aus dem WIR (intrauterin Mutter /Kind) und DU zur Mutter, Eltern etc. entwickelt hat (und somit das Wir vor dem Ich existierte), entfaltet es sich nun in der therapeutischen Beziehung mit dem Du der TherapeutIn. „Das bin Ich“ ist kein statisches, „so bin ich und bleib ich“ sondern ein lebendiges, wandelbares, entwicklungsfähiges Ich-Selbst. Genau das soll durch das „auch“ in „das bin ich auch“ verdeutlicht werden.
Metzinger spricht von einer zweiten Entzauberung. Nach der „Entzauberung der Welt“ durch die Naturwissenschaften entzaubere diese nunmehr das Selbst. So wie es keinen Zauber in der Natur gibt, gibt es kein Selbst im Menschen.
Nun, aus individualwissenschaftlicher Sicht ist eine Entzauberung der Welt schon eine gewagte Hypothese. Selbstredend ist es ein großes Verdienst der Aufklärung, die falsche Verortung, von Kobolden, Geistern, mystischen Entitäten und Göttern in äußeren Landschaften korrigiert zu haben. Nun kennen wir den Platz, wo diese Wesen existieren: in Märchen, Mythen, Geschichten und der Innenwelt bestimmter Bewusstseinszustände. Das wirklich Zauberhafte an der Welt wurde aber in keinster Weise entzaubert: DAS LEBEN.
Die Vorgänge des Lebens sind bis in das kleinste Detail beschrieben und wir können an ihnen eindrucksvolle Manipulationen vornehmen. Wir können klonen, lebendes Gewebe aus Stammzellen wachsen lassen, wir können in das Genom eingreifen, künstlich befruchten und wir konnten immer schon Leben auslöschen. Aber verstehen, was Leben tatsächlich ist (nicht wie es funktioniert), was Leben zu Leben werden lässt (nicht was es braucht, um zu entstehen) wissen wir nicht. Wir können kein Leben machen (aber als Lebewesen in der Fortpflanzung zeugen).
Wir sind Leben und können weder uns selbst noch das Leben an sich vollständig begreifen. Das ist der wahre Zauber in dieser Welt. Dieser Zauber wird erst mit dem endgültigen Tod, dem Vergehen des Lebens, verschwinden; individuell mit meinem Tod, kollektiv mit dem Ende der Menschheit, universell mit dem Ende allen Lebens auf unserem Planeten. Der Umstand, dass die Naturwissenschaft die Fragen um das Wesen des (eigenen) Lebens aus ihrem Interesse und Gesichtsfeld verbannt hat, ändert nichts an der „Zauberhaftigkeit“ des lebendigen, individuellen wie kollektiven Seins.
Nun, jetzt ist also das Selbst auch entzaubert? Der Befund, dass das Selbst kein Homunculus, kein spezialisierter Zellhaufen im Gehirn ist, ist für eine korrekte Verortung des Selbst sicherlich hilfreich. Vielleicht verhält es sich ja wie bei den mystischen Wesenheiten, dass das Selbst sich im Außen erfolgreich versteckt, weil es im Innen, der Innenschau, gefunden werden will.
Metzinger prophezeit: „Wenn die moderne Neurowissenschaft die hinreichenden Korrelate für das Wollen, Wünschen, Überlegen und Vollziehen einer Handlung entdeckt, werden wir in der Lage sein, das bewusste Erleben des eigenen Willens auszulöschen, zu verstärken, zu löschen und zu modulieren, indem wir die Aktivität dieser neuronalen Korrelate steuern (S. 190)“. Dann braucht es tatsächlich kein Selbst, keine Würde, kein Menschsein mehr. Was in dieser Zukunftsvision offen bleibt ist, wer denn nun dieses „WIR“ sein wird? Wer wird an den Schaltern der neuronalen Steuermacht sitzen? Psychiater? (willkommen im Film „Einer flog über das Kuckucksnest“ mit Jack Nicholson in der Hauptrolle), Politiker? (wie in George Orwell 1984) Anonyme Konzerne? (wie in so manchem Hollywood Blockbuster beschrieben).
Traumata und Gene
Genetiker hätten jetzt nachgewiesen, dass erlebte Traumata sich im Genom des Körpers niederschlügen und dieses veränderten. Seit Jahren (Namentlich seit Wilhelm Reich) beschreiben Körpertherapeuten die „Verkörperung“ von Erfahrung und das Leibgedächtnis von traumatischen Erlebnissen. Psychotherapeuten sprechen von der innerfamiliären, transgenerationalen Weitergabe von Traumata „als wären sie genetisch fixiert“. Nun berichten Genetiker, Hinweise dafür gefunden zu haben, dass Traumata tatsächlich genetisch repräsentiert und über Vererbungsmechanismen an nachfolgende Generationen weitergegeben werden können.
Ist dies eine erfreuliche Bestätigung psychotherapeutischen Erfahrungswissens durch die genetische Forschung? Wenn wir diesen Befund weiterdenken wird die Genchirurgie besagte traumatische Genabschnitte eines Tages operativ entfernen können. Kann einem Opfer so eine Heilungsmöglichkeit verwehrt werden? Dank der oben erwähnten neurophysiologischen Löschung wird in dieser Zukunft nicht nur das traumatische Gen herausgeschnitten, sondern die gesamte Erinnerung an das Trauma wird im Gehirn gelöscht. Es wird sein, als wäre das Trauma nie passiert.
Vielleicht werden wir dann begreifen, dass die neuronale Repräsentanz eines gegessenen Apfels nicht das reale Essen eines Apfels ist.
Traumata sind nicht nur defekte genetische Codes und unerwünschte neuronale Verknüpfungen. Sie sind ein ganzheitlich erlebtes Schreckliches, eine nachhaltige Schädigung des Selbst, der Leiblichkeit und des Vertrauens in die Welt.
Diese Verwundungen können nur mit Menschlichkeit, Leiblichkeit und wohlwollender Selbsterkenntnis behandelt werden.
Wir sind keine neurophysiologischen Organroboter, keine „selbstlose Ego-Maschinen“. Jedenfalls solange wir uns nicht darauf reduzieren lassen. Wir sind ganzheitlich erfahrende, erlebende Lebewesen. Traumatische Erfahrungen sind als Schädigung des Selbst gut verstehbar und beschreibbar. Sie sind keine lokal umschriebenen, klar vom restlichen Menschen abgegrenzten Phänomene, ob diese nun im Gehirn, im Körper oder in den Genen verortet werden.
Diese Überlegungen zur „Machbarkeit“ aus neurophysiologischen und genetischen Erkenntnissen zeigt meines Erachtens auch, wie wichtig es ist, den Naturwissenschaften die menschliche, individuelle Perspektive einer Individualwissenschaft zur Seite zu stellen, damit Forschung der menschlichen Würde und Entwicklung verpflichtet bleibt. Es zeigt auch, wie wichtig es ist, auf PhilosophInnen zu hören, die kritisch den logischen Verortungsfehler aufzeigen, den Neurophysiologen begehen, wenn sie die Erkenntnisse der Gehirnforschung einfach auf den ganzen Menschen übertragen. (Gabriel 2019, Strasser 2018, Bennet et. al. 2021). Wie Neurophysiologie und Psychotherapie sich sinnvoll ergänzen siehe Bauer (2021, 2019, 2011, 2006).
Erfahrung und Erkenntnis
In der Psychotherapie ist Erkenntnis ein Erfahrungsprozess aus der Begegnung mit einer (konkreten, gegenübersitzenden) Person. Erkennen kann ich, was der Erfahrung zugänglich ist und die PatientInnen „zeigen“. Darin unterscheidet sich Erkenntnis vom Wissen um Etwas. Ob Wissen und Erkenntnis neurophysiologisch unterscheidbare Informationsverarbeitungsmodi des Gehirnes sind, ist dabei ohne Belang. Erkenntnis erlangt nur der lebendige, zur Erfahrung befähigte Mensch.
Dies löst nicht die erkenntnistheoretischen Überlegungen der Philosophie. Eher ist es eine pragmatische Umgehung einer erkenntnistheoretischen Diskussion. Zugrunde liegt die Frage, was als Realität, als Wirklichkeit gilt, ob und wie Menschen diese erkennen können. In gewisser Weise drücken sich Naturwissenschaft und Individualwissenschaft um diese philosophische Fragestellung. In den Naturwissenschaften gilt als real, was (im Einklang mit den errechneten Naturgesetzen) gemessen und experimentell nachgewiesen werden kann. Nur das ist wahrhaft existent. Das führt zu Aussagen wie: „Es gibt keine Farben“ oder „Der Himmel ist nicht blau“. Tatsächlich gibt es aus naturwissenschaftlicher Sicht nur elektromagnetische Wellen oder kleinste Teilchen (und einige phantastische Quantenphänomene). Ein blauer Himmel ist eine Illusion, die unser Gehirn erzeugt: „Der Abendhimmel ist farblos. In der Außenwelt gibt es überhaupt keine farbigen Gegenstände… Da draußen, vor ihren Augen, gibt es nur einen Ozean aus elektromagnetischer Strahlung, eine wild wogende Mischung verschiedener Wellenlängen“ (Metzinger S. →).
Individualwissenschaftlich sind solche Äußerungen, vorsichtig formuliert, problematisch. Ich kann den Himmel entweder unmittelbar, ohne technische Hilfsmittel, als farbig wahrnehmen oder als Ansammlung physikalischer Wellen, letzteres aber nur „mittelbar“, unter Zuhilfenahme von technischen Messinstrumenten. Warum die Wahrnehmung mittels Messinstruments realer sein soll als die unmittelbare Betrachtung des Himmels ohne Messinstrumente, diese unmittelbare Betrachtung sogar eine Illusion sein soll, (um nicht Wahnvorstellung zu sagen), entbehrt der individualwissenschaftlichen Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit. Individualwissenschaftlich ist das Erleben immer eine reale, wirkliche Erfahrung, über die wir Erkenntnis erlangen. Wie wir diese Erfahrung deuten, erklären, in Sinnzusammenhänge stellen (und sie damit unser Leben beeinflusst) ist eine wichtige, aber andere Frage und ein zentrales Thema in der Psychotherapie.
Auch wenn das folgende Beispiel schon oft strapaziert wurde, verdeutlicht es doch anschaulich die psychotherapeutische Position.
Sie können alles über den Orgasmus lesen, die gesamte verfügbare Literatur, Sie werden umfassendes Wissen über den Orgasmus haben und doch werden Sie nichts vom Orgasmus „wissen“. Sie können wissenschaftlich exakte Testreihen und Untersuchungen starten, von physiologischen Begleiterscheinungen über Lautäußerungen, Stellungen bis zu molekularen Zellveränderungen und Aktivierungen von Hirnarealen. Sie können soziologische Parameter erheben und individuelle Erfahrungsberichte in ihrer Forschung berücksichtigen.
Sie werden viel über Funktion und Bedeutung des Orgasmus erfahren und sie werden manipulativ in den Vorgang eingreifen können. Aber nie werden sie wissen, wie sich ein Orgasmus anfühlt, was es bedeutet ihn zu erleben, und wie unterschiedlich er sein kann. Das ändert sich selbst dann nicht, wenn Sie beim Zusehen eine innere Repräsentanz (etwa mittels Spiegelneuronen) in ihrem Gehirn erzeugen können. Wir können diesen Vergleich noch weiterdenken.
Selbst wenn Sie Ihr Gehirn elektromagnetisch an den entsprechenden Stellen manipulieren und so eine physiologische Vergleichsreaktion erleben, selbst wenn Sie ein Plastiksurrogat anschaffen oder selbst Hand anlegen, ja selbst wenn Sie käuflich ein menschliches Gegenüber engagieren, Sie werden trotz möglicherweise gleicher neurophysiologischer Messdaten nie erfahren, was es bedeutet mit einem geliebten, altersentsprechenden Menschen in gegenseitigem Begehren im sexuellen, orgastischen Akt vereint zu sein. Zu allem naturwissenschaftlichen Überfluss kann es sich dabei um eine möglicherweise einzigartige, experimentell nicht wiederholbare, in dieser Erlebnisqualität einmalige menschliche Erfahrung handeln. Die Folgenden Orgasmen sind vielleicht vergleichbar schön, aber doch anders.
So können wir den Satz: „Wer nicht weiß, muss glauben“ ergänzen um „wem die Erfahrung fehlt, der muss wissen.“
Erleben, Erfahren kann nicht ausgelagert, „outgesourced“ werden, es kann nicht von anderen übernommen werden, nur Ich selbst kann durch Erfahrung Erkenntnis erlangen, zumindest in einer individualwissenschaftlichen Sichtweise.
Eine individualwissenschaftliche Perspektive würde eine „Rehabilitation“ der sinnlichen Wahrnehmung bedeuten. In den Naturwissenschaften besteht ein tiefes Misstrauen gegenüber jeder Form von sinnlicher Wahrnehmung. Der Grund deckt sich wohl mit den obigen Ausführungen zur Täuschbarkeit des Selbst. Unsere Wahrnehmung kann getäuscht werden, sie kann uns Dinge „vorgaukeln“, die nicht da sind.
Sie kann aus einem Bild abwechselnd zwei verschiedene entstehen lassen (alte oder junge Frau bei den Kippbildern), sie kann uns Dinge zeigen, die unmöglich sind (die Stiege von M.C. Escher, bei der Personen auf einer Treppe im Kreis gehen wobei es den Anschein hat, dass sie kontinuierlich treppauf- bzw. treppab gehen, also wieder am Ausgangspunkt ankommen, obwohl sie nur abwärts gegangen sind) und Situationen, in denen nicht mehr zwischen Realität und Spiegelung unterschieden werden kann (Spiegelbild im Spiegel) usw..
Wie kann etwas so Unzuverlässigem wie unserer sinnlichen Wahrnehmung da noch vertraut werden? Antwort der Naturwissenschaften: Wir nehmen nur mehr ernst, was in Zahlen, Wellen, Grafiken oder durch Maschinen wahrgenommen werden kann und am Bildschirm oder in (bunten) Computerausdrucken manifest wird.
Das bedeutet, wir (oder unser Gehirn, wer dies lieber hat) vertrauen den Wahrnehmungen durch die Maschinen, die wir selbst (unser Gehirn) ersonnen und gebaut haben mehr, als unserer unmittelbaren Wahrnehmung. Manchmal völlig zu Recht, immerhin konnten wir erst durch die Mikroskopie Bakterien und Viren entdecken. Aber immer? Nur? Wir sind sinnliche, wahrnehmende Lebewesen. Das Leben ist sinnlich, wenn es sinnvoll und erfüllend sein soll.
In der Psychotherapie erfolgt Erkenntnis aus der Erfahrung eines psychotherapeutischen Prozesserlebens, indem PsychotherapeutInnen ihre KlientInnen nicht wissenschaftlich untersuchen, sondern ihnen in der therapeutischen Beziehung begegnen!
Das ist der Weg der Psychotherapie zu einem „Erkenne dich Selbst“. Beziehung auf Basis unserer sinnlichen Wahrnehmung. KlientInnen wie TherapeutInnen stehen ausschließlich ihre sinnliche Wahrnehmung für Erkenntnisgewinn zur Verfügung, zur Entfaltung der Beziehung und dem Fenster zum Selbst im existentiellen Erleben gegenwärtigen Seins.
Manche Patienten benötigen viele Stunden Psychotherapie, um sich an der Farbenpracht eines Abendhimmels, den verschiedensten Blau- und Rottönungen (wieder) erfreuen zu können, um im Anblick dieser Schönheit zu einem Moment der inneren Ruhe, Gelassenheit und Freude zu gelangen. Vielleicht eines der Privilegien des Menschseins, dass die Schönheit der Natur auf unser Selbst einen positiven, erholsamen, möglicherweise heilsamen Effekt haben kann. Das steht in diametralem Gegensatz zu einem illusionären Selbst, das sich-selbst Farben halluziniert; erkannt von einem Gehirn, das sich-selbst als Welthalluzinationsmaschine entlarvt (die von egoistischen Genen gesteuert wird, Dawkins 1996) und gleichzeitig sich-selbst überzeugt, dass nur „Maschinen Marke Eigenbau“ Auskunft über die wirkliche Welt geben. Das klingt dann wohl eher wie eine Inhaltsbeschreibung der Filmreihe „Matrix“.
Nicht alle Philosophen teilen Metzingers Schlussfolgerungen aus der Hirnforschung. Ich zitiere hier Gabriel (2013), der ebenfalls sehr pointiert formuliert (Seiten 59f, 120f, 197f):