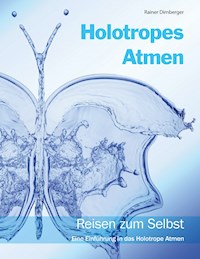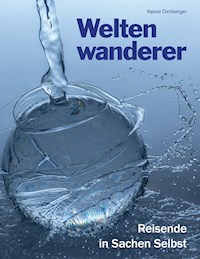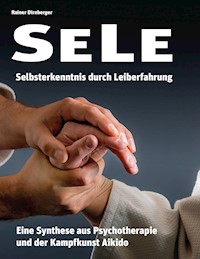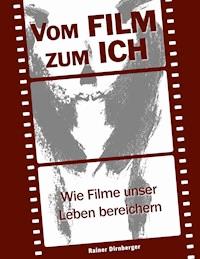
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Abenteuerspiel Filmerlebnis oder Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsentwicklung bei Filmen genießen! Der Raum ist abgedunkelt. Popcorn und Getränke sind griffbereit. Musik erklingt, schwillt an. Der Film beginnt mit den ersten Bildern des Vorspanns. Wir gehen ins Kino, um uns zu unterhalten. Warum aber erinnern wir uns an bestimmte Filme, an Szenen, Dialoge und Bilder? Es mag die Handlung und schauspielerische Leistung sein oder die poetische Wortwahl, das Spiel mit dem Licht, die berührende Musik, der Schnitt oder einfach alles zusammen. All diese Aspekte tragen dazu bei, dass wir unsere Lieblingsfilme mögen. Das ist die äußere Betrachtungsweise. Diese lässt sich durch eine Innere ergänzen, indem wir uns fragen: Was ist denn in mir, dass all diese Filmelemente genau diese Wirkung in mir auslösen? Welche Saiten kommen da in mir in Schwingung? Neugierig geworden? Lust auch dieser Frage nach der Innenperspektive etwas nachzugehen? Dann: Willkommen beim Abenteuerspiel Filmerlebnis! Nun nur noch die entspannte, achtsame Spiel-Haltung einnehmen und das Abenteuer kann beginnen. 12 Spiele-Sets mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen führen in die Kunst ein: Sich selbst beim Genießen von Filmen ein Stück besser kennenzulernen und so den Alltag zu bereichern. Das Buch richtet sich an alle Freunde von Filmen, unabhängig von Genre oder Themenvorlieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In diesem Buch wird auf Basis der Erkenntnisse bedeutender Psychologen in das Abenteuerspiel Filmerlebnis eingeführt. Dieser spielerische Weg zur Selbsterkenntnis durch Filme bereichert unseren Lebensalltag.
Konkrete Übungsbeispiele und Erfahrungsberichte erleichtern die persönliche Umsetzung.
Im letzten Kapitel ergänzen Anregungen und Spiele-Sets für Kinder das Angebot.
Das Abenteuerspiel Filmerlebnis ist ein kooperatives Spiel für einen oder mehrere SpielerInnen. Erwachsene bis 99+ Jahre. Kinder sind von Natur aus Abenteuerspieler.
Voraussetzung für das Abenteuerspiel: Neugierde, Mut und Freude sich auf Neues einzulassen, Spaß an Erkenntnis und natürlich auch an Filmen.
Dauer 5-99 ungestörte Minuten oder eine Filmlänge.
Mag. Rainer Dirnberger
Jahrgang 1964, arbeitet als Klinischer- u. Gesundheitspsychologe, Transaktionsanalytischer Psychotherapeut, Lehrtherapeut,Supervisor und Vortragender in freier Praxis.
Themenschwerpunkte in den bisherigen Buch-Veröffentlichungen: Selbsterkenntnis, nichtreligiöse Spiritualität, Psychotherapie und Kampfkunst, Holotropes Atmen
Weitere Informationen unter www.dirnberger.co.at
Das Abenteuerspiel Filmerlebnis oder
Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsentwicklung
Inhaltsverzeichnis
Das Abenteuerspiel Filmerlebnis
„Der einzige Mensch, der dir im Weg steht bist du.”
Aus Black Swan
„Die Existenz des Lebens ist ein höchst überbewertetes Phänomen.”
Aus Watchmen – Die Wächter
„Zeit spielt keine Rolle, das einzige was zählt, ist das Leben!“
Aus Das fünfte Element
„Das Gestern ist Geschichte. Das Morgen nur Gerüchte. Doch das Heute ist die Gegenwart und diese erleben zu dürfen, ist ein Geschenk.“
Aus Kung Fu Panda
„Alle guten Geschichten verdienen es, ausgeschmückt zu werden.“
Gandalf in Der Herr der Ringe
„Ich bin Gandalf. Und Gandalf bin ich.”
Aus Der Hobbit
„Möge die Macht mit dir sein.“
Aus Star Wars
„Und dann aus Neugierde, aus Langeweile, ich weiß es nicht, … da gestattete es mir ein Wunderwerk der Technik zum ersten Mal seit zweihundert Jahren den Sonnenaufgang zu sehen – und was für Sonnenaufgänge. Kein menschliches Auge kann das jemals so sehen. Zuerst silbrig, und dann, als die Jahre durchs Land zogen, in Tönen von Lila, Rot, und meinem lang entbehrten Blau.“
Aus Interview mit einem Vampir
Filme verändern mein Leben zum Bessern? Ein Abenteuerspiel Filmerlebnis als epische Reise zum Ich? Selbsterkenntnis, Persönlichkeitsentwicklung beim Anschauen von Filmen? Während ich es mir, mit einer Tüte Popcorn in der Hand, auf der Wohnzimmercouch oder im Kinosessel bequem mache? Das soll funktionieren? Ja, und dieses Buch wird euch zeigen wie.
Gewöhnlich verbinden wir mit Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsentwicklung teure Seminare, komplizierte psychologische Theorien und Verfahren, Anstrengung und wenig Spaß. Und nun soll es reichen, wenn ich einer meiner Lieblingsbeschäftigungen nachgehe und Filme genieße?
Wer bin ich? Wer bin ich in meinem ureigensten Selbst, meiner Individualität, meinem Wesen? Das ist wohl eine der ältesten Menschheitsfragen. Nicht ohne Grund stand schon am Eingangstor zum antiken Orakel von Delphi in Griechenland der weise Rat: „Erkenne dich selbst“. Und Filme sollen uns dabei helfen können? Echt jetzt? Das Filmerlebnis, in dem wir Filme als Spiegel zu unserem Ich nützen?
Es klingt schon eigenartig, dass etwas so Alltägliches und Selbstverständliches, wie sich Filme im Kino oder Zuhause anzusehen, geeignet sein soll, mehr über mich selbst in Erfahrung zu bringen; ja vielleicht sogar mein Leben positiv zu verändern? Und das Beste an der Sache, für das Basisspiel sind in uns Menschen bereits alle notwendigen Voraussetzungen angelegt? Wir brauchen sie nur zu aktivieren und passend einzusetzen? Genau das ist die „Kunst“, das „Geheimnis“, der „Spielplan“, „die Idee“ von „Abenteuer Filmerlebnis“.
So, vorerst einmal genug mit der Fragerei! Wir gehen ins Kino, um uns zu unterhalten. Filme sollen uns interessieren, amüsieren, berühren, faszinieren und, z.B. bei Dokumentarfilmen, Wissen vermitteln. Sie können uns cineastisch herausfordern. Ein Kinobesuch ist eine gute Gelegenheit, sich mit Freunden zu treffen. Anschließend können wir über Filme diskutieren, sie erzählen, unsere Wahrnehmungen und Eindrücke austauschen. Das alles und noch vieles mehr machen wir, wenn wir Filme-Ansehen. Das ist gut so und soll genau so bleiben. Als Ergänzung dazu bietet das ^IAbenteuerspiel Filmerlebnis eine spannende, neue Ebene, Filme jeden Genres zu genießen.
Filme und Kinobesuche können ein Leben verändern. Alle, die schon einmal den Kinosaal als zwei Singles betreten- und als Liebespaar verlassen haben, wissen das.
Erfahrungsbericht
Eine berührende Episode erzählte mir ein Vater in der Pause eines Seminars, als ich von diesem Buchprojekt erzählte. Er nahm mich zur Seite und sagte: „Aufgrund schwieriger Umstände habe ich meinen Sohn über zehn Jahre lang nicht gesehen. Es gab keinen Kontakt zwischen uns. Als er sechzehn Jahre alt war, sahen wir uns das erste Mal wieder.
Ich hatte ein kleines Kind in Erinnerung. Nun saß mir ein pubertierender Jugendlicher gegenüber. Wir waren uns völlig fremd. Wir hatten vollkommen divergierende Interessen, keine gemeinsamen Hobbys. Wir wussten nicht, worüber wir reden sollten. Von der Musik und den Gruppen, die er erwähnte, hatte ich noch nie etwas gehört. Nichts schien uns zu verbinden. Da stellte sich heraus, dass er zufällig denselben Film wie ich in der Vorwoche im Kino angesehen hatte. Das Eis war gebrochen. Ehe wir uns versahen, waren die nächsten beiden Stunden vergangen. Wir hatten angeregt und begeistert über Filme, Kino, Schauspieler usw. geplaudert. Für den nächsten Besuchstermin vereinbarten wir einen gemeinsamen Kinonachmittag. Das war der erfolgreiche Beginn einer neuen Vater-Sohn-Beziehung.“
Er beendete diesen Bericht mit der lächelnden Bemerkung: „Das ist jetzt schon viele Jahre her, aber Filme sind noch immer eines unserer Lieblingsthemen“.
Nun, Filme können uns nicht nur unterhalten, sondern tatsächlich unser Leben beeinflussen und verändern. Zum Guten, wie dieses Beispiel zeigt, zum Schlechten, wenn wir an die verführende Wirkung von Propaganda-Filmen denken. Im Unterschied zu diesen Möglichkeiten nutzen wir Filme bei diesem Abenteuerspiel ausschließlich, um uns selbst etwas besser kennen zu lernen.
Movie-Yoga?
Tav Sparks hat die Idee, durch Filme sich selbst besser kennen zu lernen, Movie-Yoga genannt. „Movie“ ist das englische Wort für Film und wird heutzutage auch im deutschen Sprachgebrauch gelegentlich verwendet. Yoga ist ursprünglich ein Wort aus dem indischen Sanskrit und bezeichnet „einen Weg zur Selbsterkenntnis“. Im Westen verbinden wir mit Yoga eher mehr oder weniger komplizierte Formen von „Turnübungen“.
Unter Yogi stellen wir uns meist erleuchtete, indische Männer mit wallendem weißen Rauschebart und verklärtem Blick vor, die uns von Plakaten freundlich anlächeln und zu einem kostengünstigen Meditationsseminar einladen. Tatsächlich sind Yogi jedoch Frauen und Männer, die einen Weg der Selbsterkenntnis beschreiten. Movie-Yoga kann daher übersetzt werden als: „Der Weg zur Selbsterkenntnis durch Filme“. Wir als Übende dieses Weges sind dann Abenteuerspieler. Yoga wird auch gelegentlich übersetzt mit: Übung, Übungssystem.
Ich habe Movie-Yoga bei einem mehrtägigen Seminar bei Tav Sparks kennengelernt. Tav Sparks hat Movie-Yoga als Methode entwickelt. Bei besagtem Seminar stellte Tav sein Movie-Yoga uns Teilnehmern vor. Ich war sofort begeistert.
Nicht nur, dass ich fast alle Filme, von denen er Ausschnitte zeigte, kannte und etliche zu meinen Favoriten zählen, nein, ich erkannte, dass ich auch schon lange ein Abenteuerspieler war, es war mir nur noch nicht bewusst gewesen.
Nun, ich vermute einmal, dass es auch einige unter euch Leserinnen und Lesern geben wird, die möglicherweise erkennen, dass sie schon lange Abenteuerspieler sind, zur Erinnerung, Abenteuerspieler können jedes Geschlecht haben.
Anmerkung
Im Buch verwende ich gelegentlich die Ansprache Leserinnen und Leser oder das große Binnen I. Meistens aber schreibe ich einfach Leser oder auch Leserin alleine, ohne das andere Geschlecht mitzubenennen.
Es sind dabei natürlich immer alle, die das möchten, angesprochen. Im Übrigen stecken ohnehin in jeder Frau auch männliche Anteile und in jedem Mann weibliche. Darüber hinaus erlaube ich mir als Autor die ehrenwerte Leserschaft mit Du anzusprechen, schließlich sind wir alle Gefährten auf dem Weg.
TIPP Hier vorab schon einmal zwei Tipps zum Lesen des Buches. Wenn ein Filmtitel erwähnt wird, den Du noch nicht kennst und Du beabsichtigst Dir den Film anzusehen, überspringe einfach die entsprechende Passage. So werden keine Inhalte verraten, die Deinen Filmgenuss schmälern könnten. Wann immer ein Film beschrieben wird, den Du nicht kennst, so versuche ihn durch einen von Deinen Filmen zu „ersetzen“, einfach indem Du das Gesagte auf einen Dir bekannten Film überträgst. Darauf werde ich noch zu sprechen kommen.
Das Abenteuer Filmerlebnis ein Spiel?
Wie Tav Sparks Movie-Yoga, so bezeichne auch ich das Abenteuer der Selbsterkennung beim Filme genießen als „Spiel“. Wie im Film „The Game“ kann und soll dabei aus einem „Spiel“ durchaus „Ernst“ werden. In diesem Film bekommt Michael Douglas von seinem Filmbruder ein Spiel zu seinem achtundvierzigsten Geburtstag geschenkt, um ihn davor zu bewahren „ein ausgesprochenes Arschloch zu werden“.
Mit der Zeit kann Michael Douglas immer weniger zwischen Realität und Spiel unterscheiden. Das sogenannte Spiel wird immer gefährlicher, schlussendlich lebensbedrohlich. Letzten Endes fallen beide Ebenen für ihn auf tragische Weise zusammen und er glaubt, eine geliebte Person erschossen zu haben, weil er irrtümlich dachte, er habe das Spiel durchschaut. Das ganze Spiel ist für ihn eine sehr harte, nicht zur Nachahmung empfohlene Form von heilsamer Selbsterfahrung. Natürlich mit „Happy End“ à la Hollywood.
Auch beim Abenteuerspiel Filmerlebnis streben wir, als Bereicherung und Intensivierung unseres Lebens, ein „Happy End“ an. Doch werden wir dabei weder bedroht, noch laufen wir Gefahr, Realität und Phantasie zu verwechseln, wie in dem Film „The Game“. Wir werden zwischen Innen- und Außenwelt unterscheiden und unsere angeborenen Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit und Bewusstheit eines echten Abenteuerspieler nützen. Davon gleich mehr.
Um das Abenteuerspiel Filmerlebnis spielen zu können, benötigen wir das Basisspiel. Das ist die Voraussetzungen und enthält alle notwendigen Teile. Dann gibt es einige Spielerweiterungen. Diese Erweiterungssets können beliebig mit dem Basisspiel kombiniert werden. Das Basisspiel ist jedoch für jede Erweiterung notwendig.
Bevor ich aber das Basisspiel und die Erweiterungssets vorstellen werde, noch ein paar prinzipielle Anmerkungen zu diesem Buch und zu Filmen im Allgemeinen.
Tipps zum Lesen dieses Buches
In dem Buch wird in die Basis von Movie-Yoga nach Tav Sparks eingeführt. Dann werden die vom Autor entwickelten Erweiterungssets mit dazu passenden Übungen vorgestellt. Die Spiele-Sets sind auf dem Wissen bedeutender Forscher des Selbst und der menschlichen Seele aufgebaut. Mehr dazu bei den jeweiligen Kapiteln.
In eigens markierten Anmerkungen werde ich gelegentlich theoretische Informationen ein wenig ausführlicher beschreiben, als es für die jeweilige Spielerweiterung notwendig ist.
TIPP Es ist nicht notwendig, diese Theorieteile zu wissen, um Abenteuerspiel Filmerlebnis zu spielen. Sie können problemlos ausgelassen oder zu einem späteren Zeitpunkt nachgelesen werden. Sie sind für jene gedacht, die sich für ein wenig theoretische Hintergrundinformationen interessieren.
Ich werde im Buch auf verschiedene Filme Bezug nehmen. Es handelt sich dabei nicht um meine persönliche „Best-of-Liste“. Vor allem habe ich Filme ausgewählt, die eine gewisse Bekanntheit haben und das jeweilige Thema gut veranschaulichen. Selbstverständlich habe ich sie alle zumindest einmal gesehen. Manche gehören zu meinen absoluten Favoriten und ich werde sie wohl immer wieder mal ansehen. Bei der Auswahl habe ich mich eher an Kassenschlager gehalten, als an sogenannte „künstlerisch wertvolle“ Filme. Für das Abenteuerspiel Filmerlebnis braucht es weder ein bestimmtes Genre, noch eine bestimmte Handlung.
Prinzipiell können wir mit jedem Film spielen, gleichgültig ob Kino-, Fernseh- oder Videoproduktion, Mehrteiler oder Serie. In den Buchbeispielen werde ich mich im Wesentlichen auf Kinofilme beschränken. Dabei werden zu jedem Thema und Kapitel Beispiele von verschiedenen Filmen angeführt. Als „Kunstgriff“ werde ich auf die beiden Trilogien „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ Bezug nehmen. Damit möchte ich veranschaulichen, dass nicht notwendigerweise ein bestimmter Film nur für ein „spezielles Spiele-Set“ geeignet ist, sondern sich mit dem gleichen Film verschiedene Sets spielen lassen.
Wichtig: Um das Buch zu verstehen, ist es nicht notwendig, diese Filme zu kennen oder gesehen zu haben. Schon gar nicht muss man sie oder das Genre mögen.
Filme sind unser „Hilfsmittel“. Sie unterstützen uns zu einer freundlichen Selbsterkenntnis. Nicht der Film „an und für sich“ sondern ausschließlich ob er eine ganz persönliche Reaktion, einen Eindruck auf Dich ausübt, ist von Interesse. Es geht um „Deine Filme“. Da ich als Autor diese natürlich nicht kennen kann und sich die Filmauswahl bei jeder Leserin, bei jedem Leser unterscheidet, sollst Du die Filmbeispiele mit Deinen eigenen ersetzen. Letztendlich kannst nur Du entscheiden, welcher Film für Dich für welches „Spiele-Set“ geeignet ist.
TIPP Wann immer ein Film als Beispiel erwähnt wird, versuche diesen mit einem Film, den Du kennst und möglicherweise magst, auszutauschen. Die Filmsequenzen sollen das Gesagte lediglich verdeutlichen. Versuche sie durch Deine Erinnerungen an Filmausschnitte zu ersetzen. Oft sind dabei erste spontane Einfälle sehr hilfreich. Um diese im Weiterlesen nicht wieder zu vergessen kannst Du sie am Seitenrand im Buch notieren. Somit wird das Buch zu Deinem ganz persönlichen „Spielplan“.
Gelegentlich werden persönliche Erfahrungen als Beispiele angeführt. Sie sollen das Gesagte praktisch veranschaulichen und sind als Erfahrungsbericht betitelt. Sie sind alle in der Ich-Form formuliert. Das bedeutet aber nicht, dass ich, der Autor, diese so erlebt habe. Sie stammen aus Gesprächen mit FreundInnen, KollegInnen und zum Teil KlientInnen aus meiner psychologischen Arbeitspraxis.
Ich habe dabei Details so verändert, dass es unmöglich ist, auf die konkreten Personen rückzuschließen. Wo mir diese Anonymisierung nicht ausreichend zu gelingen schien, habe ich diese Beispiele als allgemeine mögliche Erfahrungen beschrieben. Keinesfalls aber sollen diese Erfahrungsberichte andeuten, dass es wichtig und richtig sei, genau solche Erlebnisse bei diesen Filmen zu haben. Ganz im Gegenteil – das Abenteuer Filmerlebnis ist ein ganz persönliches Spiel. Es geht ausschließlich um Deine ganz individuellen Erfahrungen.
TIPP Wenn Erfahrungsberichte in Dir etwas ansprechen und Dich zum Nachdenken anregen oder eigene Erinnerungen in Dir anklingen, so lege das Buch kurz zur Seite und erlaube Dir, diesen Einfällen nachzugehen. Vielleicht magst Du sie Dir dann kurz am Buchrand zur Erinnerung notieren.
Im Buch werden auch verschiedene Übungen beschrieben. Diese dienen in erster Linie zum besseren Verständnis des jeweiligen Spiele-Sets. Sie sind Anregungen und Variationen von Möglichkeiten, das Abenteuer Filmerlebnis zu spielen. Sie können beliebig ausgelassen oder zu einem späteren Zeitpunkt nachgelesen werden. Solltest Du die eine oder andere Übung ausprobieren, so fühle Dich frei, sie in jeder erdenklichen Richtung abzuändern. Passe sie Deinen persönlichen Bedürfnissen und Deinem Geschmack an.
Es gibt nicht die „EINE richtige Art“ das Abenteuerspiel Filmerlebnis zu praktizieren. Wie gesagt sollen die Übungen vor allem die Idee des jeweiligen Kapitels auf einer praktischen Ebene verdeutlichen.
TIPP Wenn Übungen Dir beim Lesen kompliziert erscheinen oder Dich verwirren, so lass sie aus.
Das Abenteuer Filmerlebnis ist, wie Movie-Yoga, eine freudvolle Form der Selbsterkenntnis. Es kann während der Film läuft ebenso gespielt werden wie im Anschluss daran oder, wie bei den meisten Übungen im Buch, in einem beschaulichen Augenblick.
Ich habe mich bemüht, so wenig psychologisches „Fachchinesisch” wie möglich zu verwenden. Wo immer es mir wichtig erschien, habe ich diese Begriffe beschrieben, wie oben zum Beispiel das Wort Movie-Yoga.
Theorie
Selbsterkenntnis durch Filme, Tav Sparks Movie-Yoga
Movie-Yoga ist eine Methode der Selbsterkenntnis anhand der subjektiven Erfahrung beim Filme-Ansehen und wurde von Tav Sparks entwickelt.
Tav Sparks ist Direktor und Chef Instruktor der internationalen Gesellschaft für Holotrope Atemarbeit (Grof Transpersonal Training GTT) nach Stanislav Grof. Er ist Autor und hat verschiedene Fachbücher veröffentlicht. Die Methode Movie-Yoga ist in dem Werk „Movie Yoga: How Every Film Can Change Your Life“ 2009 veröffentlicht. Tav bietet Seminare zu Movie-Yoga in verschiedenen Ländern an.
Die in diesem Buch erwähnten Ideen und Anleitungshinweise zur Basis von Movie-Yoga, die in den ersten drei Kapiteln als „Basisspiel“ dargelegt werden, haben das Buch von Tav Sparks als Grundlage. Kernstück des Movie-Yoga von Tav Sparks ist die spezielle Movie-Yoga-Haltung und das Arbeiten mit den vier Phasen der Geburtsmatrix nach Stanislav Grof. Diese Ideen zur Geburtsmatrix mit den entsprechenden Filmbeispielen sind seinem Buch entnommen und hier im Kapitel „das Großmeisterset“ ausgeführt.
Alle Ideen der Formulierung von Spiele-Sets (Erweiterungssets) mit dazugehörigen Übungsbeispielen in diesem Buch, sowie das Einbeziehen weiterer psychologischer Modelle in die Spiele-Sets, sind vom Autor entwickelt.
Tav erwähnt in seinem Buch unter anderem die Erkenntnisse von C.G. Jung zu Archetypen und Schatten, sowie die Heldenreise von Joseph Campbell. Sie wurden als Ideen aufgegriffen und als eigene Spiele-Sets in diesem Buch ausgearbeitet.
Der ausgesprochen individuelle Zugang von Movie-Yoga orientiert sich an dem subjektiven Erleben beim Filme-Sehen. Dieser wird auch in diesem Buch vertreten und unterscheidet sich von der Konzeption der Filmtherapie (siehe Otto Teischel 2007). In ihr wird der Fokus auf die Filmdeutung gelegt. Gemeinsam ist allen, das Potential von Filmen für Selbsterkenntnis und zur Unterstützung einer konstruktiven Veränderung des Menschen zu nützen, indem die emotionale Erregung, ausgelöst durch den Film, in einen persönlichen Bezug gesetzt wird.
Zitat Otto Teischel (Seite →): „Das bedeutet, er gibt sich mit jedem Gang ins Kino ganz bewusst einer inszenierten Illusion von Wirklichkeit hin, und so wird es ihn um so mehr überraschen, wenn ihn plötzlich seine eigene dabei einholt. Wie zu einem riesigen Spiegel seines Unbewussten können ihm die Gesichter auf der Leinwand auf einmal werden, und nicht obwohl, sondern weil er sich über die Inszeniertheit im Klaren ist, weiß er zugleich auch, dass die eigene Erregung nicht durch den Film erzeugt wurde (wenn der auch ihr Auslöser war), sondern mit seiner eigenen Geschichte zusammenhängen muss, die der Film in ihm wachgerufen hat.“
Movie-Yoga wird in diesem Buch als ein von Tav Sparks eingeführter Fachbegriff und allgemeiner Überbegriff für einen „Weg, durch Filme zu einem besseren Verständnis von sich selbst zu gelangen“, verwendet und die, die diesen Weg beschreiten, werden in diesem Buch Abenteuerspieler genannt.
Dankenswerter Weise hat Tav sich einverstanden erklärt, dass in diesem Buch der von ihm geprägte Begriff „Movie-Yoga“ verwendet werden darf.
Movie-Yoga
„Eine Organisation intelligenter Leute fürchtet Intelligenz – auf lange Sicht unklug.“
Iron Man in Marvel‘s The Avengers
Frodo: „Dann weiß ich, was ich tun muss. Es ist nur, ich hab solche Angst davor.“
Galadriel: „Selbst der Kleinste vermag den Lauf des Schicksals zu verändern.“
Aus Der Herr der Ringe
„Ich hab da ein verdammt mulmiges Gefühl“
Aus Star Wars
„Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft“
Aus Casablanca
„Probier’s mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit…”
Aus Das Dschungelbuch
„Deine Heimat sind die sanften Hügel und kleinen Flüsse des Auenlandes.
Aber Daheim verblasst. Und die Welt rückt nah.”
Aus Der Hobbit
„Bereit, wenn Sie es sind“
Dr. Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer
Selbst dem „härtesten Kerl“, der „taffsten Frau“ sind wohl schon mal die Tränen oder zumindest feuchte Augen bei gewissen Filmszenen gekommen. Gefühle sind die perfekte Basis für Movie-Yoga. Da mögen einem die Augen wässrig werden, wenn im Actionspektakel das Traumauto geschrottet wird, während andere das nur nervend finden. Der eine mag vor Langeweile fast einschlafen, wenn Leonardo DiCaprio in „Titanic“ langsam, seine Liebe rettend, in den Tiefen des Meeres versinkt, wo andere zutiefst berührt still weinen. Langeweile und Trauer sind starke Gefühle und gut für das Abenteuerspiel Filmerlebnis geeignet.
Das Basisspiel besteht nun aus zwei leicht einzuübenden Punkten des Movie-Yoga. Zuallererst müssen wir unsere Gefühle bewusst wahrnehmen, um sie nicht gleich wieder zu vergessen oder zu verdrängen. Dann brauchen wir eine bestimmte Vorgehensweise, wie wir mit diesen Gefühlen „umgehen“. Klingt vielleicht im Moment etwas kompliziert, ist aber mit ein wenig Übung doch einfach.
Das bewusste Aufmerksamkeits-Positionierungs-System APS
Mit unserer Aufmerksamkeit können wir bewusst steuern, was wir in unserer Umgebung wahrnehmen und uns daher eher in Erinnerung bleibt. Wer schon mal frisch verliebt im Kino gesessen ist und nur Augen für die Geliebte im Arm hatte und ans Küssen dachte, kann dabei schon mal die ganze Filmhandlung verpassen. Plötzlich geht das Licht an, der Abspann wird abgespult und eben hatte doch erst die Vorschau begonnen. Die Zeit verging wie im Flug. Frisch verliebt zu sein ist vielleicht keine so gute Voraussetzung um das Abenteuerspiel Filmerlebnis zu spielen.
Wenn wir unsere Gefühle runterschlucken, vor uns und anderen verstecken, nicht zulassen oder vergessen, sind sie für uns Abenteuerspieler verloren. Wohl gemerkt, wir reden hier ausschließlich von Gefühlen, die bei gewissen Szenen nun einmal da sind. Genau das sind die Gefühle, die wir für das Spiel brauchen. Nichts künstlich Gemachtes, Übertriebenes oder Vorgespieltes. Prinzipiell eignen sich alle Formen von Gefühlen wie Freude, Angst, Entsetzen, Hoffnung, Liebe, Hass, Ärger, Trauer, Berührt-Sein, Abscheu, Spaß oder Langeweile. Letzteres ist wohl eher für fortgeschrittene Spielerinnenn .
Um unsere Gefühle wahrzunehmen, brauchen wir nichts weiter zu tun, als unser Bewusstsein in den Modus „Ich registriere, was in mir vorgeht“ zu bringen. Tav Sparks spricht vom „Bewusstseins/Aufmerksamkeits-Positionierungs-System APS“ (im englischen Original: Awareness Positioning System). Wir brauchen lediglich unser APS online zu schalten und weiter den Film zu genießen.
In diesem Bewusstseinszustand, sei es „live“ während des Filmes oder danach in der Erinnerung, werden wir bemerken, dass manche Filme, bestimmte Themen, Szenen, Dialoge oder andere Elemente von Filmen uns besser im Gedächtnis bleiben und emotionale Reaktionen in uns aktivieren. Alle diese Elemente sind für das Abenteuerspiel Filmerlebnis geeignet. In den „Erweiterungssets“ werden wir diese näher kennen lernen.
Für das Basisspiel und damit ganz allgemein für Movie-Yoga und das Abenteuerspiel Filmerlebnis brauchen wir neben dem APS-Bewusstseinszustand auch eine bestimmte Haltung, eine spezifische Einstellung, wie wir mit den an uns beobachteten Regungen umgehen. Ganz allgemein: freundlich und verständnisvoll. Schließlich sind wir es, um die es hier geht.
Normalerweise geben wir „den Umständen“, den Dingen, die da draußen um uns sind, die Schuld dafür, wie wir uns fühlen. So mag der „harte Kerl“ uns erklären, dass er Liebesfilme langweilig findet, den DiCaprio als Schauspieler nicht mag, die Dialoge platt sind, der Filmschnitt langatmig und das Ende vorhersehbar ist. Letzteres ist bei „Titanic“ auch nicht wirklich überraschend. Diese Haltung nennen wir Außenposition oder horizontale Perspektive, im Unterschied zur Innenposition oder vertikalen Perspektive.
Dieser Unterschied ist vielleicht nicht ganz einfach, aber absolut wesentlich für Movie-Yoga und um das Abenteuerspiel Filmerlebnis zu verstehen und spielen zu können.
Die Innenperspektive ist ein radikaler Positionswechsel weg von der Frage: „Was macht mich (da draußen) ärgerlich, ängstlich, traurig, was auch immer …“ hin zu: „Was ist in mir, dass ich so fühle?“ Vom „was macht es mit mir hin zum was mache ich mit mir“. Wir suchen somit die Antworten auf unsere Fragen, warum wir so und so auf den Film reagieren in uns selbst. Ganz nebenbei erfahren wir so etwas über uns selbst. So hatte der „harte Kerl“, bevor er ganz hart wurde, eine unglückliche Liebesbeziehung. Obwohl er sehr um die Liebe gekämpft hatte und viel von sich dafür geopfert hatte, verließ sie ihn, nachdem sie ein Verhältnis mit seinem damals besten Freund einging.
Wechselt unser „harter Kerl“ in die vertikale Innenperspektive, so wird er diesen Zusammenhang erkennen. Er wird den Mechanismus durchschauen, wie er sich mit dem Gefühl von Langeweile immunisiert hat, um nicht an die Trauer der damaligen Ereignisse erinnert zu werden. Dabei bemerkt er, dass er nicht nur dem Gefühl von Trauer in den letzten Jahren aus dem Weg gegangen ist. Auch seine Fähigkeit, sich berühren zu lassen und mitzufühlen, hat darunter gelitten. Diese Erkenntnis macht den DiCaprio für ihn nicht zu einem besseren Schauspieler. Seine Kritik am Film „Titanic“ bleibt möglicherweise bestehen. Die Dialoge sind für ihn immer noch platt, der Filmschnitt langatmig und das Ende vorhersehbar. Dennoch hat er durch die Innenperspektive etwas Wesentliches über sich erfahren und damit ein Stück mehr Freiheit erlangt, durch die Möglichkeit, das Vergangene nun besser ruhen lassen zu können, um in der Gegenwart genussvoller (mit allen Gefühlen) zu leben.
Wenn wir Filme voll und ganz genießen wollen, sind beide Perspektiven wichtig, die innere-vertikale und die äußere-horizontale. Wenn wir Antworten auf unsere Fragen suchen, macht es doch manchmal Sinn, von der Außenperspektive „jenseits des Horizonts“ zur Innenperspektive zu wechseln, einem „in mir selbst“, vertikal aufgespannt zwischen Himmel und Erde. In „Die unendliche Geschichte“, der Verfilmung des Romans von Michael Ende, erleben wir den radikalen Perspektivenwechsel, wenn wir mit Bastian nach Phantasien gelangen und so mitten in der Geschichte Teil der Geschichte werden.
Humorvoll erleben wir den Perspektivenwechsel in der Actionparodie „Last Action Hero“. Der elfjährige Danny erhält eine Zaubereintrittskarte. Der Besitzer dieser Karte kann zwischen Film- und Realwelt hin und her wechseln. Das führt zu einem unterhaltsamen Spektakel, wenn Arnold Schwarzenegger in der Filmwelt den Helden Jack Slater und in der Realwelt sich selbst spielt.
Theorie
In der Psychologie wird in diesem Zusammenhang von Ursachenzuschreibung bzw. Attribution gesprochen. Dabei wird zwischen interner (vertikal) und externer (horizontal) Ursachenzuschreibung unterschieden. Psychologinnen gehen dabei der Frage nach, inwieweit sich Menschen für ihre Motive, Wünsche, Handlungen, Gedenken und Gefühle intern (sich selbst) oder extern (andere) verantwortlich machen.
Intern: Bedeutet, dass Menschen Ursachen ihren Fähigkeiten, ihrem freien Willen, ihrer Selbstwirksamkeit, Absicht und Eigenverantwortung zuschreiben.
Extern: Bedeutet, dass andere Personen oder äußere Umstände Schuld und Verursacher sind. Die eigenen Verhaltensweisen werden „nur“ als „Reaktionen“ auf die anderen, die äußeren Bedingungen, die Politik, das Schicksal, das Wetter oder die Sternenkonstellation aufgefasst.
Des Weiteren wird untersucht, in welchen Fällen welche Art von Attribution förderlich ist, um Ziele zu erreichen und Gesundheit und Wohlbefinden zu erlangen.
MERKE Die Basis von Movie-Yoga nach Tav Sparks setzt sich aus zwei Elementen zusammen:
A
Der spezielle Bewusstseinszustand APS (Aufmerksamkeits-Positionierungs-System), in dem wir absichtsvoll wahrnehmen, was so alles in uns vorgeht.
B
Die vertikale innere Haltung, das ist die Einstellung, unter der wir unsere Wahrnehmungen über uns selbst betrachten.
Auf das Basisspiel wird später noch ausführlicher eingegangen.
Empfohlenes Spielealter: 0-99 Jahre, 1-99 Spieler, 1-99 Minuten
Das Abenteuer Filmerlebnis ist ein Spiel, das alleine oder mit beliebig vielen Mitspielern möglich ist. Die Angabe 1-99 Spieler ist aber etwas irreführend. Prinzipiell ist es in diesem Buch für Einzelspieler konzipiert. Alle Spiele-Sets und fast alle Übungen dazu können allein gespielt werden. Es geht ja dabei um uns selbst, um uns ganz persönlich. Sollten Übungen mit mehreren Menschen beabsichtigt sein, so empfiehlt es sich, nur in kleinen Gruppen oder zu zweit und nur mit ausgewählten, vertrauten Menschen zu spielen.
Prinzipiell ist das Abenteuerspiel Filmerlebnis, so wie in diesem Buch beschrieben, für Erwachsene gedacht. Kinder, vor allem kleine Kinder, sehen Filme ohnehin im Abenteuerspieler-Modus. Sie reagieren hoch emotional auf die Inhalte, die sie sehen. Das ist auch der Grund, warum Kinder entweder von Erwachsenen begleitet oder zumindest mit der anschließenden Unterstützung von Erwachsenen, Filme betrachten sollen.
Vielleicht erinnerst Du Dich noch, wie leicht es in der Kindheit war, sich ganz in den Filmen zu verlieren und mit den Helden mit zu leben. Im letzten Kapitel sind einige spezielle Sets zum Spielen mit Kindern angeführt.
Erfahrungsbericht
In meiner Kindheit war ich ganz verliebt in die Tarzan-Filme, mit Lex Barker und Johnny Weissmüller in der Hauptrolle. Tarzan scheint eine ideale Identifikationsfigur für Kinder zu sein. Er klettert auf Bäumen herum und spricht Kleinkindsprache in Zwei- bis Dreiwortsätzen. Am liebsten unterhält er sich in unartikulierten Grunzlauten mit Tieren.
In gewisser Weise ist er der erste Öko-Superheld, ein „Dr. Dolittle“ mit Superkräften, der für das Gute kämpft und siegt. An zwei Szenen kann ich mich heute noch erinnern. Einmal soll Tarzan geimpft werden. Er zuckt vor der Spritze, die er nicht kennt, erschrocken zurück. Das hat mir total gefallen. Dieser Riese von Muskelmann fürchtet sich wie ich kleiner Junge vor der Impfung.
Die andere legendäre Szene ist, als Tarzan sprechen lernt. Er spricht seinen Namen holprig aus in dem epochalen Dialog: „Ich Tarzan – du Jane.“ „Ich Jane – du Tarzan“. Am meisten aber faszinierte mich der Tarzan-Schrei. Nach den Filmen hüpfte ich minutenlang auf den Polstermöbeln herum und schrie aus voller Kehle den Tarzan-Schrei. Selbst wenn wir bei Verwandten oder Freunden auf Besuch waren, ließ ich von diesem Verhalten nicht ab, was meinen Eltern mitunter wenig Freude bereitete.
Mit der Zeit rückt diese kindliche Fähigkeit, ganz in Filmen „aufzugehen“, in den Hintergrund. Andere Aspekte eines Filmes werden wichtiger. Davon gleich mehr. Mit mit dem Abenteuerspiel wollen wir an dieser „alten“ Kunst, die wir alle einmal schon beherrscht haben, wieder anknüpfen.
Über die Kunst Filme zu sehen
Es gibt wohl unendlich viele unterschiedliche Motive, einen Film anzusehen. Langeweile, Zeitvertreib, um mitreden zu können und dazuzugehören, um zu kritisieren, sich zu amüsieren, aus Freude oder was auch immer. Wir werden wohl alle schon die eine oder andere dieser Möglichkeiten erlebt haben. Wollen wir einen Film aber wirklich „sehen“, im Sinne von Avatar: „Ich sehe Dich“, lassen sich drei prinzipielle Zugänge unterscheiden:
Extern-horizontal cineastisch
Frei schwebend, unvoreingenommen-offen
Intern-vertikal als Abenteuerspieler
Die horizontale Kunst Filme zu sehen
Das ist eine sehr schöne Kunst, wo wir ganz in das Metier Film, mit all seiner Faszination und Schönheit, eintauchen.
Hier sind wir ganz im Außen orientiert und dieses Außen ist der Film. Wir betrachten ihn mit den Augen des Cineasten, des Kenners, Kritikers, Genre-Liebhabers usw. Es ist das Kunstwerk Film, das uns interessiert. In diesen Kategorien werden die Oskars vergeben, die schlechtesten Filme aller Zeiten gekürt und Kritiken geschrieben. Hier versuchen wir möglichst „objektiv“ und sachlich zu urteilen und zu vergleichen. Schnitt, Regie, Licht, szenische und literarische Umsetzung von Vorlagen werden analysiert und sind Basis unserer Beurteilung. Natürlich gibt es auch hier einen Bereich, in dem uns Filme ganz persönlich ansprechen, schauspielerische Leistungen, Musik und Dialoge subjektiv beeindrucken. Dennoch ist in dieser Haltung unsere ganze Aufmerksamkeit auf das Außen des Filmes gerichtet.
Erfahrungsbericht
Während des Studiums belegte ich ein Seminar zur Schulung der Aufmerksamkeit. Dabei sahen wir uns alte Filme, vor allem Western mit John Wayne u.a. an. Unsere Aufgabe war es, in den Kulissen Steckdosen und Gegenstände zu entdecken, die es zur Zeit des „Wilden Westen“ noch gar nicht gegeben hatte. Ebenso sollten wir Regiefehler entdecken, wenn Kleidungen in einer Handlungsszene plötzlich wechselten, Verbände die Seiten tauschten, Frisuren sich auf wundersame Weise änderten und Ähnliches mehr.
Es war erstaunlich, dass wir selbst in den berühmtesten Klassikern, die mit viel Aufwand und Geld produziert worden waren, jede Menge dieser Fehler fanden. Besonders beeindruckt war ich auch von einem ganz anderen Effekt. Viele Filme hatte ich zuvor schon gesehen, ohne dass mir je einer der Fehler aufgefallen wäre. Hatte ich aber einmal diese Fehler erkannt, so sprangen sie mir buchstäblich immer wieder ins Auge. Ich konnte sie gar nicht mehr übersehen.
Die Kunst der offenen Unvoreingenommenheit
Dies ist eine wohl häufig praktizierte Kunst mit dem Vorteil, uns ganz dem Film zu überlassen. Wo auch immer der Film uns hinführen mag, zu cineastischen Freuden, verzückender Schönheit, faszinierendem Interesse oder völliger Fesselung durch die Handlung, wir lassen es auf uns zukommen und geschehen.
Wer jemals schon ärgerlich das Kino verließ, weil sich der angekündigte Superknüller als nicht enden wollender Langweiler entpuppte, weiß, dass diese offene Haltung nicht immer von Freuden und Erfolg gekrönt ist. Das ist wohl das „Berufsrisiko“ des Cineasten.
Prinzipiell ist diese Einstellung frei schwebender Aufmerksamkeit für das Abenteuerspiel Filmerlebnis gut geeignet. Voraussetzung ist, dass wir bereit sind, einen allfälligen Wechsel vom horizontalen äußeren, in den vertikalen inneren Modus uns selbst zu erlauben.
Erfahrungsbericht
Ich hatte mir den Film „The Crow“ nur angesehen, weil der Sohn von Bruce Lee, Brandon bei den Dreharbeiten verstorben ist. Bruce Lee war mein Kindheitsidol. Sehr ungewöhnlich für ein Mädchen, zur damaligen Zeit jedenfalls. Es war so eine Art Tribut an meinen Kung Fu Helden. Ich hatte keinerlei Erwartungen an den Film und diese wurden genau so auch voll und ganz erfüllt. Der Plot ist in einem Satz erzählt. Junger Mann wird ermordet, kommt als Untoter zurück und rächt sich blutig. Dennoch blieb mir eine Szene lebhaft in Erinnerung. Der Held begegnet einem Mädchen, mit dem er zu seinen Lebzeiten befreundet war. Das Mädchen ist nunmehr in der Pubertät auf dem besten Weg, auf die schiefe Bahn zu geraten. Ihre drogenabhängige Mutter kümmert sich nicht um sie, sondern ist ganz mit sich selbst beschäftigt. In besagter Szene zwingt der Protagonist die Mutter in einen Spiegel zu blicken und sich darin selbst zu erkennen. Dabei hält er sie am Unterarm fest und presst ihr aus den Nadeleinstichstellen das Rauschgift aus ihrem Körper. Er spricht den Satz, den ich bis heute nicht vergessen sollte: „Mutter ist der Name für Gott auf den Lippen und in den Herzen aller Kinder dieser Welt“.
Ich machte mir nie Gedanken darüber, warum mir gerade diese Sequenz und dieser Satz so gut im Gedächtnis blieben. Bis ich von Movie-Yoga hörte. Als ich mit dieser Methode in mich hinein spürte, bemerkte ich ein deutliches Gefühl von Berührtheit. Dieser Emotion folgend, vergegenwärtigte sich das Bild meiner Mutter. Ich erkannte meinen Wunsch, dass auch sie einmal in ihrem Leben die Kraft gehabt hätte, sich im Spiegel zu erkennen. Als ich weiter diesem Empfinden nachging bemerkte ich, dass ich sehr traurig wurde. Ich spüre ein kleines Mädchen in mir und seine große Sehnsucht, dass auch meiner Mutter durch einen dunklen Engel ihr Gift der Depression ausgesaugt würde. Ich sah vor meinem inneren Auge die Filmszene und gleichzeitig mich als kleines Mädchen. Da wurde mir bewusst, dass dieses Mädchen absolut und vorbehaltlos bereit gewesen wäre, mit seiner Mutter zu tauschen, ihr Schicksal zu tragen. Sie hätte ihr Leben gegeben, wenn die Mutter so wieder ihre Lebendigkeit und Lebensfreude erlangt hätte. Ich spürte diese unendliche Liebe dieses kleinen Mädchens in mir, aber auch die heute erwachsene Frau, die diese Zusammenhänge erkennt.
Mir wurde die tiefe Triebfeder meiner Berufswahl, Ärztin zu werden, bewusst. Es war der letzte Versuch, doch noch die Fähigkeit zu erlangen, meine Mutter von ihrer Krankheit heilen zu können, obwohl sie zu Beginn meines Studiums schon ein paar Jahre verstorben war. Diese Erkenntnis war für mich sehr erleichternd. Es änderte nichts daran, dass ich meinen Beruf mag und gerne ausübe. Vielleicht jetzt sogar ein bisschen freier, weil die Kleine in mir nun getrost die Arbeit ganz der Großen überlassen kann.
Die vertikale Kunst Filme zu sehen
Hier sind wir endgültig im Reich des Movie-Yoga und des Abenteuerspiels Filmerlebnis angekommen. Movie-Yoga bedeutet, sich absichtsvoll auf den inneren Prozess, den der Film in mir ermöglicht, einzulassen. Es ist diese spezielle Haltung gegenüber dem Film und der Einstellung mir selbst gegenüber: Mich vom Film berühren zu lassen und diese Berührung vorbehaltlos und ausschließlich unter dem Blickwinkel meines Selbst zu betrachten. Dieser Prozess wird als Bewusstseinszustand APS (Aufmerksamkeits-Positionierungs-System) und der vertikalen inneren Haltung bezeichnet.
Wir nehmen aufmerksam alle unsere Regungen wahr, was auch immer in uns an Gefühlen, Gedanken, Handlungsimpulsen, Phantasien, Wünschen usw. angeregt wird. Doch statt, wie sonst oft üblich, die „Schuld“ für diese Regungen dem Film zu überantworten, nehmen wir die vertikale innere Perspektive ein und fragen uns: Was ist in mir, dass ich gerade jetzt auf diesen äußeren Film innerlich so reagiere? Was in mir lässt mich so fühlen, denken, wünschen usw.?
Dieser Perspektivenwechsel braucht Übung. Vor allem, weil die meisten Menschen täglich eher die horizontale Weltsicht üben. Der hat mir den Vorrang genommen > darum bin ich ärgerlich. Der hat mich ungerecht behandelt > darum bin ich verletzt. Der hat mir gedroht > darum fürchte ich mich usw. Wir kennen diese Perspektive in der Regel sehr gut. Meist reagieren wir automatisch so, ohne lang darüber nachzudenken. Als Abenteuerspieler können wir als Ergänzung dazu die innere Sicht der Dinge üben. Mit etwas Erfahrung werden wir erkennen, dass diese Innenperspektive uns nicht nur mehr über uns selbst wissen lässt, sondern dass wir damit auch weniger „Opfer“ der äußeren Umstände werden. So können Movie-Yoga und das Abenteuerspiel Filmerlebnis dazu beitragen, dass diese Innenperspektive eine wichtige und hilfreiche Vervollständigung für unser Leben wird.
In dem Film „O Brother, Where Art Thou?“ befinden sich drei liebenswerte Kleinkriminelle nach einem Gefängnisausbruch auf der Flucht. Ziel ihrer Odyssee, die sie quer durch Mississippi des Jahres 1937 führt, ist ein Schatz, Beute eines letzten Raubzuges. Getrieben von der Hoffnung auf Glück durch äußeren Reichtum stolpern sie von einer prekären Situation in die nächste. Dabei entdecken sie ihren inneren Schatz in ihrer Fähigkeit und Liebe zur Musik. Letztendlich ist es dieser innere Schatz, der ihnen das Leben rettet und ein Happy End ermöglicht.
Wir stehen somit vor der bedeutsamen Frage: Wo suchen wir unser Glück? Im Innen oder Außen?
Erfahrungsbericht
Normalerweise lasse ich mich von Filmen überraschen. Ich vermeide es Kritiken und Bewertungen vorab zu lesen, um möglichst unvoreingenommen zu sehen, wohin mich der Film trägt. Bei diesem Film will ich es aber anders. Ich kenne schon eine Arbeit dieser Filmemacher und das besondere Genre („Baraka – Eine Welt jenseits der Worte“). Es gibt nur Musik und Bilder, keine Dialoge oder Kommentare, kein gesprochenes Wort. Ich zelebriere die Vorbereitungen richtig. Ich schließe den Blu-Ray Player an meine Stereoanlage an, positioniere Beamer und Leinwand. Handy ausschalten, kein Popcorn, keine Getränke, nichts solle den Filmgenuss schmälern, mich vom Film ablenken.
Die folgenden zwei Stunden gehören ganz mir. Nichts wird mich daran hindern, ganz in dem Film „aufzugehen“. Ich stelle mich voll darauf ein, mich von der Musik und den Bildern berühren und verführen zu lassen.
Der Film heißt „Samsara“ von Ron Fricke. Ein experimenteller Dokumentarfilm ohne Dialoge, ausschließlich Bilder und Musik. Das Wort Samsara bedeutet beständiges Wandern, der Kreislauf von Wandlung, Entstehen und Vergehen. Es gibt eine schöne Dokumentation von Werner Herzog mit dem Titel „Rad der Zeit“, wo er das Samsara-Ritual, wie es der Dalai Lama ausführt, beschreibt.
Ich versinke in meiner Couch im Rausch der Musik und Bilder. Ich lasse mich in Höhen und Tiefen unseres Mensch-Seins tragen, von überwältigender Schönheit und Vergänglichkeit. Einfach umwerfend. Am Ende des Filmes bleibe ich noch minutenlang in der Stille und Dunkelheit sitzen, mich ganz meinen Gefühlen hingebend. Der Film hat eine Seite in mir zum Leben erweckt, berührt und anklingen lassen, die ich sonst im Alltag doch eher verborgen halte.
Was Filme mit uns machen
Wir sitzen im Kino oder zuhause vorm Bildschirm, ausgerüstet mit einem „Überlebenspaket“, bestehend aus Getränken und Naschereien, versinken bequem im Sessel und tauchen für die nächsten anderthalb Stunden in eine andere Welt ein. Obwohl wir genau wissen, dass alles „nur ein Film“ ist, Schauspieler, die dafür bezahlt werden, vorgegebene Rollen zu spielen, alles nicht „echt“ ist, weder Menschen noch Tiere „real“ leiden oder zu Tode kommen und alles „nur Fake“ ist, „fesseln“ uns gute Filme emotional.
Wir hoffen, befürchten, sind entsetzt und erregt, aufgewühlt, verärgert, hassen und lieben, lachen und weinen, freuen uns – und – und – und … Die ganze Gefühlspalette kann in uns angesprochen werden. Wie kommt es, dass manche Menschen im Kino mehr Gefühle zeigen als im täglichen Leben? Wie kommt es, dass wir uns, wider besseres Wissens, (ist ja alles nur gespielt), emotional von Filmen so beeinflussen lassen? Warum leben wir mit Helden mit, selbst wenn sie nicht einmal Menschen sind, sondern Animationen wie in „Avatar“, reine Fantasieprojekte wie in „Der Herr der Ringe“? Das Fachwort für diesen Vorgang heißt Identifikation. Wir identifizieren uns mit Elementen aus Filmen, gerade das macht sie für uns so sehenswert und für das Abenteuerspiel Filmerlebnis so wertvoll.
Theorie
Identifikation bedeutet in der Psychologie gleichsetzen, zu Meinem machen. Das beschreibt einen Vorgang, indem Teile des Anderen als eigene erkannt werden und dadurch wie das Eigene erlebt werden. Häufig handelt es sich dabei um Gefühle. Ich erkenne die Gefühle, die mein Gegenüber, zum Beispiel der Filmheld, erlebt, auch in mir und setze meine Gefühle mit denen, die der Filmheld soeben erlebt, gleich. Ich identifiziere mich mit ihm und erlebe seine Gefühle mit.
Dieser Vorgang läuft teilweise bewusst, zum Großteil aber unbewusst ab. Einfühlungsvermögen und Feinfühligkeit, zwei menschliche Fähigkeiten, spielen dabei eine Rolle. Nicht nur Gefühle eignen sich zur Identifikation. Handlungen, Situationen, Aussehen, gemeinsame Erfahrungen und Lebensgeschichten sind ebenso Basis für Identifikation. Schauspieler identifizieren sich mit ihrer Rolle. Sie füllen diese ganz aus, werden sozusagen zu dieser gespielten Figur. Für den Zuseher ist es nicht mehr unterscheidbar ob sie die Rolle „spielen oder tatsächlich sind“.
Wir können uns auch mit Landschaften, Gegenständen oder Objekten identifizieren, zum Beispiel mit der Firma, in der wir arbeiten. Ebenso können wir uns mit Gemeinschaften, politischen oder religiösen Systemen und kulturellen Strömungen identifizieren. Somit unterscheidet sich das psychologische Identifizieren als ein „Gleichsetzen mit mir“ vom umgangssprachlichen Identifizieren als Erkennen, Bestimmen und Zuordnen ein wenig.
Wir identifizieren uns teilweise bewusst, zum Großteil aber unbewusst mit Inhalten und Figuren des Filmes. Je mehr wir uns identifizieren, desto mehr wird der Film uns ansprechen, eine Wirkung auf uns ausüben und uns in Erinnerung bleiben, desto eher werden wir ihn weiterempfehlen oder nochmals anschauen.
Regisseure wissen das. Darum verlangen sie von ihren Schauspielern ihre Rolle so glaubwürdig wie möglich zu spielen. Sie versuchen die Handlungen, Dialoge und Szenen so zu gestalten, dass wir Zuseher uns einfühlen und mitfühlen können. Blickwinkel, Licht, Geräusche und vor allem die Musik sollen das unterstützen. Schon die Filmmusik „sagt“ uns, wie wir uns fühlen sollen, ob Spannung, Freude, Angst, Entsetzen, Erleichterung oder Entspannung und Sicherheit in dieser Szene zu erleben sind.
Wie zum Beispiel die Flügerl am Helm des Asterix, der beliebten Comicfigur. Flügel nach unten bedeutet traurig, niedergeschlagen, Flügerl steif nach oben steht für heldenhaft, mutig, wackeln die Flügerl, so heißt das freudig, erregt usw. Im Film ist es die Musik, die uns Auskunft über Gemütsverfassung und Gefühlslage vermittelt. Fröhliche Musik kann problemlos die spannendste Szene zur Satire machen und umgekehrt, dramatische Musik verwandelt fröhliche, harmlose Szenen in Psychoschocker.
Erfahrungsbericht
Während des Studiums hatten wir ein Seminar zur Schulung unserer Aufmerksamkeit (wie bereits oben erwähnt). Eines Tages wurden uns zu ausgewählten Szenen ganz verschiedene Musikthemen als Untermalung vorgespielt. Der Effekt war sehr beeindruckend. Die immer gleiche Szene wirkte durch die jeweils andere Musik ängstigend, verstörend, belustigend, ja selbst langweilig.
Das war eine bemerkenswerte Veranschaulichung der verschiedenen Möglichkeiten durch bewussten Einsatz von Filmmusik. Eine Kollegin hat dieses Wissen gleich praktisch umgesetzt. Sie machte es sich zur Angewohnheit, bei ängstigenden Szenen einfach den Ton wegzuschalten. Und siehe da! Sogleich ist alles viel weniger gruselig!
Mit einer kleinen Versuchsanordnung kann die Wirkung der Musik im Film experimentell auch zu Hause erforscht werden. Eine bestimmte Szene aussuchen, am besten von einem Film den Du noch nicht kennst, den Ton abschalten und dann nacheinander verschiedene Musikuntermalungen zugleich mit dieser Szene abspielen.
Regisseure setzen alles ein, um uns in den Film, die Handlung und die Figuren zu locken. Wir gehen ins Kino, um uns verführen zu lassen.
Wie bereits angedeutet, erfolgt dieses Verführen und Identifizieren zum Großteil unbewusst. Es war Sigmund Freud, ein Wiener Arzt und Begründer der modernen Psychotherapie, der auf die fundamentale Bedeutung des Unbewussten auf unser alltägliches Leben hingewiesen hat. Unser Unbewusstes beeinflusst unser Denken, Fühlen, Wollen und Handeln ebenso wie die uns bewussten Seiten.
Normalerweise sind uns diese unbewussten Inhalte in unserem „Alltagsbewusstsein“ nicht zugänglich. Um sie zu erkennen, müssen wir in uns „reinhorchen“, nachspüren, reflektieren, um so diese Teile von uns selbst zu erschließen. Manchmal ist es schlau und angebracht, dies mit der unterstützenden Hilfe eines wohlwollenden Gegenübers zu unternehmen.
Gute Filme berühren uns in der Tiefe unserer Seele, bewusst und unbewusst. Darum können wir als Abenteuerspieler darüber nachspüren, nachsinnen, mit Freunden reden und dadurch mehr über uns selbst erfahren.
Im Film „Forest Gump“ hat der Titelheld auf den ersten Blick, sozusagen bewusst, sehr wenig mit uns gemeinsam, dennoch können viele sich mit ihm identifizieren. Auf der Oberfläche handelt es sich um einen geistig beeinträchtigten Mann, der absurde, gefährliche Situationen mit seiner naiven, dümmlichen Art meistert, oft ohne das selbst zu realisieren. Dennoch fühlen wir mit ihm mit, seiner Liebe zu Jenny, seiner Freundschaft zu Bubba, der bewegten Beziehung zu Leutnant Dan Taylor.
Wie kommt das? Nun, viele von uns werden wohl auch schon einmal in eine „Angebetete“ verliebt gewesen sein, die dann „nur“ gute Freundin sein wollte und konnte. Vielleicht wurden wir als Kinder auch mal von stärkeren drangsaliert oder wegen unseres Äußeren gehänselt und verspottet. Möglicherweise fühlten auch wir uns manchmal in Gruppen, beim Heer, am Arbeitsplatz oder in Gemeinschaften als kleine unbedeutende Ameisen im Getriebe der Großen dieser Welt. Wir kennen die Angst vor Ereignissen, die wir weder ausgelöst haben, noch beeinflussen können und die uns bedrohen. Alle diese Gefahren von Krieg, politischen Auseinandersetzungen, Umweltbedrohungen bis zu alltäglichen Problemen meistert Forest, weil und indem er so ist, wie er ist. Auf seine ganz individuelle und auch sehr liebenswerte Art.
Das mag eine tiefe Sehnsucht in uns ansprechen. Auch uns möge es gelingen, die Klippen und Gefahren, die das Leben mit sich bringt, zu meistern, einfach durch unser Dasein, so wie wir eben sind. Dann können wir, wie Forest, gegen Ende wohlhabend an inneren wie äußeren Werten, materiell abgesichert, auf ein reichhaltiges, erfülltes Leben zurückblicken. So betrachtet, kann der Film „Forest Gump“ verschiedene unbewusste Erinnerungen und Erfahrungen, gegenwärtige Situationen sowie Wünsche und Sehnsüchte in uns ansprechen. Als Abenteuerspieler können wir diesen auf die Schliche kommen.
Warum sind gelegentlich Regisseure selbst überrascht von der Wirkung ihrer Filme auf uns Zuseher? Nun, nicht nur wir betrachten Filme mit unserem Bewussten und Unbewussten. Alle am Entstehen eines Filmes Beteiligten haben ebenso ihr Bewusstes wie Unbewusstes. Und diese beiden tragen das Ihre zum Film bei, sei es zum Erfolg oder Misserfolg. In jedem Film sehen wir also mehr als nur das, was absichtsvoll, bewusst von den Filmemachern umgesetzt wurde. Auch das Unbewusste von Regisseuren, Produzenten, Schauspielern, Maskenbildnern usw. fließt in jeden Film mit ein.
Das individuelle Unbewusste erklärt auch, warum Filme und Szenen auf verschiedene Menschen oft ganz unterschiedliche Wirkungen haben. Was den einen langweilt und nervt, mag eine andere in Berührung und Verzücken versetzen. Eine Erfahrung, die einige von uns wohl schon gemacht haben, wenn wir vor der Leinwand sitzen und uns fragen, was ein anderer an diesem Film so toll finden kann?
Wie aber kommt es, dass Filme so viele Menschen begeistern können? Warum war „Titanic“ so ein Erfolg, obwohl das Thema schon zuvor verfilmt wurde? Der Schweizer Psychiater und Psychotherapeut C.G. Jung, Schüler von Sigmund Freud, hat darauf hingewiesen, dass wir nicht nur unser individuelles Unbewusstes haben, sondern auch ein kollektives Unbewusstes. In diesem sind Inhalte, er nennt sie Archetypen, die wir mit anderen Menschen und der ganzen Menschheit teilen.
Das ist leicht nachzuvollziehen, schließlich sind wir nicht nur einmalige, einzigartige Individuen, sondern immer auch Teil von Gruppen und Gemeinschaften, sowie eben auch der Menschheit. Unser Körper bringt dies deutlich zum Ausdruck. So wie wir sind, gibt es uns nur einmal. Genau dieses Wesen ist einmalig auf der Welt, selbst wenn andere uns zum Verwechseln ähnlich sehen, wie dies bei eineiigen Zwillingen der Fall ist. Dennoch haben wir gewisse, für unsere Familie und Ahnen typische Merkmale, die uns von anderen unterscheiden. Andere Charakteristika teilen wir mit ganzen Gruppen, wie Haar-, Augen-, oder Hautfarbe. Als Menschen gehören wir der Gattung Homo sapiens an und als diese zu den Säugetieren, die wiederum zu den Tieren und als Lebewesen zu allem Leben dieser Erde gehören.
Aber es geht noch weiter, unsere Moleküle und Atome weisen uns als Sternenstaub aus, Teil des Universums. So gesehen sind wir zwangsläufig mit allem verbunden, und was für unseren Körper gilt, gilt für unsere Seele allemal. Darum ist es kein Wunder, dass ein gut verfilmter Archetypus „Liebe“, wie in „Titanic“, viele Menschen in die Kinos lockt.
Weniger bekannt ist, dass der Italiener Roberto Assagioli, wie Jung Psychiater und Psychotherapeut, darauf hingewiesen hat, dass wir nicht nur über ein kollektives und individuelles Unterbewusstsein verfügen, sondern auch über ein Überbewusstsein. Dieses Überbewusstsein ist der „Ort“ unserer menschlichen Seeleninhalte, mit denen wir über uns selbst „hinauswachsen“ können, unserem Leben Sinn und Erfüllung geben, uns mit anderen zutiefst einfühlend verbunden und spirituell berührt erleben. Es gibt Filme unterschiedlicher Genres, die wohl weniger populär sind, die ganz auf dieses individuelle wie kollektive Überbewusste in uns abzielen.
Aus dem Bereich der Spielfilme können etwa „Bab´Aziz der Tanz des Windes“, „Der Himmel über Berlin“, „Wie im Himmel“ oder „Nokan, die Kunst des Ausklangs“ genannt werden, Dokumentationen wie „Das Geheimnis der Bäume“, „Die Höhle der vergessenen Träume“ oder experimentelle Dokumentationen wie „Samsara“, „Home“ oder „Unendlich Jetzt“. Bei manchen Menschen können auch Natur- und Tierdokumentationen wie „Deep Blue“, „Serengeti Symphonie“ oder die Serie „Life das Wunder Leben“ ihre spirituelle Seite zum Klingen bringen.
Theorie
In der Psychologie gibt es unterschiedliche Vorstellungen von Aufbau und Struktur der menschlichen Seele und verschiedene Auffassungen darüber, inwieweit diese Auswirkungen auf unser tägliches Leben haben. Der Wiener Arzt Sigmund Freud (1856-1939) hat jenen Teil unseres Unterbewusstseins, der Einfluss auf unser Verhalten, Denken, Fühlen, Wünschen und Wollen hat und uns bewusst im Alltag nicht zugänglich ist, das Unbewusste genannt. (Anmerkung: In diesem Buch werden der Einfachheit halber „Unterbewusst“ und „Unbewusst“ als Synonyme verwendet).
Wenn wir unter dem Einfluss alter, oft kindlicher, in unserer Kindheit entwickelter, Schemata stehen, wird dies „Regression“ genannt. Deutlich ist dies zu beobachten, wenn Erwachsene emotional wie Kinder reagieren. Wenn wir uns dem Anderen gegenüber so verhalten (denken, fühlen) als sei dies ein anderer Mensch, so wird dies „Übertragung“ und „Projektion“ genannt.
Das lässt sich in Beziehungen gut beobachten, wenn der Partner wie ein Elternteil behandelt wird, z.B. die Ehefrau wie die eigene Mutter, kommt es sozusagen zu einer psychischen Verwechslung in bestimmten Situationen. Übertragung und Regression sind normalerweise unbewusst. Das Problem ist, dass sie meist wenig hilfreich, eher oft schädlich und leidverursachend sind. Sigmund Freud hat diese Vorgänge als Erster systematisch untersucht und auf die Funktion unseres Unbewussten hingewiesen. C.G. Jung (1875-1961) war ursprünglich Schüler von Freud, trennte sich allerdings dann von diesem. Er erweiterte die Konzeption des individuellen Unbewussten um das Kollektive. Etwas vereinfacht können wir sagen, dass im individuellen Unbewussten all jene Einflussgrößen auf unser tägliches Leben sind, deren Ursachen in unserer ureigenen Lebensgeschichte liegen.
Unsere Erfahrungen in der Kindheit, der Einfluss und das Vorbild unserer Eltern, Geschwister, Verwandten und Lehrer sowie traumatische Erfahrungen haben uns nicht nur weitgehend dazu gemacht, wie wir heute sind, sondern beeinflussen uns, zumindest in bestimmten Situationen, nach wie vor. Dann formen sie unbewusst unser Denken, Wollen, Fühlen und Handeln. Nach Jung ist dieser unbewusste Einfluss nicht nur lebensgeschichtlich, individuell begründet, sondern auch kollektiv, aus unserer Verbundenheit, Geschichte und als Vertreter der Menschheit schlechthin. Diese kollektiven Einflussgrößen aller Menschen im einzelnen Menschen werden Archetypen genannt. Jung erforschte die Bedeutung und den Einfluss dieser unbewussten kollektiven Faktoren auf uns Menschen.
Roberto Assagioli (1888-1974) betonte, dass der Mensch nicht nur unter dem regressiven Einfluss unbewusster Inhalte steht, sondern auch unter progressiven, überbewussten. In diesem Überbewusstsein ist unser Bedürfnis nach Sinn und Sinnerfüllung ebenso begründet, wie wohlwollendes Einfühlungsvermögen (Empathie) oder ganzheitlich, situatives Erfassen und Verstehen (Intuition).
Auch dieses Überbewusste ist nicht auf das Individuelle beschränkt, sondern weist darüber hinaus auf eine kollektive Verbundenheit hin. Im Überbewussten wird diese Kollektivität als Transpersonalität bezeichnet. Wesentliche Aspekte des Überbewussten sind Sinnerfüllung, Mitmenschlichkeit, Verbundenheit und Spiritualität.
Ohne den Begriff des Überbewusstseins zu verwenden, hob der österreichische Psychiater und Psychotherapeut Viktor Frankl (1905-1997) die Bedeutung des Sinnes für das Leben und die Gesundheit des Menschen besonders hervor. Alle vier entwickelten ihre eigene Therapieschule, Freud die „Psychoanalyse“, Jung die „Analytische Psychotherapie“, Assagioli die weniger bekannte „Psychosynthese“ und Frankl die „Logotherapie und Existenzanalyse“.
In allen Psychotherapien wird einerseits versucht, schädigende, unbewusste Einflussfaktoren positiv zu verändern, z.B. indem sie durch Selbsterkenntnis bewusst werden und andererseits das Potential von uns Menschen für