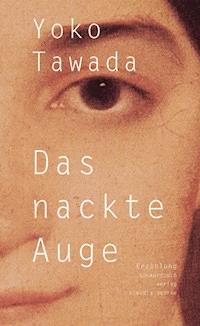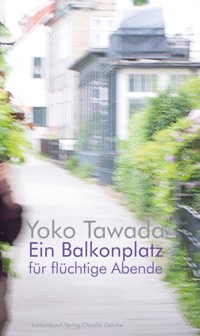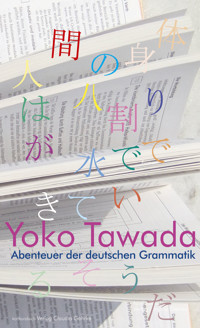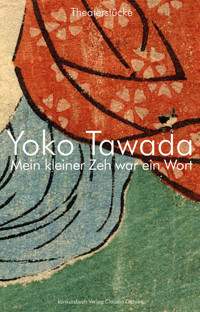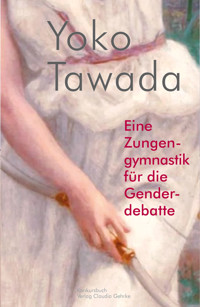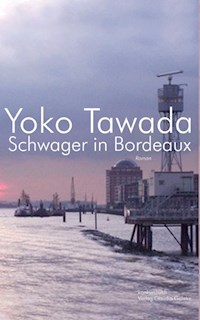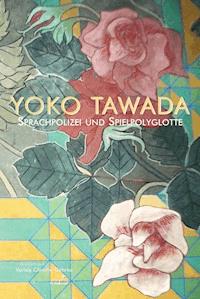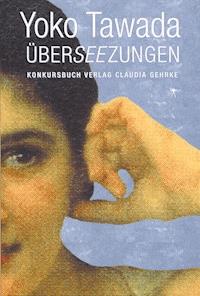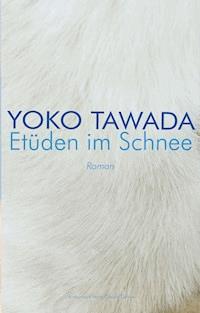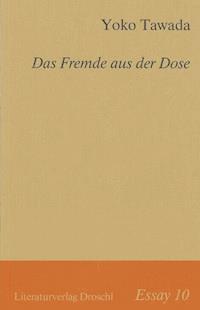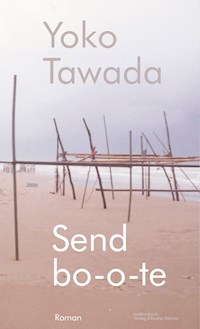
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: konkursbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach einer Katastrophe hat Japan die Verbindungen zur Außenwelt gekappt. Yoko Tawada erzählt in leichter, glasklarer Sprache von Yoshiro und seinem Urenkel Mumey. Alle Kinder in der Zeit werden krank geboren, zugleich sind sie weise und fröhlich, ein Hoffnungsschimmer. Die Alten hingegen leben immer länger. Der herzerwärmende Junge Mumey kann vieles nicht mehr. Yoshiro kümmert sich mit großer Liebe um ihn. Als Student wa Yoshiro mit einer Frau aus Deutschland befreundet. Manchmal fragt er sich, ob sich die Umwelt dort auch so verändert hat wie in Japan. Wie es deren Urenkeln geht. Als der Alltag schwieriger wird, versucht eine geheime Organisation, ausgewählte Kinder als »Sendboten« ins Ausland zu schmuggeln, zu Forschungszwecken ... "Dieses Buch hat mich berührt wie lange keins mehr", so leitete Denis Scheck sein schönes Gespräch mit Yoko Tawada in der Sendung "Druckfrisch" (17.2.2019) ein. Die Auswirkungen der Katastrophe sind nur in kleinen Details zu spüren, die beim Lesen erst nach und nach, dafür umso eindringlicher, ins Bewusstsein sickern. Es schimmern viele andere Geschichten durch: wie Japaner und wie Europäer mit Katastrophen umgehen, »japanische Psyche«, Historisches . „Ein eindrucksvoller und berührender Roman. Keine Dystopie, aber auch kein aufmunternder Durchhalteroman. Eine Erzählung über das Leben unter dem Aspekt seiner Unentrinnbarkeit. Ein existentialistischer Roman ohne Pathos.“ (Peter Pörtner) „Ihr Übersetzer Peter Pörtner leistet überragende Arbeit … auf den ersten Blick fast lapidare Bemerkungen, aus denen in "Sendbo-o-te" eine Leichtigkeit entsteht, die das Fantastische nebensächlich normal und das Normale außergewöhnlich schön erscheinen lässt.“ (Lea Schneider, Süddeutsche, 10.12.18)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Yoko Tawada
Sendbo-o-te
Roman
aus dem Japanischen von Peter Pörtner
konkursbuch Verlag Claudia Gehrke
Zum Buch
Nach einer Katastrophe hat Japan alle Verbindungen zur Außenwelt gekappt. Yoshiro kümmert sich mit großer Liebe um seinen Urenkel Mumey. Die Kinder in der Zeit werden krank geboren, ihr Leben hängt am seidenen Faden, zugleich sind sie weise und fröhlich, ein Hoffnungsschimmer. Die Uralten leben immer länger. Viele Tiere gibt es nicht mehr, Pflanzen mutieren, auch die Menschen. Als Student war Yoshiro mit einer Frau aus Deutschland befreundet. Manchmal stellt er sich vor zu reisen, fragt sich, wie es den Urenkeln der Frau geht, was sie essen, ob sich die Umwelt in Europa auch so stark verändert hat. Als der Alltag schwieriger wird, versucht eine geheime Organisation, ausgewählte Kinder als »Sendboten« ins Ausland zu schmuggeln – zu Forschungszwecken. Was wird aus dem liebenswerten Mumey? Es schimmern viele weitere Geschichten durch: wie Japaner und wie Europäer mit Katastrophen umgehen, Historisches, was mit der Sprache passiert in einer solchen Situation. Erzählt in der leichten glasklaren Sprache Yoko Tawadas.
»Dieses Buch hat mich berührt wie lange keines mehr.« (Denis Scheck, Druckfrisch, 17.2.2019)
»Eine Geschichte über das Leben unter dem Aspekt seiner Unentrinnbarkeit. Ein existentialistischer Roman ohne Pathos.« (Peter Pörtner)
»Ihr Übersetzer Peter Pörtner leistet überragende Arbeit ... Es sind diese auf den ersten Blick fast lapidaren Bemerkungen, aus denen in Sendbo-o-te eine Leichtigkeit entsteht, die das Fantastische nebensächlich normal und das Normale außergewöhnlich schön erscheinen lässt.« (Lea Schneider, Süddeutsche Zeitung)
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Zum Buch
Mumey saß
Wenn es menschlich ist
Die Dokumente
Das Messer
Alle diese neuen Feiertage
Von Liebe war keine Rede
Das war nicht auszuhalten
Aus dem Nachbarhaus
Die Straße ist aus durchsichtigen Glasplatten
Der fünfzehnjährige Mumey
Zur Autorin
Impressum
Mumey saß
Mumey saß, in einen blauen Schlafanzug aus Seide gekleidet, wie angeheftet auf dem Boden. Er sah aus wie ein Küken. Das lag wohl daran, dass sein Kopf für seinen langen, dünnen Hals zu groß war. Seine seidenfeinen Haare waren nass von Schweiß und klebten fest an seiner Kopfhaut. Die Augen leicht geschlossen, bewegte er seinen Kopf, als wollte er mit den Ohren die Luft erkunden. Und das Geräusch der Fußstapfen, draußen, auf dem Sandweg, mit dem Trommelfell auffangen. Die Fußstapfen werden lauter und lauter, bis man plötzlich keine mehr hört. Eine Schiebetür nimmt ratternd wie ein Güterzug Fahrt auf. – Und als Mumey die Augen öffnet, blendet ihn die Morgensonne, – gelb wie eine geschmolzene Löwenzahnblüte. Er zieht seine Schultern kraftvoll nach hinten, streckt die Brust nach vorne und, als würden sich Flügel ausbreiten, streckt er seine Arme aus.
Schwer atmend kommt Yoshiro heran. Er lächelt, wobei sich tiefe Falten an seinen Augenwinkeln bilden. Als er ein Bein vorstreckt und sich niederbeugt, um einen Schuh auszuziehen, tropft der Schweiß von seinem Gesicht.
Jeden Morgen mietet sich Yoshiro beim »Hunde-Verleih« an der Kreuzung vor dem Damm einen Hund und rennt mit ihm dreißig Minuten das Flussufer entlang. In der wasserarmen Zeit schnurrt der Fluss zu einem silbernen Bändchen zusammen, das in eine sehr weite Ferne zu fließen scheint. – Früher haben die Leute dieses nutzlose Herumrennen »jogging« genannt, aber gleichzeitig mit dem Verschwinden der Fremdwörter hat man irgendwann angefangen, von kakeochi zu reden, von »Durchbrennen« oder »Ausreißen«, und zwar zu zweit. Es begann damit, dass man scherzhaft sagte »Wenn man miteinander durchbrennt, fällt der Blutdruck!« – Das Wort ist dann in Mode gekommen und hat sich eingebürgert. Mumeys Generation hat schon längst vergessen, dass zwischen jenem Durchbrennen und Liebe irgendein Zusammenhang bestehen könnte.
Fremdwörter sind zwar ungebräuchlich geworden, im Hunde-Verleih kann man aber noch eine Menge katakana-Zeichen finden, mit denen die Fremdworte auf Japanisch geschrieben werden. Als Yoshiro anfing, regelmäßig auszureißen, war er sich noch sicher, welches Tempo er sich zumuten konnte und dachte, dass ein möglichst kleiner Hund für ihn wohl am besten sei. Er mietete sich einen »Yorkshire Terrier«. Aber leider war der unfasslich schnell und riss Yoshiro derart mit sich und hinter sich her, dass der fast hinstürzte und dem Hund stolpernd und strauchelnd und keuchend nachrannte. – Der Hund blieb hin und wieder stehen und schaute sich mit einer verächtlichen Miene nach ihm um, so als wollte er sagen »Mann, wo bleibst du denn?« – Der Dachshund, den Yoshiro sich am nächsten Tag auslieh, war apathisch und lustlos und schien nicht einmal die Spur eines Antriebs zu laufen zu verspüren. Yoshiro musste ihn, der nach zweihundert Metern wie auf den Boden festgeklebt hocken blieb, an der Leine zum Hundeverleih zurückschleifen.
»Es gibt eben auch Hunde, denen Promenaden nicht so liegen …«
»Eh… Promenaden? – Ah… Promenaden, klar … jajaja, Sie haben recht!«
Der Hundeverleiher musste über den Alten, der ausgestorbene Wörter wie Promenaden benutzte, lachen. Wobei sein Lachen ziemlich herablassend klang.
Die Lebensdauer der Wörter wird immer kürzer. Dabei soll man aber nicht glauben, das beträfe nur die Fremdwörter. Denn auch unter den Wörtern, denen der Stempel »altmodisch« aufgedrückt wird, und die – eines nach dem anderen – verschwinden, sind solche, die keine Nachfolger finden.
Die Woche davor hatte er sich einen Deutschen Schäferhund ausgeliehen, der, anders als der Dachshund, so gut dressiert war, dass Yoshiro sich ihm unterlegen fühlte. Yoshiro rannte mit allem Elan. Aber unterwegs verließen ihn seine Kräfte. Und er konnte sich nur noch vorwärtsschleppen. Der Hund aber blieb immer genau und treu an seiner Seite. Wenn Yoshiro ihn ansah, schien es ihm, als wollte er ihm mit einem Seitenblick nur »Toll, wie ich das mache, was?!« zurufen. Dieses irgendwie musterschülerhafte Gehabe war Yoshiro unangenehm. Daher entschloss er sich, auch keine Deutschen Schäferhunde mehr auszuleihen.
Yoshori kann keinen geeigneten Hund finden. Aber wenn er gefragt wird: »Welchen Hund ziehen Sie heute vor?« – ist er innerlich doch irgendwie damit zufrieden, dass er um eine Antwort verlegen ist.
Wenn er in jungen Tagen nach seinem Lieblingskomponisten, seinem Lieblingsdesigner oder seinem Lieblingswein gefragt worden war, hatte er immer sofort zu antworten gewusst. Er war sich sicher gewesen, dass er einen guten Geschmack hat. Und er hatte Geld und Zeit verschwendet, um zum Beweis dafür auch die entsprechenden Dinge zusammenzukaufen. Jetzt denkt er aber nicht mehr daran, seine Vorlieben gleichsam als Bausteine zu benutzen, um daraus ein Haus namens Individualität zu bauen. Zugegeben, Schuhe sind ihm immer noch wichtig, aber er setzt sie nicht mehr als Mittel seiner Selbstinszenierung ein. Die Himmelshund AG hat kürzlich Hermes-Sandalen auf den Markt gebracht, die enorm bequem sind, und irgendwie an Strohsandalen erinnern. Die AG hat ihren Stammsitz in der Provinz Iwate. Auf den Sandalen steht, mit einem Haarpinsel geschrieben, »Iwate made«. Das soll vielleicht an das aus der Mode gekommene englische »Made in Japan« erinnern, die Japaner lesen es aber »I-wa-te-ma-de«, ohne sich viel dabei zu denken. Denn die wörtliche Bedeutung »bis nach Iwate« macht ja nicht viel Sinn.
In der Oberschule empfand Yoshiro den Körperteilen gegenüber, die Füße genannt werden, ein ziemliches Gefühl der Fremdheit. Er liebte die Schuhe einer ausländischen Marke, die seine Füße wie ein dicker Gummi umschlossen. Diese weichen und verletzlichen Füße, die sich ohne Rücksicht auf die anderen Körperteile so selbstsüchtig entwickelt hatten. Später, als er eine Weile in einer Firma arbeitete, hat er, um vor seiner Umgebung zu verbergen, dass er gar nicht immer Angestellter bleiben wollte, schwere braune Lederschuhe getragen. Als er dann für sein Debut als Schriftsteller sein erstes Honorar erhielt, hat er sich Bergsteigerschuhe gekauft. – Wenn er aus dem Haus ging, auch wenn er nur zum Postamt in der Nachbarschaft wollte, schnürte er, um einem Unglück vorzubeugen, die langen Schnürsenkel fachmännisch zusammen.
Erst als er die Siebzig überschritten hatte, begannen seine Füße, an Sandalen aller Art Vergnügen zu finden, denn in Sandalen werden sie von Moskitos malträtiert und sind dem Regen ausgesetzt. – Yoshiro betrachtete seine Fußrücken, die so widerstandslos all diese Unannehmlichkeiten hinnahmen, und dachte: Die sind wie ich! – Und das Bedürfnis, einfach los- und wegzurennen, stieg in ihm auf. – Auf der Suche nach Schuhen, die Sandalen ähnlich wären, war er zufällig denen der Himmelshund AG begegnet.
Yoshiro zieht sich am Eingang seine Schuhe aus und stützt sich mit einer Hand gegen den Holzpfosten. Er spürt dessen Maserung an den Fingerspitzen. Im Inneren eines Baumes hinterlassen die Jahre ein Wellenmuster. Aber wie wird die Zeit wohl im eigenen Körper bewahrt? Jedenfalls nicht in der Form von Jahresringen, die sich in gewellten Mustern ausbreiten. Die Jahre reihen sich auch nicht in einer Linie auf. Vielleicht liegen sie ja ungeordnet da, wie in einer Schublade. Ein Durcheinander. Da schwankte er und stellte den linken Fuß wieder auf den Boden. Er murmelte, als spräche er mit sich selbst:
»Ich kann immer noch nicht auf einem Bein stehen.«
Mumeyhörte das, kniffseine Augen zusammen, hob die Nase ein wenig und fragte:
»Will der Urgroßvater denn zu einem Kranich werden?«
Sein Kopf wippte kurz hin und her, fast so wie ein Luftballon, und rastete auf der Spitze seines Rückgrats ein. Mumeys Blick war zweideutig, freundlich und verbittert zugleich. Yoshiro erschrak darüber, dass er einen Augenblick lang in dem schönen Gesicht seines Urenkels das Lächeln eines Buddha gesehen hatte, und sagte mit gespielter Strenge:
»Bist du denn noch immer im Schlafanzug? Zieh dich schnell um!«
Er öffnete die Schublade eines Schranks, in der die am Abend zuvor ordentlich gefaltete Schulkleidung samt Unterwäsche übereinandergestapelt lag und manierlich auf die Instruktionen des Hausherrn warteten. Mumey hatte immer die Sorge, dass die Sachen während der Nacht heimlich ausgehen könnten. Und wer garantierte dann, dass sie nicht Cocktails trinkend in Bars und Clubs herumlungern und tanzen und danach schmutzig und zerknittert nach Hause zurückkommen? – Aus diesem Grund verschließt Yoshiro abends vor dem Schlafengehen die Schublade, in der er Mumeys Sachen verwahrt, mit einem Schlüssel.
»Zieh Dich selbst an! – Ich helfe Dir nicht!«
Yoshiro legt einen Satz Kleidung vor Mumey, geht zum Waschbecken und wäscht sich mit kaltem Wasser, laut platschend, das Gesicht. Er trocknet sich mit einem kleinen japanischen Handtuch ab und starrt eine Weile auf die Wand vor seinen Augen, wo kein Spiegel hängt. Wann hat er sein Gesicht wohl das letzte Mal in einem Spiegel gesehen? – Bis in seine Achtziger hinein hat er sein Gesicht allmorgendlich im Spiegel inspiziert. Die Nasenhaare, wenn sie zu lang waren, geschnitten. Die Haut unter den Augen, wenn sie trocken war, mit Kameliencreme bestrichen.
Yoshiro legt das Tuch über die Stange draußen und befestigt es mit einer Wäscheklammer. Irgendwann haben sie aufgehört, große westliche Handtücher zu benutzen und nur noch kleine, tenugui genannte Tücher zu gebrauchen. Wenn man die großen Handtücher wäscht, dauert es wirklich lange, bis sie trocken sind. Und man hat nicht immer eines zur Hand. Aber wenn man ein tenugui über die Stange auf der Veranda hängt und den Wind herbeiruft, dann flattert es sanft. Und ist irgendwann plötzlich trocken. Früher hat Yoshiro diese dicken, riesigen Badetücher vergöttert. Nach dem Gebrauch hat er sie in eine Waschmaschine hineingestopft und den Luxus genossen, verschwenderisch Waschpulver darüberzuschütten. Aus heutiger Sicht war das komisch. Die arme Waschmaschine durchlief alle Leiden, wenn sie diese schweren Tücher im Kreis in ihrem Bauchherumwälzen musste. Das nahm sie so mit, dass sie nach drei Jahren, völlig erschöpft, an Überarbeitung starb. So sind eine Million tote Waschmaschinen auf den Grund des Pazifiks gesunken, wo sie den Fischen als Kapselhotels dienen.
Zwischen dem immerhin fast sechzehn Quadratmeter großen Zimmer und der Küche gab es einen zwei Meter langen Dielenraum, wo ein einfacher Picknicktisch und ein Klappstuhl, von der Art, wie Angler sie benutzen, abgestellt waren. Und auf dem Tisch stand, um einen etwa aufsteigenden Wandertrieb noch mehr anzustacheln, eine runde Feldflasche, auf die das Bild eines Dachses gemalt war, und in der eine große Löwenzahnblüte steckte.
Neuerdings gibt es Löwenzahnblüten, deren Blütenblätter bis zu zehn Zentimeter lang sind. Es passierte einmal, dass bei einer der alljährlichen Chrysanthemen-Leistungsschauen jemand eine Löwenzahnblüte mitbrachte und fragte, ob man sie nicht als Chrysantheme akzeptieren könnte? Als die Gegner dieser Idee aber behaupteten: »Eine so große Löwenzahnblüte ist keine Chrysantheme, sondern nur eine plötzliche Mutation eines Löwenzahns!« führte der Einwand, dass »plötzliche Mutation« ein »diskriminierender Ausdruck« sei, zu einem monatelangen Disput. – Um ehrlich zu sein, das Wort »plötzliche Mutation« wurde in diesem Kontext kaum mehr gebraucht. Stattdessen war das Wort »Umweltanpassung« in aller Munde. Wenn man in einem Milieu, in dem die meisten Feldblumen gigantische Formen annehmen, nur selbst klein bleibt, wird man zu einem Schattengewächs, einem Ausgestoßenen – Vielleicht hat ja auch der Löwenzahn seine Größenur verändert, um in der heutigen Umwelt überleben zu können. Es gibt aber übrigens, umgekehrt, auch Pflanzen, die der Strategie folgen, kleiner zu werden. So ist auch eine neue Bambus-Spezies entstanden, die, unabhängig davon, wie gut man sie pflegt, nur so groß wie ein kleiner Finger wird. Daher nennt man diese Art den »Gemeinen Kurzfinger-Bambus«. – Das heißt, wenn, wie in der alten Geschichte vom Bambussammler und der leuchtenden Prinzessin, mitten in einem solchen kleinen Bambus ein Baby leuchtet, das vom Mond stammt, müssen der Alte und die Alte aus dem Dorf herbeigekrochen kommen und es mit der Lupe suchen. Sonst finden sie es nicht.
Unter den Löwenzahn-Gegnern gab es auch solche, die daran festhielten, dass »die Chrysantheme eine edle Pflanze ist, die immerhin zum kaiserlichen Hauswappen gewählt wurde«, während der Löwenzahn ein Unkraut sei, mit dem man sich nicht gemein machen sollte. Dagegen setzte die Union der »Löwenzahnisten«, die aus einer ursprünglichvon Ramen-Nudelköchen gegründeten Gewerkschaft hervorgegangen war, das berühmte kaiserliche Diktum: »Ein Kraut, das ein Unkraut ist, gibt es nicht.« – Diesem imperialen Slogan wusste die Gegenpartei nichts mehr zu entgegnen, und so fand der Chrysanthemen-Löwenzahn-Disput nach sieben Monaten sein Ende.
Wenn YoshiroLöwenzahn sieht, dann erinnert er sich daran, wie er als Kind, allein auf einer Wiese auf dem Rücken liegend, in den Himmel geschaut hat. Die Luft ist warm. Im Unterholz ist es schattig und kühl. Aus der Ferne hört er das Zwitschern der Vögel. Er dreht den Kopf zur Seite, da blüht neben ihm, nur wenig über seinen Augen, Löwenzahn. – Er schließt die Augen, spitzt seine Lippen zu einer Art Schnabel und gibt der Löwenzahnblüte einen Kuss. – Es kam auch vor, dass er sich hastig aufrichtete, um sich zu versichern, dass er von niemandem beobachtet worden war.
Mumey hat seit seiner Geburt niemals auf einer echten Wiese gespielt. Aber er hat sich in seinem Innern ein Bild von einer »Wiese« gemalt, das er sorgsam hegt und pflegt.
»Kauf mir Farbe! Ich will die Wand streichen.«
Es war vor ein paar Wochen, dass Mumey das plötzlich sagte.
Yoshiro verstand nicht recht und erwiderte:
»Die Wand? Die ist doch noch schön!«
»Ich streiche sie so an, dass sie wie der Himmel aussieht. Himmelblau. Und dann male ich noch Wolken undVögel.«
»Für ein Picknick im Haus?«
»Ein Picknick draußen, das geht ja nicht.«
Yoshiro musste schlucken. In ein paar Jahren wird Mumey das Haus gar nicht mehr verlassen und nur noch in seiner Kammer, inmitten einer gemalten Landschaft lebenkönnen. Yoshiro versuchte, ein heiteres Gesicht zu machen und sagte:
»Du hast recht. Ich gehe jetzt und besorge blaue Farbe.«
Solange Mumey, dachte er, dieses Eingesperrtsein noch keine Angst macht, ist es ja gut. Es ist nicht nötig, daran etwas zu ändern.
Mumey kann nicht gut auf einem Stuhl sitzen. Er sitzt stattdessen auf einem tatami auf dem Boden und isst an einem Lacktablett, auf das der berühmte Meereswirbel von Naruto gemalt ist. Er sitzt dann da, als würde er einen Fürsten spielen. Seine Hausaufgaben erledigt er an einem kleinen Tischchen am Fenster. – Dennoch widerspricht Mumey heftig, als Yoshiro sagt:
»Wir brauchen keine Stühle. Und auch keine Tische. Verschenken wir sie!«
Stühle und Tische haben für Mumey zwar keinen praktischen Nutzen, sie sind für ihn aber wie Installationen, die vergangene Zeiten oder ferne Länder, die er nie, nie wird besuchen können, vor seinen Blick zaubern.
Yoshiro schälte aus einem Wachspapier, das dabei wie ein leichter Regen knisterte, ein Roggenbrot. Ein deutsches Brot nach Shikoku-Art, mit seiner Farbe wie angebrannte Dunkelheit, dem Gewicht von Granit und mit seiner knarrend festen Kruste. Aber innen ist es weich und feucht. Dieses Schwarzbrot mit seinem feinsäuerlichen Geschmack hatte den merkwürdigen Namen »Aahen«, das klingt in japanischen Ohren wie Aachen und ahen, Opium, zugleich. Der Besitzer der Bäckerei gab den Broten, die er backte, seltsame Namen, die alle Wortspiele enthielten: »Hanobaa«, »Hannover, die Klingentante« – »Buremen«, «Bremen, die Wackelnudel« – »Rotenburoku«, »Rotenburg, der Freiluftbadebezirk«. An der Ladentür hing ein Poster mit der Aufschrift: „Brote gibt es hier allerlei. Finden Sie eines, das ihrem Munde köstlich dünkt!“ – Dieser Spruch verdarb den Sprachnerven Yoshiros zwar den Spaß, aber als er die dicken Ohrläppchen des Bäckers sah, kehrte sein Vertrauen zurück: Leckere Ohrläppchen, wenn man sie kneten und backen würde; knackige Ohrläppchen, die – gewiss! – Süße entwickeln, wenn man sie kaut. Der Bäcker ist ein »junger Alter«. Früher gab es Leute, die in Gelächter ausbrachen, wenn sie das Wort »junger Alter« hörten. Aber auch dieser Ausdruck ist mittlerweile längst eingebürgert. – In einer Epoche, in der die Neunzigjährigen »Alte mittleren Alters« genannt werden, war der Bäcker gerade erst in die zweite Hälfte seiner Siebziger eingetreten.
Wenn es menschlich ist
Wenn es menschlich ist, wie halbtot im Bett liegen zu bleiben, obwohl man eigentlich aufstehen müsste, ist an diesem Mann gar nichts menschlich. Jeden Morgen um vier Uhr, da braucht kein Wecker zu läuten, springt er wie Jack mit der Hilfe einer Sprungfeder am Hintern aus seiner Box. Erzündetzunächst ein zehn Zentimeter langes Streichholz an und mit dem brennenden Streichholz eine zehn Zentimeter hohe Kerze mit einem Durchmesser von fünf Zentimetern, die auf einem Teller befestigt ist. Mit dieser Leuchte in der Hand betritt er die stockdunkle Backstube, seinen gewohnten Arbeitsplatz. Er betritt ihn mit andächtiger Spannung, wie eine Krypta.
Immer wenn er schläft, bringt jemand einen unsichtbaren Brotteig in diesem Raum zur Gärung und bäckt ihn. Davon liegt immer noch eine leichte Wärme in der Luft. Er denkt: Unsichtbares Nachtbrotlässt sichnicht verkaufen. Aber nur weil es dieses Mitternachtsbrot gibt, existiert auch das Mittagsbrot. Die Zeit, in die es aus einem anderen Raum hineinduftet, dauert nur sehr kurz. Dem Wesen, das in der Nacht das Brot bäckt, kann er zwar nicht begegnen. Aber in der Zeit, in der er allein seiner Arbeit nachgeht, fühlt er sich überhaupt nicht einsam. Das verdankt er vielleicht nur jener seltsamen Existenz.
Seinen Laden öffnet er morgens um sechs Uhr fünfzehn. Er schließt ihn abends um sechs Uhr fünfundvierzig. Es gibt Leute, die diese Öffnungszeit so deuten, dass er früher einmal einen pädagogischen Beruf ausgeübt haben muss. Aber der eigentliche Grund ist dieser: Wenn er die Zeit, in der er aufwacht, und die Zeit, die er für die Arbeit braucht, genau abwägt und kalkuliert, dann kommt es wie von selbst zu dieser Regelung. Firmenangestellte müssen, wenn ihre Firma das so festlegt, ob sie nun müde sind oder nicht, pünktlich um acht Uhr dreißig zur Arbeit erscheinen. Und unser Bäcker hält einfach nur präzise die Regel ein, die er sich selbst gesetzt hat.
In seinem Laden gibt es einen Mitarbeiter, der, wie auch Yoshiro, mehr als hundert Jahrezählt. Er ist klein von Statur und flink wie ein Wiesel. Als Yoshiro einmal seine flinken Bewegungen beobachtete, flüsterte ihm der Bäcker ins Ohr:
»Mein Onkel! Er sagt, dass man, wenn man einmal über Hundert ist, keine Ruhepausen mehr braucht. Wenn ich ihm sage: Onkel, ruhe dich ein bisschen aus und trink einen Tee! – dann wird er böse und schimpft: Neuerdings ruht ihr jungen Leute euch mehr aus, als ihr arbeitet!«
Yoshiro antwortete mit einem Nicken.
»Die Alten sagen schon immer solche Dummheiten. Dass die jungen Leute neuerdings zu nichts zu gebrauchen seien. Das scheint gut für ihre Gesundheit zu sein. Wenn man sie über die Jugend schimpfen lässt und dabei ihren Blutdruck misst, kann man angeblich zusehen, wie er sinkt.«
Der Bäcker, der zu den »jungen« Alten gehört, schaute Yoshiro, dem echten Alten, der nicht mit dem Makel eines Etiketts wie »jung« oder »mittel« behaftet ist, jetzt geradezu neidisch ins Gesicht.
»Jedenfalls hat mein Onkel wirklich einen niedrigeren Blutdruck als ich. Obwohl er keine Pillen nimmt. Sie scheinen ja alle einen niedrigen Blutdruck zu haben. Wenn man den Onkel so herumflitzen sieht, kommt es einem doch seltsam vor, dass es einmal eine Zeit gab, in der die jungen Leute mit sechzig Jahren in Rente gegangen sind.«
»Ja, das war ein seltsames System. Aber unter dem Aspekt, dass auf diese Weise Arbeitsplätze für die Jüngeren frei wurden, war es doch ganz sinnvoll.«
»Ich selbst habe Bilder gemalt und war mir sicher, dass ich nie in Rente gehen würde.«
»Aber Sie haben doch damit aufgehört.«
»Japp! Ich habe nämlich abstrakte Bilder gemalt. Aber immer kam da ein Kunstkritiker, der so etwas gesagt hat wie: Das ist eine Alpenlandschaft! – Und das hat mich alarmiert und nervös gemacht. Meine Bilder hat man immer, weiß der Teufel warum, für Landschaften ferner Länder gehalten. Das war wirklich furchtbar. Deswegen habe ich den Familienbetrieb zu meinem eigenen Schutz übernommen. Und lebe jetzt vom Brotbacken. Brot kommt zwar auch aus Europa, aber das lässt man mir durchgehen.«
»Früher sagte man furansu-pan für französisches und igirisu-pan für englisches Brot. Wenn man das heute sagt, klingt es sehr nostalgisch und japanisch.«
Wenn Yoshiro die Namen fremder Länder ausspricht, wird seine Stimme leise. DerBäcker lässt seine Augen wachsam hin und her rollen, als wollte er sich versichern, dass ihn niemand hören kann, und flüstert:
»Dieses Brot wurde früher tatsächlich jaaman-breddo, Deutsches Brot,genannt. Heutenennt man es bei seinem richtigen Namen und sagt Sanuki-pan. Obwohl pan ja auch ein portugiesisches Fremdwort ist.«
»Pan erinnert einen daran, dass es fremde Länder gibt. Ich esse zwar lieber Reis. Aber in pan, da steckt ein Traum. Ich hoffe, auch in Zukunft noch –.«
»Ja, aber das ist eine harte Arbeit. Körperliche Schwerstarbeit. Von Kräfteökonomie verstehe ich nichts. Ich habe beständig Angst, eine Sehnenscheidenentzündung zu bekommen. Wenn ich mich abends ins Bett lege, sind mir die Arme furchtbar schwer. Und ich denke mir manchmal, es wäre bequemer, wenn ich mir wie einer Gliederpuppe vor dem Schlafengehen die Arme aus den Schultern drehen könnte.«
»Es gibt Kurse, in denen man Kräfteökonomie lernen kann. Vor kurzem habe ich eine Anzeige gesehen. Es war, glaube ich, in einem Aquarium. Ich hatte statt Sehnenscheidenentzündung aber Seepolypenentzündung gelesen.«
»Das Poster habe ich auch gesehen: Lerne geschmeidig zu sein wie die Mollusken.«
»Genau! Früher hat man sich über Weichtiere lustig gemacht, aber, wer weiß, die Menschen entwickeln sich womöglich in eine Richtung, die keiner vorhergesehen hat. Vielleicht nähern sie sich ja den Kraken an. Wenn ich mir meinen Urenkel ansehe, halte ich das für möglich.«
»Sind wir in hunderttausend Jahren also alle Kraken?«
»Exakt! – Vielleicht! – Früher hat man anscheinendzwar gedacht, dass es eine Degeneration sei, wenn die Menschen zu Kraken werden, aber in Wirklichkeit ist es ein Fortschritt.«
»In der Oberschule fand ich Körper beneidenswert, die wie griechische Skulpturen waren, und wollte an einer Kunsthochschule studieren. Aber irgendwann gefielen mir dann ganz andere Körper. – Die von Vögeln und Kraken, zum Beispiel. – Ich möchte nämlich gern einmal alles mit anderen Augen sehen.«
»Mit anderen Augen?«
»Ich meine – mit – den Augen – eines – Kraken.«
Yoshirowärmte in einem kleinen Topf Sojamilch auf und dachte an sein Gespräch mit dem Bäcker. Mumey hat brüchige Zähne und kann nur Brot essen, das in eine Flüssigkeit getunkt wurde.
Als er gesehen hatte, wie Mumeys Milchzähne aus seinem Mund herausquollen, als wären sie das Fruchtfleisch eines Granatapfels, und seine Lippen blutverschmiert waren, war Yoshiro eine Weile ratlos im Zimmer herumgelaufen. Um die aufgeregten Angstwellen in seinem Herzen zu beruhigen, hatte er sich schließlich gesagt, dass Milchzähne ja ausfallen müssen. Er setzte Mumey auf den Gepäckträger des Fahrrads und brachte ihn zum Zahnarzt. Sie hatten keinen Termin und mussten über zwei Stunden warten. Im schwülen Wartezimmer legte er seine Beine immer wieder anders übereinander und hielt zwei Finger an seine Lippen, als würde er rauchen. Er zupfte gedankenlos an seinen Augenbrauen und schaute immer wieder hoch nach der Uhr an der Wand. Im Wartezimmer standen Modellzähne herum. Mumey benutzte einen großen Weisheitszahn wie einen Lastwagen, den er langsam über den roten Teppich schob. Yoshiro sah eine menschenleere Welt vor seinen Augen, in der gigantische Zähne als Lastwagen über die Straßen gleiten. Und es schauderte ihm.
Aber Mumey hatte das Spiel mit den Zahnmodellen bald satt. Er legte ein großes Buch mit dem Titel Die Abenteuer des Herrn Hundezahn