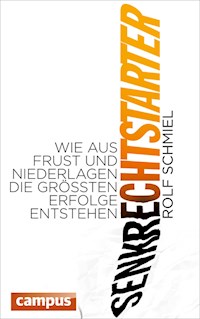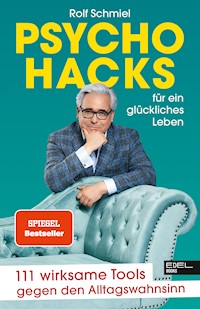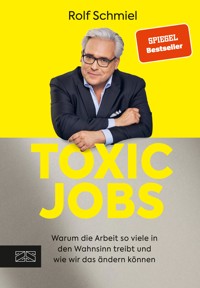Rolf Schmiel
Senkrechtstarter
Wie aus Frust und Niederlagen die größten Erfolge entstehen
Campus Verlag Frankfurt/New York
Über das Buch
DIE WAHRHEIT ÜBER SPITZENLEISTUNG!
Ganz oben stehen. Anerkennung genießen. Stolz verspüren auf die eigene Leistung. Und sich beim Blick auf andere Top-Performer nie wieder fragen: »Wie schaffen die das nur?«
Rolf Schmiel – »Deutschlands unterhaltsamster Wirtschaftspsychologe« – lüftet für Sie das erstaunliche Erfolgsgeheimnis prominenter Senkrechtstarter: Frust und Niederlagen sind es, die ihnen die Energie für Spitzenleistungen geben.
Emotionen wie Zorn, Neid und Arroganz sind natürliche Reaktionen auf erlittenes Unrecht. Wer sie in sich hineinfrisst, leidet. Wer sie aber in konstruktive Bahnen lenkt, den beflügeln sie!
Finden Sie heraus, welcher Motivationstyp Sie sind und mit welchen Methoden Sie Ihre verdrängten Ressourcen am besten anzapfen. Wollen, tun und durchstarten – in jedem steckt ein Senkrechtstarter!
Über die Autoren
Rolf Schmiel – »Der Psychologe unter den Motivationstrainern« (Süddeutsche Zeitung) ist seit 1999 als selbstständiger Berater, Dozent und Kongressredner tätig. Zu Rolf Schmiels Kunden gehören internationale Konzerne und traditionsreiche Mittelständler wie Audi, BMW, Coca-Cola, DHL, Lufthansa, Siemens, Vodafone, Würth und Xerox. Sein besonderes Markenzeichen als Speaker ist sein begeisternder Vortragsmix aus Motivation, Spaß und Psychologie.
www.rolfschmiel.de
Für Leonard
Alles geben Götter, die unendlichen, ihren Lieblingen ganz, alle Freuden, die unendlichen, alle Schmerzen, die unendlichen, ganz. Johann Wolfgang von Goethe
Inhalt
Vorwort
Ein Geständnis: Senkrechtstarter und Bruchpilot
Teil I Die Wahrheit über Spitzenleistungen
Das Erfolgsrezept der Senkrechtstarter
Willenskraft – Einsatz, bis der Arzt kommt
Fokus – Alles auf eine Karte
Opfer – An der Spitze ist es einsam
Risiko – Der Spieler im Sieger
Mentoren – Die Paten des Erfolgs
Glück – Der unterschätzte Faktor
Großzügigkeit – Reich ist, wer gerne gibt!
Alles hat seine Zeit – Work-Life-Tides
Die dunklen Triebkräfte der Top-Performer
Gier – Genug kann nie genügen
Zorn – Dir zeig ich’s!
Neid – Das will ich auch!
Selbstsucht – So what, I’m God!
Skrupellosigkeit – Erfolg um jeden Preis
Wollust – The Winner takes them all!
Arroganz – Eure Armut kotzt mich an!
Was ist das eigentlich – »Erfolg«?
Teil II Die rosarote Scheinwelt der Motivationsgurus
Von Freud bis Tsjakkaa-Schreien: Irrwege der Motivationspsychologie
Epikur: Ich will Spaß!
Freud: Denn wir wissen nicht, was wir tun
Die Behavioristen: Entscheidend ist, was hinten rauskommt
Humanistische Psychologie: Erzähle mir, wer du bist
Leistungsmotivation: Die Geheimnisse der Streber
Amerikanisches Erfolgsdenken: Sprenge deine Grenzen!
Zehn Motivationsmärchen, die Sie besser nicht glauben
Alles ist möglich! – Inklusive Bankrott, Burn-out und Betrug
Tsjakkaa! – Urschrei-Therapie für Versager
Positiv Denken! – Selbstbetrug statt Aufbruchstimmung
Ziele setzen! – Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht
Visualisieren! – Fata Morgana der Träumer
Glaub an dich! – Sprüche statt Strategien
Sei ein Teamspieler! – Wer’s glaubt, wird selig, aber nicht erfolgreich
Lauf Marathon! – Unsinn des sportlichen Aktionismus
Sei ganz du selbst! – Die Lüge des Authentischseins
Hab Spaß! – Das Lächeln der Loser
Die Wahrheiten in einem Meer von Halbwahrheiten
Teil III Die neue Psychologie der Motivation
Wie man Menschen motiviert: Ein Blick hinter die Kulissen
Sadomaso in Nadelstreifen – Von Einpeitschern und Ausgepeitschten
Jeder Jeck ist anders – Einführung in die Persönlichkeitspsychologie
Psychotests für Motivatoren
Schmiels Schnelltest: Einpeitscher, Partylöwe, Grübler oder Aussitzer?
Postskriptum
Statt eines Schlusswortes: Sofortmaßnahmen
Wir bleiben in Kontakt!
Danke!
Anmerkungen
Personenregister
Leseprobe
Vorwort
Probleme sind Chancen in Verkleidung, davon bin ich felsenfest überzeugt. Wer mit Chancenblick durchs Leben geht, wird zum Glückskind. Wer dagegen darauf wartet, dass Fortuna das Glücksrad zu seinen Gunsten dreht, wird am Ende seiner Tage mit Wehmut und einem großen »Hätte ich doch …« zurückschauen. Lieber gelegentlich mit Karacho scheitern und mit Verve die Welt zurückerobern, als im faden Mittelmaß stecken zu bleiben.
Dass ich heute in der ganzen Welt zu Hause bin, mit meinen Vorträgen die größten Säle fülle, Vorlesungen an renommierten Universitäten halten und Marktführer beraten darf, verdanke ich diesem Credo. Der Erfolg wurde mir nicht in die Wiege gelegt, denn diese Wiege stand nicht in einer Nobelvilla im Millionärsviertel, sondern in einer bayrischen Kleinstadt, wo meine Eltern einen Lebensmittelladen führten. Es war ein langer Weg von dort bis auf die Bühnen rund um den Globus. Doch ich bereue keine Sekunde, auch nicht die Hindernisse und Stolpersteine, die manchmal bedrohliche Ausmaße hatten. Sie haben mich nur angestachelt und wachsen lassen – wie gesagt, Probleme sind Chancen in Verkleidung.
Vor diesem Hintergrund war ich sofort elektrisiert, als mein Rednerfreund Rolf Schmiel mir von seinem Buchprojekt erzählte. Dieses Buch zeigt die ungeschminkte Wahrheit über Motivation. Es entzaubert die Tsjakka-Mythen der Trainerszene und gibt neue, psychologisch fundierte Impulse. Speziell das Kapitel über die dunklen Triebkräfte der Top-Performer war für mich ein echter Augenöffner. |10|
Als Psychologe hat der Autor einen unbestechlichen Blick auf das Thema, als Redner weiß er, wie man Menschen unterhält, und als kreativer Kopf scheut er sich nicht, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Ich empfehle Ihnen dieses Buch als Inspiration, als Mutmacher und als packende Lektüre. Ergreifen Sie die Chance, zum Senkrechtstarter zu werden!
Ihr Hermann Scherer|11|
Ein Geständnis: Senkrechtstarter und Bruchpilot
Es ist gute Tradition, nur über etwas zu schreiben, von dem man wirklich etwas versteht. Und mit Senkrechtstarts und Niederlagen kenne ich mich aus. Ich hatte mein Psychologiediplom kaum in der Tasche, da ging es für mich steil aufwärts. Während meine früheren Kommilitonen sich durch Praktika hangelten oder für überschaubare Gehälter in Nine-to-five-Jobs schufteten, war ich als Trainer enorm erfolgreich. Bald fuhr ich einen nachtblauen Luxuswagen mit verchromter Raubkatze am Bug. Ich gönnte mir ein überdimensioniertes Büro, liebte meine Maßanzüge, logierte in Fünf-Sterne-Hotels. Statt Bier mit Fußballkumpel musste es jetzt Champagner mit Business-Partnern sein. Ich hatte die Tipps der klassischen Motivationsliteratur inhaliert und war begeistert, wie leicht das Leben sein konnte. Ich glaubte an mich, dachte positiv, steckte mir ambitionierte Ziele und war wie betrunken von meiner eigenen Großartigkeit. Kurz: Ich verliebte mich in meine eigene Imagebroschüre.
Dann traf ich einige Entscheidungen, die mein Unternehmen ins Wanken brachten. Ich verlor einen wichtigen Kunden. Ein sicher geglaubter Großauftrag ging an einen Mitbewerber. Und, typisch für Krisen, es kam noch mehr. Offenbar hatte ich dem falschen Steuerberater vertraut, und nun forderte das Finanzamt für die letzten Jahre eine sechsstellige Nachzahlung, zahlbar binnen vier Wochen. Mein Vater wurde todkrank. Weitere Katastrophen im privaten Umfeld trieben mich in die Enge. Innerhalb weniger Wochen drohte alles zu zerbrechen, was ich mir über Jahre |12|aufgebaut hatte. Die Konten waren leer, ich stand kurz vor der Insolvenz. Und ich musste erschüttert feststellen: Die Ratschläge der Motivationsgurus halfen mir in dieser Situation herzlich wenig.
Statt aufzugeben, rappelte ich mich nach dem ersten Schock wieder auf und analysierte, was falsch gelaufen war. Schnell stellte ich fest, dass ich nicht der Einzige war, der eine solche Bruchlandung erleben musste – im Gegenteil: Viele Senkrechtstarter waren irgendwann durch eine harte Schule gegangen. Gerade für Menschen, die wir heute bewundern und manchmal um ihren nachhaltigen Erfolg beneiden, war der Weg zum Gipfel alles andere als ein Spaziergang. Von ihnen lernte ich die wahren Erfolgsgeheimnisse der Überflieger.
Auf den folgenden Seiten möchte ich weitergeben, was mir selbst geholfen hat. Heute bin ich glücklich und dankbar, schon eine ganze Weile wieder Erfolg zu haben. Wenn ich auf der Bühne stehe, mit dem Ziel, Menschen in den unterschiedlichsten Unternehmenssituationen neue Motivation zu geben, soll das den Zuhörern Spaß machen und sie gut unterhalten. Aber ich weigere mich, sie mit billigen Rezepten und emotionalen Trostpflastern einzulullen. Bei mir erfahren sie die ganze Wahrheit. Das gilt auch für dieses Buch.
Frust und Niederlagen gehören zum Leben dazu. Mein Vater, der 15 Jahre voller Zuversicht gegen den Krebs kämpfte und am Ende doch verlor, wusste das als Nachkriegskind schon früh. Ich brauchte mehr als drei Jahrzehnte, um es zu lernen. Doch nur wer bereit ist, die rosarote Brille abzusetzen und sich den Realitäten zu stellen, wird die Erfahrung machen, dass aus Bruchlandungen Neustarts werden können und aus Niederlagen große Erfolge. Anlässe zum Feiern und Genießen gibt es dann immer noch viele, denn auch das gehört zum Leben unbedingt dazu.
Ihr Rolf Schmiel
Essen, im August 2014|13||14|
Teil I
Die Wahrheit über Spitzenleistungen
»Die Basis allen Wollens aber ist Bedürftigkeit, Mangel, also Schmerz.« Arthur Schopenhauer|15||16|
Das Erfolgsrezept der Senkrechtstarter
»Ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden«, sagte Harry Belafonte einmal. Belafonte kam als Sohn eines Matrosen und einer Hilfsarbeiterin 1927 im Schwarzenghetto von Harlem zur Welt. Die schlechte Nachricht für alle Teilnehmer heutiger Castingshows und Superstarwettbewerbe: Vor seinem märchenhaften Aufstieg in den Fünfzigerjahren schlug sich Belafonte unter anderem als Fahrstuhlführer und Verkäufer durch – und er arbeitete hart für seinen Erfolg, etwa durch den Besuch einer ambitionierten Schauspielklasse, in der auch Marlon Brando oder Rod Steiger an ihrem Erfolg bastelten.1 »Senkrechtstarter« sind häufig schon eine ganze Weile unterwegs und haben eine Menge getan, bevor sie scheinbar plötzlich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregen. Die Wahrheit hinter märchenhaften Erfolgen ist häufig alles andere als märchenhaft. Doch wir alle lieben den Mythos vom hässlichen Entlein, das über Nacht zum schönen Schwan wird, oder vom gehemmten Handyverkäufer, der von jetzt auf gleich als Tenor groß herauskommt und Millionen zu Tränen rührt wie Paul Potts. Dass Potts ein Jahrzehnt in verschiedenen Chören sang, schon früh privat Gesangsunterricht nahm und vor seinem großen Erfolg einen ersten Talentpreis von 8 000 Pfund komplett in Gesangsunterricht an italienischen Opernschulen investierte, wird dabei gern übersehen. Zwischen Potts’ erstem kleinen Erfolg in der Talentshow My Kind of Music und seinem Sensationsauftritt in Britain’s Got Talent lagen immerhin acht Jahre!2 Wer sich unter den Supererfolgreichen genauer umsieht, erkennt also schnell: Das »Erfolgsrezept« |17|gibt es ebenso wenig wie das Rezept zum Goldmachen, nach dem Alchimisten in aller Welt jahrhundertelang suchten. Statt eines todsicheren Rezepts gibt es eine Reihe von Zutaten, die großen Erfolgen den Weg ebnen – oder auch nicht, wenn das nötige Quäntchen Glück fehlt. Schnallen Sie sich also an für den Senkrechtstart zum Erfolg: Sie müssen jetzt sehr tapfer sein!
Willenskraft – Einsatz, bis der Arzt kommt
Im Februar 2014 porträtierte das manager magazin Topmanager und andere Prominente »im Unruhestand«, zum Beispiel den früheren Fresenius Medical Care-CEO Ben Lipps, der trotz seiner 73 Jahre lieber ein Berliner Start-up mit 18 Mitarbeitern leitet, als in Florida die Sonne zu genießen, den Modeschöpfer Karl Lagerfeld, der auch mit 80 noch Chefdesigner bei Chanel ist, oder Ex-Spiegel-Chef Stefan Aust, der sich mit 67 auf das Himmelfahrtskommando einließ, Die Welt als Herausgeber aus der Krise zu führen. Man braucht also gar nicht über den großen Teich zu schauen, wo Warren Buffett auch mit 83 noch Tag für Tag ins Büro geht. Während in Deutschland gerade mal wieder über die Rente mit 63 diskutiert wird, ist für manche Menschen der Ruhestand offenbar ein Schreckgespenst: »Im Ferienhäuschen aufs Meer blicken, das würde ich keine zwei Tage aushalten«, sagt Linde-noch-CEO Wolfgang Reitzle.3
Hinter vielen außergewöhnlichen Erfolgen steckt schlicht – Arbeit, Arbeit, Arbeit. »Erfolg hat nur der, der etwas tut, während er auf den Erfolg wartet«, beschied Thomas Alva Edison seinen Bewunderern. Ausgesprochen erfolgreiche Menschen gehen nicht selten in ihrer Tätigkeit auf und können daher mit 63, 67 oder 70 den Schalter nicht einfach umlegen. »Ich fange immer noch fast jeden Tag um vier Uhr früh an zu arbeiten«, sagt Ben Lipps. Sie können natürlich im Lotto gewinnen, erben oder reich heiraten. |18|Doch darüber hinaus gilt: Die Hoffnung auf den bequemen Aufstieg ist Augenwischerei. Vor einiger Zeit hatte ich einen jungen Existenzgründer im Coaching, der mit dem Anliegen kam: »Wie kann ich mehr Erfolg haben?« Auf die Frage, wie sein Tagesablauf aussähe, beschrieb er mir ein eher gemütliches Leben: Frühstück mit der Familie, gegen halb zehn im Büro und nach dem Rechten schauen, ein paar Dinge regeln, spätestens um 17, 18 Uhr wieder nach Hause, Zeit für Hobbys und Familie. Er hatte ein glückliches Händchen bei der Wahl seiner Mitarbeiter bewiesen, die früher kamen und häufig nach ihm das Büro verließen. Und wo sein Problem sei, wollte ich wissen. »Es läuft eigentlich ganz gut, aber ich hatte mir vorgestellt, dass der Laden abgeht wie eine Rakete.« Nur braucht eine Rakete mächtig viel Treibstoff, um im Bild zu bleiben.
Work-Life-Balance ist der garantierte Weg in die Mittelmäßigkeit. Oder kennen Sie jemanden, der seine Hobbys pflegt, genug Zeit für die Familie hat, Sport treibt und auf seine Gesundheit achtet, sich ehrenamtlich engagiert, seine Spiritualität lebt – und beruflich supererfolgreich ist? Ich nicht. Senkrechtstarter setzen zumindest phasenweise alles auf eine Karte, gleichgültig, ob sie im Showbusiness, im Leistungssport oder in der Wirtschaft unterwegs sind. Das bedeutet weder, dass am Lebensmodell des gemütlichen Existenzgründers irgendetwas falsch ist, noch, dass das Lebensmodell von Ben Lipps für jeden das richtige ist. Es bedeutet nur, dass man im Leben nicht alles (zumindest nicht auf einmal) haben kann. Das ist weder neu noch spektakulär, das wusste wahrscheinlich schon Ihre Großmutter. Umso erstaunlicher ist es, dass durchschnittlich intelligente und gut ausgebildete Mitteleuropäer immer noch Motivationsgurus auf den Leim gehen, die ihnen vorgaukeln, mit der richtigen »Programmierung ihres Unterbewusstseins« werde sich ihr Erfolg quasi im Schlaf einstellen (vgl. Teil II). Dazu die Gründerin eines Kosmetikimperiums Estée Lauder, die ihre ersten Cremes in der elterlichen Küche zusammenrührte: »Ich habe niemals an Erfolg geglaubt – ich habe dafür gearbeitet.« Und zwar viele Jahrzehnte und mit einem genialem Gespür für Marketing.4|19|
No pain, no gain
»Ich kann mich noch quälen« ist ein Interview überschrieben, das Tennisprofi Tommy Haas, 35, dem Spiegel im Januar 2014 gab. Haas war zu dem Zeitpunkt 12. der Weltrangliste und trat gegen Spieler an, die wenig mehr als halb so alt waren. Auf die Frage, warum er sich das noch antue, antwortete der Gewinner von 15 ATP-Titeln, einer olympischen Silbermedaille und zweifache World-Team-Cup-Sieger: »Wenn die Schmerzen irgendwann unerträglich werden, wenn du merkst, dass sich jeder zweite Tag anfühlt wie die Hölle, dann solltest du aufhören. (…) Gerade geht es. Im vergangenen Jahr gab es immer mal wieder eine ganze Woche, in der ich kaum Schmerzen hatte.« Während der Normalo über eine Woche mit Schmerzen jammert, freut sich der Top-Performer also über eine gelegentliche Woche ohne. Der Tagesablauf von Haas: »An einem normalen Trainingstag stehe ich vier Stunden auf dem Platz. Um fünf Uhr abends bin ich fertig, dann kommen Physiotherapie, Massagen und Reha. Oft muss ich nach dem Abendessen noch zwei Stunden dranhängen, da bin ich dann selten vor elf Uhr im Bett.«5 Anderen Spitzensportlern geht es nicht anders. Während ich diese Zeilen schreibe, kann man lesen, dass der russische Megastar des Eiskunstlaufs, auf dem bei den Winterspielen 2014 alle nationalen Hoffnungen ruhten, bereits zwölf Operationen hinter sich hat und einen Rücken, der von einem Kunststoffimplantat zusammengehalten wird. »Sport ohne Schmerzen, das geht nicht«, sagt Jewgenij Pljuschtschenko.6 Ich fürchte, das gilt nicht nur für Erfolge im Leistungssport, sondern auch für Höchstleistungen anderswo.
In Zeiten der Burn-out-Debatte und angesichts ständiger Hinweise auf die Zunahme stressbedingter psychischer Erkrankungen ist die Forderung nach überdurchschnittlichem Engagement fast eine Provokation. Tatsächlich ist der Grad zwischen erfüllendem Ausleben von Ambitionen und ungesundem Workaholismus schmal. Ob »Arbeit, Arbeit, Arbeit« einen Menschen glücklich oder unglücklich macht, hängt vom persönlichen Wertekostüm ebenso ab wie |20|vom Grad der Selbstbestimmung. Ehrgeizige Menschen mit hohem Leistungs- und Machtmotiv und ausgeprägter Handlungsorientierung haben weniger Probleme damit, anderes zugunsten der Arbeit zurückzustellen, als etwa Menschen mit einem hohen Bedürfnis nach Ruhe und harmonischen Sozialkontakten. So zeichnen sich beispielsweise erfolgreiche Existenzgründer durch die erstgenannten Eigenschaften aus, wie der Osnabrücker Psychologe Elmar Koetz in einer Langzeitstudie nachwies.7 Und Menschen, die sich als unabhängig erleben, verkraften ein hohes Arbeitspensum besser als Menschen, die sich Zwängen ausgesetzt sehen. Dies führt paradoxerweise dazu, dass Selbstständige auch dann zufriedener mit ihrer Arbeit sind, wenn sie mehr arbeiten und weniger verdienen als Angestellte – zumindest dann, wenn sie die Selbstständigkeit freiwillig gewählt haben und nicht als Notausgang aus der Arbeitslosigkeit. Belegt wird dies unter anderem durch eine Studie der Hamburger Psychologinnen Katrin Cholotta und Sonja Drobnic, die 750 Gründer(innen) befragten.8 »Wer selbstbestimmt lebt und arbeitet, bleibt gesund«, unterstreicht auch Lothar Seiwert, bekannt geworden als Experte für Zeitmanagement und inzwischen zum Rufer für bewusste Lebensführung geläutert.9
Wer Leistung und Lebensglück verbinden will, muss sich nicht selbstständig machen – Krux ist vielmehr, »sein Ding« zu finden, eine Tätigkeit also, die mit eigenen Talenten und Interessen harmoniert. Denken Sie nur an den Kranführer (59), der einer Stern-Reporterin sagt: »Ich bin eins mit meinem Job. Ich weiß nicht, ob ich mit 65 in Rente gehe. … Aus Spaß habe ich zu meinen Kollegen schon mal gesagt: ›Ich möchte mal auf meinem Kran sterben.‹«10 Wer sein Gehalt hingegen als Schmerzensgeld empfindet, wird sich eher schwertun mit einem wirklich großen Wurf im Beruf. Hat man seine Berufung gefunden, löst sich auch das Problem der Selbstmotivation. Der Kranführer hat wahrscheinlich ebenso wenig Probleme, morgens aus dem Bett zu kommen, wie Ben Lipps mit seinem Medizin-Start-up oder der umtriebige Richard Branson, der ein ver|21|rücktes Projekt nach dem anderen anzettelt und zurzeit an einem Shuttleservice ins All bastelt (mit 63). Keiner von ihnen muss seine Willenskraft mühsam wie einen Muskel trainieren, wie neuere Publikationen empfehlen.11
Nicht jeder, der sehr viel arbeitet, ist also zwangsläufig ein Workaholic. Zum Thema »Arbeitssucht« sind in den letzten Jahren zahlreiche Publikationen erschienen. Kleinster gemeinsamer Nenner: Gefährlich wird Arbeit dann, wenn der Betroffene sich in einen Teufelskreis von zwanghaftem Schuften befindet, wenn Arbeit körperlich krank macht, wenn Arbeit keine Befriedigung mehr bringt, sondern oft sogar von Erfolglosigkeit begleitet wird, was der echte Workaholic zu bekämpfen sucht, indem er die Dosis erhöht und noch mehr arbeitet.
Krankhaft Arbeitssüchtige auf den ersten Blick von bloßen »Vielarbeitern« zu unterscheiden ist nicht einfach. Die US-Wirtschaftsprofessoren Stewart D. Friedman und Sharon Lobel postulieren den Typus des »happy workaholic«, der Erfüllung in der Arbeit findet, ohne sein eigenes Lebensmodell zu verabsolutieren und sein Umfeld mit seinen überzogenen Arbeitsansprüchen zu terrorisieren. Sie verweisen auf das eigene Wertekostüm als entscheidenden Handlungsauslöser und Motivator.12 Krankhafte Arbeitssucht dagegen erwächst häufig aus einem Erziehungsstil, der Liebe an Leistung koppelt, oder umgekehrt aus mangelnder Anerkennung für erbrachte Leistungen.13 Spätestens wenn jemand tatsächlich arbeitet, bis immer häufiger der Arzt kommen muss, besteht also Suchtgefahr. Ebenso, wenn das Arbeitspensum nur noch mit begleitenden anderen Drogen zu schaffen ist, beispielsweise mit »Cola, Koks und Ritalin«, wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung einen Artikel zum Thema Doping im Büro überschrieb.14
Fazit: Wer außergewöhnlich erfolgreich ist, hat meistens außergewöhnlich viel dafür getan. Dabei ist es wichtiger, über eine lange Strecke in Fahrt zu bleiben, als zum Start Vollgas zu geben. Neben der Willenskraft, hart zu arbeiten, braucht es außerdem die Wil|22|lensstärke, sich nach Misserfolgen wieder hochzurappeln und weiterzumachen, darin sind sich Erfolgsmenschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen einig.
Bekenntnisse einiger Aufsteiger15
»Mein Ticket aus den Berliner Hinterhöfen war Bildung, Wissen, Glück und jede Menge harte Arbeit.«
Cherno Jobatey, Journalist
»Ich gehe für meine Ideen durch die Hölle.«
Ibrahim Evsan, Unternehmer und Gründer von sevenload
»Man muss wie eine Bulldogge sein.«
Erman Tanyildiz, Gründer der OTA Hochschule
»Ich gebe nie auf.«
Prof. Dr. Ulrike Detmers, Wirtschaftswissenschaftlerin und Managerin
»Nur das gut Gemachte zählt, nicht das gut Gemeinte.«
Bodo Hombach, Landes- und Bundesminister, langjähriger Geschäftsführer der WAZ-Mediengruppe
»An Problemen wachse ich.«
Dr. Carl-Heiner Schmid, Vorarbeiter, leitender Mitarbeiter, Geschäftsführer und schließlich Alleingesellschafter der Firmengruppe Heinrich Schmid|23|
»Ich muss immer etwas bewegen.«
Joachim Hunold, Gründer von Air Berlin
»Man muss dranbleiben.«
Ingrid Hofmann, Gründerin eines Zeitarbeitsunternehmens
Willensstarke Menschen sind hartnäckig. Sie geben nicht gleich auf, wenn sie im ersten Anlauf erfolglos sind. Der amerikanische Motivationstrainer Jim Rohn hat diese Fähigkeit einmal »Ameisen-Philosophie« genannt. Legt man einer Ameise ein Hindernis in den Weg, lässt sie nicht einen Moment betrübt die Fühler hängen, sondern sucht sofort nach einem Weg, die Barriere zu überwinden: vielleicht rechts oder links vorbei, drüber oder drunter her? Eine Ameise gibt niemals auf. Sie grübelt ganz offensichtlich nicht darüber nach, warum das ausgerechnet ihr passieren musste. Und beim nächsten Hindernis verfährt sie genauso.16 Im Abschnitt 4 (»Risiko – Der Spieler im Sieger«) werden Sie sehen, wie viele Anläufe vermeintliche Senkrechtstarter oft nehmen mussten, bis sie erfolgreich waren.
Schnell-Check Willenskraft
Haben Sie »Ihr Ding« schon gefunden? Dann fällt es Ihnen leichter, durchzuhalten.
Sind Sie bereit, früher aufzustehen und länger zu arbeiten als andere? Damit wachsen Ihre Erfolgschancen.
Wie viele Rückschläge sind Sie bereit, in Kauf zu nehmen? Nur selten glückt ein wichtiges Projekt im ersten Anlauf.|24|
Durchhalten, viel arbeiten, diszipliniert sein – mir ist bewusst, dass dies ein sehr desillusionierender Rat ist. Doch das Sand-in-die-Augen-Streuen überlasse ich lieber anderen. Dass Lebenserfolg viel mit Selbstdisziplin zu tun hat, wissen Psychologen längst, auch dank des berühmten »Marshmallow«-Tests: Vorschulkinder, die es schafften, einen verlockenen Marshmallow 15 Minuten lang nicht zu essen, wenn man ihnen fürs Warten einen zweiten versprach, erwiesen sich in einer Langzeitstudie der Stanford University auch später als erfolgreicher. Auf YouTube können Sie den Kleinen dabei zusehen, wie sie verzweifelt versuchen, sich mit Wippeln und Kippeln von der Süßigkeit direkt vor ihrer Nase abzulenken.17 Auch der Psychologe Roy F. Baumeister verweist 2012 in seinem Buch Die Macht der Disziplin auf zahlreiche Studien, die belegen, dass Selbstbeherrschung entscheidender für den Lebenserfolg ist als Selbstbewusstsein oder Intelligenz.
Fokus – Alles auf eine Karte
Otto von Bismarck sagte einmal über das Geheimnis seiner Erfolge: »Ich jage nie zwei Hasen auf einmal.« Wer Großes erreichen will, muss sich fokussieren. Wir alle haben nur begrenzt Talent und Zeit zur Verfügung, und Allround-Dilettanten sind weitaus häufiger als Universalgenies. Mit »Fokus« meine ich ein Höchstmaß an Konzentration auf eine Sache und damit das Gegenteil von Verzettelung. Fokussierung kann zu grotesker Einseitigkeit führen, wie etwa im Klischee des zerstreuten Professors, der sein Fachgebiet genial beherrscht, aber an Alltagskleinigkeiten scheitert. Über Martin Winterkorn, den technikbesessenen VW-Chef, wird beispielsweise berichtet, er habe eine Veranstaltung im New Yorker Museum of Modern Art, wo er vor Megastars wie Madonna, Yoko Ono, Lou Reed oder Patti Smith auftrat, früh verlassen: »Er müsse jetzt noch den neuen Passat in Manhattan testfahren«, soll er ge|25|sagt haben.18 Mal ehrlich: Würden Sie lieber Passat fahren, als mit Madonna zu plaudern? Das erinnert ein wenig an den exzentrischen Mathematiker Grigori Perelman, der mit der Poincaré-Vermutung19 eines der sieben »Millennium-Probleme« der Mathematik löste. Das dafür ausgelobte Preisgeld von einer Million Dollar 2010 schlug er aus, weil er nicht zur Preisverleihung in die USA reisen wollte. Stattdessen verschanzte er sich weiterhin in der St. Petersburger Wohnung seiner Mutter. Perelman will nur Mathe, Winterkorn nur perfekte Autos. Für anderen Schnickschnack bleibt da keine Zeit. Im Alltag begegnen mir dagegen häufig Menschen, die mal dies, mal jenes probieren, immer kurzatmig auf der Suche nach dem großen Wurf und ohne die Bereitschaft, länger durchzuhalten und so einen Kompetenzvorsprung aufzubauen. Dazu zählen beispielsweise Vertriebler, die alle zwei Jahre die Stelle wechseln, und immer liegt es »am Produkt«, wenn der Bombenerfolg bis dahin ausgeblieben ist. Der erfolgreichste Autoverkäufer aller Zeiten, Joe Girard, ist in 15 Jahren auch nicht auf die Idee gekommen, zwischendurch auf Hochseejachten umzusatteln.
Zu schnelle Wechsel verhindern Tiefe und echte Meisterschaft. Ausnahmeerfolge setzen Konzentration und oft auch langjährige Erfahrung voraus. Der Wissenschaftsjournalist und Bestsellerautor Malcolm Gladwell rückte diesen Aspekt in seinem Buch Überflieger ins Bewusstsein, in dem er der »10 000-Stunden-Regel« ein ganzes Kapitel widmete. In Kürze besagt diese Regel: Wer etwa 10 000 Stunden etwas intensiv betreibt, hat sehr gute Chancen, darin zum »Ausnahmetalent« zu werden, und zwar gleichgültig, ob es sich dabei um ein Musikinstrument, eine Sportart oder das virtuose Knacken von Safes handelt. Erste Belege für diese Regel sammelten die Psychologen K. Anders Ericsson, Ralf Krampe und Clemens Tesch-Römer vor über 20 Jahren an der Berliner Hochschule der Künste. Sie befragten Geigestudenten, wie viel sie im Laufe ihres Lebens geübt hatten. Alle hatten mit etwa fünf Jahren zu spielen begonnen. Doch die »künftigen Musiklehrer« brachten es bis zum Alter von 20 Jahren auf etwa 4 000 Übungsstunden, die »gu|26|ten« Studierenden auf etwa 8 000 Stunden, die Virtuosen auf stolze 10 000. Auch für Komponisten, Schachspieler oder Basketballstars ließ sich diese Zahl nachvollziehen: Nach ungefähr 10 000 Stunden hat man es drauf. Und jetzt raten Sie mal, wie viele Stunden die Beatles in Hamburger Clubs auf der Bühne standen, bevor sie 1964 ihren großen Durchbruch hatten. Gladwell kommt auf 1 200 Auftritte, bei denen die späteren Weltstars als Nachtclub-Band jeweils acht Stunden für Stimmung sorgten.20 All das deutet darauf hin, dass Talent zwar nicht völlig unwichtig ist, aber gnadenlos überschätzt wird – und manchmal auch als lahme Ausrede jener herhalten muss, die sich nicht wirklich mit Haut und Haaren einer Sache verschreiben wollen. »Naturtalente«, die mühelos und ohne viel zu üben an die Weltspitze vorstießen, fanden Ericsson und seine Kollegen in verschiedenen Untersuchungen übrigens nicht.21
Der Picasso, der viel zu teuer war
Pablo Picasso wurde in einem Restaurant von einer unbekannten Dame um eine Probe seines Könnens gebeten. In nur 30 Sekunden warf er eine beeindruckend vollendete Zeichnung auf ein Blatt Papier (in manchen Versionen der Geschichte ist auch von einer Serviette die Rede). Auf die Frage, wie viel er dafür haben wolle, antwortete Picasso: »10 000 Dollar.« Die Dame hakte empört nach: »10 000 Dollar für 30 Sekunden Arbeit?!« Darauf Picasso lapidar: »Ja, aber ich habe dafür auch 30 Jahre Erfahrung gebraucht.«
Picassos Vater war übrigens Kunstlehrer, und der kleine Pablo soll schon als Kind »unentwegt« gezeichnet haben.22 Seit seinem siebten Lebensjahr wurde er von seinem Vater unterrichtet. Sein erstes Ölgemälde malte er mit neun: Es heißt »Picador«, und Sie können es sich im Internet anschauen.23 Wenn Sie jetzt überlegen, was Sie mit neun Jahren getrieben haben, wissen Sie, warum aus Ihnen oder mir kein neuer Picasso wurde. Picasso fokussierte sich sein Leben lang gnadenlos auf eine Sache – so |27|sehr, dass er seinen eigenen Sohn und seine Enkel meist vom Diener an der Haustür abweisen ließ und lieber malte.24 Viele hoch motivierte Menschen haben tatsächlich ihre dunklen Seiten – mehr dazu im zweiten Teil dieses Buches.
Wenn Ihnen das jetzt zu viel Kunst und zu wenig Wirtschaft war: Erfolgreiche Unternehmensgründer sind oftmals ebenso besessen vom Geschäft, wie es Picasso von der Malerei war. Als Aldi-Mitgründer Theo Albrecht 1971 entführt wurde, ließen sich die Kidnapper vorsichtshalber seinen Ausweis zeigen. Sie konnten nicht glauben, dass der bescheiden gekleidete Herr, dem sie vor der Firmenzentrale aufgelauert hatten, tatsächlich der gesuchte Multi-Millionär war. Theo und sein älterer Bruder Karl Albrecht waren zeitlebens für ihre Sparsamkeit berüchtigt; ähnlich wie Ingvar Kamprad, der mit IKEA steinreich wurde. Der kauft angeblich die Teelichter im billigen IKEA-Plastiksack und nutzt den Seniorenrabatt im Bus, statt sich ein Taxi zu gönnen.25 Die Energie dieser super erfolgreichen Kaufleute floss in ihr Geschäft; von Ablenkungen durch Yachten, Luxusimmobilien rund um die Welt oder Brillantcolliers für diverse langbeinige Gefährtinnen ist nichts bekannt. |28|Die Expansion ihrer Unternehmungen geht auf das Konto hoher Investitionsfreude bei geringer Konsumfreude. Bei vielen Möchtegern-Superheros von heute ist es leider genau umgekehrt.
Schnell-Check Fokus
Welches Projekt ist Ihnen so wichtig, dass Sie bereit sind, zumindest zeitweise alles dafür zu geben?
Auf wie vielen Hochzeiten tanzen Sie zurzeit? Warum?
Worauf könnten Sie zukünftig verzichten, um mehr Energie in das Vorhaben zu investieren, das Ihnen am allerwichtigsten ist?
Opfer – An der Spitze ist es einsam
Aus den beiden bisherigen Zutaten für den Senkrechtstart – Willensstärke und Fokussierung – ergibt sich die dritte schon fast zwangsläufig: Wer nach oben will, muss Opfer bringen. »Luxus« sind für Erfolgsmenschen oft ganz einfache Dinge: Zeit für die Familie, ein Abend mit Freunden, ein Tag offline. Wer Leistungssport betreibt, zahlt mit Schmerzen und langfristig oft mit seiner Gesundheit dafür. Wer international Karriere macht, wird seine Kinder nicht oft sehen und beim Aufwachen manchmal nicht wissen, auf welchem Kontinent er/sie sich gerade befindet. Wer sich seiner Kunst verschrieben hat, balanciert oft jahrelang am Rand des finanziellen Absturzes. Fraglich ist, ob hoch motivierte Erfolgsmenschen das tatsächlich als Opfer sehen: »Ich mag den Schmerz, der mich zum Sieger macht«, soll Arnold Schwarzenegger gesagt haben. VW-Chef Martin Winterkorn liest im ohnehin knapp bemessenen Urlaub am liebsten Fachbücher, etwa über Lkw-Technik oder Batteriechemie, hat der Spiegel erfahren. Und während das Morgenradio üblicherweise schon donnerstags fröhlich das nahe Wochenende für Otto und Emma Normalverbraucher einläutet, lebt Topmanagerin Marion Helmes, Finanzchefin des Arzneimittelgrossisten Celesio, die Sechstagewoche der Nachkriegszeit und kennt die gängige Brückentagsurlaubsoptimierung wenn überhaupt nur vom Hörensagen. Beiersdorf-CEO Stefan Heidenreich hingegen ist täglich um sechs im Büro, ab sieben hält er Besprechungen ab.26 Wer weiter kommen will als andere, muss offenbar auch früher aufstehen. Managementexperte Reinhard K. Sprenger hat schon vor Jahren moniert, dass viele Menschen große Ambiti|29|onen haben, aber nicht bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen. Ich fürchte, Sprenger hat recht.27 Wenn die Lust auf Verzicht fehlt, war die Motivation offenbar nicht groß genug.
Schnell-Check Opfer
Auf was haben Sie bisher verzichtet, um Ihrem Ziel näher zu kommen?
An welcher Stelle bringen Sie deutlich mehr Einsatz als Menschen in vergleichbarer Situation?
Hat Sie schon mal jemand als »übermotiviert« bezeichnet und Ihnen vorgeworfen, Sie vernachlässigten anderes?
Geradezu sprichwörtlich ist die größere Einsamkeit, die ein Leben an der Spitze mit sich bringt. Spitzenpolitiker reden ebenso notorisch wie verräterisch von »den Menschen draußen im Lande«. »Man wird einsam da oben«, bekennt auch Daimler-Chef Dieter Zetsche gegenüber dem Magazin der Süddeutschen Zeitung, eine Erfahrung, die er mit Popstar Lady Gaga oder Schauspielerin Emma Watson teilt.28 Sehr fraglich allerdings, ob einer der drei auf seinen Erfolg verzichten würde zugunsten normaler Sozialkontakte. Dafür arbeiten sie schon viel zu lange und viel zu ausdauernd an ihrer Karriere.
Der goldene Käfig
Mit einem »Vogel im Aquarium« verglich Exvorstand Daniel Goeudevert die Situation eines Topmanagers, und so heißt auch das Buch, das er nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand des VW-Konzerns schrieb. Dort heißt es: »Steigt man in der Hierarchie eines Unternehmens bis zum Vorsit|30|zenden, dann befindet man sich meist auch auf der letzten Etage des Firmengebäudes. Und je weiter man aufsteigt, desto mehr verwandeln sich die Fenster in Spiegel. Auf der letzten Stufe der Hierarchie schließlich ist man nicht nur allein, sondern man hat auch keine Fenster mehr. Der Blick auf die Außenwelt ist verwehrt. Man sieht nur noch sich selbst. Auch die Mitarbeiter, mit denen man verkehrt, stellen ständig einen Spiegel auf: Gucken Sie mal, Chef, Sie sind der Beste. Selbst wenn man versucht, sie zu Widerspruch oder Dialog zu animieren, bekommt man selten eine Resonanz, die zu weiterem Nachdenken stimuliert.« Auf dem Gipfel seiner erstaunlichen Karriere vom Autoverkäufer zum Konzernvorstand nahm Goeudevert die Schattenseiten eines Lebens an der Spitze jedoch kaum wahr: »Ich vermochte das höfische Zeremoniell nicht zu durchschauen, das auf der Vorstandsetage herrscht. Ich erkannte nicht, dass man dem Chef aus Prinzip nicht widerspricht und um ihn herum ein goldenes Gefängnis baut, das ihm unversehens zum Verhängnis werden kann. Der Mächtige weiß oft genug nichts von der schweren Goldkrone, die er trägt, und die Beziehung zu seinen Lakaien scheint ungetrübt – solange er auf dem Thron sitzt.« 29 Wer in einer Aufgabe aufgeht, verliert womöglich den Blick dafür, was er dafür opfert, und muss ab und zu von seiner Umgebung daran erinnert werden.
Risiko – Der Spieler im Sieger
»Nur wer mitspielt, kann gewinnen«, das gilt nicht nur beim Lotto, sondern auch im Spiel des Lebens um Macht und Einfluss. Wer nicht bereit ist, Risiken einzugehen, wird mit großer Wahrscheinlichkeit im Mittelmaß stecken bleiben. Darin ist an sich nichts Verwerfliches. Trotzdem sei der Hinweis gestattet, dass ein rundherum abgesichertes Vollkaskoleben wenig Chancen auf einen fulminanten Senkrechtstart bietet. Ein schönes Beispiel für Risikofreudigkeit ist Titus Dittmann. Nie gehört? Dann haben Sie |31|noch nie auf einem Skateboard gestanden. Dittmann gilt als Vater der Skateboard-Szene in Deutschland. Diesen Ehrentitel erwarb er durch zahlreiche Aktivitäten und etliche Unternehmensgründungen: einen der ersten Skateshops Europas, den ersten deutschen Outdoor-Skatepark, das erste Skateboardteam in Europa (»Titus Show Team«), eines der weltweit wichtigsten Skateboard-Turniere (die »Münster Monster Mastership«), ein Veranstaltungszentrum (»Skaters Palace«), die Titus AG mit bundesweit 30 Läden, die Titus Mailorder GmbH, ein Jugend-Lifestyle-Kaufhaus, um nur einige Beispiele zu nennen. Der umtriebige Unternehmer erhielt Orden und Preise und lieferte Stoff für einen Kinofilm mit dem schönen Titel »Brett vorm Kopp«. Das Interessante: Dittmann startete in einem Beruf, der nicht unbedingt für seine Risikofreudigkeit bekannt ist: als Lehrer. Er unterrichtete vier Jahre lang als Studienrat, bevor er Beamtendasein und sichere Pension sausen ließ. 30
Ist Dittmann ein Zocker, der alles auf die Skateboard-Karte setzte? Nein. Bei genauerem Hinsehen ging Dittmann Risiken sehr kontrolliert ein. Er handelte bereits sechs Jahre mit Boards31 und hatte schon diverse Aktivitäten gestartet, bevor er den Beamtenjob hinwarf. Er kannte sich in der Szene bestens aus. Er setzte auf kontinuierliches Wachstum. Doch ein Risiko blieb die Unternehmung. Als der Skateboard-Boom Ender der Achtzigerjahre abebbte, geriet das Unternehmen in eine erste Krise. 2002 bis 2007 folgten weitere schwere Jahre, Dittmann schlitterte knapp an einer Insolvenz vorbei und löste seine Lebensversicherungen auf, um das Unternehmen zu retten.32 Die Kehrseite eines Senkrechtstarts ist die mögliche Bruchlandung, das eine ist ohne das andere kaum zu denken.
Die Niederlagen der Gewinner – schöner scheitern!
Die Liste prominenter Senkrechtstarter, die empfindliche Niederlagen erleiden mussten, ist lang. Steve Jobs geht eigentlich immer als Beispiel, so |32|auch hier: 1985 wurde er aus seiner eigenen Firma geworfen, erst Jahre später kehrte er zu Apple zurück. Vladimir Nabokov bekam von einem puritanischen Verleger den Rat, sein Manuskript zu Lolita unter einem dicken Stein zu vergraben, und zwar möglichst »für tausend Jahre«.33 Heute zählt der Roman zur Weltliteratur. Henry Fords erstes Unternehmen, die »Detroit Automobile Company«, war nach wenigen Jahren pleite. Buchstäblich an Niederlagen gewöhnt war Winston Churchill. Er fiel 1892 zwei Mal durch die militärische Aufnahmeprüfung, war 1899 beim ersten Versuch, ins Unterhaus einzuziehen, erfolglos, musste 1915 als Marineminister zurücktreten, verlor 1922 aufgrund der Wahlniederlage seiner Partei wieder sein Ministeramt, was ihm 1929 erneut passierte. Weitere Niederlagen warteten auf ihn, aber auch der Posten des britischen Premierministers und ein Nobelpreis (für Literatur). Walt Disneys erste Filmfirma floppte, für weitere Projekte fehlte ihm das Geld. Für seine anschließende Idee eines »Trickfilms mit sprechenden Tieren« hätte er um ein Haar keinen Geldgeber gefunden.34 Und Fred Astaire bewahrte auf dem Kaminsims die Notiz eines Aufnahmeleiters von Metro Goldwyn Meyer auf. Der hatte über den legendären Tänzer 1933 notiert: »Kann nicht spielen! Etwas kahlköpfig! Kann ein bisschen tanzen!«35
»Resilienz« nennen Psychologen die Fähigkeit, nach Misserfolgen wieder aufzustehen und unbeirrt weiterzumachen. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Physik und bezeichnet die Eigenschaft eines Werkstoffs, auf Druck nachzugeben und danach wieder in die ursprüngliche Form zurückzufinden. Menschen, die über ein hohes Maß an Resilienz verfügen, rappeln sich nach Tiefschlägen wie ein Stehaufmännchen wieder auf. Ihre psychische Widerstandsfähigkeit wird gespeist durch Realitätssinn, eine optimistische Grundhaltung, Lösungsorientierung und Übernahme von Eigenverantwortung. Resiliente Menschen fragen bei Misserfolgen also eher »Was kann ich jetzt tun?« als »Warum musste das ausgerechnet mir passieren!?«.
Hinzu kommt: Manches, was im Nachhinein wie eine geniale |33|Strategie aussieht, ist in Wahrheit das Ergebnis geduldigen Ausprobierens und Tüftelns. Für das Gag-Feuerwerk, das ein Comedian auf der Bühne entzündet, werden im Team Hunderte von Witzen geschrieben und ausprobiert. Die allermeisten erweisen sich im Praxistest als Blindgänger und verschwinden in der Versenkung. Jedes Jahr erscheinen rund 200 neue Parfums, mehr als 90 Prozent werden nach kurzer Zeit wieder vom Markt genommen.36