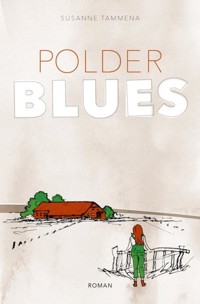Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Im Oktober 2020 kennt die Medienwelt nur zwei Themen: die Coronapandemie und der sich dramatisch zuspitzende amerikanische Präsidentschaftswahlkampf. Doch Ines Lohmann, Journalistin und alleinerziehende Mutter, beschäftig ein ganz anderes Problem. Ihre Tochter wird bald sechzehn und dann wird sie ihr endlich verraten müssen, wer ihr Vater ist. Eine komplizierte Angelegenheit, obwohl sie ihr doch schon vor langer Zeit erzählt hat, dass kein geringerer als der amerikanische Präsident für ihre Zeugung verantwortlich ist und sein Konterfei mit weißem Stetson vor dem Sternenbanner völlig zu Recht einen Ehrenplatz im Kinderzimmer hatte. Wenn es mit der Wahrheit doch so einfach wäre…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Tammena wurde 1975 in Leer in Ostfriesland geboren. Nach dem Studium der Geschichte an der FernUniversität in Hagen war sie einige Jahre als freiberufliche Journalistin tätig. Seit 2016 arbeitet sie als Vertretungslehrerin und nebenbei als Schriftstellerin.
Sie lebt mit ihrem Ehemann und den gemeinsamen Kindern in der Nähe von Leer auf dem Land.
Sex mit George W. Ist ihr dritter Roman.
Ebenfalls von Susanne Tammena sind erschienen:
Polderblues, November 2021, ISBN 798-3-7549-2703-8
Corona & Amore –
Liebe in Zeitendes Lockdowns,Januar 2021, ISBN 798-3-7531-5349-0
Für Monique
1. Ausgabe Juli 2022
Texte: Copyright by Susanne Tammena
Verlag:
Susanne Tammena
Dorenborg 3
26810 Westoverledingen
Umschlaggestaltung und Satz:
Copyright by Monique Meyer,
www.mmgrafikdesign.com
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Prolog
Heute am späten Nachmittag kam Willemina aus dem Reitstall und fragte mich, ob ich vom neuesten Gezwitscher Donald Trumps gehört hätte. Hatte ich nicht, obwohl es mich von Berufs wegen natürlich etwas anging, und ich hörte ihr pflichtschuldigst zu, nur um den Inhalt des Tweets sofort wieder zu vergessen, weil ich mich nebenbei bereits mit der Frage beschäftigte, wie sie es auf dem Rücken eines Pferdes schaffte, die News auf ihrem Handy zu checken. Es war weder die Meldung verschärfter Rassengesetzgebung, noch die Ankündigung eines atomaren Erstschlags gegen den Iran, und gegen alle anderen Meldungen, die in der Wahrnehmung empfindlicherer Gemüter vermutlich ebenso höchste Empörung verdient hätten, war ich inzwischen so abgestumpft, dass mein Geist sie kaum noch für erinnerungswürdig befand. Während meine Tochter entrüstet weitersprach, kehrten meine Gedanken zumindest zu ihrem Thema zurück und ich dachte darüber nach, dass für den Präsidenten endlich ein soziales Netzwerk namens „Thunder“ geschaffen werden müsste. Es wunderte mich, dass er selbst bisher noch nicht den Wunsch geäußert hatte. Zweifellos wäre er dankbar, wenn seine Meinung endlich – sagen wir – von Thors Hammer verkündet würde und nicht mehr aus dem Schnabel eines blauen Vögelchen geflattert käme. Im Jahr 2020 dürfte das doch eigentlich kein unerfüllbarer Wunsch mehr sein, oder?
„Hast du wirklich nichts dagegen, Mama?“
Willeminas plötzlich jubilierender Tonfall schreckte mich aus meinen Gedanken an martialisch geschwungenes Werkzeug auf und mir wurde bewusst, dass ich unablässig zustimmend genickt hatte, um ihr das Gefühl voller Aufmerksamkeit zu vermitteln.
„Wie bitte? Wogegen?“, fragte ich alarmiert.
„Dass ich nach Brandenburg fahre, zu dem Western-Treffen…“, wiederholte sie ebenso genervt wie enttäuscht. Sie hatte mich längst durchschaut. Schön, inzwischen war also Willemina wieder beim Reiten gelandet, während ich mir Gedanken über Trumps Twitter-Gewitter machte.
„Wann soll das sein?“, fragte ich streng, mich innerlich auf meine Rolle als verantwortungstragende Verbieterin einstellend.
„Die letzte Oktoberwoche.“
Willeminas Stimme hatte sich in leiser Resignation gesenkt.
„Das ist mitten in der Schulzeit! Kommt gar nicht in Frage!“, lehnte ich kathegorisch ab.
„Wenigstens das Wochenende?“, hakte sie nach, doch ich winkte schon ab.
„Das lohnt sich doch überhaupt nicht.“
Ich wusste zwar nicht so genau, was dort stattfinden sollte – irgend etwas mit Pferden, soviel war klar – und „Brandenburg“ als Ortsangabe war auch nicht unbedingt sehr aussagekräftig, aber ich persönlich finde eine zurückzulegende Strecke von hundert Kilometern für ein Wochenende schon zuviel, also wollte ich mich gar nicht erst auf Diskussionen einlassen.
Es ist bereits Oktober, aber noch immer warm und sonnig, so dass Willemina ohnehin fast jeden ihrer ungezwungenen Schülerinnennachmittage auf dem Reitplatz oder den angrenzenden Waldwegen verbringt. Da muss es ja wohl nicht extra Brandenburg sein!
Obwohl seit Monaten nur zwei Themen, die Pandemie und der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf, die Medien beherrschen, das allerdings in einem Maße, dass die täglichen Wiederholungen jedem einigermaßen gut informierten Bundesbürger bereits physische Schmerzen bereiten, kreisen meine Gedanken in selbstquälerischer Weise um ein ganz anderes Problem. Und das seit Wochen. Genau genommen seit Jahren. Dieses Sorgentürmchen spitzt sich in meinem Hirn in einer immer enger werdenden Spirale zu, in seinem Zentrum der entscheidende Tag, das entscheidende Datum, auf das die Geschichte hinauslaufen wird - der 13. August 2021.
Es sticht mir in meinen Alte-Weiße-Frauen-Bauch. Seit einigen Jahren leide ich unter zunehmender Mittelitis, wie John Updike es einmal über eine seiner weiblichen Hauptfiguren gesagt hatte, über Rabbits Frau, die kleine, harte, braune Nuss. Ich bin nicht klein und nicht braun, sondern langbeinig und blond, und früher bin ich auch einmal sehr schlank gewesen. Eigentlich bin ich es noch immer, nur meine Mitte nimmt zu und nimmt mir damit einen bedeutenden Teil meiner ohnehin nicht sehr üppigen Weiblichkeit. Seit einiger Zeit beneide ich meine alte Schulfreundin Barbara um ihre ausladenden Hüften, die dafür sorgen, dass es die Mittelitis niemals schaffen wird, etwas an der grundsätzlich gegebenen Eieruhrform zu ändern.
Meine eigene Identität als inzwischen mittelalte, weiße Frau ohne Migrationshintergrund macht mir das Leben und insbesondere die Erklärung, die ich hier abgeben will, gerade sowieso nicht unbedingt leichter. Denn wer interessiert sich schon für alte weiße Frauen? Wer sollte schon Lust haben, etwas über sie zu lesen? Die Lebensgeschichte einer Person, die zu der sozialen Gruppe gehört, die eindeutig die Mehrheit stellt? Ja, die Mehrheit! Wir Frauen sind weltweit natürlich immer in der Überzahl, weil wir zäher sind und außerdem nicht ständig Kriege führen müssen, in denen dann ein nicht unerheblicher Prozentsatz sterben würde. Trotz des bundesdeutschen Pazifismus – okay, Kosovo, Afghanistan, aber da liegen die Todeszahlen ja überschaubar bei einigen Dutzend, die zählen eher nicht – sind wir Frauen natürlich auch in Deutschland in der Überzahl, wir weißen Frauen hierzulande sowieso und wir älteren weißen Frauen ganz besonders, falls ihr es noch nicht wisst - wegen unserer zähen Langlebigkeit, wir unterziehen uns mehr Krebsvorsorgeuntersuchungen und sterben seltener am Herzinfarkt.
Glaubt man den queeren oder zumindest feministischen BIPoCs, die relativ regelmäßig in der linksliberalen Presse, die ich bevorzugt lese, zu Wort kommen, will einfach niemand mehr etwas von uns hören oder lesen, unsere Zeit ist abgelaufen, wir sind nur noch als schweigendes Publikum gefragt, aber nicht mehr dazu bestimmt, das Wort selbst zu erheben, denn wir sind die fleischgewordene Langeweile, unsere Lebensgeschichten so über- wie durchschaubar, und dabei so widerwärtig privilegiert, dass man nicht einmal ein Gähnen daran verschwenden sollte. Es betrübt mich, natürlich, auf diese Art an den Rand des Geschehens gedrängt zu werden. Ich wollte immer herausragen, immer lieber der Big Fish im small Teich sein, als unter Tausenden gleich guten, gleich hübschen, gleich qualifizierten Fischchen meinen Beitrag zur Schwarmintelligenz zu leisten. Das hat leider nicht geklappt und jetzt schwimme ich als langer, weißer Fisch mit zunehmenden Bauchproblemen in einem großen Schwarm dahin, alle so gleich weiß und lang und mittig verdickt wie ich, dass sich ein Grizzli kaum die Mühe machen würde, hinzuschauen, bevor er mit der Tatze eine von uns aus dem Fluss reißt. Meine Identität ist zur Identitätslosigkeit verkommen und der Schlamm der Gesichtslosigkeit, in den ich und meinesgleichen nach über Jahrhunderte ausgelebter Dominanz – Welche Dominanz? War Feminismus nicht gestern noch ein ehrbares politisches Programm? – hineingehören, arbeitet daran, mich endlich zu verschlingen, obwohl das Bild natürlich nicht genau passt, weil Schlamm nur in schwarzer und brauner Form existiert, weißer Schlamm ist mir noch nie untergekommen. Vielleicht ist es gerade deshalb so schwer, eine echte, ernstzunehmende Gleichberechtigung aller möglichen Hautfarben zu etablieren. White Trash findet in der Natur einfach kein Äquivalent.
Ich schwimme also so konturlos wie Eierstich – ein Weibchen ohne weiblichen Reiz – in einer trüben Suppe herum, die es mir zunehmend erschwert, wahrgenommen zu werden – nicht zuletzt weil inzwischen jeder Fisch glaubt, er wäre ein fetter, egal ob mit oder ohne Mittelitis – und hoffe trotzdem, dass mir jemand zuhört. So, please, be kind!
Wie jede verantwortungbewusste Bundesbürgerin – ich versuche gerade, mir berufsbedingt das generische Maskulinum abzugewöhnen, aber nur die weibliche Form ist vielleicht zu einseitig, auch wenn ich von mir als Frau unter Frauen spreche? – also vielleicht besser: wie jedes verantwortungsbewusste Mitglied der Bundesbürgerschaft, das die Nachrichten wider besseres Wissen dann doch einschaltet und die immer abstruser werdenden Aktionen und Behauptungen des amerikanischen Präsidenten verhalten sensationslüstern konsumiert, ein wenig verschämt natürlich und hinter vorgehaltener Hand, aber eben doch jeden neuen Aufreger des Tages als ein wundersames Digestiv genießend, welches es schafft, den zähen Klumpen unverdaulicher Coronameldungen im kommunalen Verdauungstrakt zu zersetzen, zwinge auch ich mich, die Nachrichten zu schauen und beide Themen – Corona und Trump – als Betäubungsmittel gegen den Schmerz in meinen Eingeweiden zu nutzen, die der Gedanke an den 13. August in mir auslöst.
Am 13. August wird Willemina sechzehn Jahre alt. Und dann wird sie eine Antwort haben wollen. Vielleicht nicht sofort, denn das Fragen hat sie sich schon lange abgewöhnt, weil ich ihr oft genug keine Antwort gegeben habe, oder aber solche, die sie nicht akzeptieren konnte. Aber mit sechzehn, so steht es im Bürgerlichen Gesetzbuch der Bundesrepublik, hat ein Kind das Recht darauf zu erfahren, wer sein biologischer Vater ist. Und in Willeminas Fall bedeutet das, überhaupt etwas zu erfahren, denn einen Vater, ob biologisch oder sozial, hat es in ihrem Leben nie gegeben.
Meine wunderschöne Erzählung über ihre Empfängnis, in der der amerikanische Präsident – der damalige natürlich und nicht der gegenwärtige mit der blonden Tolle, über den sich vermutlich auch in hundert Jahren noch keine schönen Märchen erzählen lassen werden – eine entscheidende Rolle spielt, wollte sie nicht mehr hören, nachdem sie dumm genug gewesen war, sie in der Schule weiterzuerzählen, und weder ihre Mitschüler noch ihre Lehrerin ihr geglaubt hatten, dass sie die Tochter von George W. Bush sei. Dabei entsprach die Geschichte so sehr der Wahrheit, wie es einem Märchen überhaupt nur gelingen kann, sich einer wie auch immer gearteten Wahrheit anzunähern.
Für mich wird Willemina immer George W.s Tochter bleiben. Und welche andere Wahrheit ich ihr am 13. August präsentieren werde, oder aber an einem anderen Tag, an dem sie auf die Idee kommen wird, eine Antwort einzufordern, – lange wird es nicht dauern, sie ist ein schlaues Mädchen und wird ihre Rechte schnell erfasst haben – diese Entscheidung schiebe ich seit Wochen vor mir her. Prokrastination nennt man so etwas, ein Wort so sperrig, dass es in jedem Türrahmen stecken bleibt und deswegen wohl auch in meinem Hirn gefangen ist, obwohl mir Fremdwörter aller Art sonst immer entfallen und während meiner kurzen Zeit in der Redaktion der Morgenpost das Duden-Fremdwörterlexikon mein treuester Begleiter war. Die Angewohnheit, mit Fremdwörtern um sich zu schmeißen, gehört glücklicherweise inzwischen in die Mottenkiste der Rhetorikgeschichte, auch Endungen, mit deren Hilfe man einmal zweifelsfrei Substantive bestimmen konnte, geraten mehr und mehr ins Hintertreffen. Aus der „Schaltung“ wurde spätestens mit den Coronavideobotschaften der Kanzlerin die „Schalte“, wie schon vor Jahren der „Schreibstil“ zur „Schreibe“ schrumpfte, warum auch nicht, es spart Zeit und im Zweifelsfall auch Papier, wenn man Überflüssiges kürzt. Spätestens die Reden Trumps haben uns darüber belehrt, dass auch Abkürzungen im Bereich der Kausalitäten bisweilen von Vorteil sein können. Weniger Zeit, weniger Gedanken, weniger Hirn sind vonnöten, um komplexe Zusammenhänge zu begreifen – ressourcenschonender kann Politik kaum sein. Mehr Abkürze, weniger Bestürze, hurra!
Der Simplizissimus seiner America-First-Kampagne überlagert nun seit fast vier Jahren alles, was der westlichste aller Kontinente jemals an Kultur hervorgebracht hat, seit er sich vom Empire lossagte, und alles scheint darunter verschüttet wie Pompeji unter der Asche des Vesuvs: Die Glanzzeiten des Liberalismus unter Wilson ebenso wie der bürgerfeindliche Neo-Liberalismus unter Reagan. Die Großzügigkeit des Marshallplans, die auf dem Fuße der Großzügigkeit folgte, Europa von Hitler befreit zu haben. Das hektische Treiben an der Wallstreet, bei MacDonald’s oder Walmart. Das wildromantische Bild eines von Ennio Morricone untermalten Italo-Western und mit ihm gleich der ganze Glamour Hollywoods. Alles, wirklich alles, schmeckt schal und scheint ohne Würze seit Donald Trump seine übergroße Dosis Glutamat über der Kultur seines Landes verschüttet hat. Um so schwerer fällt es mir, mich an die zaghaft aufwühlenden Wochen des Spätherbstes 2004 zu erinnern. Das Wort „zaghaft“ ist nur im Rückblick nötig, wir waren hochgradig erregt. Aber vieles wurde ja über die letzten Jahre stark relativiert, wie schon so oft in der Geschichte. Die Zerstörungskraft des Dreißigjährigen Krieges etwa sollte aus historischer Sicht durchaus nicht kleingeredet werden, sie war traumatisierend und nachhaltig, und doch würde sie einem Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg natürlich nicht standhalten. Zaghaft war die Entrüstung damals also nur im Vergleich zur Empörung, die der Trumpismus in uns ausgelöst hat. Man arbeitete sich damals – in der Bush-Ära – tatsächlich noch an Sachfragen ab, während es heute der Diagnose „Narzisstische Verhaltensstörung“ kaum noch etwas hinzuzufügen gibt. Trotz dieser im Rückblick scheinbar notwendigen Hierarchisierung bleibt festzuhalten, dass vor sechzehn Jahren in Deutschland über den Präsidenten der Vereinigten Staaten ganz ähnlich gesprochen wurde, wie wir es heute von unseren Urteilen über den Mann mit der blonden Tolle gewöhnt sind. Die schon damals sprachlich ausgereizten Superlative ließen eine erneute Steigerung, die eigentlich nötig gewesen wäre, um Donald Trump wirklich gerecht zu werden, einfach nicht zu. Und so bedient man sich heute des gleichen Vokabulars, schleudert es wie frischen Honig aus den Waben, wo es sich doch nur um alte Kamellen handelt, die jedoch glücklicherweise in den letzten vier Legislaturperioden in Vergessenheit geraten sind.
Auch damals vor sechzehn Jahren war man sich in großen Teilen Europas über den amerikanischen Präsidenten einig: Im Weißen Haus regierte ein Verrückter, ein Größenwahnsinniger, der den gesamten Nahen Osten ins Chaos gestürzt hatte, indem er das wohlaustarierte System aus Duldung und Isolation, mit dem die zivilisierte Welt den dortigen autokratischen Herrschern, seien es nun Generäle, Fürsten oder Abgesandte Allahs, begegnete, durch seine Kriegslust ins Wanken brachte. Und auch die Diagnose war eindeutig: Dem Präsidenten fehlten ein paar Gehirnwindungen, die er für die ordentliche Ausübung seines Amtes dringend benötigt hätte. Der Sprecher der Bundesregierung Uwe-Karsten Heye bezeichnete ihn als „intellektuell äußerst niederschwellig“, und sprach damit zumindest der schlaueren Hälfte der deutschen Seele aus dem Herzen, die andere Hälfte hasste den Präsidenten aus anderen Gründen, an die ich mich nicht so gut erinnere, Arroganz und die Wortprägung des „Alten Europas“ sollte man aber wohl eher nicht Bush selbst sondern anderen Mitgliedern seiner Administration zuschreiben, soweit reichten Bushs Europakenntnisse sicher nicht aus.
Intelligenz, so lehrt uns zumindest die jüngere amerikanische Geschichte, ist also anscheinend nicht das entscheidende Merkmal, das einen amerikanischen Präsidenten zieren muss, es gibt Wichtigeres.
Der rebellische Sänger und Songschreiber Scott-Heron wusste schon in den Achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, dass Amerika in schwierigen Zeiten immer einen John Wayne gewollt hat, den Mann mit dem weißen Hut auf dem weißen Pferd, der kommen wird, um Amerika zu retten, im letzten Moment, ja, im allerletzten Moment, wie in einem B-Movie. Wer fragt denn da nach IQ? Ronald Reagan war so einer gewesen und vor vier Jahren war wieder einer ins Weiße Haus geritten, von Texas nach Washington D.C., aufrecht und heroisch, und kämpfte jetzt um seine Wiederwahl. Welch eine Farce, dass er an der Heimatfront überhaupt kämpfen musste! Hatte er nicht mutig sein Pferd gesattelt und war in den Nahen Osten gezogen? Hatte Amerika vor dem Terror der Taliban gerettet und die ganze Welt vor den Massenvernichtungswaffen Saddam Husseins? Der Held mit dem Stetson und dem mokanten Lächeln, hinter dem sich Unwissenheit so gut verbergen ließ, schien tatsächlich auch in Amerika zum Auslaufmodell zu werden, die Wählerschaft begann zu zweifeln, ob der berittene Zweikampf noch zur Lösung ernstzunehmender Probleme taugte, und aus heutiger Sicht ist die Lage natürlich eindeutig: Er war es nicht mehr. Und folgerichtig hatte dann auch der nächste Superheld in republikanischem Gewand, der kommen würde, um Amerika im allerletzten Moment vor sich selbst zu retten, die Statur und Energie einer Dampfwalze und trug den trotzigen Ausdruck des Avengers-Helden im Gesicht, der auf seinem Kreuzzug gegen das Böse keine Kollateralschäden scheut. Sein Gefährt würde ein Bulldozer sein, ein Pferd wäre unter ihm zusammengebrochen, und den Revolver hatte er längst gegen ein vollautomatisches Maschinengewehr eingetauscht. Doch im November 2004 taugte dieser Typ des Superhelden noch nicht fürs Weiße Haus. Noch befand sich das Land im Umbruch, noch träumte ein Teil vom Helden aus der Zeit des Goldrauschs, der sein Geld noch mit der Kraft der eigenen Muskeln verdiente und die Ehre seiner Frau schützte. God bless America!
Wie war das mit der Prokrastination? Dieser Bericht hier soll eine Übung sein. Ich übe die Erklärung, die Beichte, die ich Willemina bald schuldig sein werde. Und was tue ich? Ich schwafele über amerikanische Präsidenten, statt die Sache wirklich in Angriff zu nehmen. Aber ganz ehrlich, tun wir das nicht alle, jeden Tag? Obwohl wir im wunderbar liberalen und trotzdem sicheren Europa leben, durch einen ganzen Ozean getrennt von dieser so-called einzig verbliebenen Supermacht, beschäftigt uns seit Generationen kein Thema so sehr wie die neuesten Ideen der US-Administration, kein Thema raubt so viel Nachrichtenzeit ohne wirklich für uns von Bedeutung zu sein – von Fußball einmal abgesehen. Man sollte probehalber eine Umfrage in den Straßen Berlins durchführen: „Kennen Sie den Namen des chinesischen...?“ Ich kann die Frage hier nicht ausformulieren, weil ich nicht einmal die genaue Amtsbezeichnung kenne, unter der der Lenker chinesischer Staats- und Parteigeschicke firmiert. Der Name war irgendetwas mit Chi oder Xi oder so, das schreibe ich jetzt hier zu meiner Ehrenrettung, interessiert aber sowieso niemanden. Die Problematik ist, denke ich, deutlich geworden. Ich versuche also jetzt mit meiner Geschichte zu beginnen, ohne weitere prokrastinative Amerikanisierungen, aber ganz ohne amerikanische Präsidenten wird es nicht gehen, denn zumindest einer ist schließlich von entscheidender Bedeutung. Kehren wir also zurück in die Zeit, als noch berittenen Helden um ihre Wiederwahl kämpften.
Erster Versuch
Am Rudi
Im Herbst 2004 wohnte ich für einigen Wochen bei Barbara in Berlin. Geboren und aufgewachsen sind wir beide in Bad Zwischenahn, der norddeutschen Rentnerstadt am See, wo die Straßen hübsch gepflastert sind und die Weiße Flotte so blankgeputzt über das Zwischenahner Meer zieht, dass ich als Kind glaubte, das Traumschiff käme aus dem Ammerland. Wer in Bad Zwischenahn kein Hotel oder Café für betagte, gutsituierte Kurgäste betreibt oder ihnen Hüftoperationen und Rehamaßnahmen verschreibt, der arbeitet in einer der oben erwähnten Einrichtungen oder einer der zahlreichen Baumschulen in der Umgebung als Gärtner. Oder in der Wurstfabrik. Diese ziert sich zwar mit dem romantischen Namen einer pommerschen Mühle – wer denkt bei „Mühle“ nicht sofort an Wind oder rauschende Bäche, oder rauschenden Wind in goldenen Weizenfeldern, dieser wohlgelungenen Marketing-Poesie können auch die Windmühlenflügel in waschechtem Schinkenwurstformat nichts anhaben – und doch ist sie eben eine zum fleischverarbeitenden Gewerbe gehörige Fabrik und nebenbei der größte Arbeitgeber der Region. So war es vor vierzig Jahren und so ist es noch heute. Meine Eltern arbeiteten beide in der Verwaltung der Rehaklinik, Barbaras in der Wurstfabrik. Für beide Paare galt die alte Regel, dass man den Lebenspartner am häufigsten am Arbeitsplatz kennenlernt. Obwohl meine Eltern, Agnes und Theodor Lohmann, keine weißen Halbgötter waren, mein Vater immerhin Verwalter des Hausdienstes und meine Mutter nicht mehr als eine einfache Sekretärin, glaubte ich als Kind, meine Eltern wären die eigentlichen Chefs im Krankenhaus, die, die alles organisierten, die die Bücher und Akten verwalteten und damit eigentlich noch über den Ärzten standen. Mit diesem Glauben wuchs mein Selbstbewusstsein. Alles war möglich, ich konnte Chefin der ganzen Welt werden, wenn meine Eltern schon die Chefs eines Krankenhauses geworden waren.
Barbara war da verständlicherweise bodenständiger. Sie wollte nicht in der Fabrik enden, das war ihr erklärtes Lebensziel und dafür arbeitete sie hart und ausdauernd. Nach einem eher durchschnittlichen Abitur studierte sie Sonderpädagogik im nahe gelegenen Oldenburg. Bis zum letzten Tag wohnte sie dort im Studentenwohnheim, weil sie sich von ihrem Bafög auch in den neunziger Jahren schon kein anderes Zimmer leisten konnte. Rumpelige Häuser für Studenten-WGs wie später in Berlin gab es in der chicken Beamtenstadt kaum. Ich dagegen schwebte in der unerschütterlichen Gewissheit, dass mir im Leben noch Großes verheißen war, nach dem Abitur erst einmal ein Jahr lang von einem Job zum nächsten. Ja, ich arbeitete nicht, ich schwebte. Ich setzte meinen zarten Ballerinafuß mal hierhin, mal dorthin und beglückte meinen jeweiligen Arbeitgeber mit meiner strahlenden Anwesenheit, ob als Barfrau im Jagdhaus Eiden, wo sich die Herrschaften vor ihren Casinobesuchen trafen und meine luftige Unbekümmertheit wie ein Glasperlenspiel zwischen den Wänden aus dunklen Eichenpaneelen hing, als Rezeptionistin in der Rehaklinik, wo sich die älteren Patienten häufig wünschten, von mir persönlich betreut zu werden, nachdem ich sie einmal in Empfang genommen hatte, oder als Eisverkäuferin bei Luigi, wo ich immer im Service, nie im Fensterverkauf und erst recht nicht in der Küche arbeitete. Luigi ließ mich so oft und so lange wie möglich draußen zwischen den Tischen flanieren und die Gäste anlächeln, er glaubte fest daran, dass ich dadurch den Umsatz mehr ankurbeln würde, als es durch doppelte Geschwindigkeit in der Eisbecherdekoration möglich gewesen wäre, und vermutlich hatte er recht.
Ich strahlte, solange es mir nicht zu langweilig wurde, dann zog ich weiter, doch meine Chefs – kein generisches Maskulinum, tatsächlich war nicht eine einzige Frau darunter – ließen mich immer nur ungern gehen, denn solange ich strahlte, fühlten sich alle wohl in meiner Nähe und gut betreut, von der Kur-Lady bis zum Spaghettieis-Kunden.
Ich beschloss, Journalistik zu studieren, und ging nach Hamburg, belegte einige Jahre später noch ein paar Kurse in Public Relations und machte einen zweiten Abschluss. Die Professoren – wieder kein generisches Maskulinum – liebten mich wie die Spaghettieis-Kunden, vielleicht gab es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der Liebe und dem durchgehend männlichen Geschlecht in deutschen Führungsetagen?
Im Herbst 2004 wollte ich dann mit der üblichen Leichtigkeit zu einem weiteren Sprung hinein ins blühende Leben ansetzen. Einer der leitenden Angestellten der Rügenwalder Mühle war ein Freund meines Vaters und er hätte mich gern für die Pressearbeit in der Wurstfabrik gehabt. Doch die Wurstfabrik war für mich tabu. Wenn mir jemand die Leitung der Kurklinik angeboten hätte, wäre ich vielleicht – entgegen meinem erklärten Ziel, mich überall auf der Welt aber auf gar keinen Fall in der Rentnerstadt niederzulassen – in Versuchung geraten, doch Wurstfabrik blieb Wurstfabrik, egal auf welcher Management-Ebene. Außerdem war quasi zeitgleich bei Air Berlin eine Stelle als stellvertretende Pressesprecherin ausgeschrieben. Sicherlich eine Position, in der man noch sehr viel mehr Geld verdienen konnte, doch noch mehr als das Gehalt lockte mich die Vorstellung, in Zukunft einmal vor einem Mikrofon, eventuell sogar vor einer Kamera zu stehen. Die Öffentlichkeit reizte mich ebenso wie die Nähe zu einer Konzernspitze, ein ähnlicher Reiz wie heute die Gier nach Trump-Sensationen, verständlich und doch irgendwie beschämend.
Das Bild einer weißen Flugzeugflotte – wobei Air Berlin natürlich an Weißheit mit der Lufthansa nicht ganz mithalten konnte, aber ein paar Abstriche musste man schließlich machen im Leben – erinnerte mich auch irgendwie an die Traumschiffe meiner Kinderzeit. Der Weißen Flotte wuchsen Flügel – konnte es ein schöneres Bild für meinen eigenen Aufstieg geben?
In der sicheren Annahme, dass ich die Stelle bekommen würde – meine Noten waren exzellent – traf ich ungefähr zeitgleich mit meinen Bewerbungsunterlagen in Berlin ein. (Das kann ich natürlich nur vermuten, denn im Gegensatz zu mir reiste meine Bewerbung mit der Post.) Meine zügige Anreise mit der Bahn diente dem Zweck, flexibel auf die Einladung zu dem zu erwartenden Vorstellungsgespräch reagieren zu können und nebenbei ein paar unbeschwerte Wochen mit Barbara zu verbringen. Nichts stand mir im Wege, alles war möglich.
Barbara war zwei Jahre zuvor von Oldenburg aus in den dynamischen Stadtteil Friedrichshain gezogen, noch sehr ostdeutsch geprägt, doch durch seine Nähe zur Mitte bereits deutlich von Gentrifizierung bedroht. Sie wohnte im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses am Rudolfplatz, von seinen Anwohnern liebevoll „Rudi“ genannt, der auf durchaus überschaubarer Fläche den Kindern des Kiezes einen kleinen Spielplatz und den Eltern einige Bänke bot. Neben dem Spielplatz gab es noch einen umzäunten Bolz- und Basketballplatz für ältere Kinder und Jugendliche. Da nicht alle Jugendlichen nur Basketball spielten, fanden sich hier manchmal auch leere Bierdosen und unzählige Kippen. Manchmal vermischten sich auch die Einflusssphären der Bewohner – generisches Maskulinum, endlich! – ein wenig, dann lagen Kippen im Sand verstreut und die Hunde der abgelenkten Eltern, die ähnlich dem jugendlichen Nachwuchs ihre Aufmerksamkeit oft genug den mitgebrachten Bierdosen zuwandten, hatten ihre Haufen an den Rand des Basketballfeldes gesetzt. Trotzdem schien es mir der beste Kiez, den man sich in Friedrichshain nur wünschen konnte. Auf dem Rudi und in den Hinterhöfen der Altbauten standen Bäume, in denen im Sommer vermutlich die Spatzen zwitscherten, und die Bebauung der anliegenden Straßen war offen und großzügig, die geschlossenen Häuserzeilen, die den Platz säumten, an etlichen Stellen durch niedrigere Gebäude unterbrochen: eine Kindertagestätte, ein Supermarkt und einige alte Lagergebäude. Als ich ankam, war ich begeistert von all der Luft, die mir Berlin zum Atmen bot. Ich hatte mit engen Straßen und mehr Verkehr vor der Haustür gerechnet, doch dieses Carré am Rudi, dessen nordwestliche Ecke noch dazu von einer Kirche geschmückt wurde, was mir mitten in der Stadt sehr romantisch und irgendwie aus der Zeit gefallen schien, als bestehe nur noch in Dörfern Bedarf an seelsorgerischem Beistand, erschien selbst so beschaulich wie ein Dorf. Zugegebenermaßen etwas heruntergekommen. In Wirklichkeit war das Kirchengebäude alles andere als romantisch, weder hübsch, noch einladend. Um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert gebaut, ragten seine spitzen Fronten martialisch wie Speere in den Himmel und auch der glatte Schiefer der Bedachung drückte vor allem makellose Wehrhaftigkeit aus, gegen wen auch immer es nötig zu sein schien.
Das Haus, in dem Barbara eine der beiden Wohnungen im vierten Stock bewohnte, war eines der wenigen im Viertel, das noch nicht saniert worden war. Zu beheizen waren die Wohnungen nur mit den Kachelöfen, die sich in den Wohnräumen befanden, und der Keller war ganzjährig schwarz vom Kohlenstaub. Sowohl die inneren als auch die äußeren Flügel der uralten Kastenfenster waren nach innen zu öffnen, eine Berliner Originalität, die ihnen jede Winddichtigkeit nahm. Da das Holz der Rahmen auf der Wetterseite bereits Löcher hatte und immer morscher wurde, konnte dafür der zwischen den Fenstern liegende Raum im Winter stromkostenfrei als Kühlschrank genutzt werden. Einen Aufzug gab es natürlich auch nicht, doch das sahen wir eher als sportliche Herausforderung.
Barbara hatte in ihrer Wohnung die alten Dielenböden abgezogen und geölt, die Wände und die hohen Decken waren weiß gestrichen, und überhaupt schien das bunteste in der Wohnung der senfgelb und okkerbraun gemusterte Kachelofen zu sein, der in meinem Gästezimmer eingebaut war, ein schwerfälliges Gerät, das eigentlich dauerhaft befeuert werden wollte, was bei den Temperaturen im Oktober aber noch völlig übertrieben war. Deshalb blieb er meistens kalt und ich saß bei Barbara in der warmen Stube, bevor ich abends unter meine Decke kroch.
Der Sanierungsstau der Wohnungen war gewollt, und zwar von den Mietern. Tatsächlich gab sich die Wohnungsbaugesellschaft, die Eigentümerin des Hauses war, alle Mühe, im Einverständnis mit den Mietern die gröbsten Altersschäden zu beseitigen. Doch nachdem immer häufiger Ankündigungen über bevorstehende Sanierungen mit auszufüllenden Einwilligungserklärungen in ihren Briefkästen gelandet waren, hatten sich die Bewohner des Hauses an einem schönen Sommerabend auf dem Rudi zusammengesetzt und sich darauf verständigt, dass alle – aber auch wirklich alle – vom Vermieter vorgeschlagenen Maßnahmen abzulehnen wären. Von allen. Stärke durch Geschlossenheit! Jede Sanierung würde Mieterhöhungen mit sich bringen, da war man sich einig, und keiner war bereit, die zu tragen, entweder aus Armut oder aus Überzeugung.