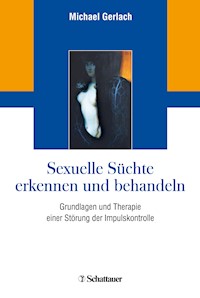
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schattauer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Toxic Erotica: Wenn Lust zur Qual wird Wenn sexuelle Lust zum Zwang wird, stehen Betroffene häufig mit ihrem Leiden alleine da. Dieses Buch leistet einen wichtigen Beitrag zum Verständnis dieses Tabu-Themas und zeigt psychotherapeutische Auswege und Behandlungsansätze. Dabei steht im Vordergrund, wie Sexsüchtige eine genuine Liebes- und Bindungsfähigkeit entwickeln können. Drei Schwerpunkte erhellen diese stoffungebundene, aber nicht minder dunkle Sucht, die sich in unserer medialisierten Gesellschaft auf dem Vormarsch befindet: - Was ist Sexualität und was ist Liebe? - Was ist Sucht und speziell sexuelle Süchtigkeit? - Wie gelingt Heilung? Befunde aus interpersoneller Neurobiologie, Evolutionspsychologie, Suchtforschung und Sexualwissenschaft helfen, die Formen sexueller Süchte zu verstehen und Genesungswege zu beschreiten. Der Psychotherapeut und Experte für hypersexuelle Störungen Michael Gerlach gibt Einblicke in das Heilungsgeschehen zwischen Therapeut und Patient. In vielen Fallbeispielen bildet er das Geschehen in der Psychotherapiestunde authentisch ab. Eine Bereicherung für Therapeuten und ein Befreiungsschlag für Patienten, die ihre sexuellen Abhängigkeiten und ihr impulshaftes Verhalten überwinden wollen – für eine beziehungsverantwortliche und gesunde Sexualität und Liebesfähigkeit. Keywords: Sexsucht, süchtige Sexualität, Hypersexualität, hypersexuelle Störung, süchtiger Pornographiekonsum, Pornosucht, Nymphomanie, Don Juanismus, Promiskuität
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Michael Gerlach
Sexuelle Süchte erkennen und behandeln
Grundlagen und Therapie einer Störung der Impulskontrolle
Mit Geleitworten von Ilse Manuela Völk und Peter Brieger
Impressum
Michael Gerlach
Psychologischer Psychotherapeut, Fachkunde der Verhaltenstherapie
Hochgrat Klinik
Wolfsried 108, 88167 Stiefenhofen bei Oberstaufen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Besonderer Hinweis
Die Medizin unterliegt einem fortwährenden Entwicklungsprozess, sodass alle Angaben, insbesondere zu diagnostischen und therapeutischen Verfahren, immer nur dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung des Buches entsprechen können. Hinsichtlich der angegebenen Empfehlungen zur Therapie und der Auswahl sowie Dosierung von Medikamenten wurde die größtmögliche Sorgfalt beachtet. Gleichwohl werden die Benutzer aufgefordert, die Beipackzettel und Fachinformationen der Hersteller zur Kontrolle heranzuziehen und im Zweifelsfall einen Spezialisten zu konsultieren. Fragliche Unstimmigkeiten sollten bitte im allgemeinen Interesse dem Verlag mitgeteilt werden. Der Benutzer selbst bleibt verantwortlich für jede diagnostische oder therapeutische Applikation, Medikation und Dosierung.
In diesem Buch sind eingetragene Warenzeichen (geschützte Warennamen) nicht besonders kenntlich gemacht. Es kann also aus dem Fehlen eines entsprechenden Hinweises nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Schattauer
www.klett-cotta.de
© 2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Franz von Stuck »Die Sünde«. Foto: Museum Villa Stuck
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Printausgabe: ISBN 978-3-608-43166-7
E-Book: ISBN 978-3-608-19136-3
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-26994-9
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Lektorat: Volker Drüke
Projektmanagement: Dr. Nadja Urbani
Inhalt
Geleitwort 1
Geleitwort 2
Vorwort
Einleitung: Der Mann, der seinen Sohn vergaß
1 Was ist Sex und was ist Liebe?
1.1 Sexualität und Evolution oder: Von Liebeswanzen und Cunnilingus
1.1.1 Die Liebeswanze: Drei Tage im Liebesrausch
1.1.2 Charles Darwin und die Entstehung der Arten
1.1.3 Sexuelle Auslese oder: Warum männliche Feuerkäfer besonders giftig sein müssen
1.1.4 Die Eintagsfliege: Sex haben und sterben
1.1.5 Wo nur Königinnen Sex haben und warum Sex mehr ist als Fortpflanzung
1.1.6 Der Krieg der Spermien
1.2 Evolutionäre Psychologie
1.2.1 Von brutalen See-Elefanten, fleißigen Hüttengärtnern und treuen Präriewühlmäusen
1.2.2 Sexualität bei Primaten
1.2.3 Von Marmosetten und Titis oder Kuscheln bis zum Umfallen
1.2.4 Von Menschenaffen und Penisgrößen oder: Warum größer besser ist
1.3 Die Sexualität des Menschen
1.3.1 Die »Masters of Sex«
1.3.2 Die sexuellen Orientierungen
1.3.3 Wie fließend ist die sexuelle Orientierung?
1.3.4 Sexualpräferenz
1.3.5 Von Zahlen und Zyklen: Im Zahlenreich von Kinsey
1.3.6 Der sexuelle Zyklus, eine Grundfigur des sexuellen Erlebens
1.3.7 Der Orgasmus
1.3.8 Romantische Verliebtheit als »partnerschaftlicher Rausch«
1.3.9 Monogamie und Polygamie – die Liebe ist monogam, der Mensch ist es nicht
1.3.10 Masturbation, Autoerotismus und solitäre Sexualität
1.3.11 Pornografie
1.3.12 Perversionen oder die Lust, ein Pony zu sein
1.4 Sexualität und Liebe
1.4.1 Die »Masters of Intimacy«
1.5 Zusammenfassung
2 Was ist Sucht und sexuelle Süchtigkeit?
2.1 Sucht als körperliche Erkrankung
2.1.1 Dopamin: ein Glücksversprechen
2.1.2 Vasopressin und Oxytocin
2.1.3 DeltaFosB, eine genetische Stellschraube
2.1.4 Testosteron, ein Männermärchen?
2.1.5 Das Serotonin-System
2.1.6 Das Noradrenalin-System
2.1.7 Das Opioid-System
2.1.8 Die Neurobiologie von Hemmung und Erregung
2.2 Sucht als psychische Störung
2.2.1 Gibt es Willensschwäche?
2.2.2 Primäre Störungen des sexuellen Begehrens
2.2.3 Wow! – Supernormale Reize
2.3 Sucht als soziale Störung
2.3.1 Der Park der Ratten und die reichhaltige Umgebung
2.3.2 Permission und Restriktion
2.3.3 PC, Tablet und Smartphone: Triple A und die Macht des Internets
2.4 Sucht als spirituelle Störung
2.4.1 Von Entheogenen, Epiphanien und Selbsthilfegruppen
2.5 Sexuelle Süchte als spezifische Verhaltenssüchte
2.5.1 Kann man sexuelle Sucht messen?
2.6 Über die Ursprünge sexueller Verhaltenssüchte
2.7 Scham, Schuld und sexuelle Süchtigkeit
2.8 Männliche Homosexualität und Sucht
2.8.1 Gaetan Dougas – der Mann, der »Patient Zero« war
2.8.2 Sexuelle Süchte bei schwulen Männern
2.9 Die Vignetten: Gestalten sexueller Süchtigkeit
3 Was ist Heilung?
3.1 Heilung sexueller Süchtigkeit
3.1.1 Nicht-klinische Verläufe und suchtnahe oder kritische Verdichtungen
3.1.2 Genesung bei vorliegender Abhängigkeit
3.1.3 Die Behandlungsperspektiven: nah und fern
3.1.4 Erste Sitzung: Das Suchtmuster erfassen und bewerten
3.1.5 Zweite Sitzung: Wissensvermittlung, Erhöhung der Motivation und Mitgefühl
3.1.6 Dritte Sitzung: Weiteres Erkennen und Umgang mit Auslösern
3.1.7 Vierte Sitzung: Verhaltensweisen zur Bewältigung suchtauslösender Reize aufbauen
3.1.8 Fünfte Sitzung: Andrängendes süchtiges Denken behandeln und Denkfehler erkennen
3.1.9 Sechste Sitzung: Rückfallvermeidung
3.1.10 Gruppentherapie für Männer in Genesung
3.1.11 Den Verstand einschalten und nüchtern denken
3.1.12 Die Rückfallvermeidung und Rückfallbewältigung – RUN!
3.2 Heilung der Störungen der Intimität – Arbeit an den distalen Faktoren
3.2.1 Gibt es gesunde Sexualität überhaupt?
3.2.2 Die interpersonelle Neurobiologie als Schlüssel zum anderen
3.2.3 Intimität lernen: Zustände tiefer Vertrautheit erleben
3.2.4 Heilung in der partnerschaftlichen Liebe
3.2.5 Karezza – Sex ohne Orgasmen
3.2.6 Der epikureische Hedonismus
Literatur
Sachverzeichnis
Für Verena, Charlotte und Marie.
Die Menschen, die mich das Lieben lehren.
Geleitwort 1
Dass in psychotherapeutischen Behandlungen das Thema »Sexualität« einen großen Stellenwert zugemessen bekommt, ist eine Überzeugung, die gemeinhin in der Allgemeinbevölkerung weit verbreitet ist. Krafft-Ebing, Hirschfeld, Sigusch und in erster Linie Freud haben da ihre Spuren hinterlassen. Die Realität ist weit davon entfernt – das ist ein offenes Geheimnis. Das Thema Sexualität bleibt gerade in der psychotherapeutischen Behandlung allzu oft ein Thema für Spezialisten, die es zu wenig gibt. Über die mehr oder weniger lieblos erhobene Sexualanamnese geht in der Versorgungsrealität die Diagnostik oder Therapie der Sexualität bzw. Sexualstörungen zumeist nicht hinaus. Die Einordnung der sozialen Medien und des Internets in die psychotherapeutische Praxis ist dann noch einmal eine Herausforderung, die schwer »in den Griff« zu bekommen ist. Wie ist Internetpornographie zu bewerten? Wie häufig ist sie? . . . Und dann kommt noch die ungeliebte Frage der nichtstoffgebundenen Süchte zum Tragen. Sexsucht? Internetpornosucht? Sind das wirkliche »Abhängigkeitserkrankungen«? Und überhaupt, was ist krank und was ist gesund?
Michael Gerlach ist ein eindrucksvolles Buch gelungen, das Antworten auf diese Fragen sucht. Es richtet sich sowohl an den praktisch tätigen Psychotherapeuten wie auch an den aus grundsätzlichem Interesse Lesenden. Das Buch gibt einen klaren und konzisen Überblick über die geschichtliche Entwicklung. Gerlach zeigt psychologische, physiologische, soziologische und neurobiologische Hintergründe auf. Aber was das Buch besonders macht, ist seine Grundhaltung: Als Psychotherapeut unterlegt der Autor seine Gedanken und Thesen mit Beispielen eigener Patienten/Klienten. Dabei wird eine überzeugende psychotherapeutische Grundhaltung deutlich. Er zeigt auf, wie Behandlung aussehen kann, diskutiert, was krank ist und was nicht, und formuliert Behandlungsziele. Das Thema der »Süchtigkeit« ist dabei ein zentrales. Gerlachs eigene Sichtweise ist dabei auch durch den Faktor »Spiritualität« geprägt – eine Herangehensweise, die im Bereich der Sexualmedizin nicht verbreitet ist. Die Mischung dieser verschiedenen Aspekte macht das Buch besonders.
In Zeiten des Internets mit seinen leicht verfügbaren Botschaften (auch sexuellen), der schnellen Information, des »Quick Hits« – wer liest da noch Bücher? Das vorliegende Buch verdeutlicht, warum es wertvoll ist, sich die Zeit zu nehmen, auch ein wissenschaftliches Buch als gesamtes Werk zu lesen. Die Erfahrungen, das Wissen und die Haltung von Michael Gerlach werden nämlich »als Ganzes« deutlich – und diese Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, ist besonders.
Es wäre schön, wenn durch dieses Buch Psychotherapie, Psychiatrie, Psychosomatik und verwandte Fächer wieder mehr Interesse auf den Bereich der Sexualität legen würden.
Kempten, München Prof. Dr. Peter Brieger, Ärztlicher Direktor des kbo-Isar-Amper-Klinikum
Geleitwort 2
Herr Michael Gerlach, der leitende Psychologe in der Hochgrat Klinik, spannt in seinem Buch über sexuelle Süchte als Störungen der Impulskontrolle einen weiten Bogen und wendet sich mutig einem schwierigen und sonst eher mit großer Scheu behandelten Thema zu.
Er beginnt mit einem Blick in die Verhaltensbiologie und den Erkenntnissen aus der Evolutionsforschung. Er spricht über evolutionäre Psychologie und skizziert die Komplexität der menschlichen Sexualität eingebettet in Bindungs- und Intimitätserfahrungen – und lässt bereits hier anklingen, dass eben diese frühe Sicherheit spendenden Erfahrungen wesentliche Faktoren sind, die eine gesunde Sexualität entstehen lassen können.
Im zweiten Teil gibt er uns Einblicke in die verschiedenen Ebenen der sexuellen Süchtigkeit: Er lässt uns teilhaben an Erkenntnissen der Neurobiologie, den Forschungsergebnissen über Neurotransmitter und Hormonwirkungen im Körper. Nach der körperlichen Ebene führt er uns auf eine psychische Ebene, eine soziale Ebene und zuletzt auch auf eine spirituelle Ebene. All dies lässt er lebendig werden durch vielfältige Fallvignetten aus seiner langjährigen klinischen wie auch ambulanten Tätigkeit.
Der dritte und letzte Teil ist der therapeutischen Antwort gewidmet, dem »Heilungsweg«. Im ganzen Buch klingt immer wieder an, dass das Suchtmittel eine zentrale Ersatzfunktion für zwischenmenschliche Kontakte, Beziehungen, Liebes- und Näheerfahrungen liefert. So folgen wir seinem therapeutischen Ansatz, dass eine Behandlung der süchtigen Sexualität nur dann Erfolg haben kann, wenn es gelingt, die Störung der Intimität zu beheben. Dabei arbeitet er heraus, welche Behandlungsimplikationen dies für die therapeutische Begleitung und die therapeutische Haltung hat. Das Buch geht detailliert auf die einzelnen möglichen Behandlungsschritte ein und lässt uns teilhaben an einigen Verläufen, ambulant wie auch stationär.
Gerlach wagt die Definition einer gesunden Sexualität und macht Hoffnung, dass eine Behandlung sexsüchtiger Menschen gelingen kann und sie begleitet werden können – heraus aus einer leidvollen und für die gesamte Umgebung schmerzvollen Zeit hinein in eine »nüchterne«, ehrliche und auch befriedigende Beziehungsfähigkeit mit der Befähigung zu intimer und tiefgehender stabiler Partnerschaft.
Hier in unserer Klinik durfte ich vielfach miterleben, wie Herr Gerlach Männer erfolgreich auf den Weg der Abstinenz begleitete, die sich äußerst dankbar auf einen neuen, wenn auch nicht einfachen Weg machen konnten.
Ich wünsche diesem Buch eine große Leserschaft!
Dr. Ilse Manuela Völk, Chefärztin der Hochgrat Klinik Wolfsried
Vorwort
Ich weiß nicht, was in Ihnen vor sich geht, wenn Sie sich die Zeit nehmen, um das Bild von Franz von Stuck mit dem Titel »Die Sünde« auf dem Einband zu betrachten. Wenn ich auf das Bild blicke, dann sehe ich zunächst einen weiblichen Körper. Betrachtet man das Bild länger, dann hat man nach geraumer Zeit das Gefühl, als wölbe oder spanne er sich dem Betrachter entgegen. Der Körper ist hell, glatt, und die festen Brüste sind gut sichtbar. Für einen Moment verliert sich der Betrachter in dieser verführerisch dargebotenen Leiblichkeit. Als nächstes fällt der Blick auf die Augen der Gestalt, deren Kopf sehr deutlich verschattet ist. Der Blick ist erschreckend einladend und fixiert den Betrachter, so als wolle er sagen: »Komm und sieh!« Oder: »Komm näher, komm, dieser Körper soll dir gehören!« Im weiteren Hineinblicken erkennt der Betrachter unwillkürlich die dunkle Schlange, die sich um den Leib der Gestalt schlingt. Zunächst bemerkt man die Schlange gar nicht, doch dann erkennt man erschrocken, wie sich ihre mächtige Rückenpartie über die linke Schulter der Gestalt legt und wie der überaus seltsame und bedrohliche Schädel des Tieres einen unvermittelt und plötzlich anblickt. Dem Künstler Franz von Stuck gelingt es auf beeindruckende Art und Weise, mit seinem Werk die unheimliche Macht zerstörerischer Triebe zu erfassen, und der Betrachter erlebt ein obszönes Verführungsmoment, in das man über verschiedene Wahrnehmungsschichten immer tiefer hineingezogen wird.
Um Sünde wird es in diesem eher ungewöhnlich angelegten Fachbuch nicht gehen, aber um den süchtigen Gebrauch von Sexualität und sexueller Erregung. Dabei wird – wie im Gemälde von Stuck – die Lust zu einem von tatsächlicher menschlicher Beziehung befreiten Anziehungspunkt. Ein verzehrender Selbstzweck und die bisweilen völlige Ersetzung personaler Beziehung. Leib in Erregung, jedoch ohne tatsächliche Begegnung. Warum das so ist und wie es dazu kommt, das werden wir im Verlauf des Buches erfahren. Freilich ohne den Begriff der Sünde weiter zu bemühen.
Als mich mein damaliger Oberarzt Hans Esser vor einigen Jahren fragte, ob wir nicht eine Gruppe für Männer mit sexuellen Süchten und zwanghaftem und obsessivem sexuellen Verhalten einrichten sollten, zögerte ich zunächst. Der Behandlungsbedarf schien groß, aber unser Wissen darüber eher gering. Allerdings hatten mich sexualpsychologische Fragestellungen schon seit meiner Studienzeit in Heidelberg interessiert. Nicht zuletzt deshalb, da sich mein Hochschullehrer für die klinische Psychologie Peter Fiedler intensiv mit sexualpsychologischen Fragestellungen befasst hatte (Fiedler 2004). In meiner späteren Tätigkeit als psychologischer Psychotherapeut hatte ich immer wieder Männer und Frauen mit sexuellen Süchten und daraus resultierenden schweren Konflikten, mit Problemen der sexuellen Orientierung und sexuellen Identitäts- und Reifungskrisen behandelt. Schließlich sagte ich meinem Oberarzt zu, und wir begannen mit den betroffenen Patienten zu arbeiten. Bald erkannten wir, wie schwerwiegend die persönlichen, sozialen, finanziellen und gesundheitlichen Konsequenzen dieser auf Sexualität bezogenen Verhaltenssüchte sein konnten und wie dringend notwendig Behandlungswissen und eine wirksame, daran anknüpfende Behandlungsmethodik waren.
Das vorliegende Buch ist die Frucht dieser nun mehrjährigen fachlichen Tätigkeit, von der ich hoffe, dass sie vielen Kollegen hilft, sich ohne übermäßige Scheu und mit viel Neugier und Zuversicht dieser Thematik anzunehmen. Vor allem für die betroffenen Menschen kann eine störungsorientierte Psychotherapie viel leisten, um weiteren Schaden von sich selbst und ihren Liebsten abzuwenden. Die Behandlungsrate bei sexuellen Süchten liegt leider nur im Promillebereich. Das bedeutet, dass wesentlich weniger Männer und Frauen eine angemessene Behandlung ihrer Problematik erhalten, als es notwendig wäre. Leider schrecken auch viele weibliche Therapeuten vor einer Behandlung zurück. Deshalb wünsche ich mir bezüglich der Wirkung des Buches drei Dinge: Erstens, dass sich die Behandlungsrate erhöht, zweitens, dass sich mehr Kollegen dieser Thematik annehmen, und drittens, dass auch weibliche Kolleginnen den Mut finden, Menschen mit diesen Störungen zu behandeln.
Mein Dank gilt dabei besonders all den Frauen und Männern, die in ihrer Not den Mut hatten, sich an uns zu wenden und sich mit ihren sexuellen Süchten und erotischen und romantischen Obsessionen auseinanderzusetzen und neue Wege der Genesung und Reifung zu beschreiten.
Noch nie in der Geschichte der Menschheit war es leichter, romantische, erotische oder einfach nur sexuelle Kontakte zu knüpfen oder Bilder und Filme mit pornografischen Inhalten zu konsumieren. Das Zeitalter des Computers und die Entstehung des Internets haben dies möglich gemacht. Auf dem Videoportal Youtube gibt es den Vortrag eines jungen Studenten mit dem Titel »Porn, The New Tobbaco« (Pornografie, der neue Tabak). Dieser Titel ist Programm für die massenhafte Verbreitung und die Zugänglichkeit zu einer speziellen Form der sexuellen Erregung – der Pornografie – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Durch neue Technologien haben wir unmittelbaren, fast kostenfreien und ungehinderten Online-Zugang zu wirklichen und fiktiven Personen und sexuellen Szenarien. Dabei stehen uns sexuelles Bild- und Filmmaterial und sexuelle Möglichkeiten in einer Menge und Unmittelbarkeit zur Verfügung, wie es bisher in der Geschichte der Menschheit nicht bekannt war.
Für viele Menschen stellt diese Entwicklung eine Fülle neuer Möglichkeiten zur Verfügung, mit Sex und Erotik umzugehen. Die Schattenseiten dieser Entwicklung beinhalten jedoch, dass sich immer mehr Menschen immer häufiger in den Netzwerken der Pornografie und Sex- und Erotikplattformen verlieren, um sexuelle und romantische Wünsche und Bedürfnisse anonym und schnell zu befriedigen. Dabei geraten betroffene Menschen – sowohl Männer als auch Frauen – in sexuelle Abhängigkeiten und in impulsives oder zwanghaftes sexuelles Verhalten und obsessive Impulsmuster hinein, aus denen sie sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien können. Mit den Auswirkungen, die diese problematischen Verhaltensweisen haben, können sie sich selbst und den Menschen, die sie lieben, enormes Leid zufügen.
Dieses Fachbuch möchte einen Beitrag leisten zum besseren Verständnis der Sexualität ganz allgemein und ihren süchtigen, zwang- und impulshaften Ausprägungen. Vor allem möchte es Möglichkeiten der Beeinflussung und Behandlung einer aus den Fugen geratenen Sexualität, hin zu einer verantwortlichen und partnerschaftlichen Sexualität und Liebesfähigkeit aufzeigen.
Michael Gerlach
Einleitung: Der Mann, der seinen Sohn vergaß
Seit ca. fünf Stunden saß ein 10-jähriger Junge in einem roten Lieferwagen in der Seitenstraße der Hauptverkehrsachse einer Großstadt in Süddeutschland. Da es bereits 23 Uhr nachts und ein gewöhnlicher Werktag war, wurden Passanten auf den stumm im Fahrzeug sitzenden Jungen aufmerksam. Sie klopften gegen die Fensterscheibe und riefen schließlich die Polizei, die den Jungen befragte. »Mein Vater sagte, er komme gleich wieder, aber bis jetzt ist er immer noch nicht wiedergekommen. Ich weiß auch nicht, wo er ist, aber ich möchte jetzt endlich nach Hause«, sagte der Junge. Die Polizei suchte zunächst in den umliegenden Straßen nach dem Vater. Die Suche blieb jedoch erfolglos. Schließlich entschlossen sich die Beamten, in einem in unmittelbarer Nähe gelegenen Pornokino zu suchen. Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, wurden sie fündig. Der Mann hatte sich die ganze Zeit über, in der sein Sohn im Auto auf ihn gewartet hatte, im Pornokino aufgehalten. Er hatte die Zeit und deshalb auch seinen Sohn einfach vergessen.
Als ich ihn fragte, wie sein Sohn sich wohl gefühlt haben mochte, meinte der Mann, der inzwischen mein Patient geworden war, er wäre doch ohnehin gleich aus dem Kino gekommen. Einigermaßen fassungslos fragte ich ihn, wann zuerst und wie oft er in der folgenden Zeit während seines Aufenthaltes diesen Gedanken gehabt habe. Kleinlaut antwortete er mir: »Schon früh und dann noch sehr häufig.« Die verzerrte Vorstellung, süchtiges Verhalten »gleich« beenden zu können, ist typisch für suchtnahes Denken. Wenn das »süchtige Gehirn« aktiviert ist, dann wird das Zeitempfinden radikal verändert. Das Denken ist eingeengt, und die Konsequenzen des eigenen Verhaltens werden oft völlig falsch eingeschätzt. Gedanken wie »Ich will nur noch schnell . . .« oder »Nur noch eine Minute!« beinhalten die Fixierung auf eine scheinbar unmittelbar bevorstehende Belohnung, die zwar eintreten kann, jedoch in der Regel von kurzer Dauer, sehr flüchtig ist und zur Wiederholung zwingt. Sucht ganz allgemein bewirkt, dass wir an dem Haken unseres Belohnungssystems aufgehängt sind, wie ein Fisch an einer Angel.
Insbesondere ein Botenstoff des Gehirns spielt hier eine Schlüsselrolle: das Dopamin. Diese(1) Substanz erzeugt starke Belohnungserwartungen und bindet das Gehirn und damit die Person außerordentlich stark an das süchtige Handeln. Die Stimulation dieses körpereigenen Stoffes ist ein zentraler Wirkmechanismus aller Verhaltenssüchte und aller Störungen der Impulskontrolle. »Gleich!« oder »Nur noch kurz!« oder »Nur noch einmal!« sind typische sprachliche Ausdrücke dieser neurobiologischen Vorgänge. Süchtige Prozesse beinhalten immer eine überstarke und erzwingende Belohnungserwartung und führen zu süchtigen, zwanghaften und impulshaften Belohnungswünschen und Belohnungshandlungen. Sie sind überaus mächtige Versprechen für unser unmittelbares Wohlbehagen und oft genug schnelle und mächtige Befreier von den Ketten qualvoller innerer Zustände.
Wie bereits erwähnt, wurde der Mann, der seinen Sohn vergaß, für einige Zeit mein Patient. Dass er seinen Sohn vergessen hatte, erfuhr ich nicht von ihm, sondern von seiner Frau. Diese bestand darauf, ihn in mindestens eine Behandlungsstunde zu begleiten. Sie wollte mir einen Eindruck seines Verhaltens aus ihrer Perspektive geben und war sehr aufgebracht und erzürnt, da sie den Eindruck hatte, ihr Mann befasse sich nicht ernsthaft genug mit seinen Problemen und werde mich über den wahrhaft katastrophalen Zustand seines Lebens hinwegtäuschen wollen. Sie hatte Recht! Sie berichtete mir, dass dies beileibe nicht die einzige Episode gewesen sei, in der er unzuverlässig gewesen war, die Zeit vergessen hatte und erst spät oder in den frühen Morgenstunden nach Hause gekommen war. Zweimal habe sie sich mit Gonorrhoe und einmal mit Feigwarzen angesteckt, nachdem er immer wieder ungeschützten Kontakt mit Prostituierten gehabt hatte. Eigentlich sei sie es leid, dieses Verhalten weiter zu dulden, wisse aber nicht, was sie tun solle. Verlassen wolle sie ihn nicht, sie hätten ja schließlich vier Kinder, im Alter von 8, 10, 13 und 15 Jahren. Sie wolle ihre Familie nicht zerstören. Allerdings fühle sie sich zunehmend entmutigt, gedemütigt, niedergeschlagen und hoffnungslos angesichts seiner sexuellen Probleme. Im Verlauf des Gesprächs mit seiner Frau wurde mir deutlich, dass mein Patient viele unangenehme Details und Episoden seiner suchtartigen Sexualität bisher vor sich selbst und anderen außerordentlich stark geleugnet, verharmlost und verschwiegen hatte. Bei allen Süchten und insbesondere bei sexuellen Süchten spielen Scham und meist tiefer lebensgeschichtlicher Schmerz, Geheimnisse, Einsamkeit und Heimlichkeit eine zentrale Rolle. Wir werden später noch auf diese Themen zu sprechen kommen.
Nach der denkwürdigen und schockierenden Stunde mit seiner Ehefrau erzählte er mir in den folgenden Stunden von seiner überaus kargen und einsamen Kindheit auf dem kleinen Hof seiner Eltern. Da waren die ewig streitenden Eltern, der Vater, der drohte, sich im Heuboden zu erhängen, und die immer traurige Mutter, die, eingegraben in sich selbst, die Familie zwar gerade noch versorgen konnte, jedoch unzugänglich war und verhärtet und immer fern wirkte. Sein einziger Freund war ein Bernhardinerhund, dessen Nähe er liebte, von dem er sich gerne ablecken ließ und der in seiner Pubertät sein erster sexueller Spielpartner wurde.
In einer anderen Stunde fragte ich ihn, was das Anziehende und Besondere für ihn sei, dort in den Pornokinos. Nach langem Schweigen sagte er, er habe an diesen Orten das Gefühl, in eine andere, bessere Welt einzutauchen. Eine Welt, die ihn von allen Mühen seines Lebens entheben würde. Das Licht abgedunkelt, einzig die flackernden und leuchtenden Monitore, angefüllt mit endlosen Abfolgen pornografischer Szenarien. Dort fühle er sich wohl und wohlig überflutet von Glücksgefühlen, verbunden mit einer lustvollen Erregung und dem Alltag völlig enthoben. Er fühle sich erhaben und leicht, könne alles auswählen, ohne auf jemanden Rücksicht nehmen zu müssen. Er beginne dann in Abständen zu masturbieren. Immer wieder unterbreche er diese Abläufe, um sich umzuschauen und die anonyme Atmosphäre zu genießen. Manchmal fühle er, dass diese Orte sein wirkliches Zuhause seien. Er fühle sich dort behütet, geborgen und umhüllt, irgendwie wie in einer Kirche. Er könne sich selbst und die Mühsal seines Lebens dann ganz und gar vergessen und in einen Zustand des Enthoben-Seins eintauchen, dies sei wunderbar und wahrhaft unwiderstehlich – »mein Himmel auf Erden . . .«
Wie kann ein Pornokino zur Zuflucht und »Kirche« eines Menschen werden?
Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir die frühe Lerngeschichte oder »Prägungsgeschichte« süchtiger Menschen zur Kenntnis nehmen und die Bedingungen und Beziehungen untersuchen, welche die Weichen für eine süchtige Entwicklung gestellt haben. Fast immer haben bei süchtigen Menschen zentrale zwischenmenschliche Vorgänge und fürsorglich-bindende Kontaktmuster nicht oder nur sehr unzureichend stattgefunden. Diese sind für das innere Wohlbefinden und Gleichgewicht eines Menschen jedoch unbedingt notwendig und beinhalten Berührungsbehagen, sprachliche und körperliche Tröstung, Schutz und Beruhigung, Verbundenheit, Bestätigung und Anerkennung sowie dadurch ausgelöste innere Zustände des Wohlbefindens, der Ruhe und der Sicherheit. Diese Zustände, die der Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott Zustände formloser Ruhe – »formless quiesence« – genannt hat, haben im zwischenmenschlichen Raum der Betroffenen meist nicht ausreichend stattgefunden (Greenberg & Mitchell 1983; Cozolino 2010). Zurück bleiben dann oft quälende und schnell auslösbare psychische Zustände innerer Unruhe, das Erleben von mangelnder Verbundenheit, Haltlosigkeit und Einsamkeit, Gefühle des Unbehagens, des Getrieben-Seins, der Verstimmung und einer schnellen Reizbarkeit; darüber hinaus ein Überforderungserleben im zwischenmenschlichen Bereich. Diese oft permanenten und meist leicht auslösbaren negativen Zustände des inneren Befindens werden später durch Süchte selbst behandelt, verändert und gelindert. Im Falle der suchtartigen Sexualität – mit Sex als Suchtmittel – werden sie »autoerotisch« oder »promiskuitiv« behandelt und führen für eine gewisse Zeit zu verschiedenen wünschenswerten Zuständen, die das Leiden an sich selbst vergessen machen.
Die Bestsellerautorin Caroline Knapp beschreibt in ihrem Buch Drinking: A Love Story (Knapp 1999) in erschütternder und berührender Art und Weise ihre Liebe zum Alkohol. Die Liebe zum Suchtmittel – sei es Sexualität, Alkohol oder ein anderes Rauschmittel – ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt zum Verständnis jeder Sucht als ein Ersatz für die mangelnden Liebes- und Näheerfahrungen, aber auch als Ersetzung für erschreckende, traumatische oder unverhältnismäßig strafende Erfahrungen mit den frühen prägenden Bezugspersonen. In der Regel werden die Bindungspersonen – meist Mutter und Vater – geliebt, da sie eine lebensnotwendige Beziehung zur Verfügung stellen, die für das körperliche und seelische Überleben wesentlich ist. Aus diesem Grunde werden Suchtmittel aber auch geliebt, da sie eine zentrale Ersatzfunktion für zwischenmenschliches Verhalten erfüllen. Deshalb ist der Verlust einer Sucht wie der Verlust eines engen Vertrauten oder einer Bezugsperson. Sie kann zutiefst Ich-synton sein, und zwar umso mehr, je früher sie bestimmte Aufgaben im psychischen Erleben des Betroffenen übernommen hatte. Wir werden uns später mit dieser bindungsorientierten Facette von Sucht befassen und besser verstehen, warum eine intensive therapeutische Beziehung, eine intime partnerschaftliche Beziehung und die 12-Schritte-Gruppen mit ihrem Selbsthilfekonzept eine so heilsame und schützende Erfahrung bieten können.
Übrigens ist das Phänomen des Vergessens der eigenen Kinder – wie beim Eingangsbeispiel – bei Suchtprozessen nicht unüblich. Der ungarisch-kanadische Arzt und Autor Gabor Maté beschreibt in seinem Buch In the Realm of Hungry Ghosts (Maté 2009) – einem umfangreichen und klugen Werk über Sucht, auf das wir noch gelegentlich zu sprechen kommen werden –, dass vor den Toren der Spielcasinos im kanadischen Vancouver immer wieder Kinder in Fahrzeugen von der Polizei aufgefunden werden. Ihre Eltern haben sie dort zurückgelassen, um spielen zu gehen, und dabei die Zeit vergessen. Die Polizei kennt dieses Phänomen des Vergessens und patroulliert deshalb regelmäßig, um die vergessenen Kinder in den Fahrzeugen zu erlösen.
Wenn jeder Mensch, der Mangelerfahrungen gemacht hat, süchtig werden würde, dann würde es womöglich nur noch süchtige Menschen geben; dies ist aber nicht der Fall, obwohl fast jeder Mensch suchtnahe Erlebens- und Verhaltensweisen ausbilden kann. Wir hätten als Spezies mit Sicherheit nicht überlebt, wenn die Entstehung von Suchtprozessen die Regel wäre. Welche Faktoren Menschen vor Suchtprozessen schützen, d. h. welche sogenannten Resilienzen Menschen trotz widriger Umstände schützen, ist erforscht und soll in Bezug auf Syndrome sexueller Sucht im Verlauf der Kapitel aufgegriffen und betrachtet werden. Um es vorwegzunehmen: Der beste Schutz vor Süchten besteht in intakten zwischenmenschlichen Beziehungen und im Erleben von Selbstwirksamkeit in Bezug auf die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Motive. Durch gelingende Beziehungen wird eine Vielzahl unserer Grundbedürfnisse gestillt und durch das Erleben von Selbstwirksamkeit machen wir die Erfahrung, »Herr im eigenen Hause« zu sein und die Fähigkeit zu haben, unser Handeln an unseren Werten, Zielen und Absichten auszurichten.
Die Ursachen für die Entstehung von Süchten und Störungen der Impulskontrolle sind vielschichtig und biologisch, psychologisch, sozial sowie spirituell bedingt. Der Psychologe Peter Fiedler spricht von »nahen« und »fernen« Entstehungsfaktoren. Anders formuliert, gibt es sowohl ursächlich-auslösende und darüber hinaus unmittelbar aufrechterhaltende Faktoren von süchtigen Prozessen. Die unmittelbar aufrechterhaltenden Faktoren besitzen meist eine hohe funktionale Selbstständigkeit. Sie werden quasi zu Selbstläufern. Die funktionale Selbstständigkeit ist ein Begriff, der von Gordon Allport (1937), einem wichtigen psychologischen Denker des 20. Jahrhunderts, formuliert wurde. Er meinte damit, dass sich süchtige Prozesse von ihren ursprünglichen Beweggründen ablösen und ein sich selbst erhaltendes Eigenleben in sogenannten Suchtkreisläufen führen. Es ist überaus wichtig, nahe (proximale) und ferne (distale) Prozesse in ihrem Wirken zu verstehen, um süchtiges Verhalten minimieren, blockieren, beenden und letztlich verwandeln zu können.
Der Sinn dieses Buches besteht darin, die vielschichtigen Phänomene von Sexualität und Liebe zu verstehen, so wie sie sich uns durch die Linsen verschiedener empirischer Wissenschaften darstellen. Dadurch wird ein Verständnishorizont geschaffen, um abweichende, süchtige und destruktive Sexualitäten ableiten, erkennen und verändern zu können. Dazu müssen wir das grundsätzliche Wesen von sexuellen Prozessen und die Natur der Sexualität erfassen. So können wir süchtiges von nicht-süchtigem und gesundes von gestörtem sexuellen Handeln unterscheiden lernen. Dies, um eine möglichst partnerschaftliche oder beziehungsbezogene Liebesfähigkeit zu entwickeln, die eine Vielzahl unserer zwischenmenschlichen Bedürfnisse erfüllen kann, und zwar dann, wenn wir uns dies wünschen und anstreben. Dabei soll dieses Fachbuch ein Denkanstoß zum Verstehen, Erwägen und Entgegnen sein.
Der Aufbau des Buches erfolgt über drei Hauptteile, die jeweils konkrete Fragen beantworten und die aufeinander bezogen sind. Die drei Teile des Buches können relativ unabhängig voneinander, aber auch als ein verbundenes Ganzes gelesen werden und beinhalten drei große Kapitel.
Der erste Teil befasst sich mit der Frage, was Sexualität und Liebe überhaupt und grundsätzlich sind. Deshalb werde ich zunächst die überaus spannenden und vielfältigen Fragestellungen des sexuellen Erlebens und Verhaltens von Lebewesen im Bezugsrahmen der Evolutionsbiologie beschreiben. Dazu werden wir einige ihrer oft rätselhaften und manchmal seltsamen Erscheinungsformen und Verhaltensfiguren kennenlernen. Diese Erscheinungsformen werden uns weiterführen zu den Themen, die uns schließlich die Fragen zu Suchtprozessen, zu süchtiger und gestörter Sexualität öffnen können. Den Themenfeldern nähern wir uns durch den Zugang über die Evolutionstheorie und den Forschungszweig der evolutionären Psychologie an. Wir werden die Grundlagen der Sexualität und viele Spielarten sexuellen Verhaltens bei anderen Arten und bei einigen unserer nächsten Verwandten den Primaten und insbesondere den Menschenaffen kennenlernen; dies soll uns helfen, zu einem tieferen Verständnis der Sexualität und der Liebe in der Natur zu gelangen. Schließlich werden wir uns mit der Sexualität des Homo Sapiens Sapiens – des Menschen, der wir gegenwärtig sind – befassen. Nach diesem Kapitel wird es möglich sein, einige seltsame, interessante und weiterführende Fragen zu beantworten, wie:
Warum paaren sich Präriewühlmäuse nach ihrer Bekanntschaft mehrere Hundert Mal?
Warum bauen männliche Vögel in Neuguinea kunstvolle Häuser?
Sind Menschen monogam oder polygam veranlagt?
Kann Oralverkehr gut für Beziehungen sein?
Warum masturbieren wir?
Was sind Perversionen?
Warum sollte ein Mann sich von seiner Frau beeinflussen lassen?
Welche Verhaltensweisen zerstören eine Liebesbeziehung mit fast absoluter Sicherheit, wenn sie zu häufig ausgeübt werden?
Wir werden die wichtigsten modernen Vordenker der menschlichen Sexualität – die »Masters of Sex« – und ihre Ideen kennenlernen. Meistens waren das Mediziner, Psychologen, Psychoanalytiker und Biologen, die sich mit vielerlei Rätseln und Phänomenen der menschlichen Sexualität befassten und diese zu verstehen und zu erklären versuchten. Ihre Ideen werden uns helfen, herkömmliche und abweichende menschliche Sexualität zu verstehen und Fragen nach deren Aufrechterhaltung zu beantworten.
Wer Lust hat, sich mit den Grundlagen der Sexualität als Phänomen der Erhaltung des Lebendigen und lebendiger Vielfalt zu befassen, dem möchte ich dieses Kapitel nahe legen. Es stellt die Grundlage für das Verständnis der Sexualität in der Welt des Lebendigen dar.
Der zweite Teil des Buches befasst sich mit der Frage: Was ist Sucht? Zunächst betrachten wir unterschiedliche Annahmen über Sucht und die mit ihr verwobenen Prozesse ganz allgemein. Diese Betrachtung soll deutlich machen, wie verschiedene ferne, d. h. weiter zurückliegende, und nahe, d. h. unmittelbar aufrechterhaltende, Faktoren bei Suchtprozessen zusammenwirken und wie unterschiedliche Entwicklungsverläufe entstehen können. Dadurch gewinnen wir einen Eindruck von den starken Kräften, die auf Individuen einwirken und ihr Erleben und Verhalten süchtig ausformen.
Konkreter stellt sich uns die Frage: Wie können Verhaltenssysteme in Menschen entstehen, die eine so zerstörerische und gleichzeitig eine so anziehende Wirkung entfalten? Gibt es unterschiedliche Formen von süchtigem Verhalten? Wie verlaufen Suchtprozesse? Wie geraten Menschen in Süchte hinein und wie kommen sie wieder heraus? Benötigen süchtige Menschen immer Therapie oder was benötigen sie überhaupt, um ihre Sucht zu überwinden? Nach der allgemeinen Erörterung dieser Fragen wenden wir uns den sexuellen Süchten im Besonderen zu und betrachten diese unter dem Blickwinkel der nicht-stofflichen, der sogenannten Verhaltenssüchte oder der Störungen der Impulskontrolle, d. h. Störungen, die damit einhergehen, dass Impulsmuster so stark und unwiderstehlich werden, dass die Vernunft, die Willenskraft und die Selbststeuerung einer Person völlig außer Kraft gesetzt scheinen.
Nach diesem Kapitel wird es möglich sein, folgende Fragen zu beantworten:
Warum gibt ein Mann in einem Monat 18 000 Euro für Telefonsex aus?
Warum glaubt eine Frau, ein Mann würde sie über alles lieben, obwohl er nicht mehr mit ihr sprechen will?
Warum will ein Mann 16-mal am Tag mit seiner Freundin schlafen?
Wie kann es sein, dass ein junger Mann missbraucht werden will?
Warum schläft ein Mann mit acht verschiedenen Frauen am Tag?
Der dritte Teil des Buches befasst sich mit der Frage nach der Heilung sexueller Süchte. Zum einen geht es um die Fähigkeit zum Verzicht auf süchtiges Verhalten, zum anderen um die Frage, was an die Stelle von süchtiger Sexualität treten kann. Wir verfügen heute über ein recht umfassendes Verständnis von Heilungsvorgängen bei Süchten im Allgemeinen und bei sexuellen Süchten im Besonderen. Wir werden sehen, dass die Heilung von Sucht die Heilung des Ich durch Beziehung ist. Programmatisch und in Anlehnung an Sigmund Freud könnte man formulieren: »Wo Sucht war, sollen Ich und Du sein.« Heilung von sexueller Sucht bedeutet die Entwicklung von Liebesfähigkeit. Viele Sexsüchtige leiden an verschiedenen Formen von Störungen der Intimität und besitzen nur eingeschränkte Fähigkeiten, zwischenmenschliche Nähe als wünschenswert und belohnend zu erleben. Noch ausgeprägter sind Störungen der sexuellen Aversion. Diese Störungen sind charakterisiert durch das Erleben von Ekel, Unbehagen, Angst und einen Widerwillen vor intimen sexuellen Kontakten. Die Fähigkeiten, süchtiges Handeln zu unterlassen, sich selbst ohne süchtiges Handeln zu ertragen, sich verantwortungsvoll in Bezug auf das eigene Wertesystem zu steuern und in Beziehung zu setzen, sind die Hauptachsen der Heilung sexueller Süchte.
Nach diesem Kapitel wird es möglich sein, folgende Fragen zu beantworten:
Welche Behandlungselemente benötigt man zur Behandlung sexueller Süchte?
Warum ist das Verständnis von Scham bei sexuellen Süchten extrem wichtig?
Was erhält die Erotik in einer langjährigen Partnerschaft lebendig?
Warum muss man den »sinnlichen Fokus« kennen?
Warum sollte man gelegentlich auf Orgasmen verzichten?
Was ist Karezza?
Dieses Buch soll eine Inspirationsquelle sein. Für alle Betroffenen und deren Angehörige wünsche ich mir, dass sie einen Einblick in die Welt der sexuellen Süchte erhalten und Hoffnung auf Veränderung und Genesung erfahren können. Für alle behandelnden Kollegen wünsche ich mir im Besonderen, dass sie ermutigt werden und Lust bekommen, die Störungen der Impulskontrolle – insbesondere die sexuellen Süchte – zu behandeln.
1 Was ist Sex und was ist Liebe?
»Echtes Wissen bedeutet die Ursachen zu kennen.«
Sir Francis Bacon
Alessandro Moreschi wurde wegen seiner himmlischen Stimme der »Engel von Rom« genannt. Es existieren zwei Tonaufnahmen aus den Jahren 1902 und 1904 von ihm. Moreschi war der letzte Kastratensänger. 1868 wurde er kastriert. Seine Keimdrüsen – beim Mann die Hoden – wurden entfernt. Wir wissen nicht genau, wie sich ein menschliches Leben ohne Sexualität angefühlt haben mag, haben jedoch das Gefühl, dass Männer ohne Keimdrüsen um einen ganz wesentlichen Aspekt ihrer Existenz beraubt sind. Vielleicht gestattet ihr Zustand ihnen aber auch ein Leben in »seligem Frieden« jenseits der starken Triebkräfte der Sexualität. Historiker vermuten bei Menschen Ersteres, und trotzdem stehen wir selbst unseren kastrierten Hunden und Katzen mit einer Mischung aus Bedauern und Beneiden gegenüber.
Heute wird glücklicherweise niemand mehr kastriert, und spätestens in der Pubertät, der einsetzenden Geschlechtsreife, werden wir konfrontiert mit starken Triebkräften, die unser Erleben und Verhalten tiefgreifend umformen und bestimmen. Die Sexualität, die dann zutage tritt, umfasst verschiedene Empfindungen und Handlungen und ist weit mehr als nur Geschlechtsverkehr zum Zwecke der Fortflanzung. Dabei begleitet uns unsere Sexualität ein Leben lang und ist ein grundlegendes Bedürfnis und Teil unserer Persönlichkeit, dem wir vor allem im Rahmen von Beziehungen viel Bedeutung beimessen. Dabei beruht unsere Sexualität auf einem komplexen Zusammenspiel von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren und kulturellen Einflüssen.
1.1 Sexualität und Evolution oder: Von Liebeswanzen und Cunnilingus
1.1.1 Die Liebeswanze: Drei Tage im Liebesrausch
In den frühen Morgenstunden schwärmen(1) die Männchen der Liebeswanzen massenhaft(1) aus und kreisen in einem Abstand von ca. 30 Zentimetern über der Erde. Sie warten im Flug auf die Möglichkeit, sich mit einem Weibchen zu paaren. Die weiblichen Liebenswanzen fliegen meist nicht, sie bleiben am Boden und kriechen aus der schützenden Vegetation in Richtung der fliegenden Männchen. Manchmal wird ein Weibchen von einem Männchen erwischt, bevor es selbst auffliegen kann. Oft sind die Männchen in Kämpfe verwickelt, dabei können sich bis zu zehn Männchen um ein einzelnes Weibchen drängeln. Erfolgreiche Männchen entfernen sich mit ihrem Weibchen vom Schwarm, und das Insektenpaar gleitet zur Kopulation auf den Boden. Das Männchen wird mit dem Weibchen drei ganze Tage lang kopulieren und sich vor Ablauf dieses Zeitraums kein einziges Mal von ihm lösen. Was das Insektenpaar dabei empfindet, wissen wir nicht.
Wenn wir uns das sexuelle Verhalten der Liebeswanzen anschauen, dann fragen wir uns bald: Warum tun sie das, was sie tun? Und was tun sie überhaupt? Warum tun sie es auf diese Art und Weise?
Um Sexualität zu verstehen, muss man ihre Aufgabe in der Welt des Lebendigen verstehen. Sexualität ist(1) zunächst Verhalten und Erleben zum Zwecke der Fortpflanzung. Man kann sagen: Ihr augenscheinlicher Sinn besteht in der Entstehung neuer Generationen. Geschlechtliches Verhalten findet(1) in der Regel zwischen Geschlechtspartnern statt und hat zusätzliche, oft komplexe Aufgaben im Sozialgefüge von Lebewesen. Im weiteren Sinne bezeichnet Sexualität die Gesamtheit der Verhaltens- und Erlebensweisen von(1) zwei unterschiedlichen Geschlechtern, männlich und weiblich, und deren wechselseitige Bezogenheit aufeinander – meist zum Zwecke der Fortpflanzung und(1) deshalb auch gelegentlich zum Zwecke der Bindung der Partner aneinander. Dabei ist Sexualität ein vielgestaltiges, gelegentlich auch skurril anmutendes Geschehen, mit dem Sinn der Vervielfältigung lebender Organismen, in den sie umgebenden Umwelten.
1.1.2 Charles Darwin und die Entstehung der Arten
Charles Darwin, der(1) Begründer der Evolutionstheorie, hat(1) uns als Erster ein umfassendes Verständnis der Entstehung der Arten und(1) der damit verbundenen Aufgabe der Fortpflanzung gegeben(1). Natürlich wusste man auch schon vor Darwin, was Fortpflanzung ist, aber erst Darwin hat uns die tiefere Bedeutung der Sexualität und der sexuellen Auslese in einem umfassenden naturkundlichen Zusammenhang erschlossen. Dieser war vor ihm nur unzureichend erkannt und verstanden worden.
Am 24. November 1859 erschien sein Hauptwerk On The Origin of Species (Über die Entstehung der Arten) (Darwin 2012). Hier gelang es ihm, die grundlegenden Mechanismen der Entstehung und Vermehrung von Lebewesen zu beschreiben. Seine Ideen bilden die Grundlage für die moderne Biologie und haben unser Verständnis von der Natur des Lebendigen und von uns selbst als Menschen für immer verändert. Nach Darwin gehören Menschen zu einer Gruppe von menschähnlichen Affen, den Hominiden. Dazu(1) gehören Gorillas, Schimpansen, Bonobos und Orang-Utans. Diese Affen sind zwar eng miteinander verwandt, unterscheiden sich jedoch stark hinsichtlich ihres sozialen Verhaltens, z. B. sind Orang-Utans ganz überwiegend lebenslange Einzelgänger, Bonobos dagegen ausgesprochen aufeinander bezogene Gruppentiere, bei denen die »soziale Sexualität« eine(1) besonders wichtige Rolle spielt. Intuitiv können wir diese stammesgeschichtliche Nähe zwischen uns und den Menschenaffen spüren, wenn wir z. B. im Zoo in ihre Gesichter blicken und sie in die unsrigen. Dann erleben wir oft ein seltsames, manchmal verwirrendes Gefühl der Ähnlichkeit und Nähe.
Als Darwin 24 Jahre vor Erscheinen seines Hauptwerks, das die bis dahin gängige, biblische Weltsicht umstürzte, die Galapagosinseln bereiste, stellte er zu seiner Überraschung fest, dass es auf den 14 sehr abgelegenen Inseln jede Menge Vögel gab. Diese Vögel hielt er für Meisen, Spechte und andere typische Landvögel. Nachdem er unterschiedliche Exemplare gefangen und präpariert hatte, schickte er sie nach England, um sie von dem Vogelexperten des Museums der Zoologischen Gesellschaft von England John Gould untersuchen zu lassen. Dieser stellte jedoch – zum großen Erstaunen Darwins – fest, dass es sich bei allen Vögeln um bisher unbekannte Finken handelte, dass also alle Tiere Exemplare einer einzigen Art waren. Darwin war angesichts des Variantenreichtums dieser artgleichen Vögel fasziniert und verwundert und schloss schließlich daraus, dass es einen bestimmten Prozess der Entwicklung von Arten geben müsse.
Der zentrale Aspekt dieses Vorgangs ist nach Darwin die Hervorbringung von verschiedenen Exemplaren einer Art, d. h. von etwas voneinander abweichenden Artgenossen. Diese(1) »variierenden Artgenossen« sind dann zufällig mehr oder weniger angepasst oder geeignet für das Überleben in einer bestimmten Umgebung, wie z. B. in Steinwüsten mit Kakteen oder in Wäldern mit hohem Baumbestand. Je besser die zufällige Anpassung gelingt, desto höher wird die Überlebens- und Fortpflanzungswahrscheinlichkeit einzelner(1) Exemplare. Mit dieser naturkundlichen Denkfigur erklärte(1) sich Darwin die Entstehung seiner weltberühmt gewordenen Darwinfinken: Die Natur sorgt durch spezielle genetische Mechanismen – die natürliche Zuchtwahl – für Variationen, welche sich zufällig als nützlich für das Überleben in einer bestimmten Umwelt erweisen. Die Träger der nützlichen Merkmale überleben durch ihre bessere Anpassung an die gegebene Umwelt mit höherer Wahrscheinlichkeit und können ihre Merkmale durch Fortpflanzungserfolge an nachfolgende Generationen weitergeben, die dann auch passender ausgerüstet sind.
Nach Darwin besteht also die Hauptaufgabe der Sexualität, die(2) in der Regel zweigeschlechtlich ist, in der Hervorbringung neuer und unterschiedlicher Individuen, bestimmt durch eine jeweilige, spezifische Genkombination. Die zweigeschlechtliche Fortpflanzung ermöglicht einen großen Spielraum für genetische Neukombinationen, die dem Überleben und der Fortpflanzung dienlich sein können. Warum wir uns nicht mit drei oder noch mehr Geschlechtern fortpflanzen, ist nicht vollständig geklärt. Auf der Ebene der Wimperntierchen gibt es Arten, die mehr als zwei Paarungstypen aufweisen – möglicherweise hatte die mehrgeschlechtliche Fortpflanzung zu viele Nachteile, als dass sie sich im Bereich der höher entwickelten Tierwelt hätte herausbilden können.
1.1.3 Sexuelle Auslese oder: Warum männliche Feuerkäfer besonders giftig sein müssen
Darwin erkannte als Erster(1) die Grundprinzipien für die unglaubliche Vielfalt des Lebens und der Fortentwicklung von Arten durch die natürliche Auslese. Die Finken auf den Galapagosinseln wurden zum Symbol und zum Grundmuster für alle evolutionären Prozesse. Darüber hinaus erkannte er, dass es einen weiteren sehr wichtigen Prozess gab, der das sexuelle Verhalten von Tieren und Menschen maßgeblich bestimmt. Zusätzlich zur natürlichen Zuchtwahl durch die Umwelt findet nämlich die sogenannte sexuelle Auslese statt. Die sexuelle Auslese ist(1) ein spezieller Auswahlprozess innerhalb einer Art, der nicht, wie die natürliche Auslese und somit durch die jeweils gegebene Umwelt und ihren speziellen Anpassungsdruck wirkt, sondern durch die Mitglieder der eigenen Art ausgelöst wird.
Dieser faszinierende Vorgang spielt sich innerhalb der Männchen und Weibchen einer Art ab und bestimmt den Fortpflanzungserfolg und somit die Fortpflanzungsrate von unterschiedlichen Artgenossen. Die sexuelle Auslese unterscheidet zwei Vorgänge: erstens die gleichgeschlechtliche Konkurrenz zwischen Angehörigen desselben Geschlechts um Paarungszugang und zweitens die gegengeschlechtliche Konkurrenz, d. h. die Partnerwahl, durch Angehörige des anderen Geschlechts. Häufig erfolgt der zuletzte genannte Zugang über die Weibchen, die sich die Männchen auswählen.
Die gleichgeschlechtliche Auslese wirkt(1)(1) auf körperliche Merkmale und Verhaltensmerkmale, die den Zugang zu Geschlechtspartnern ermöglichen sollen, und bezieht sich auf Eigenschaften wie die Körpergröße bei See-Elefanten, die Bruströte bei Blutbrustpavianen und das Geweih von Hirschbullen. So ist es z. B. stärkeren See-Elefanten möglich, Nebenbuhler in oft heftigen und blutigen Kämpfen zu verletzen und sie vom Harem – der 10–20 Kühe umfassen kann – an den Rand der Kolonie abzudrängen. Dies hindert die kleineren Bullen übrigens nicht daran, sich gelegentlich doch heimlich mit Weibchen am Rande der Kolonie zu paaren.
Bei der gegengeschlechtlichen Auslese findet(1)(1) die Partnerwahl durch Angehörige des anderen Geschlechts statt. So kann sich ein Weibchen durch ihre Partnerwahl direkte Vorteile sichern, z. B. ein hochwertiges Territorium, die Beteiligung des Männchens an der Aufzucht der Jungen oder die Abwehr von Feinden für ihre Nachkommen. Dazu muss es ihr aber gelingen, ein geeignetes und fähiges Männchen zu finden. Bei den Feuerkäfern prüft das Weibchen, wie giftig ein Männchen ist, bevor sie es auswählt. Das Männchen nimmt das Gift Cantharidin auf(1), dessen Aufgabe es ist, das Tier vor Fressfeinden zu schützen. Je mehr Cantharidin das(1) Männchen aufnehmen kann, desto wahrscheinlicher lässt sich das Weibchen von ihm paaren. Das Cantharidin der Spanischen Fliege wurde übrigens lange als Aphrodisiakum verwendet(1).
Auch bei Homo Sapiens Sapiens – uns Jetzt-Menschen – spielen die oben angeführten evolutionären Auswahlprozesse noch eine sehr bedeutsame Rolle, und dies trotz unserer kulturellen Entwicklung. Viele Frauen fühlen sich z. B. von reichen Männern und deren Status überaus angezogen. Dies liegt aus evolutionärer Sicht daran, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Männer ausreichende oder sogar sehr üppige Ressourcen zur Verfügung stellen können, sehr hoch ist. Nach Artjom Tolokonin, dem bestbezahlten Psychotherapeuten der Welt, der in Moskau milliardenschwere Oligarchen für angeblich 7000 Euro die Stunde behandelt, leiden diese reichen Männer häufig unter der Angst, von ihren Geliebten wegen ihres Reichtums ausgebeutet zu werden. Eine durchaus nachvollziehbare und berechtigte Angst, denn es findet ein mehr oder weniger verschleierter Austausch von Ressourcen statt – Jugend, Sex und Schönheit gegen Geld und Macht. Wenn es einer Geliebten nicht gelingt, die Frau eines Oligarchen zu werden, kann sie vielleicht wenigstens ein Kind von ihm haben und sich so weitgehende Ressourcen sichern, die ihr und das Überleben ihres Nachwuchses sichern. Eine Geliebte, die nicht die Frau eines Oligarchen hatte werden können und auch kein Kind von ihm bekommen hatte, drückte es so aus: »Es war so dumm von mir, es nicht so zu machen wie die anderen – wenn ich ihm ein Kind in die Welt gesetzt hätte, wäre er ein Leben lang nicht mehr von mir weggekommen, und ich hätte für immer ausgesorgt.«
Merke
Die zentralen Wirkmechanismen der(1) Evolution sind die natürliche Auslese und die sexuelle Auslese durch die zwei Geschlechter bzw. durch die zweigeschlechtliche Fortpflanzung. Dabei finden Auswahlprozesse häufig durch die Weibchen einer Art statt, die sich die Männchen, mit denen sie sich begatten, aussuchen.
Es gibt aber auch Reizbedingungen, die Weibchen für Männchen sehr attraktiv machen. Im Bereich der sexuellen Süchte werden Männer oft durch sogenannte supernormale Reize übermäßig an sexuelle Szenarien gebunden.
1.1.4 Die Eintagsfliege: Sex haben und sterben
Als ich in Heidelberg studierte, kam es einmal im Jahr zu einem seltsamen Spektakel, das wie ein Spuk kam und ging und das uns Studierende alljährlich faszinierte und völlig überraschte. Beim abendlichen Überqueren der Neckarbrücke flogen Abertausende Insekten – gemeine Eintagsfliegen – durch die Luft und lagen in Massen auf dem Brückenboden und den ufernahen Straßen, sodass es kaum möglich war, nicht auf die kleinen, mattweißen Insekten zu treten. Bei genauerem Hinschauen konnte man erkennen, dass die Eintagsfliegen nicht(1) alleine waren. Die meisten dieser Insekten befanden sich mitten in der Paarung und taumelten verklammert durch die Luft oder lagen, sich ineinander krümmend, auf dem Boden. Die Eintagsfliege pflanzt sich nur an einem einzigen Tag des Jahres fort und stirbt kurz danach. Diese Form der einmaligen Fortpflanzung wird(1) mit dem seltsamen Ausdruck »Semelparie« beschrieben(1) und kommt nicht nur bei Insekten, sondern auch bei Kraken, Lachsen und Wegschnecken vor. Nachdem die Weibchen am Grunde des Neckars geschlüpft sind, fliegen sie in den sogenannten Hochzeitsschwarm der Männchen und werden dort von diesen ergriffen. Dann beginnt die Paarung. Die Weibchen legen danach ihre Eier ins Wasser von Flüssen, wobei sie vorher einige Kilometer entgegen der Fließrichtung des Gewässers – also flussaufwärts – geflogen sind. Bei einigen Arten sind fast ausschließlich Weibchen vorhanden, diese entwickeln sich durch Jungfernzeugung, d. h. durch nicht-sexuelle Fortpflanzung. Nicht-sexuelle Fortpflanzung ist die Entstehung von Individuen durch einfache Teilung ohne genetische Neukombination durch zwei Geschlechter.
Natürlich kann man sich auch fragen, warum wir Menschen uns nicht durch einfache Teilung, sondern durch die sexuelle, zweigeschlechtliche Fortpflanzung vermehren(1). In der Tat spielt vor allem bei Pflanzen die eingeschlechtliche Fortpflanzung eine wichtige Rolle. Verschiedene Gewächse besitzen sogenannte Brutblätter, an denen winzige, jedoch vollständige Pflänzchen mit Wurzeln heranreifen. Wenn diese Pflänzchen zur Reife kommen, fallen sie einfach ab, wurzeln sich ein und wachsen an. Diese Form der Fortpflanzung ist die Klonung – die(1) Entstehung genetisch identischer Nachkommen. Ihr Nachteil: Es entstehen keine neuen Varianten, sondern alle sind gleich. Wäre es nicht praktisch, wenn wir uns nicht ebenso fortpflanzen würden? Wenn uns an Brutfingern kleine Klone wachsen würden, die vollständig heranreifen, abfallen und dann ihrer Wege gehen würden? Ein seltsamer Gedanke, theoretisch jedoch möglich.
Vermutlich benötigen höher entwickelte Lebewesen für ihr Überleben einen größeren Variantenreichtum, um sich in ihren Umwelten ausdehnen oder in ökologischen Nischen neue Lebensräume erschließen zu können. Menschen haben diese Fähigkeit in ganz außerordentlichem Ausmaß durch ihre Intelligenz entwickelt und sich dadurch in fast allen Gegenden der Erde beheimatet. Möglicherweise sind wir Menschen auch zu kompliziert aufgebaut, als dass einfache Klonung überhaupt für uns möglich wäre.
Merke
Die natürliche Auslese und(1) die sexuelle Auslese begründen die Verschiedenheit und Vielfalt des Lebendigen in der Natur.
Es findet also keine Neukombination von genetischem Material statt, die Geschwister sind genetisch gleich. Fähig zur Jungfernzeugung sind(1) u. a. Rüsselkäfer, Krebse und zum Schrecken aller Eltern mit Kindergartenkindern: Kopfläuse! Im Bereich der höheren Säugetiere sind eineiige Zwillinge oder Drillinge genetisch identische Individuen, diese entstehen jedoch durch sexuelle Fortpflanzung.
Wenn(1) wir in diesem Buch von Sexualität sprechen, meinen wir eigentlich immer die zweigeschlechtliche Sexualität und das damit einhergehende Verhaltensrepertoire, kurz: das gesamte direkte und indirekte sexuelle Verhalten. Direkt meint z. B. die eigentliche Paarung und indirekt meint alle Verhaltens- und Erlebensweisen, die direktes sexuelles Verhalten vorbereiten, wie z. B. die ausgefallenen Balzrituale der Paradiesvögel oder den unglaublichen Nestbau der Männchen beim Hüttengärtner, aber auch die Werbung eines Mannes um eine Frau.
1.1.5 Wo nur Königinnen Sex haben und warum Sex mehr ist als Fortpflanzung
Ein besonders wichtiger Vertreter der Biologie des 20. Jahrhunderts ist Edward O. Wilson(1). In seinen aktivsten Zeiten war er ähnlich umstritten, wie es Darwin in seiner Zeit gewesen war. Wilson ist der Begründer der Soziobiologie (Wilson(1) 2013; Voland 2013). Die Soziobiologie ist ein evolutionsbiologischer Zweig der Verhaltensbiologie. Sie(1) erforscht alle Formen des sozialen Verhaltens – insbesondere des sexuellen Verhaltens – unter dem Blickwinkel der natürlichen Auslese. Wilsons Spezialgebiet waren zunächst soziale Insekten, vor allem Ameisen. Seine biologischen Erkenntnisse über die Organisation von Ameisen hat er ausgedehnt auf andere Tierarten und Menschen. Er geht davon aus, dass alles tierische – und deshalb auch menschliches – Verhalten das Produkt von Erblichkeit, Umgebungsreizen und vergangenen Erfahrungen, d. h. von Lernen, ist.
Die zentrale Einheit aller biologischen Auswahlprozesse und deshalb auch der Sexualität ist für Wilson nicht das Einzelwesen – das Individuum –, sondern das Erbgut, das Genom. Dies(1) konnte er seiner Ansicht nach überzeugend durch das selbstlose und asexuelle Verhalten von(1) Ameisen zeigen. Die weiblichen Ameisen eines Volkes opfern sich nämlich häufig unter Einsatz ihres Lebens für ihre Königinnen auf. Dies ohne selbst jemals sexuelles Verhalten zu zeigen oder sich fortzupflanzen. Mit ihren Schwestern teilen sie den überwiegenden Teil ihrer Gene. Sie schützen, pflegen und hegen ihre Ameisenkönigin unter Einsatz ihres Lebens. Die Königin ist das einzige weibliche Individuum ihres Volkes, welches Sex hat und Nachkommen zur Welt bringt. Man kann sagen, sie ist die Brutstätte des Volkes. Mit ihren befruchteten Eiern gründet die Königin einen neuen Staat. Die Männchen sterben nach dem Hochzeitsflug, sobald sie sich mit einer Königin gepaart haben. Sie haben keine weiteren Aufgaben.
Wilsons Ideen blieben nie unwidersprochen und mussten z. T. auch durch neue Befunde korrigiert werden. Vor allem wird ihm vorgeworfen, dass das Modell sozialer Insekten kein Erklärungsmodell für das Verhalten von Menschen sein kann. Dennoch hat er sich häufig zur menschlichen Sexualität unter der soziobiologischen Perspektive geäußert(1) und wichtige Fragen des menschlichen Sexualverhaltens und sogar sexueller Ethik aufgegriffen. Zum Beispiel erklärt er, warum Paare nicht nur zum Zwecke der Zeugung miteinander schlafen und warum Homosexualität als(1) ein Beitrag zur Vielfalt der menschlichen Sexualität betrachtet werden sollte. Er äußert sich explizit gegen eine enge, dogmatische Sexualethik, wie(1) sie z. B. viele Religionen vertreten und aus Wilsons Sicht meist auf völliger biologischer Unkenntnis und Ignoranz basiert. Homosexualität z. B. hält Wilson für »tendenziell« angeboren. Wobei er von einem sexuellen Merkmal ausgeht, das nicht völlig fest fixiert ist und deshalb das Verhalten einer Person auch nicht zwingend determiniert, sondern Teil einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Entwicklungspfades in ein stabiles homosexuelles Verhalten und Erleben hinein sein kann.
Die Tatsache, dass Menschen nicht nur zum Zwecke der Zeugung Sex haben (oder haben sollten), erklärt er mit dem Phänomen des verborgenen Eisprungs bei(1) Frauen. Hiermit wird die Tatsache umschrieben, dass Männer nicht genau erkennen können, wann ihre Partnerin fruchtbar und empfängnisbereit ist. Wenn Männer Sicherheit bezüglich ihrer Vaterschaft haben wollen, sind sie gut beraten, sich so zu verhalten, dass sich eine Frau dauerhaft an sie binden möchte, damit diese ihre Kinder von ihm und nicht von anderen Männern haben will. So erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der eigenen genetischen bzw. biologischen Vaterschaft(1). In streng patriarchalen Gesellschaften wurde die Sicherheit in die Vaterschaft oft genug auf Kosten der Frauen erzwungen, indem diesen der Kontakt mit Männern, die nicht ihre Ehemänner waren, unter Strafandrohung völlig verboten war. Diese erzwungenen Formen partnerschaftlicher Inbesitznahme zum Zwecke der Sicherheit in die Vaterschaft kommen auch bei vielen höheren und niederen Tieren vor. So gibt es männliche Käfer, die ihre Weibchen nach der Kopulation verplomben, damit diese sich nicht mit anderen Männchen vereinigen können, oder Männchen, die sich tagelang auf den Weibchen festklammern, damit kein anderes Männchen sie begatten kann. Wir werden bald noch mehr über diese Phänomene erfahren. Wilson spricht sich jedenfalls sehr deutlich gegen eine dogmatische Sexualethik und für die sexuelle Vielfalt aus.
Das Phänomen des verborgenen Eisprungs steht in engem Zusammenhang mit dem sexuellen Verhältnis zwischen Frauen und Männern und mit verschiedenen vorgeprägten Fortpflanzungsstrategien, welche die sexuellen und sozialen Verhaltenstendenzen von Mann und Frau unterschiedlich ausformen. Deshalb können die männliche und die weibliche Sexualität auch(1)(1) zu verschiedenen sexuellen und romantischen Verhaltenssüchten führen. In der Regel stehen bei den Säugetieren den wenigen befruchtungsfähigen Eiern der Weibchen eine sehr große Menge an Spermien der Männer gegenüber, weshalb eine intensive Konkurrenz zwischen den Spermien selbst und den Besitzern der Spermien auftreten kann. Als Faustregel lässt sich sagen: Je größer die sexuelle Konkurrenz unter den Männchen, desto mehr Spermien werden erzeugt!
1.1.6 Der Krieg der Spermien
Mit nur einer Ejakulation kann ein Mann so viele Spermien abgeben, dass damit die gesamte weibliche Bevölkerung der USA einmal befruchtet werden könnte. Darüber hinaus haben wir viel häufiger Lust auf Sex als Lust auf Zeugung. Warum nimmt die Sexualität eine so hervorgehobene Stellung in unserem Leben ein?
Der Biologe Robin Baker (2006(1)) versucht diese Fragen mit der Idee von der Spermienkonkurrenz zu(1) beantworten. Dabei konkurrieren sowohl die Spermien eines Individuums als auch die Spermien verschiedener Männchen um den Zugang zum Ei des Weibchens. Ein Grund für die hohe Anzahl an Spermien ist die Begattung des Weibchens durch mehrere Männchen. Die Männchen, die am meisten Sperma produzieren können, haben eine größere Befruchtungswahrscheinlichkeit als die Männchen, die weniger Sperma produzieren, und tatsächlich besitzen die hochpromiskuitiven Schimpansen deutlich größere Hoden als die Gorillas, die im Alleinanspruch dieselbe Gruppe von Weibchen begatten. Außerdem gibt es verschiedene Arten von Spermien, die blockierende und abtötende Funktionen gegenüber fremdem Sperma haben. Eine wichtige Funktion der Spermienkonkurrenz wurde vor kurzem von dem Zoologen Dieter Lukas von(1)





























