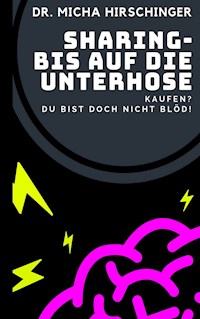
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kaufen Sie noch oder leben Sie schon? Wir haben uns so ans Kaufen und Besitzen gewöhnt, dass wir vergessen haben, wie beides die Ressourcen der Erde ruiniert, das Klima zerstört und das eigene Leben ersticken kann. In der Fülle der Besitztümer verschwindet der Mensch, das Klima und die Umwelt. Dabei könnten wir es so viel einfacher und besser haben: Dank Sharing. Für jedes Auto, das wir sharen, müssen 15 andere nicht gebaut werden, welche die Ressourcen der Welt verschwenden und das Klima vergiften. Und was fürs Auto gilt, gilt für (fast) jedes andere erdenkliche Produkt und Gut: Bohrmaschine, Rasenmäher, Grill, Hochzeitskleid, Sauna, Apfelbäume ... Bis auf die Unterwäsche könnten wir so gut wie alles sharen, was wir brauchen. Das heißt nicht, dass wir heute unseren Besitz verkaufen müssen, um morgen nur noch zu sharen. Es heißt: Mit jedem Gegenstand, den wir statt teuer zu kaufen künftig kostengünstig sharen, befreien wir uns von der Last des Besitzes, das Klima von Treibhausgasen und unsere Kinder von einer Zukunft auf einer geplünderten Erde. Rettet die Sharing Economy die Welt und unsere zeitweise viel zu egoistische Gesellschaft? Ja, wenn wir sharen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort vom Teilen
Der unterschätzte Megatrend
Kaufen ist doof
Sharing ist schön
Das Sharing-Paradies
Welchen Müll haben Sie diese Woche gekauft?
Sharing von A wie Arbeitsplatz bis Z wie Ziege
Sei dabei! Die Sharing Community
Die größten Flops
Stresstest Sharing: Lohnt das wirklich?
The Sharing Score
Nachwort von einer besseren Welt
„People don’t want to buy a quarter-inch drill. They want a quarter-inch hole.” Theodore Levitt, Harvard Business School-Legende
Vorwort vom Teilen
Vor kurzem wollte ich ein Auto kaufen. In die engere Auswahl fielen einige Marken und Modelle der Mittelklasse, allesamt sehr attraktiv – es gibt keine hässlichen Neuwagen. Aber: Neuwagen?
Der Wertverlust in den ersten drei Jahren ist schockierend: unglaubliche 50 Prozent. Und dann: Kann man heutzutage noch einen Diesel kaufen? Hat mein Vermieter überhaupt einen Stellplatz für mich? Was kost‘ mich das? Und die Versicherung: Voll- oder Teilkasko? Welche Ausstattung brauche ich eigentlich und worauf kann ich gut und gerne verzichten? Wie groß sollte der Kofferraum sein? Wieviel PS sollte der Motor haben? Was schluckt er auf 100 km? Wie vertrauenswürdig ist diesbezüglich die Hersteller-Angabe? Und was sagt mein umweltbewusstes persönliches Umfeld, wenn ich demnächst mit einem „Klimakiller“ vorgefahren komme?
Bei so viel Geld für Anschaffung und Unterhalt eines Autos wollte ich sichergehen, dass ich es hinterher nicht bereue. Also zerbrach ich mir über Tage den Kopf. Manche machen das gerne.
Ich nicht. Ein Auto ist ein nützlicher und ästhetisch ansprechender Gebrauchsgegenstand, aber sicher kein Anlass für tagelanges Grübeln. Ein Auto ist schließlich keine lebensentscheidende Frage. Es gibt Wichtigeres, über das man ernsthaft mal nachdenken sollte. Vor allem, wenn man das Ende bedenkt: Da ringt man sich unter Mühen endlich eine Entscheidung ab – und dann steht das Auto doch die meiste Zeit unbenutzt auf irgendwelchen Parkplätzen und verliert Wert. Deshalb kaufen insbesondere Großstädter, die über ein höheres Einkommen verfügen, heutzutage kaum mehr ein Auto. Nicht nur, weil sie keines brauchen.
Sondern auch, weil man keine Parkplätze findet in den Innenstädten und oft noch nicht einmal in der eigenen Wohnsiedlung. Weil bei Innenstadt-Terminen die Parkplatzsuche oft mehr Zeit verschlingt als der eigentliche Termin (oder die Anfahrt). Weil man Großstadtluft mit dem Messer schneiden und giftmüllentsorgen kann. Und weil die Ressourcen der Erde schlicht nicht mehr reichen: Die Blechlawine der Neuwagen verschlingt die Rohstoffe der Erde in einem so irrwitzigen Tempo, dass unsere Kinder auf dem Trockenen sitzen und unsere Raffgier verfluchen werden. Schon bald wird die Menge der jährlich produzierten Neuwagen die 100-Millionen-Marke überschreiten: Das hält kein Planet aus. Man könnte auch sagen: „Kauf noch schnell ein Auto! Deine Kinder werden es weder können noch wollen!“ Dabei müsste niemand ein Auto kaufen.
Es gibt schließlich Carsharing. Wenn einer ein Auto kauft, nutzt einer das Auto. Das heißt, er nutzt es ja nicht. Er fährt damit eine halbe bis eine Stunde zur Arbeit und wieder zurück und 22 oder 23 Stunden steht das Fahrzeug, das seinem Namen keine Ehre macht, nutzlos am Straßenrand oder in der Garage. Wenn jemand das Auto jedoch shart, nutzen dasselbe Auto viele Menschen und es ist im Idealfall ständig in Bewegung. Deshalb kann ein geshartes Auto, laut Umweltbundesamt, bis zu 15 gekaufte Autos ersetzen. 15 Autos weniger verstopfen die Innenstadt! Auf die Millionen herumfahrender Autos angewandt: Alle Staus der Welt wären mit einem Schlag abgeschafft! Wenn wir sharen statt kaufen würden. Denn mehr Sharing bedeutet auch weniger Stau.
Eine Studie der Unternehmensberatung Deloitte zeigt, dass allein die USA jährlich 185 Millionen Dollar an Spritkosten und 2,2 Milliarden Dollar für im Stau verlorene Arbeitszeit sparen könnten, wenn mehr geshart würde. Das würde in den Städten auch fast eine Million Tonnen weniger CO2-Ausstoß bedeuten. Wenn wir sharen und nicht kaufen würden. Und nicht nur Autos.
Wer sich in Verwandtschaft und Bekanntenkreis umhört, erfährt erstaunt, dass bereits jetzt schon fleißig geshart wird. Tante Gertrud zum Beispiel kauft das Spielzeug nicht, mit dem ihre beiden kleinen Nichten bei ihren sporadischen Besuchen spielen. Sie shart es via MeineSpielzeugkiste. de und bezahlt mit Spielzeugflatrate. Inzwischen haben ihre Schwester und die Mutter der Kleinen die Idee ebenfalls entdeckt: „Was wir jährlich für Spielzeug ausgeben, ist horrend! Dann spielen die beiden drei, vier Tage damit und dann liegt es in der Ecke. Sharen kostet mich keine 15 Euro im Monat! Und wir bekommen dafür ständig neues Spielzeug.“ Tante Gertruds Nichten sind vielleicht etwas extrem. Doch selbst Ernst Kick, Chef der Spielwarenmesse Nürnberg, weist darauf hin, dass ganze 40 Prozent aller verkauften Spielwaren lediglich eine Nutzungsdauer von nur eineinhalb Jahren haben. Das erklärt auch, warum ein „normaler“ westeuropäischer Haushalt geradezu in Spielzeug erstickt. Was schätzen Sie? Wieviel Spielzeuge nennt ein durchschnittliches westeuropäisches Kind sein eigen?
Laut „The Telegraph“ besitzt ein normales britisches Kind 238 Spielzeuge. Mit Ihrer Schätzung lagen Sie eklatant darunter? Nicht nur Sie. Alle Erwachsenen unterschätzen den Spielzeug-Tsunami, der in Kinderzimmern tobt. Wir unterschätzen leider auch die Tsunami-Folgen, vor denen die Wissenschaft schon lange warnt. Das Fachblatt „Infant Behavior and Development“ zum Beispiel hat (2018) eine Studie veröffentlicht, die zeigt: Zu viel Spielzeug bremst die gesunde geistige Entwicklung des Kindes. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Je weniger Spielzeug ein Kind hat, desto besser kann es sich konzentrieren und desto kreativer wird es. Zu viel Spielzeug ist schlecht fürs Kind.
Jährlich geben wir Deutschen, laut Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels (BVS), 3,1 Milliarden Euro für Spielzeug aus (2017). Bei 8,2 Millionen deutscher Paarhaushalte mit minderjährigen Kindern ergibt das Ausgaben pro Haushalt in Höhe von durchschnittlich 378 Euro. Im Jahr. Würde die Familie nicht kaufen, sondern sharen, könnte sie ihre lieben Kleinen für dieselbe Summe mehr als doppelt so lange mit Spielzeug versorgen: zwei Jahre und ein Monat. Man könnte daraus flott die Faustregel ableiten: Sharen ist doppelt so gut wie Kaufen. Und nicht nur beim Auto. Es gibt heute fast nichts mehr, was man nicht sharen könnte. Worauf tippen Sie?
Zum Beispiel, ganz erstaunlich: Auch und gerade medizinische Geräte werden heutzutage geshart. Denn beispielsweise für minimalinvasive endoskopische Instrumente gilt in den meisten Krankenhäusern, was auch fürs Auto gilt: Grob die Hälfte der Zeit steht das Zeug ungenutzt herum, kostet Geld, aber spielt selbes nicht über seine Nutzung ein. Oder: Luxushandtaschen. Echt jetzt?
Ja. Edle Teile von Luis Vuitton, Gucci, Chanel und anderen Luxusmarken bietet zum Beispiel „Rent the Runway“ gegen Nutzungsgebühren an, die sich jede Frau leisten kann. Weiters können Sie und ich heute schon sharen: Digital- Kameras, Drohnen, eine komplette Sauna und sogar Christbäume und das Hochzeitskleid. Es gilt heutzutage fast schon: Was man kaufen kann, kann man auch sharen, zum Beispiel Putzlappen.
Kein Scherz. Seit 110 Jahren. So lange gibt es zum Beispiel die MEWA mit Sitz in Wiesbaden schon. Ärzte kaufen ihrem Team nicht die weißen Kittel, sie sharen sie bei der MEWA. 220 Außendienstler eines Herstellers für Hochdruckreiniger brauchen einheitliche Sakkos? Werden geshart, nicht gekauft. Außerdem Hygienekleidung für Bäcker, Reinraumanzüge fürs Labor … Seit über 100 Jahren? Sharing ist nicht neu. Sogar Erde kann man sharen.
Der Sharing-Anbieter heißt sinnigerweise Shared Earth, kommt aus den USA, ist aber auch in Europa vertreten und bringt Hobbygärtner ohne Garten mit Gartenbesitzern zusammen, die einen Garten aber keine Lust haben, ihn zu pflegen.
Aufs Sharing kam ich nicht erst beim anstehenden Autokauf, sondern während meines Promotionsstudiums, bei dem ich mich mit der Theorie der Access-Based Consumption auseinandersetzte. Diese Theorie ist, grob gesagt, das wissenschaftliche Grundgerüst für den Populärbegriff „Sharing“. Genauer: Es ist der Überbegriff für alle Spielarten dieser besonderen Form der Nutzung von Gütern, bei der kein Eigentumsrecht erworben wird, sondern ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht. Wörtlich übersetzt: zugangsbasierter Konsum. Mit meinem Geld kaufe ich das Auto oder Spielzeug nicht, sondern verschaffe mir vielmehr Zugang (Access) zu dessen Nutzung. Ich kaufe kein Auto oder Spielzeug, ich erwerbe vielmehr einen exklusiven Teil seiner Nutzungszeit. Der alte Spruch, dass niemand für ein Glas Milch gleich die ganze Kuh kauft, bekommt durch Sharing eine ganz neue Bedeutung …
Mit meinen Co-AutorInnen habe ich damals zum Thema geforscht und (unter anderem im Journal „Thunderbird International Business Review“) über eine Abwandlung von Carsharing publiziert, die buchstäblich die Welt retten kann – leider erst nach einer Katastrophe. Wenn nämlich wieder ein Erdbeben, ein Tsunami, ein Wirbelsturm oder eine andere Naturkatastrophe zuschlägt, leiden viel zu viele Menschen nicht nur wegen der eigentlichen Katastrophe, sondern weil nach der Katastrophe die Hilfe nicht schnell genug zu ihnen gelangt: Regierungen und Hilfsorganisationen verfügen schlicht über zu wenig geeignete Transportmittel vor Ort. Was, wenn diese fehlenden LKW im Krisenfall alle geshart und für die Notfall-Logistik herangezogen werden könnten?
Dann wäre die Krise sehr viel schneller überstanden. Das leuchtet ein. Und nicht nur für Länder der 3. Welt, sondern auch für hoch zivilisierte Länder wie das Bundesland Bremen. Dort nutzt die Polizei ebenfalls Carsharing. Wenn zu viele eigene Fahrzeuge in Reparatur sind, nutzt die Polizei auch mal gesharte PKW für Einsätze ohne Martinshorn. Wenn das so sinnvoll ist, warum gibt es dann nicht in jedem von Naturkatastrophen bedrohten Land oder für jede Polizei-Dienststelle nicht längst solche Sharing-Systeme?
Weil die dritte Welt dasselbe Problem hat wie wir in der ersten: Wir teilen zu wenig. Wir könnten, sollten und müssten sehr viel mehr miteinander teilen, gemeinsam statt einsam nutzen. Nicht nur unsere LKW, PKW und unser Spielzeug, sondern jeden denkbaren und undenkbaren Artikel des täglichen Gebrauchs – bis eben auf die Unterhose. Die sollte man noch kaufen. Den ganzen Rest können wir sharen.
Warum tun wir es nicht?
„Das Ende des privaten PKW ist längst eingeläutet.“ Maxim Nohroudi, Mitbegründer der Mobilitätsplattform Door2Door
1 Der unterschätzte Megatrend
Haben Sie ein Standzeug?
Sharing ist ein sogenannter Megatrend. In jeder „Future of Mobility“-Studie wird Sharing bejubelt. Von der Fachwelt. Außerhalb des kleinen Kreises internationaler Zukunftsforscher redet kaum jemand über Sharing. Weil die anderen Megatrends mehr Sex-Appeal haben. Autonomes Fahren zum Beispiel: Wen soll die Künstliche Intelligenz im autonomen Auto im Risiko-Fall eher umbringen? Den Fahrer oder einen Passanten, wenn sich ein Unfall nicht mehr vermeiden lässt? Darüber können Techno-Feuilletonisten endlos enthusiastisch spekulieren. Sharing dagegen wird kaum diskutiert. Weil wir weniger über Sachthemen und lieber über Skandale diskutieren – zum Beispiel den Diesel.
VW zum Beispiel möchte sowohl ins autonome Fahren wie auch in E-Autos in den nächsten Jahren zusammen 44 Milliarden Euro investieren. Ins Carsharing? Das vermeldet die Schlagzeile nicht. Dabei schätzt die Wirtschaftsberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) den weltweiten Markt für Carsharing im Jahr 2025 auf über 330 Milliarden US-Dollar. Aber redet jemand drüber? Außer PwC nicht viele. Und das ist nicht nur beim Auto so. Auch andere Sharing-Angebote rollen momentan die (Wirtschafts)Welt auf – aber keiner merkt’s.
AirBnB zum Beispiel ist aktuell mit 31 Milliarden US-Dollar bewertet. Hilton, derzeit zweitgrößte Hotelkette der Welt, ist „nur“ knapp 22 Milliarden wert. Während AirBnB um 50 Prozent gewachsen ist (von 2016 auf 2017), wuchs die Hotelbranche nur zwischen fünf und sechs Prozent (nach Deloitte). Aber: So gut wie niemand realisiert das. Dabei hätten wir es nötig. Denn was wir mit den Dingen machen, die wir kaufen, spottet jeder Beschreibung.
Das Wirtschaftsmagazin Fortune hat errechnet, dass ein gekaufter PKW einen Nutzungsgrad von lediglich 5 Prozent hat. Wir erinnern uns: Die EU hat die Glühbirne verboten, weil sie exakt denselben Wirkungsgrad hatte. Fünf Prozent? Absolut unterirdisch, indiskutabel, kriminelle Ressourcenverschwendung (eine LED-Leuchte hat 40-50 Prozent Wirkungsgrad, bezogen auf die Lichtausbeute).
23 von 24 Stunden fährt das durchschnittliche Fahrzeug nicht. Das Fahrzeug steht die meiste Zeit, ist also kein Fahrzeug, sondern ein Standzeug. Wenn das Auto dann tatsächlich mal fährt, errechnet das Infas-Institut in einem Kurzreport (2018) für das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) bei der Hälfte aller Distanzen, die ein Mensch im Alltag zurücklegt, lediglich eine Länge zwischen zwei (für den Einkauf) und acht Kilometern (zur Arbeit). Und für diese im Schnitt maximal acht Kilometer kaufen wir ein Auto? Wir kaufen, um zu parken? Das wäre doch mal ein Werbeslogan für die Automobilindustrie! Kaufen, um zu parken.
Wobei wir jetzt nicht verbal auf die Automobilindustrie einprügeln wollen. Das Problem hat nicht nur das Auto. Auch wenn wir das Rad nehmen (und nicht gerade passionierte Mountain-Biker sind), ist Kaufen keine gute Idee. Beim Rad sind wir jedoch schon weiter, was unser Verständnis fürs Sharing angeht: In jeder größeren deutschen Stadt und sowieso in den Metropolen der Welt ist Bikesharing so selbstverständlich wie Tram, Einkaufszentren und Parkplatzprobleme. Neulich war ich in China, in Changzhou (3,5 Mio. Einwohner) und wollte ein Rad sharen. Aber obwohl die Stadt praktisch vollgepflastert ist mit Bikesharing-Stationen an jeder Ecke: Ich kriegte keines! Die waren alle unterwegs. Bei der in Changzhou herrschenden Verkehrsdichte, den wahnsinnigen Parkplatzproblemen und der alle 20 Meter scharf schießenden Radarüberwachung wird das Autofahren zur Qual.
Das hat nur bedingt etwas mit den Metropolen dieser Welt zu tun. Der Fehler liegt nicht in den großen Städten. Der Fehler liegt in der Konstruktion des Auto- und Radkauf-Modells: Weil wir es kaufen, parkt es. Der Fehler liegt im Kauf. Würden wir es sharen, würde es nämlich fahren.
Was geshart wird, wird bewegt
Ein normaler PKW wird im Schnitt eine Stunde täglich bewegt. Dieser geringe Wert kommt zustande, weil die ellenlangen Pendler-Staus zwar ein intensiv empfundenes Übel sind, jedoch in der viel größeren Masse der Privat-PKW praktisch untergehen: Es gibt sehr viel mehr private PKW-Besitzer als Pendler. Deshalb fahren alle PKW im Durchschnitt täglich nicht länger als eine Stunde.
Im Gegensatz dazu wird ein Sharing-Anbieter, der gut gebucht ist, jedes seiner Autos täglich so oft an den Mann und die Frau bringen, dass es viele Stunden im Betrieb, in Nutzung und in Fahrt ist.
Der Anbieter DriveNow (dahinter steht BWM) gibt zum Beispiel an, dass seine gesharten Autos nicht die übliche eine Stunde am Tag bewegt werden, sondern fünf Stunden lang. In Berlin knacken sie gerade die 6-Stunden-Marke. Im Schnitt wird ein Sharing Car auch sechs bis acht Mal am Tag genutzt. Ich korrigiere mich also: Sharing ist nicht nur (wie beim Spielzeug, s. Vorwort) doppelt so gut wie Kaufen, sondern sechs bis acht Mal so gut.
Experten schätzen, dass ein geshartes Auto – je nach Ort des Sharings – zwischen zehn und 20 privat gekaufte Autos ersetzen kann. Normalerweise kann ein Sharing Car bis zu 15 Kauf-Autos ersetzen, in Ballungszentren bis zu 20 Autos (laut Bundesverband CarSharing bcs). Die Parkplatznot in den Innenstädten und Wohngebieten wäre mit einem Schlag verschwunden. Wenn ein Auto in einer großen Stadt geshart wird, müssen 19 Autos nicht mehr gekauft werden. Das schont nicht nur unseren Geldbeutel. Das hat auch einen starken Effekt auf die Parkplatzsituation: 19 nicht gekaufte Autos setzen 99 Meter Straßenkante frei (laut Umweltbundesamt).
Noch besser: Diese 19 überflüssigen Autos müssen noch nicht einmal gebaut werden! Wir sparen uns und der Erde die Ausbeutung der dafür nötigen Ressourcen. Wie praktisch. Und wie nachhaltig. Sharing macht’s möglich. Und nicht nur fürs Auto.
Niemand braucht eine Bohrmaschine
Es geht eigentlich gar nicht um Sharing. Es geht um die erdrückende Lawine von Eigentum, das wir besitzen, aber nicht benutzen. Zum Beispiel die Bohrmaschine. Haben Sie eine?
Der SPIEGEL und das Wirtschaftsmagazin brand eins haben erhoben, dass die Bohrmaschine des typischen Heimwerkers – was schätzen Sie? – wie lange tatsächlich nicht im Keller rumliegt, sondern wirklich Löcher bohrt? Wie viele Stunden ihrer kompletten Lebenszeit?
Nicht Stunden. Minuten. Nämlich über die gesamte Lebenszeit der Maschine gerechnet lediglich 13 Minuten. Da liegt so ein Ding zehn, 20 Jahre im Keller oder auf dem Speicher – und dann braucht man es gerade mal 13 Minuten. Man gibt 80 Euro aus für 13 Minuten – was für eine Geldverschwendung.
Wenn unsere Kinder mit so einer Geldverschwendung ankommen würden, würden wir ihnen den Kopf waschen und das Taschengeld kürzen. Aber da es unser eigenes Geld ist, geben wir es munter aus.
Und nicht nur für die Bohrmaschine. Was der durchschnittliche Hobbywerker an Handwerkszeug und Gerät im Hobbyraum liegen hat, geht in die Tausende Euro. Und macht hauptsächlich was?
Es liegt herum und fängt Staub. Und dafür haben wir es gekauft? Das ist irre. Oder wie die ZEIT online (12.7.2016) es nennt: „Absurder Konsum“. Wir kaufen immer mehr, aber wir nutzen immer weniger. Früher hat man gekauft, um zu nutzen. Heute kauft man offensichtlich immer mehr, um nicht zu nutzen. Das ist nicht nur widersinnig. Das ist geradezu obszön ressourcenverschwenderisch. Wenn wir die Ressourcen der Welt wenigstens für Lebensnotwendiges, Sinnvolles, Nötiges auf den Kopf hauen würden. Das ginge noch an. Aber wir beuten die Erde aus, um Millionen Tonnen gekaufter Dinge unnütz herumliegen zu lassen? Das ist die Definition des Wahnsinns.
Dabei muss man keine Bohrmaschine kaufen. Man kann sie längst sharen. Und nicht nur mit dem Nachbaren, sondern über sogenannte Tool Libraries (wörtlich: Werkzeugbibliotheken). Diese sind vor allem in den USA stark verbreitet, doch auch in Europa finden wir welche, zum Beispiel in Berlin, London, Brüssel, Utrecht oder Belfast. In den USA kann man gegen einen geringen Mitgliedsbeitrag schon für einen Dollar am Tag ein Gerät aus dem Heimwerkerbedarf leihen; von der Leiter, dem Schraubenzieher über den Rasenmäher oder Luftdruckkompressor bis hin zum Anhänger. Selbst Handwerker nutzen das. Baumärkte dagegen leben von der Dummheit der Hobbywerker? Das ist zwar leicht beleidigend, aber nicht von der Hand zu weisen. Und es ist noch nicht einmal das Schlimmste. Schlimmer ist, was wir der Welt damit antun.
Verantwortungsloser Ressourcenverbrauch
Wie wir heute die Rohstoffe der Erde ausbeuten, kann nur mit einem Wort beschrieben werden: gewissenlos. Die World Bank Group hat sich das Ausschlachten der Erde einmal genauer angesehen und die aktuellen Verbrauchsmengen (2017) gegen die noch vorhandenen Vorkommen hochgerechnet.
Danach vererben wir unseren Kindern bei den für Zukunftstechnologien essenziellen Rohstoffen ein leergeräumtes, verwüstetes Lagerhaus; unter anderem:
Mangan reicht nur noch für 34 Jahre.
Molybdän für 41 Jahre,
Nickel für 31 Jahre.
Das erschreckt Sie? Muss es nicht. Die Zahlen sind längst allen Informierten bekannt. Und was machen die Informierten mit dieser Information? Bremsen sie die raffgierige Ausbeutung der Erde? Nein. Sie diskutieren unter anderem die Erschließung der Bodenschätze – auf dem Mond. Kein Witz, kein Scherz. Selbst wenn diese Idee nicht so utopisch wäre: Sie löst das Problem nicht. Sie verschiebt es lediglich. Auf den Mond. Dabei könnten wir das Problem hier auf der Erde sauber und glatt lösen. Indem wir sharen statt kaufen. Das würde massig Rohstoffe sparen.
Denn so ein Auto frisst Rohstoffe en masse. In einem einzigen Golf zum Beispiel stecken 1,3 Tonnen Metall. Wenn Sie also Ihren Golf sharen statt kaufen und damit die Herstellung von 20 Neuwagen überflüssig machen (weil ihr Sharing Car noch von 20 anderen Nutzern genutzt wird), sparen Sie der Erde 26 Tonnen Metall. Und je mehr Menschen sharen, desto länger halten die Rohstoffe der Erde. Wir könnten jährlich Millionen Tonnen Rohstoffe sparen.
Eine etwas genauere Schätzung liefert die Unternehmensberatung Frost & Sullivan (2015). Sie geht von einem damals aktuellen Bestand von circa 112.000 gesharten Autos weltweit aus. Das ist nicht viel. Aber wenn man von einer realistischen Wachstumsrate des Bestandes von jährlich 14 Prozent ausgeht, kommt man im Jahr 2025 bei einem Carsharing-Bestand von 427.000 Autos heraus. Dieser würde der Welt 11 Millionen Tonnen Metall sparen. Eine ungeheure Menge. Und das ist ja nicht alles: Was wir mit dem Auto machen, könnten wir auch mit Rasenmähern, Bohrmaschinen, Küchengeräten und vielem anderen machen, das wir sharen statt kaufen könnten und das die Ausbeutung der Erde mindern könnte. Wir ersparen der Welt Milliarden Tonnen unnötiger Ausbeutung. Wir retten die Welt! Indem wir sharen. Ist das nicht ein wenig übertrieben?
Ist es nicht. Denn jedes Jahr werden derzeit über 100 Millionen Neuwagen gebaut: Das Ausmaß der Ausbeutung ist unvorstellbar. Aber wenn das E-Auto kommt, wird dann nicht alles besser? Das wollen uns einige weismachen. Dabei verbraucht so ein E-Auto zum Beispiel sehr viel mehr seltene Erden (für die Akkus) als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Dadurch nehmen die Rohstoffe der Erde noch schneller ab. Wir könnten das ändern.
Indem wir nicht länger wie die Irren kaufen und dann nicht nutzen, sondern indem wir sharen. Das wäre ressourceneffizient. Es wäre verantwortlich. Das muss man sich mal vor Augen halten: Mit unserer gegenwärtigen Ressourcenverschwendung übernehmen wir keine Verantwortung für unseren eigenen Planeten. Wie selbstmörderisch ist das denn? Warum machen wir das? Weil wir sex-süchtig sind.
Vernunft ist nicht sexy
Als informierte Bürger haben wir ein leicht perverses Verhältnis zur Information. Wir informieren uns nicht vorrangig oder hauptsächlich über das, was geboten, angeraten, angemessen, vernünftig oder notwendig wäre.
Wir lesen und hören vor allem das, was sexy ist.
Unsere Medien sind das Spiegelbild dieser Sex-Sucht. Sie sind praktisch Info-Zuhälter. Sie malen zum Beispiel wahre Terminator-Szenarien rund ums autonome Fahren: Die Künstliche Intelligenz übernimmt erst das Auto, dann die ganze Welt! Darüber wird nicht ad nauseam berichtet, weil das wahrscheinlich oder entscheidend wäre. Sondern weil die Story sexy ist: „Maschinen übernehmen die Welt!“ Das bringt Aufmerksamkeit, Einschaltquote und Auflage. Dass selbst das KI-gesteuerte autonome Auto dann immer noch gekauft statt geshart wird und damit weiterhin die Ressourcen der klammen Erde ausbeutet: total unsexy. Das altsowjetische Politbüro mit seinen tausenden Zensoren war ein Witz an Ineffizienz verglichen mit unserer Informationsneurose. Wir brauchen keine Zensoren. Wir zensieren uns selber. Bis hinauf auf höchste politische Ebenen.
Das Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur zum Beispiel hat die Ethikkommission „Automatisiertes und vernetztes Fahren“ eingesetzt, die 20 Regeln „für den automatisierten und vernetzten Fahrzeugverkehr“ verfasst hat. Darin werden Dilemmata des autonomen Fahrens thematisiert wie: Wenn ein Unfall unvermeidlich ist – wen soll die Künstliche Intelligenz (KI) des autonomen Autos dann über den Haufen fahren? Eher die Oma oder eher das Kind? Was ist mit einer Frau mit Kinderwagen?
Damit keine Missverständnisse entstehen: Das sind brennende Fragen der praktisch angewandten Verkehrsmoral, die geklärt werden müssen. Doch ihre Klärung verursacht extreme Opportunitätskosten: Wer über sowas nachdenkt, denkt nicht darüber nach, was jedes autonome Auto den Ressourcen der Erde antut. Denn diesbezüglich ist schnurzegal, ob das Auto vom Fahrer oder von der KI gefahren wird: Wird es gekauft, verschwendet es die Rohstoffe der Natur.
Auch das E-Auto wird heftig diskutiert. Es könnte Umwelt, Luft und Städte retten. Doch eigentlich dürfte man es nicht kaufen, sondern müsste es sharen, weil Sharing ein sogenannter Enabler (Hebel, Wirkungsfaktor) ist, um das E-Auto der breiten Masse des fahrenden Volkes näher zu bringen. Denn wenn ein E-Auto (bislang noch) 80.000 Euro kostet, wird es mit der Weltrettung nichts, weil sich nur wenige Menschen so ein Auto leisten können werden. Es sei denn, es wird geshart. Mit Sharing könnten wir in kürzester Zeit eine wirklich große Flotte an E-Autos aufbauen (wenn wir denn weiter glauben wollen, dass das E-Auto die Welt retten sollte).
Trotzdem redet keiner über Sharing. Nicht die Politik, nicht die Medien und (deshalb) nicht die Öffentlichkeit. Vor diesem Hintergrund sind Sie geradezu herausragend: Sie lesen darüber. Dass die dumpfe Masse es nicht tut, hat noch einen weiteren Grund: Schwarze Schafe.
Schwarze Sharing-Schafe
Als das Penicillin erfunden wurde, kursierte das Gerücht, es verursache Haarausfall. Besonders stilbewusste (und leichtgläubige) Zeitgenossen verzichteten daraufhin auf „das neumodische Zeug“ und starben lieber an einer Infektion. Wie gesagt: Vernunft ist nicht sexy – aber dagegen volles Haar. Zu Sharing kursieren ähnlich krasse Gerüchte.
Zum Beispiel rund um Uber und Airbnb. Die Gerüchte besagen: Uber fördere die Selbstausbeutung der Fahrer, verzerre den Wettbewerb im Taxi-Gewerbe und halte sich an keine Tarifbindung wie „echte“ Taxis. Deshalb würde Uber Taxifahrer-Arbeitsplätze killen sowie den öffentlichen Nahverkehr schädigen und die Staus in Großstädten verschlimmern. Über Airbnb heißt es: Airbnb schädige Hotels und Pensionen, verknappe den ohnehin spärlichen Wohnraum in den größten Städten noch weiter, überlaste Stadtviertel, nutze seine Steuerfreiheit schamlos aus, unterliege keinen Brandschutzvorschriften wie anständige Hotels und Pensionen und bringe Nachbarn zur Raserei, wenn Airbnb-Nutzer aus aller Welt lärmend Dauerparty machen. Wegen dieser beiden schwarzen Schafe sei Sharing also der größte Mist, schlussfolgert die gut informierte Öffentlichkeit. Haben Sie den Fehler entdeckt?
Der Fehler ist offensichtlich, setzt jedoch Kenntnis der gehandelten Begriffe voraus:
Uber ist kein Sharing und Airbnb ist ein schwarzes Schaf.
Und wegen eines schwarzen Schafes gleich die ganze Herde zu schlachten, ist, grob gesagt, etwas voreilig. Warum betreibt Uber kein Sharing?
Uber macht kein Sharing
Uber macht kein Sharing, weil Uber keine Autos besitzt. Wer bei DriveNow ein Auto shart, shart es von DriveNow und DriveNow besitzt das Auto. Wir haben gesagt (s. Vorwort), dass Sharing das temporäre Nutzungsrecht über ein Gut verschafft, für das die Eigentumsrechte zeitlich begrenzt übertragen werden. Uber kann diese Rechte nicht übertragen, weil Uber keine Autos besitzt. Uber leiht aber quasi seine Fahrer aus?
Ja und deshalb vertreten einige Experten die Auffassung, dass das bereits Sharing sei. Denkt man diesen Gedanken weiter, ist der Installateur, der Ihren Badboiler repariert, auch Sharing. Denn diesen Handwerker „leihen“ Sie sich ja auch aus – eine meines Erachtens ziemlich abwegige Definition von Sharing. Man kann Güter sharen – keine Menschen. Der Uber-Fahrer sitzt zwar die ganze Zeit während der Fahrt neben mir. Doch er würde mir was husten, wenn ich ihm sagen würde, er übertrage während der Dauer der Fahrt sein Eigentumsrecht an seinem Auto auf mich („Mein Auto gehört mir!“). Einmal ganz davon abgesehen, dass die unterstellte Rechte-Übertragung de facto und de jure schlicht nicht stattfindet. Der Uber-Fahrer überträgt nichts, er fährt bloß. Was er da macht ist kein Sharing, sondern Chauffieren. Er ist kein Sharing-Anbieter, er ist mein Privatchauffeur.
Dass man Uber jedoch vorwerfen kann, sich nicht um Mindestlöhne zu kümmern und seine Fahrer auszubeuten – das kann und sollte man ernstnehmen. Doch das ist keinesfalls repräsentativ für die Sharing Economy. Sharing hat nichts mit Ausbeutung zu tun. Etwas anders sieht die Sache bei Airbnb aus.
Das Airbnb-Problem: Schaf oder nicht?
Dass Sharing oft ignoriert oder sogar für schädlich gehalten wird, liegt leider auch an Airbnb. Was würden Sie sagen? Ja, richtig: Bei Airbnb liegt Sharing vor. Im Grunde eine gute Idee. Oder spricht etwas dagegen, dass ich während meiner dreiwöchigen Urlaubsreise meine Berliner Wohnung (falls ich eine hätte) einem Urlauber aus einem anderen Land zur Verfügung stelle? Und indem ich das tue, übertrage ich das exklusive Nutzungs- und das temporäre Eigentumsrecht auf meinen Airbnb-Gast: Das ist Sharing.
Airbnb ist Sharing und damit prinzipiell eine gute Sache aus bekanntem Grund: Was ungenutzt ist, ist Verschwendung. Wenn ich weg bin, wird meine Wohnung dank Airbnb aber trotz meiner Abwesenheit genutzt: der überragende Nutzungsgedanke von Sharing. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ein Riesenproblem: Indem ich meine Berliner Wohnung (falls ich eine hätte) share, verschärfe ich die ohnehin schon katastrophale Berliner Wohnraumsituation. Das behauptet zumindest die üble Nachrede, die Airbnb zum schwarzen Sharing-Schaf stempelt. Stimmt das?
Wenn ich diese Frage im privaten Kreis einer Handvoll Freunden stelle, sind immer zwei dabei, die sofort sagen: „Das ist doch Unfug! Du könntest die Wohnraumsituation doch nur verschlechtern, wenn dein Airbnb-Gast einem normalen Mieter eine potenzielle Mietwohnung wegnehmen würde. Aber wegen drei Wochen mietet doch kein normaler Mieter eine Wohnung! Eher wegen drei Jahren. So lange bist du doch nicht in Urlaub!“ Dass Airbnb also ein schwarzes Schaf ist, stimmt schon rein modelltheoretisch nicht. Es stimmt auch massenstatistisch nicht (soweit Statistiken valide sind).
Denn 93 Prozent aller Berliner Airbnb-Mitglieder sind (nach eigenen Angaben) Gelegenheitsvermieter. Sie wandeln keine potenzielle Mietwohnung in eine illegale Dauerpension um und berauben damit den Mietmarkt einer Wohnung, in der sie nicht einmal selber wohnen. Nein, sie bieten ihre eigene Wohnung, in der sie wohnen, ein oder zwei Mal im Jahr Gästen zur exklusiven Nutzung an. Meist, wenn sie selber in Urlaub sind. Airbnb verschärft die Wohnraumlage nicht. Außerdem ist unser Rechtstaat ja auch recht ausgeschlafen. Sein Zweckentfremdungsverbotsgesetz, das durch die jeweilige Kommune durchgesetzt wird, verhindert massenhaften Sharing-Missbrauch. Man muss das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und wegen einzelner Missbrauchsfälle Sharing gleich in Bausch und Bogen verdammen. Man kann Missbrauch auch anders verhindern.
Die Sharing-Polizei: Missbrauch verhindern
Selbst wenn Sharing-Anbieter wie Airbnb die hehren Sharing-Prinzipien verletzen würden: Das kann man regeln. Tut man auch, beispielsweise in vielen Großstädten wie Wien, San Francisco, Paris, Hamburg, Berlin oder München. Die Wiener erheben zum Beispiel eine Tourismusabgabe – wie die Kurtaxe für jeden Gast eines normalen Hotels oder einer Pension. San Francisco sagt ganz klar: „Du darfst nur deinen Hauptwohnsitz sharen!“ Damit sind Investoren, die nicht in der Wohnung wohnen und einen schnellen Reibach machen wollen, schon mal raus.
Viele Städte bestehen auch darauf, dass Wohnungssharing gemeldet wird. In Berlin ist das Sharing einer vorhandenen Zweitwohnung darüber hinaus auf 90 Tage limitiert. In München darf man eine Wohnung für maximal acht Wochen sharen; bei einem Bußgeld für Verstöße von bis zu 500.000 Euro. Aber das alles weiß der Gerüchtekoch nicht.
Er wirft Uber und Airbnb in einen Topf und denkt: „Sharing ist Scheiße!“ – sofern er nicht selber Uber und Airbnb nutzt. Er sieht die paar schwarzen Schafe, die Fahrer und andere Leistungsanbieter unter Missachtung der Mindestlohngesetze ausbeuten und zu modernen Sklaven machen. Er sieht die wenigen schwarzen Schafe, die als mächtige Investoren knappen Wohnraum wegkaufen und an Touristen vermieten, ohne sich um Brandschutz- und andere Vorschriften zu kümmern, die jedes anständige Hotel klaglos einhalten muss. Er sieht die wenigen schwarzen Sharing-Schafe, schüttet das Kind mit dem Bade aus und findet Sharing blöd: ein Irrtum, ein Fehler, ein Missverständnis. Doch wer soll diesen Irrtum aufklären?
Lokal ist häufiger, aber weniger bekannt
Sharing wird bislang auch deshalb unterschätzt, weil es nur sehr wenige Anbieter gibt, die Sharing im großen Stil und landesweit praktizieren, zum Beispiel bei Spielzeug oder Kleidung. Dass man zum Beispiel einen Smoking eher leiht als kauft, hat sich schon herumgesprochen. Wie oft trägt man schon einen Smoking? Zur eigenen Hochzeit unter Umständen, zum Opernball, also eher sporadisch. Bei sperrigen Gütern bereiten allein Logistik und Versand ein Sharing-Problem: Leitern oder Rasenmäher passen eben nicht in handliche Pakete. Ein Smoking schon.
Aus diesem Grund findet der Großteil von Sharing eher lokal statt oder innerhalb von begrenzten Gruppen. Denken Sie an die eigene Nachbarschaft, in der ein Nachbar sich einen Aufsitz-Rasenmäher leistet und im Sinne guter Nachbarschaft (und damit Motor und Getriebe oft genug bewegt und durchgeschmiert werden) regelmäßig mit drei, vier Nachbarn shart, die sich mit entsprechenden Gefälligkeiten revanchieren. In guten Nachbarschaften ist Sharing seit Erfindung des Höhlenfeuers eine Stütze der Gemeinschaft.
Häufig geshart wird auch die große Leiter, die zwei Stockwerke hoch bis zur Dachrinne reicht, die im Herbst vom Laub befreit werden muss: Wenn jeder Nachbar sich so eine Leiter kaufen würde, wäre das reine Verschwendung von Geld und Stauraum. Hierzulande shart man via Nachbarschaftsfunk, in den USA gibt es Sharing-Plattformen dafür, zum Beispiel Zilok („Rent anything!“, „The eBay of renting!“): Von der Leiter über die X-Box oder die Kamera bis hin zum Rasenmäher oder zur Violine kann alles geshart werden. Zum Zeitpunkt der Manuskripterstellung kostete zum Beispiel eine große Leiter 15 Dollar pro Tag – Zilok sagt, wo sie abgeholt werden kann. In Deutschland gibt Myturn darüber Auskunft, welche Tool Library welches Werkzeug zum Sharen anbietet.
In der Schweiz sehr verbreitet ist die Pumpipumpe Sharing Community. Sie ist ein gemeinnütziger, nicht profitorientierter Verein der Nachbarschaftshilfe mit einem im virtuellen Zeitalter genial analogen Trick: Die Community-Mitglieder kleben einen Aufkleber an ihren Hausbriefkasten, auf dem steht, was sie gerne mit anderen teilen: Bohrmaschine, Leiter, Heckenschere … Natürlich kann man auch auf einer Landkarte im Internet sehen, auf welchem Briefkasten welcher Sticker klebt. Die Nachbarschaftshilfe floriert! Via Pumpipumpe sharen die Leute Lichterketten für Weihnachten, Waffeleisen, den unvermeidlichen Rasenmäher, Leitern, Küchenwaage, Kuchenform, Grill, Bücher, Schlauchboot, Kabeltrommel, Gesellschaftsspiele, Werkzeugkasten …
Die lokalen Sharing-Lösungen werden stark genutzt, machen aber keine medialen Wellen. In Nürnberg zum Beispiel shart „Kinderreich“ alles, was Kinder brauchen: Spielzeug, eine Für-Draußen-Spielkiste, Bollerwagen für 10 Euro am Tag, Kindersitze …
Selbst die Sauna wird geshart. Also jetzt nicht nur privat die stationäre Sauna. Sondern auch via Saunamobil für 120 Euro pro Tag (bei Rent-Sauna.de





























